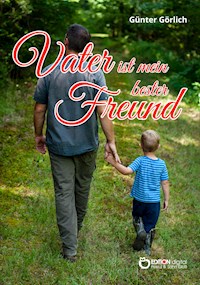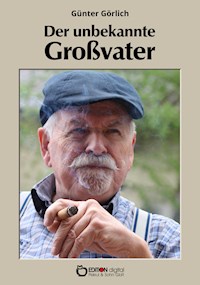7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Damals, Anfang der Achtzigerjahres des vorigen Jahrhunderts, als dieses Buch erstmals veröffentlicht wurde, gab es noch Telegramme – Botschaften in Kurzfassung, im Telegrammstil eben. Und es gab noch Räte der Kreise und deren Vorsitzende. Ein solcher ist, im Norden der damaligen Republik, Norbert Weiß geworden. Von dem erhält der Erzähler eben eine solche Bitte im Telegrammstil, die manches sagt, aber eben nicht alles, und die für den Empfänger zunächst rätselhaft bleibt: Muss Dich unbedingt sprechen. Erfolgt keine Absage, bin ich morgen, Donnerstag, den 12. 2., um 15.00 Uhr bei Dir im Institut. Gruß Wolfgang Weiß Der Erzähler und jener Wolfgang Weiß sind alte Bekannte, seit Neunzehnhundertzweiundsechzig oder dreiundsechzig, hatten sich aber lange nicht gesehen. Ihr letzte Begegnung lag fünf oder sechs Jahre zurück, in der Mitte der Siebzigerjahre. Dieses Telegramm beschwört Spannung und Unruhe herauf, und es leitet für den Genossen Karras, Klaus Karras, so der vollständige Name des Erzählers, – und damit auch die Leserinnen und Leser - einen unruhigen und auch aufregenden Zeitabschnitt ein. Da keine Absage erfolgt, trifft Wolfgang Weiß pünktlich auf die Minute, am 12. Februar bei Karras ein. Er trug einen Halbpelz und eine Pelzmütze, der man die Moskauer Herkunft sofort ansah. Der Gast kommt gleich zur Sache und bittet Karras um Hilfe: „Meine Frau hat mich verlassen. Vor drei Wochen. Ich begreife nicht, warum sie weggegangen ist. Sie ist hier in Berlin.“ Diese Frau, das ist Monika Möglin, der sich nach Ansicht von Karras, der einst ihr Mentor gewesen war, eine großartige Entwicklungsmöglichkeit geboten hätte, wenn nicht Weiß … Das Einzige, was Frau Weiß ihrem Mann beim abschiedlosen Weggang hinterlassen hatte, war ein langer, nachdenklicher Brief, in dem sie schreibt: „Ich gehe fort, weil ich anders leben will. Bliebe ich hier, wäre eigentlich mein Leben beendet. Vielleicht sind das zu große Worte, ich weiß aber keine treffenderen. Einen anderen Mann gibt es nicht, hat es nie gegeben.“ Der Abschied hat auch mit der letzten Silvesterfeier zu tun. Der Ratsvorsitzende und Mann einer 34-jährigen Frau, der immer wenig Zeit hat, kann nicht verstehen, weshalb ihm seine Frau davongelaufen ist – wahrscheinlich für immer. Und er erhofft sich Hilfe von Karras, der zu ihr fahren und für Klarheit sorgen soll. Und der lässt sich hineinziehen in diese Geschichte, sogar tief hineinziehen. Aber erst muss er diese Frau finden, ehe er mit ihr reden kann. Wo ist sie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Die Chance des Mannes
ISBN 978-3-96521-701-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1982 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I.
Muss Dich unbedingt sprechen. Erfolgt keine Absage, bin ich morgen, Donnerstag, den 12. 2., um 15.00 Uhr bei Dir im Institut.
Gruß Wolfgang Weiß
Das Telegramm gab mir Rätsel auf. Es war gestern am späten Abend in der Kreisstadt im Norden aufgegeben worden, in der, wie ich mich erinnerte, Weiß arbeitete und lebte. Ich hatte Wolfgang Weiß lange nicht gesehen. Unsere letzte Begegnung lag fünf oder sechs Jahre zurück, in der Mitte der Siebzigerjahre.
Damals arbeitete ich noch an der Universität und wollte an einem Mittag vom Hauptgebäude zur Kommode rüber, um irgendwelche Unterlagen einzusehen. Meine Zeit war knapp. Ich hatte keinen Blick für das zarte Hellgrün der Lindenblätter in der Maisonne, auch nicht für das lebhafte Treiben auf der Straße, ich war in Gedanken bei meiner Vorlesung. Da sagte jemand: „Schau an, der Genosse Karras. Wie immer im Trab.“
Ich erkannte Weiß, das heißt, ich brauchte ein paar Sekunden, um mir klar zu werden, dass der Mann vor mir Wolfgang Weiß war.
Er hatte sich verändert.
Mir schien er größer zu sein, das war natürlich barer Unsinn, aber auf jeden Fall breiter und imposanter, in seinem gut sitzenden hellen Anzug, trotz der Wärme mit geschlossenem Hemdkragen und korrekt gebundener Krawatte. Nur sein festes blondes Haar, niemals recht zu bändigen, erinnerte an den früheren Wolfgang Weiß.
„Na, das ist schon eine Überraschung“, sagte ich, „und dann noch vor der Uni. Vor Jahren hast du ja auch immer hier gewartet. Aber nicht auf mich.“
„Ja, vor vielen Jahren“, sagte Weiß.
Wir schüttelten uns die Hände, und da ich es wirklich eilig hatte, schlug ich ein Treffen am Nachmittag im Operncafé vor.
Weiß bedauerte, er habe leider keine Zeit, müsse zurück. Am Abend habe er auf einer Veranstaltung in seiner Kreisstadt eine Rede zu halten.
Und ich erfuhr, er war vor einigen Monaten zum Ratsvorsitzenden dieses Kreises ernannt worden.
Ich spürte, für ihn war es noch nicht selbstverständlich, diese Funktion im Zusammenhang mit seiner Person zu nennen.
Ich gratulierte ihm herzlich. Weiß hatte einen Aufstieg hinter sich. Der hatte sich in einem Jahrzehnt vollzogen. Mitte der Sechzigerjahre war Weiß aus Berlin weggegangen und hatte dort im Norden beim Rat des Kreises zu arbeiten begonnen.
„Wie geht’s deiner Frau, der Monka?“, fragte ich, „und was macht euer Junge?“
„Der Monka?“, sagte Weiß sinnend, die Zärtlichkeitsform für Monika, die er vor Jahren erfunden hatte, schien ihm nicht mehr so recht vertraut zu sein. „Ja, Monika geht’s den Umständen entsprechend. Dem Jungen auch. Manchmal reden wir von dir und den alten Zeiten. Schade, die Entfernung …“
Für mich hatte es kaum einen Anlass gegeben, an die beiden Weiß zu denken. Durch die Zeit und die räumliche Entfernung waren die Erinnerungen verblasst.
Als wir uns an jenem Maitag vor dem Eingang der Universität verabschiedeten, nahmen wir uns vor zu schreiben, wenigstens mal anzurufen, uns vielleicht sogar gegenseitig zu besuchen, und wir wussten wohl schon, dass es bei diesen freundlichen Versprechungen bleiben würde.
Und jetzt, Jahre später, dieses Telegramm.
Ich blickte in meinen Terminkalender. Am Nachmittag des Zwölften war ein Gespräch mit einem Mitarbeiter vorgesehen. Keine dringliche Angelegenheit, ich konnte diese Sache ohne Nachteil für den Kollegen verschieben.
Also war ich bereit für Wolfgang Weiß. Ich vermerkte den Termin im Kalender und bat meine Sekretärin, mich für den morgigen Nachmittag vor unangemeldeten Besuchern abzuschirmen.
Das Telegramm versetzte mich in eine gewisse Spannung.
Was konnte Weiß von mir wollen? Unsere Arbeitsgebiete unterschieden sich, ich befasste mich mit Zeitgeschichte, er war Staatsfunktionär, Praktiker vor allen Dingen, spezialisiert auf ökonomischem Gebiet. Vielleicht stand er in der Weiterbildung, brauchte meine Hilfe. Vielleicht war er in seiner Tätigkeit auf etwas gestoßen, was meinem Bereich zugehörte, geschichtliche Fakten oder ähnliches. Alles möglich.
Das Telegramm beschwor auch Erinnerungen herauf, die aber mehr mit seiner Frau als mit ihm zusammenhingen. Sie hieß Monika Mögelin, als sie ihr Studium Unter den Linden begann. Das allerdings lag sehr weit zurück, da musste man in das Jahr 1961 zurückgehen, in jenen ereignisreichen Herbst.
Doch Wolfgang Weiß hatte das Telegramm abgeschickt.
In diesem Augenblick wusste ich noch nicht, dass seine Bitte für mich einen unruhigen und auch aufregenden Zeitabschnitt einleitete.
Der Vormittag des 12. Februar ließ mir wenig Zeit, an die Verabredung mit Weiß zu denken. Ich jagte von einer Besprechung zur anderen, die aber alle herzlich wenig mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hatten. Da ging es um die verrottete Heizung im Institutsgebäude. Ich sollte meine Autorität in die Waagschale werfen, damit endlich die Erneuerung der Anlage durchgesetzt würde. Welche Autorität? Waren dafür nicht andere Leute verantwortlich?
Da ging es um die Vorbereitung des Geburtstages einer historischen Persönlichkeit, vor Monaten noch als eine Aufgabe unter anderen in unserem Arbeitsplan vermerkt, die plötzlich durch aktuelle Ereignisse eine neue Wertung erfuhr. Nun sollten wir ran, das notwendige Material beschaffen, plausible Begründungen finden, und das Ergebnis war ein „Feuerwehreinsatz“, der mit Wissenschaftlichkeit nur sehr entfernt etwas zu tun hatte.
Der Vormittag war also recht dazu angetan, Missmut und Groll zu wecken. Meine Höflichkeit litt darunter, was mich Frau Schirmer, meine Sekretärin, spüren ließ.
Zu Hause hatte ich kaum an die Weiß’ gedacht, meine Frau kannte die Leute und die dazugehörigen Geschehnisse nicht. Den vergangenen Abend hatte ich benutzt, eine Arbeit weiterzuführen, die mir schon lange am Herzen lag, eine Studie über die Bündnispolitik mit der künstlerischen Intelligenz Anfang und Mitte der Fünfzigerjahre.
Kurz und gut, als ich vom Mittagessen kam, das mir an diesem Tag auch nicht sonderlich geschmeckt hatte einschließlich des Kaffees, war es kurz vor fünfzehn Uhr, und meine Sekretärin sagte: „Ich möchte Sie erinnern, um drei ist Ihr Besuch zu erwarten.“
„Danke, Frau Schirmer“, erwiderte ich, „ich hatte es fast vergessen.“
„Ich dachte es mir. Nach diesem Vormittag.“
„Ja, wenn man sich das alles vom Hals schaffen könnte. Aber ich werde es durchsetzen. Ich werde Ordnung schaffen.“
„Das habe ich schon oft von Ihnen gehört, Kollege Karras“, sagte Frau Schirmer.
„Entschuldigen Sie, ich weiß ja“, sagte ich.
„Soll ich Kaffee kochen? Oder Tee?
„Tee bitte. Sie können das ja wunderbar.“
Da ich die Tür zum Vorzimmer offengelassen hatte, konnte ich sehen, wie Weiß dort eintrat. Pünktlich auf die Minute.
Er trug einen Halbpelz und eine Pelzmütze, der man die Moskauer Herkunft sofort ansah.
Diesmal erkannte ich ihn gleich, vielleicht auch deshalb, weil ich auf sein Kommen vorbereitet war. Aber ich hätte ihn wohl auch auf der Straße erkannt, die Jahre nach unserer letzten Begegnung hatten ihn nicht so stark verändert. Natürlich, älter war er geworden. Das war am deutlichsten zu sehen, als er die Pelzmütze abnahm. Das Haar war dünn.
Er sagte: „Guten Tag. Mein Name ist Weiß. Ich habe mich beim Genossen Karras angemeldet.“
„Sie werden erwartet“, sagte Frau Schirmer.
Ich stand schon in der Tür.
Weiß zog seinen Halbpelz aus, legte sorgfältig den Schal darüber und sah sich um, als erwarte er, dass ihm jemand die Kleidungsstücke abnehme.
Meine Sekretärin aber blieb an ihrem Tisch sitzen und arbeitete weiter. Sie wusste, dass sich der Kleiderhaken, für jedermann sichtbar, neben der Tür befand. Weiß musterte den nicht sehr großen Raum, mochte vielleicht denken, dass er für das Sekretariat eines nicht gerade unbekannten Instituts etwas karg ausgestattet sei.
Ich ging auf ihn zu, nahm ihm den Pelz ab, hängte ihn an die Garderobe.
„Sei gegrüßt“, sagte ich, „pünktlich wie die Maurer.“
„Was die Pünktlichkeit betrifft, so ist es wohl selbstverständlich. Ob das mit den Maurern aber heute noch zutrifft?“ Er steckte seinen Schal sorgfältig in einen Ärmel seines Halbpelzes, legte die Mütze auf die Ablage, zog seinen Anzug glatt, strich sich über das Haar und gab mir dann die Hand.
„Frau Schirmer“, sagte ich, „könnten Sie uns bitte den Tee machen.“
„Schon fertig“, sagte sie und stand auf.
Sie ging an Weiß vorbei, sah ihn an und dachte sicher, er würde auch ihr die Hand reichen. Aber Weiß war vielleicht in Gedanken schon bei unserem Gespräch, denn er folgte mir, ohne Frau Schirmer zu beachten, in mein Zimmer.
„Hier arbeitest du also“, sagte er.
„Ja, und nun schon ein paar Jahre.“
„In der Universität war’s ja auch eng.“
„Die Aufgaben wachsen, die Räumlichkeiten nicht“, sagte ich und forderte ihn auf, sich zu setzen.
Am Fenster hatte ich eine Sesselecke, die sich abhob von der sonstigen Einrichtung. Sitzcouch und Sessel waren mit gelblichem Kunstleder bezogen, äußerst unpraktisch und unschön die Farbe. Unsere Einkäufer denken so gut wie gar nicht.
Weiß setzte sich ohne Zögern in den Sessel, der mit der Rückwand zum Fenster stand, konnte so das Zimmer überschauen und hatte das Licht im Rücken. Das war sonst mein Platz, wenn ich jemanden zum Gespräch dahatte.
Frau Schirmer brachte den Tee.
Weiß öffnete sein Jackett, zog den Schlips zurecht.
„Ich habe erst vergangene Woche erfahren, dass du an diesem Institut bist“, sagte er.
„Hast du dich an der Uni erkundigt?“
„Ja“
„Bin schon eine Weile dort weg“, sagte ich, und leichter Ärger kam in mir auf. Er kommt zu mir, um mich über meinen Arbeitsstellenwechsel auszufragen!
„Dein Telegramm hat mich überrascht.“
„Wieso?“
„Durch die Art, wie es abgefasst ist.“
„Ich hab’s in Eile diktiert“, sagte er.
„Möchtest du Zucker in den Tee?“
„Ja.“
Er nahm drei Würfel, zerrührte sie bedächtig in der Tasse.
Sein Haar war tatsächlich stark gelichtet, die Falten auf der Stirn und um den Mund hatten sich vertieft.
Er sah mich prüfend an, und ich konnte mir vorstellen, dass er in diesem Moment über mich ähnliche Feststellungen traf.
Ich war fünfundfünfzig und er mehr als zehn Jahre jünger. Wahrscheinlich waren die Veränderungen bei mir deutlicher zu merken.
„Du hast dich also gewundert, dass ich zu dir kommen will“, sagte er.
„Ein bisschen schon. Wir haben lange nichts voneinander gehört.“
„Ich brauche deine Hilfe“, sagte er.
Er schien mir jetzt weniger selbstsicher zu sein. Er sah mich an, als hinge von meiner Antwort für ihn ungeheuer viel ab.
„Meine Frau hat mich verlassen. Vor drei Wochen. Ich begreife nicht, warum sie weggegangen ist. Sie ist hier in Berlin.“
Ich stand auf und schloss die Tür. Diese Zeit brauchte ich, um Weiß’ Eröffnung aufzunehmen.
„Nach so vielen Jahren ist sie weggegangen?“
„Ja, nach fast zwanzig Jahren.“
„Ein anderer?“
„Nein, kein anderer. Das hat sie mir jedenfalls geschrieben. Und ich glaube es.“
„Ja, da weiß ich nun nicht …“
„Du kennst sie doch“, sagte er.
„Ich kannte sie, wie sie damals war“, widersprach ich, „ist schon lange her.“
„Von dir hat sie immer viel gehalten“, meinte Weiß fast beschwörend, „du warst sehr wichtig für sie. Das weiß ich.“
Sie war für mich auch wichtig, dachte ich. Monika Mögelin war meine Entdeckung gewesen. Ich hatte ihr eine glänzende Laufbahn prophezeit und alles in meinen Kräften Stehende getan, ihr das Rüstzeug dafür zu geben. Es war nichts daraus geworden. Der Mann, der da vor mir saß, war die Ursache gewesen, dass sich meine Prophezeiung nicht erfüllt hatte. Was wäre aus Monika Mögelin geworden, wenn sie in mir nicht nur den hilfreichen Mentor gesehen hätte? Ich glaube, sie hatte nicht die geringste Ahnung, mit welchen Gedanken und Gefühlen ich mich damals herumschlug. Die waren jetzt wieder sehr lebendig und versetzten mich in eine seltsame Stimmung. Einen Augenblick lang hatte ich das bittere und traurige Gefühl, eine Gelegenheit fürs ganze Leben vertan zu haben. Zur gleichen Zeit dachte ich im Zeitraffertempo an alles, was damals war und was hätte sein können, wenn der nicht gekommen wäre, der vor mir im Sessel hockte und mich anstarrte. Oder wenn ich nicht immer wieder gezögert hätte, schon vorher, als Weiß noch nicht da war.
Nun war es aber an der Zeit, dass ich mich zusammennahm, wieder meinen nüchternen Verstand einschaltete. Die letzte Begegnung mit der Frau lag Jahre zurück. Es war auf einem Absolvententreffen gewesen.
Doch Schluss jetzt damit. Wolfgang Weiß erwartete eine Antwort.
„Meinst du, es hat Sinn, wenn ich zu ihr gehe?“, fragte ich.
„Und wenn es nur den einen Sinn hat, dass du mir sagen kannst, was tatsächlich los ist. Ich finde keine Ruhe. Ich bin in meinen Gedanken immer wieder bei dieser Frage. Warum? Warum von heute auf morgen? Warum ohne Abschied? Warum ohne den Jungen, der doch alles für sie war? Warum ohne Rücksicht auf mich, auf meine Arbeit, die nicht gerade unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.“ Weiß beugte sich erregt vor, presste die Knie an den niedrigen Tisch, als wollte er ihn wegschieben.
Ich kannte ihn nur ruhig, ausgeglichen, höchstens etwas ironisch.
Besonders der letzte Satz gab mir zu denken. Die Öffentlichkeit. Ich konnte mir schon vorstellen, dass so etwas in einem kleinen Städtchen Staub aufwirbelt: Die Frau des Ratsvorsitzenden verlässt Hals über Kopf die Familie.
Sie war sicher bekannt in Stadt und Kreis, das bringt die Funktion des Mannes mit sich.
„Wieso ohne Abschied?“, fragte ich.
„Ohne Abschied, ohne Ankündigung. Ja, genau so. Ich kam am Abend nach Hause, hatte einen anstrengenden Tag hinter mir und fand das Haus leer. Nur einen Brief auf meinem Schreibtisch. Es war der Tag, als der Junge wieder abgefahren war. Steffen lernt in Rostock, will zur Handelsflotte. An diesem Morgen war er wieder losgefahren, sein Urlaub war abgelaufen.“
Weiß sah mich an, schien zu überlegen, zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein Kuvert. Zögernd entfaltete er einen Briefbogen.
„Hier ist der Brief“, sagte er, „lies ihn. Du musst ihn wohl lesen. Ich bin ja zu dir gekommen.“
Die Schriftzüge erkannte ich sofort. Die Schrift der Monika Mögelin war damals schon ausgeprägt gewesen, sehr gleichmäßig, ohne Schnörkel, gut leserlich. So war sie geblieben.
Aber ich musste mir erst die Brille vom Schreibtisch holen, gewann dadurch Zeit, denn auf einmal erschien mir der ganze Vorgang hier in meinem Arbeitszimmer, in dem ich schon manche heiße Debatte in fachlichen Dingen erlebt hatte, doch recht seltsam und sehr privat. Es war mir peinlich, in diese ureigene Sache der beiden hineinzuschauen. Sicher würde sich das durch den Brief noch verstärken, den Weiß mir nun preisgab.
Ich nahm die Brille, setzte mich in den Sessel und begann den Brief zu lesen.
Lieber Wolfgang!
Ich gehe heute von hier weg, von Dir und dem Haus. Den Brief schreibe ich am frühen Morgen, oben im Schlafzimmer, das ich auch in dieser letzten Nacht allein zur Verfügung hatte. Du bist spät nach Hause gekommen. Wärst Du eine oder zwei Stunden früher gekommen, vielleicht hätte ich den Mut aufgebracht, Dir meinen Entschluss zu sagen. Doch so ist es besser, das weiß ich. Ich hätte nicht standgehalten, wäre in meinem Entschluss wankend geworden.
Ich gehe fort, weil ich anders leben will. Bliebe ich hier, wäre eigentlich mein Leben beendet. Vielleicht sind das zu große Worte, ich weiß aber keine treffenderen.
Einen anderen Mann gibt es nicht, hat es nie gegeben.
Wir werden uns später sehen und aussprechen. Wenn Du es willst. Aber später. Ich kann jetzt die Gründe für meinen Entschluss nicht in allen Einzelheiten darlegen, das kann ich wirklich nicht. Dazu reicht ein Brief nicht, und ich glaube, ich würde mich wiederholen und wirres Zeug schreiben. Wolfgang, Du hast Dich verändert, und Du bist mir fremd geworden. Manchmal erschrak ich über meine Gedanken und Empfindungen. Ich habe Dich betrachtet und beurteilt, als hätten wir nicht viele Jahre zusammengelebt. Ich habe mich geprüft, ob ich mich verändert habe. Meine Abneigung gegen Dich habe ich versucht zu unterdrücken, habe geheult und mich beschuldigt. Aber es half nichts.
Wenn Du nach Hause kamst, verschlossen, selbstsicher, und ich hatte eine Frage, spürte ich, dass es für Dich äußerst verwunderlich war, weshalb ich überhaupt eine Frage stellen konnte. Deine Antwort, meistens nur der Ansatz einer Antwort, drückte das aus. Wolfgang hat keine Zeit, habe ich gedacht. Das ist alles nur Abwehr bei ihm. Er muss mit seinen steigenden Aufgaben fertig werden. Nein, das war es nicht, und das ist es nicht. Dein Verhältnis zu den Menschen ist anders geworden, ist abstrakt und kühl und unterliegt Zwängen, denen Du Dich früher nie unterworfen hast. Erinnere Dich an letzten Silvester. Ich war so froh, dass wir seit Jahren einmal allein feiern würden. Ich erhoffte mir Ruhe und Nachdenken, vielleicht auch ein offenes Wort, gerade am Jahreswechsel. Und ich hatte alles vorbereitet, mich an alte Gewohnheiten erinnert. Zum Beispiel an das Bleigießen. Weißt Du noch, wie viel Spaß das gemacht hat? Wie wir gelacht haben, wenn wir die seltsamen Figuren ausdeuteten, die sich im kalten Wasser gebildet hatten? Und wie wir, abergläubisch ist man ja doch ein bisschen, möglichst Günstiges für uns herausbekamen? Wir hielten lange Reden, leidenschaftlich und mit Feuer, um die eigene Ausdeutung zu verteidigen.
Ja, und dann blieben wir nicht in unseren vier Wänden, sondern gingen ins Klubhaus. Zwei Tage vorher hast Du mir das mitgeteilt. Und der Grund? Der Erste Sekretär, hattest Du erfahren, feiere diesmal, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, den Jahreswechsel im Klubhaus. Ich versuchte zu protestieren, ein schwacher Versuch, ich weiß. Ich meinte, was es mit uns zu tun habe, wenn der Erste Sekretär, den ich ja schätze, mit seiner Familie im Klubhaus feiere. Du hast mich, wie immer, angehört oder wenigstens so getan und dann gesagt: Es ist notwendig, dass wir dort sind. Du ziehst am besten das lange dunkle Kleid an.
Ich bin mitgegangen, wie immer habe ich mich der „Notwendigkeit“ gefügt. Es war für mich ein schlimmer Jahreswechsel.
Wie mit Röntgenaugen sah ich die Leute im Saal, die einen, die wie Du dorthin gekommen waren, weil es ihnen notwendig erschien, und die anderen, weil sie feiern wollten. Der Erste Sekretär und seine Familie zählten offensichtlich zu den letzteren. Vielleicht zu Deinem Leidwesen. Es kann sein, dass ich keinen Blick für diese Notwendigkeiten habe! Ich war nicht böse oder wütend, nur traurig.
Du hast mir zu verstehen gegeben, dass sich das nicht gehöre. In einer öffentlichen Silvesterfeier habe die Frau des Vorsitzenden fröhlich zu sein, charmant, reizend, habe nicht Trübsal zu blasen.
Vielleicht übertreibe ich jetzt, doch es waren und sind meine Empfindungen. Ich erinnere Dich auch nur daran, weil das der letzte Anstoß zu meinem Entschluss war. Ich weiß, Du kannst das nicht akzeptieren. Du wirst Erklärungen suchen, die Dir genehm sind oder die Deinem Verständnis entsprechen.
Ich muss neu beginnen. Auch wenn ich schon neununddreißig bin oder gerade weil ich dieses Alter habe. Jetzt kann es noch nicht zu spät sein.
Wolfgang, ich kann mir vorstellen, wie Du diesen Brief liest. Du wirst an Deinem Schreibtisch sitzen, sehr gerade und sehr ruhig. Du bist allein in der Wohnung, Du wirst Dir trotzdem nichts anmerken lassen, nichts von Deinen Gefühlen und Empfindungen wird sichtbar werden, und ein heimlicher Beobachter könnte nicht die kleinste Unbeherrschtheit feststellen.
Bewunderungswürdig? Möglich! Und wohl auch erstrebenswert für einen Menschen, der eine verantwortungsvolle Aufgabe hat. Doch Haltung darf nicht zum Korsett werden.
Unserem Steffen werde ich auch schreiben. Das wird mir sehr schwer fallen. Wie soll er für meinen Entschluss Verständnis aufbringen? Für ihn war unser Zuhause eine heile Welt. Bitte, Wolfgang, versuche gerecht zu bleiben, wenn Du mit dem Jungen sprichst. Vielleicht verlange ich Unmögliches, doch ich bitte Dich, versuche es wenigstens ihm gegenüber.
Für die nächsten Tage ist alles vorbereitet. Frau Krüger wird jeden Tag kommen. Du kennst sie ja, sie ist sehr zuverlässig. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich für immer weggehe.
Monika
Ich legte den Brief auf den Tisch. Von weitem wirkte das Schriftbild ausgeglichen, harmonisch. Wie so etwas täuschen kann.
Weiß hatte sich zurückgelehnt. Während ich las, hatte er sich anscheinend zur Ruhe gezwungen.
Der Brief erlaubte mir einen ziemlich tiefen Einblick in die innere Welt der beiden Menschen, die ich von früher kannte. Und er berührte mich auf eine seltsame Art. Ich war eingeweiht, wusste, dass ich mich nun nicht mehr heraushalten konnte. Ich hatte es befürchtet. Nun war es geschehen.
Der Mann, an den der Brief gerichtet war, sah mich ruhig an. Oder täuschte ich mich?
Die Wirkung auf ihn musste anders gewesen sein, nicht so, wie es Monika Weiß im Brief beschrieben hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er, allein im Haus und in seinem Zimmer, beim Lesen dieses Briefes beherrscht an seinem Schreibtisch sitzen geblieben war.
Vielleicht hatte er den Briefbogen zusammengeknüllt und in den Papierkorb geworfen? Doch das wäre dem Papier anzusehen. Oder er hatte die Lampe vom Tisch gefegt, einen Spiegel zertrümmert? Man kann auch erstarren bei so einer Nachricht, ehe man sie begreift, in ihrer Tragweite erkennt.
Ich brach das Schweigen. „Du weißt, wo sie jetzt ist.“
„Ich vermute bei den Eltern.“
„Du vermutest? Hast du sie nicht gesucht?“
„Nein.“
„Es ist doch ein Monat vergangen?“
„Ja, fast ein Monat.“
„Willst du nicht zu den Eltern fahren?“
„Ich? Bin ich denn weggegangen?“
„Es ist wahr, du bist nicht weggegangen.“
„Du hast es gelesen. Sie will mich in absehbarer Zeit nicht sehen und sprechen.“
„Und was soll ich bei der Sache?“
„Du kennst sie. Ich muss Klarheit haben.“
„Und der Brief? Was meinst du zu dem, was sie schreibt?“
Weiß löste sich jetzt aus seiner starren Haltung, legte die Hände ineinander, rieb sie, als wären sie kalt.
„Ich verstehe sie nicht. Ich hatte ja Zeit, darüber nachzudenken, viele Nachtstunden. Auch am Tage überfallen mich die Gedanken, sogar während der Sitzungen. Ein unmöglicher Zustand.
Ich begreife sie nicht. Ich solle schuld sein? Ich hätte mich verändert? Natürlich, jeder verändert sich, man wird zum Beispiel älter. Ich bin Ratsvorsitzender, und was das bedeutet in puncto Arbeit und Verantwortung, wird dir nicht unbekannt sein. Ja, meine Zeit ist knapp. Aber das weiß sie doch. Wir haben jahrelang gemeinsam so gelebt. Sie wusste, dass meine Arbeit ihre Besonderheit hat. Man steht nun mal in der Öffentlichkeit. Selbstverständlich gilt es da Rücksicht zu nehmen, gibt es Verpflichtungen, plötzliche Entscheidungen. Aber das wusste sie doch, wir hatten keine Geheimnisse voreinander, sie stand nicht am Rande. Sicher, sie hat keine Arbeit, die ihrer Ausbildung entspricht, es ist auch nicht so einfach, in unserem Kreis, fernab jeder großen Stadt für sie eine geeignete Aufgabe zu finden. Schließlich ist auf meine gesellschaftliche Stellung Rücksicht zu nehmen. Wir haben einiges versucht. In der Kreisbibliothek hat sie gearbeitet, im Kabinett für Kulturarbeit. Das Haus war da. Ihr ist zu verdanken, dass der Hausbau und alles, was damit zusammenhing, gut über die Runden kam. Ich? Wann hatte ich Zeit. Ich muss sagen, sie hat die Sache gemeistert. Und da war der Junge. Er brauchte besondere Fürsorge, in den ersten Jahren war er oft krank. Das sind doch Aufgaben für eine Frau. Wieso soll ich mich geändert haben? Unsinn. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist, ich stehe vor einem Rätsel. Ich habe diesen Monat gewartet. Die Leute glauben, meine Frau sei zur Kur. Eine Kur geht aber einmal zu Ende. Wie soll ich ihr Wegbleiben erklären? Meine Frau ist mir weggelaufen. Sie langweilt sich mit mir. Ich bin ihr fremd geworden. Was soll dieses Zeug? Wer soll das verstehen? Das sind alles Dinge, die mit nüchternem Verstand nicht zu fassen sind. Sie gibt keine Nachricht. Der Junge kommt bald von großer Fahrt nach Hause. Er weiß noch nichts. Ich möchte dich bitten, dass du zu ihr gehst. Ich bitte dich sehr darum.“
Nun hatte sich auch sein Gesichtsausdruck verändert. Seine Augen waren voll auf mich gerichtet, ein verzweifelter, zorniger Blick.
Wenn auch diese Öffnung nicht lange anhielt, denn er lehnte sich schon wieder zurück und verschränkte die Arme, veranlasste sie mich doch, ihm zu sagen, dass ich versuchen würde, ihm zu helfen.
„Ich bekomme von dir Nachricht“, sagte er.
„Ja, ich gebe dir Bescheid.“
Weiß sagte übergangslos: „Ich habe noch einen Termin im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft. Da ist bei uns was zu klären, und über die örtliche Ebene ist kein Vorankommen. Also dann eben ein Versuch von oben nach unten.“
Ich wollte mich schon interessiert geben, aus Gewohnheit, aus Höflichkeit, besann mich aber und wünschte meinem Gast Erfolg in seiner Mission von oben nach unten.
Weiß erhob sich, schaute sich noch einmal im Zimmer um, trat an das Fenster, von dem man in einen kahlen Hof hinuntersah, und sagte: „An diesen Raum müsste ich mich erst gewöhnen.“
„Er hat seine Vorteile. Hier lenkt nichts von der Arbeit ab, keine Schönheit der Landschaft, kein Straßenverkehr, kein Lärm.“
Im Vorzimmer half ich ihm in den Halbpelz. Von der Tür aus nickte er meiner Sekretärin zu, gab mir die Hand.
„Ich bedanke mich. Ich warte auf deine Nachricht.“
Ich murmelte eine Floskel, keine Ursache, oder: Es wird schon alles klarkommen.
Ich schloss die Tür hinter ihm.
„Der Tee war wieder ausgezeichnet, Frau Schirmer.“
„Danke“, sagte sie und schrieb weiter.
„Kamen Anrufe?“
„Ich habe sie notiert. Auf meinem Tisch liegt ein Zettel. Nichts von Bedeutung.“
„Danke“, sagte ich, überflog Frau Schirmers Notizen und wusste in diesem Augenblick, dass ich heute für meine Arbeit keine Konzentration mehr aufbringen würde.
Ich ging in mein Zimmer und schloss die Tür, setzte mich an den niedrigen Klubtisch. In der Tasse, die Weiß benutzt hatte, glänzte ölig der abgestandene Tee. Ich wollte mir über die letzte Stunde klar werden. Warum hatte ich mich so weit hineinziehen lassen in diese Geschichte? Aber sie waren ja keine Fremden für mich. Ich konnte einfach nicht leidenschaftslos über die Geschehnisse um die beiden Weiß’ nachdenken.
Den Brief hatte Weiß wieder eingesteckt. Auch wenn er den Briefbogen zum hundertsten Male aus dem Kuvert herausnehmen würde, sähe der immer noch glatt und sauber aus.
Weiß zeichneten schon damals Korrektheit und Ordnungsliebe aus. Neunzehnhundertzweiundsechzig lernte ich ihn kennen. Oder war es dreiundsechzig? Nein, Ende neunzehnhundertdreiundsechzig kam ja schon der Junge, der Steffen. Wir hatten von der Fakultät aus den Wunsch geäußert, einige zusätzliche Vorlesungen über ökonomische Probleme zu hören, und hatten uns an die Hochschule in Karlshorst gewandt. Ein Dr. Weiß wurde uns angekündigt, und ich, damals Dozent, erhielt den Auftrag, mit ihm das Nötige abzusprechen.
Pünktlich, zur angegebenen Zeit, erschien der Doktor. Er war noch sehr jung. Das Blauhemd stand in seltsamem Widerspruch zu dem fast feierlichen dunklen Anzug, den er anhatte. Ich wusste nicht, dass es sein einziger war. Den trug er zu allen besonderen Gelegenheiten. Der Kragen des Blauhemds war zugeknöpft, das erhöhte den Eindruck der Reserviertheit, der von seiner ganzen Erscheinung ausging.
Im ersten Augenblick dachte ich: Da haben uns die Leute aus Karlshorst jemanden geschickt, der sich bei uns ausprobieren soll oder den man bei ihnen gerade mal entbehren kann.
Ich sollte bald merken, dass ich mich irrte. Nach einigen allgemeinen Sätzen kamen wir zur Sache. Und der junge Doktor erläuterte seine Konzeption.
Ich höre seine Stimme noch.
„Ich nehme an, Genosse Karras, man erwartet von mir keinen allgemeinen Überblick über die Ökonomie des Sozialismus, sondern einige Problemdarstellungen zur Ergänzung des Geschichtsstudiums. Ich kann Ihnen mehrere Vorschläge unterbreiten. Sie müssen sagen, was Ihnen brauchbar erscheint.“
Ruhig trug er sein Angebot vor, sah nach jedem Passus fragend auf, und wenn ich zustimmend nickte, las er weiter.
Seine Vorschläge waren alle brauchbar. Ich war überrascht, dass er ausgewählt hatte, was wir tatsächlich als Ergänzung nötig hatten – und ich sagte ihm das.
„Ich habe mich beraten lassen“, sagte er, „und einige Erfahrungen habe ich auch.“
Ich fragte ihn nach seinem Alter.
„Fünfundzwanzig“, antwortete er etwas erstaunt, „warum fragen Sie?“
„Da haben Sie schon viel geschafft“, sagte ich und dachte an den Weg, den ich hinter mir hatte. Ich war über zehn Jahre älter und gerade oder noch nicht einmal soweit wie er. Und diese zehn Jahre Zeitverzug schrieb ich dem Krieg und den Nachkriegszeiten zu.
„Es geht eigentlich alles ziemlich planmäßig“, sagte Weiß, „natürlich muss man arbeiten.“
Der Mann gefiel mir ausnehmend. Was mich etwas störte, war seine zu trockene Darstellungsweise. Das konnte am Stoff liegen. Auf dem Gebiet der Ökonomie war ich damals nicht sonderlich beschlagen und kann mich auch heute nicht gerade als Experte bezeichnen. Damals ging in der Praxis nicht alles auf, was die Theorien verkündeten. Vielleicht war es auch so, dass sich die Theorie zu wenig auf die Tendenzen und Bewegungen in der Praxis orientierte. Zuviel wurde über Wünschenswertes geredet und weniger über das, was real möglich und machbar war.
Doch unsere neue Erwerbung, der Gastdozent Dr. Weiß aus Karlshorst, vermied geschickt, so schien es mir jedenfalls, diese Klippen, versuchte sachlich und nüchtern über das zu reden, was möglich und verständlich war.
Vor seiner ersten Vorlesung, muss ich gestehen, bangte ich etwas darum, wie er bei uns aufgenommen würde. Im Vorlesungssaal spürte ich hinter mir fast körperlich die ansteigenden Reihen, in denen sich unsere zukünftigen Historiker drängten. Und wieder kam er in seinem dunklen Anzug und dem Blauhemd mit geschlossenem Kragen. Sein dichtes blondes Haar hatte er streng gescheitelt, wahrscheinlich konnte er es nur auf diese Weise bändigen.
Es gab Raunen und Unruhe im Saal, denn der von der Ökonomie war recht jung, nicht viel älter als die auf den Bänken.
Er ließ sich Zeit an seinem Tisch, ordnete, wie mir schien, umständlich seine Unterlagen.
Ungeduldig wartete ich auf das mit ihm verabredete Zeichen, ich wollte ihn vorstellen, ihm den Start an unserer Uni erleichtern.
Endlich nickte er mir zu, ich erhob mich und hielt meine kurze Rede.
Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz besetzt. Es war eine Pflichtveranstaltung. Vom Lehrkörper unserer erlauchten Fakultät sah ich jedoch nur wenige Kollegen. Ökonomie, nun ja. Trockene Angelegenheit. Ich bedauerte diese Einstellung. Wenigstens nicht so deutlich zeigen musste man sie vor den Studenten.
Weiß brachte mit dem ersten Satz die Leute zur Ruhe.
Ohne besondere Betonung sagte er: „Geschichtliche Abläufe sind ohne Kenntnis der ökonomischen Bedingungen der jeweiligen Zeit nicht zu verstehen. Für die Zeitgeschichte trifft das in erhöhtem Maß zu.“
Weiß’ Antrittsvorlesung bei uns wurde ein voller Erfolg.
Dabei verzichtete der Mann auf alle Faxen, war kein blendender Rhetoriker, arbeitete keine Pointen heraus, er bestach durch die Klarheit und Logik seines Vortrages und durch seine Kenntnisse. Die brachte er ganz selbstverständlich ins Spiel, er hatte sie drauf. Unsere Studenten spürten das sofort, verfolgten seinen präzisen Vortrag mit Aufmerksamkeit.
Weiß benutzte seine Aufzeichnungen nur selten, manchmal orientierte er sich nur oder las Zitate heraus.
Die Sympathie unserer Studenten für Weiß war unüberhörbar.
Während der übliche Lärm ausbrach, der nicht zu vermeiden ist, wenn junge Leute einen Saal verlassen, ordnete Weiß sorgsam seine Unterlagen. Er hatte verschiedene Mappen und Kladden und verstaute alles in seiner großen schweinsledernen Aktentasche.
Ich ging auf ihn zu und sagte: „Gratuliere, Genosse Weiß.“
„Danke“, erwiderte er, „eure Leute hier sind ja wirklich sehr aufmerksam.“
Das waren meine ersten Begegnungen mit Wolfgang Weiß.
Und diese Antrittsvorlesung war auch die erste Begegnung seiner späteren Frau mit ihm. Monika Mögelin saß in einer der oberen Bankreihen, und sie war unter den letzten, die an diesem Nachmittag den Hörsaal verließen. Als ich mit Weiß unten am Tisch sprach, ging sie dicht an uns vorüber.
Wolfgang Weiß hat sie an jenem Novembertag bestimmt nicht wahrgenommen.