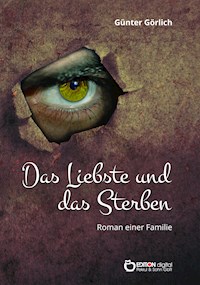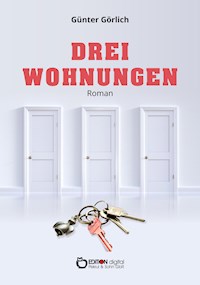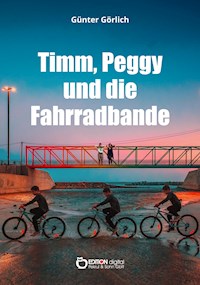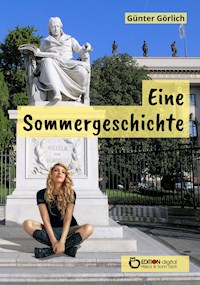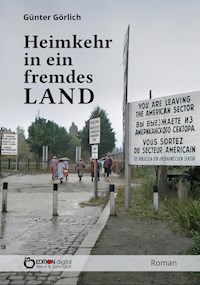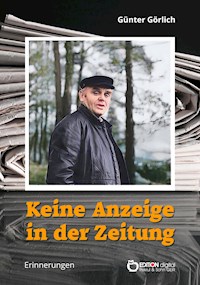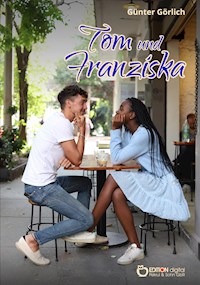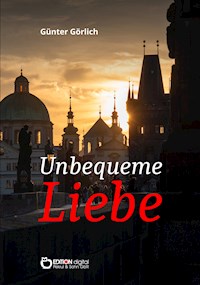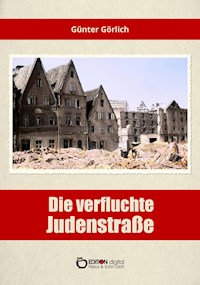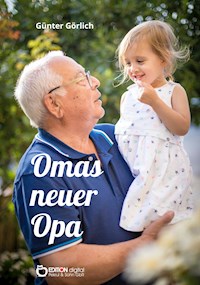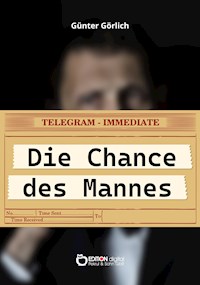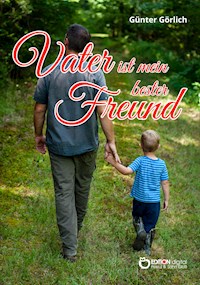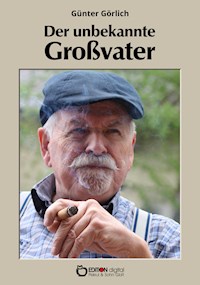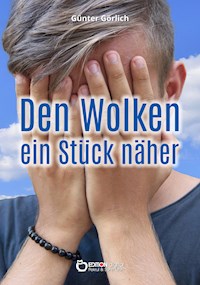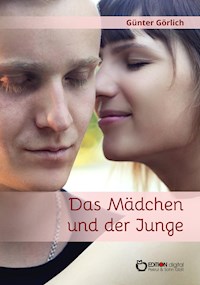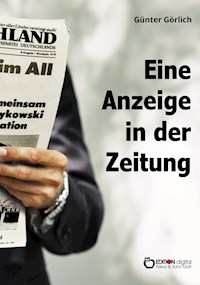
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eva warnt ihren Mann: Du brauchst nicht eifersüchtig zu werden. Wäre dumm. Der andere Mann, um den es bei dieser Bemerkung geht, das ist ein neuer Lehrer, der vor zwei Jahren an die Schule gekommen war - Ein kluger, gut ausgebildeter Mann und vor allen Dingen, das musste ich bald zugeben, eben auch ein Lehrer mir Leib und Seele, wie ihn sein Kollege Kähne beurteilt, der Erzähler der Geschichte und der Mann von Eva. Vor zwei Jahren, Mitte August, war Manfred Just in der kleinen Stadt L. an unserer Schule aufgetaucht. Er war nicht zu übersehen, schon sein Äußeres sorgte dafür. Das gefiel mir nicht besonders. Auch Karl Strebelow teilte meine Meinung. Oder ich seine. Ich weiß nicht mehr genau, sprachen wir zunächst über Justs Äußeres oder über seine für unsere Begriffe hemmungslose Neugier, mit der er Kollegen, Schüler, Wandzeitungen, die Einrichtungen des Lehrerzimmers, überhaupt alles in unserer Schule musterte und begutachtete. Sein Äußeres? Weiße Flanellhosen, zitronengelbes Hemd, offener Kragen und ein buntes Seidentüchlein um den Hals gebunden. Die Haare blond und für einen Lehrer etwas zu lang. In dieser Aufmachung stand er da oder schlenderte umher, sah sich alles an und hatte immer ein leichtes Lächeln im Gesicht. Manfred Just, Oberlehrer, Geschichte, Geografie, Staatsbürgerkunde. Wird in diesen Fächern unterrichten, wie er vorgestellt wurde, kam von der berühmten Einstein-Schule, einer Erweiterten Oberschule in P., eine Bahnstunde von seinem jetzigen Arbeitsort an der 6. Oberschule in L. ( einer stinknormalen Schule) entfernt, aber weshalb er versetzt worden war, erfuhren seine neue Kolleginnen und Kollegen nicht. Ein Abstieg? Just fällt aber nicht nur durch seine Kleidung auf, sondern auch durch seine Art des Unterrichts auf und durch seine Fragen, die zum Diskutieren reizen. Just bringt Unruhe in die Schule. In einer „besonderen Mission“ soll ihn Kähne unter Beobachtung halten. Und dann das: „Woran ist er gestorben?“, fragte ich ungeduldig. „An einer Überdosis Tabletten“, sagte Karl Strebelow nüchtern. Ich glaubte, mich verhört zu haben. „An Tabletten?“ „Ja, an einer Überdosis. Zuviel hat er geschluckt.“ „Er hat sich das Leben genommen?“ „Eine Anzeige in der Zeitung“ war auch vom DDR-Fernsehen verfilmt und erstmals am 7. September 1980 ausgestrahlt worden – mit Alexander Lang als Manfred Just, Hans Teuscher und Christine Schorn als Herbert Kähne und Eva Kähne sowie Kurt Böwe als Schuldirektor Karl Strebelow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Eine Anzeige in der Zeitung
ISBN 978-3-96521-717-1 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1978 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I.
Anfang August, an einem Donnerstag, vermutlich in den Vormittagsstunden, nahm sich der Lehrer Manfred Just das Leben.
Zu dieser Zeit flog ich mit Eva, meiner Frau, in einer Linienmaschine der Aeroflot von Moskau nach Adler. Meine Gedanken waren auf die vor uns liegenden drei Wochen gerichtet, die wir in Gagra am Schwarzen Meer in einem Heim der Moskauer Pädagogen verbringen sollten, und würde ich auch nur die leiseste Andeutung von dem vernommen haben, was in dieser Stunde in der Stadt P. geschah, ich hätte es nicht geglaubt. Manfred Just, fünfunddreißig Jahre alt, der heitere, aktive Mensch, setzt seinem Leben selbst ein Ende? Ich kannte ihn doch ziemlich genau, wusste um seine Probleme und Schwierigkeiten, seine Leistungen, seine Hoffnungen. Und ich wusste um seine Gier nach Leben.
Ich spähte aus dem Flugzeugfenster und versuchte unter uns die Erde zu erkennen. Wolkenschleier entzogen mir den Blick auf das Land. Die Maschine befand sich laut Bordinformation in neuntausend Meter Höhe. Eva hatte mir den Fensterplatz überlassen, sie flog nicht gern.
Bevor die Maschine zur Landung ansetzte, zog sie eine weite Schleife über dem Meer, und es war, als würde das Flugzeug auf den Wellen aufsetzen. Im klaren Wasser erkannte ich deutlich ein Boot, das untergegangen war.
Die Landung vollzog sich genauso, wie sie mir Manfred Just lebhaft und anschaulich beschrieben hatte. Das war unser letztes Gespräch am letzten Schultag vor den Ferien gewesen. Er beneidete mich heftig um diese Reise in eine der schönsten Gegenden unserer Erde, wo er selbstverständlich schon gewesen war. Dann bemerkte er noch lachend: „Ich gönn dir’s, altes Haus. Ehrenwort, dir gönn ich’s von ganzem Herzen.“
Ich war überzeugt, Just meinte es so. Auf meine Frage, wie er den Urlaub geplant habe, erwiderte er, dass er keine besonderen Pläne habe, er wolle mal in den Tag hinein leben, sich überraschen lassen vom Leben.
„Du kennst mich ja“, hatte er hinzugefügt, „manchmal bin ich ein sprunghafter und launenhafter Kollege, wie es von mir hin und wieder höheren Ortes heißt.“ Er lächelte spöttisch.
Ich wusste, seine letzte Bemerkung bezog sich auf die Auseinandersetzung mit Karl Strebelow im Mai, als Just eine Fahrt mit seiner Klasse an die polnische Ostseeküste unternommen hatte, ohne den Schulleiter davon in Kenntnis zu setzen. Just rechtfertigte sich mit der Ansicht, dass diese Kurzfahrt in den Ferien stattgefunden habe, und die müsse er nur mit den Eltern absprechen, das habe er getan.
Karl Strebelow erwiderte scharf, dass er eine derartige Trennung in der Arbeit eines Lehrers, gewissermaßen in Schulzeit und Ferienzeit, nicht akzeptiere.
Ich fand, dass Karl die Sache etwas aufbauschte, im Prinzip aber gab ich ihm recht.
Ich machte Just Vorhaltungen.
Er sagte: „Nun ja, das ging alles so schnell vor den Ferien, ich bekam das Quartier ganz überraschend. Es blieb keine Zeit, zum Kollegen Direktor zu gehen. Ich hab’s einfach vergessen. Selbstverständlich hätte ich einen Brief schreiben können.“
„Warum hast du das nicht so im Kollegium dargestellt?“
Er sah mich ein wenig schuldbewusst an. „Warum muss man immer gleich prinzipiell kommen? Sofort ein Grundsatzproblem draus machen. Aber nicht eine winzige Nachfrage, wie die Sache dort in Polen war. Könnte ja interessant gewesen sein.“
Ohne Grundsätze ginge es nicht in unserer Arbeit, erwiderte ich, spürte sofort, wie kraftlos meine Antwort war.
Deshalb vielleicht fügte ich noch hinzu, dass man bei Karl Strebelow immer die Generation berücksichtigen müsse, der er angehöre. Er sei einer aus der Schar der wenigen Leute, die sofort nach dem Kriege ohne Wissen und Kenntnisse an die Arbeit gingen. Damals war es unbedingt notwendig, grundsätzlich zu betonen, was neu zu machen sei in der Pädagogik. Sonst wäre man baden gegangen, um es milde auszudrücken.
Da hatte Just gesagt: „Wenn ich mich nicht irre, lieber Kollege Kähne, bist du ja auch einer aus dieser legendären Schar.“
Im Übrigen war die Fahrt an die polnische Ostseeküste für Justs Klasse ein Erlebnis. Das erfuhr ich ohne Mühe, als ich für ihn, der um einen Tag Urlaub gebeten hatte zwecks Klärung einer persönlichen Angelegenheit, eine Stunde Vertretung in Geschichte gab.
Die Mädchen und Jungen seiner 9b schwärmten geradezu von der Reise.
Doch an diesem Augustvormittag auf dem Flugplatz Adler lag der Schulalltag mit seinen Problemen weit hinter mir. Ich war froh, dass Eva die Landung gut überstanden hatte und ihr Gesicht allmählich wieder Farbe bekam.
In der Ferne stiegen die Berge des Kaukasus auf, wir entdeckten die ersten Palmen, deren Blätter sich im warmen Wind raschelnd rieben. Und es begannen die Wochen in diesem südlichen Land, die ich nicht vergessen kann, vielleicht auch deshalb nicht, weil diesen Wochen eine Zeit folgte, die sich krass davon abhob.
Wir überquerten im Taxi die Grenze nach Asien. Es war schon ein seltsames Gefühl. Eva meinte: „Jetzt müssten wir umkehren und zu Fuß noch einmal die Grenzlinie, die schließlich zwei Erdteile trennt, überschreiten. Was meinst du? Ist doch für uns ein historischer Augenblick.“
Ich meinte, sie solle das dem Fahrer sagen, schließlich spreche sie gut russisch, der werde schon Verständnis haben.
Wie immer zweifelte sie ihre Sprachkenntnisse an, redete aber doch mit dem Fahrer. Der wendete und fuhr zurück über die Grenze nach Europa hinein. Wir stiegen aus und gingen langsam, Hand in Hand, über die Grenzlinie, betraten zum ersten Mal in unserem Leben asiatischen Boden.
Das war schon ein Spaß mit einem Schuss Feierlichkeit.
Es könnte sein, dass in jenem Augenblick in der Stadt P. sich Manfred Just das Leben nahm, denn es war vierzehn Uhr, und man musste ja drei Stunden zurückrechnen, um auf die Zeit zu kommen, die zu Hause gültig war. Es lag also im Bereich des Möglichen.
Nur dass wir so etwas auch nur vermutet hätten, war ganz und gar unmöglich.
Zwar dachte ich an die Schule, aber an meinen Genossen Karl Strebelow, stellte mir vor, was der sagen würde, wenn er uns hier bei dieser Zeremonie sähe. Die Augenbrauen würde er zusammenziehen, und wahrscheinlich wäre auf seinem Gesicht nicht das leiseste Lächeln zu bemerken. Karl käme das alles ein wenig abgeschmackt vor, unernst und der Bedeutung des Augenblicks überhaupt nicht angemessen. In der Richtung würde er sich äußern und dabei den Kopf schütteln. Vielleicht würde er mir noch mildernde Umstände zubilligen, weil er Eva kennt, die er schätzt in ihrer Arbeit im Verlag, vor der er Respekt empfindet, denn Bücher sind die Produkte ihrer Arbeit, und vor jedem gedruckten Text hat Karl Strebelow eine große Hochachtung. Bloß mit ihren verrückten Einfällen kann er sich nicht abfinden.
Ich lächelte in Gedanken, und Eva fragte natürlich nach dem Grund.
„Ich hab an Karl gedacht“, sagte ich.
Sie sah mich an. „Du, ich hätte ihn dazu gebracht, mit auszusteigen.“
„Überschätzt du dich da nicht?“
„Ich hätte es nur etwas ernsthafter begründen müssen. So in der Art, dass dieses Erlebnis vom Auto aus keins ist, weder vom Verstand noch vom Gefühl her. Und, Karl, hätte ich gesagt, wie willst du deinen Schülern das schildern?“
Ich lachte. „Seine wunde Stelle, meinst du!“
„Wunde Stelle?“, fragte Eva. „Seine beste.“
Ja, so konnte man das bei Karl Strebelow auch sehen.
Unser Fahrer öffnete weit die Autotür.
„Charascho“, sagte er, „unser Asien. Georgien. Wunderschönes Land, sehr wunderschönes Land.“
Es gibt einen Zustand, der fast unwirklich ist, traumhaft, weil er mit dem realen Leben nicht übereinzustimmen scheint. Alles ist schön, alles ist gut.
Die Bucht von Gagra habe nicht immer klares Wasser, versicherte man uns, es könne allerhand angetrieben werden, vor allen Dingen Quallen, wenn der Wind ungünstig stehe. Oder die Augusthitze. Sie könne drückend sein, schwül, denn kein Windhauch von Nord oder Ost dringe durch, die hohen Berge ließen das nicht zu. Das Thermometer könne weit über 30 Grad klettern. Das Atmen würde schwer.
Nichts von dem war in unseren Wochen. Das Wasser grünlich und klar und ohne Quallen, die Temperatur nie über 30 Grad und keine Schwüle in der Bucht von Gagra.
Wir waren wohl Glückskinder, jedenfalls glaubte Eva fest daran, und nur das Wissen, dass wir in absehbarer Zeit wieder nach Adler fahren würden und in ein Flugzeug steigen müssten, trübte hin und wieder ihre Freude.
Wir bewohnten ein Zimmer mit Blick zum Meer. Auf dem Balkon saßen wir oft bis spät in die Nacht.
Auf dem Balkon schrieben wir auch fleißig unsere Kartengrüße in die ferne Heimat. Darunter war selbstverständlich ein Gruß an Manfred Just.
Den überließ ich Eva. Sie hatte etwas übrig für Just. Die beiden hätten, glaube ich, ein gutes Paar abgegeben, wenn sie sich früher begegnet wären. Vielleicht. Als vor zwei Jahren Just an unsere Schule gekommen war, sahen sich beide das erste Mal auf einer Faschingsfeier. Sie fanden von der ersten Minute an, Just saß an unserem Tisch, den leichten Ton, der mir nicht immer gelingen wollte in den vielen Jahren meiner Ehe mit Eva. Ich war schon nahe daran, eifersüchtig zu werden. Aber meine Frau kennt mich in dieser Hinsicht und kam mir zuvor.
„Der Neue ist ja eine Perle. So was habt ihr nicht ein zweites Mal in eurem etwas sehr ernsten Verein. Der kann andere, aber auch sich selbst herrlich auf die Schippe nehmen. Das gefällt mir. Aber du brauchst nicht eifersüchtig zu werden. Wäre dumm.“
So durfte ich es auch nicht sein. Eine Weile fiel es mir ziemlich schwer, doch bald hatte Just den Ton gefunden, mit dem man bei meiner Eva auf die Dauer als guter Freund bestehen kann.
Eva also schob ich auf dem Balkontisch die Karte hinüber mit der Aufforderung, sich für Just etwas einfallen zu lassen. Sie zögerte keinen Augenblick, schrieb und las mir dann vor.
Lieber Just, Manfred, Lehrer im Urlaub im langweiligen Mitteleuropa!
Es grüßen Dich zwei Fast-Georgier. Nun wissen wir genau, was Dich hier so beeindruckt hat. Die Berge, die zum Meer abfallen? Na ja, sicher auch. Der Wein, der die Zunge löst und den Kopf etwas schwer macht, wenn die Zunge sich zu sehr lösen wollte? Kann sein, kann sein. Aber Just, Manfred, es sind die Frauen, die Dich geschafft haben, alter Junge. Schön, glutäugig, unnahbar. So sehe ich das jedenfalls und mein lieber Mann Herbert, dem ich eine derartige Einstellung auch geraten haben möchte. Oder hast Du, Casanova des Nordens, etwa andere Erfahrungen gemacht? Decken wir den Mantel des Schweigens über alle Abgründe. Und wie dem auch sei, uns geht’s sauwohl.
Grüß auch Anne Marschall, Deine Kollegin und Mitstreiterin, von der wir annehmen, dass sie hin und wieder Deine einsamen Stunden verschönt durch ihre Anwesenheit.
Viele heiße Kampfesgrüße von Eva und Herbert.
„Mein Gott, dir geht’s gut“, sagte ich lachend.
„Na klar, und so soll’s anderen auch gut gehen“, erwiderte Eva ernsthaft.
Mit Anne Marschall, die Eva so selbstverständlich grüßen ließ, lag für mich, was Just betraf, nicht alles so eindeutig, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussah.
Die Marschall war vor einem Jahr, also ein Jahr später als Just, zu uns gekommen, von der Hochschule frisch in die Schulwelt entlassen, mit Bangen und Tatendrang, wie das eben so ist.
Just hatte sich der Absolventin angenommen, war ohne Aufforderung ihr Mentor geworden, denn die Marschall ist ein schönes Mädchen. Da waren zwei Blonde und Blauäugige zusammengekommen, und Eva stellte bald ihre berühmten Überlegungen an, wie die Kinder der beiden aussehen könnten. Noch blonder, noch blauäugiger. Der Superlativ von blond, der Superlativ von blauäugig.
Anne Marschall gefiel mir am Anfang überhaupt nicht. Ihre bohrenden Fragen, ihre aufgeregte Naivität erzeugten bei mir Antipathie. Es kostete mich Überwindung, sie das nicht spüren zu lassen.
Und dann begann zu dem Zeitpunkt, als sie zu uns kam, mein Verhältnis zu Just nach etlichen Spannungen und Auseinandersetzungen freundschaftlich zu werden. Ich befürchtete, sie könnte diese Entwicklung stören. Das Verhältnis zu Just wurde wichtiger für mich, als ich wahrhaben wollte.
Ich gehe auf die Fünfzig zu und gehöre einer Lehrergeneration an, die durch die Zeitumstände gezwungen war, lange jung zu bleiben. Es ist nicht so einfach, Frische und Schwung zu zeigen, wenn man sie nicht mehr in dem Maße besitzt, wie es verlangt wird. Und dann unser mühseliger Weg, das fehlende Wissen. Aber Lehrer sind wir mit Leib und Seele.
Diese Gründe erklären es, dass wir dazu neigen, alle und alles mit unseren Erfahrungen zu vergleichen, nur unsere Maßstäbe anzulegen. So fällt es uns manchmal schwer, die nach uns Kommenden gerecht zu beurteilen. Just war für mich eine Art Prüfstein. Ein kluger, gut ausgebildeter Mann und vor allen Dingen, das musste ich bald zugeben, eben auch ein Lehrer mir Leib und Seele.
Nur glaubte ich damals, Just hätte über diesen etwas gefühlsbetonten Ausdruck ironisch gelächelt. Für ihn stellte sich das alles viel nüchterner dar. Wissen, Methodik, Psychologie – ja, damit ist etwas anzufangen.
So war ich misstrauisch und bewunderte zugleich manches, was Just betraf. Ich war überzeugt, Karl Strebelow ging es wie mir. Nur Karl ging nie so dicht heran an Just und andere dieser Art. Vielleicht hatte er sogar recht damit.
Für Karl Strebelow gab es einen ehernen Grundsatz: Das einheitlich und geschlossen handelnde Lehrerkollektiv verbürgt, dass im sozialistischen Sinne erzogen und ausgebildet wird.
Im Prinzip gab es gegen diesen Grundsatz nichts einzuwenden.
Anne Marschall betrat also zu einem Zeitpunkt unsere Bühne, als Just und ich Partner wurden – und machte sofort Eindruck.
Bald aber merkte ich mit Erstaunen, dass die Marschall für Just anscheinend eine ähnliche Bedeutung hatte wie er für mich; sie war ja zehn Jahre jünger als er.
Wer weiß, was er in ihr sah oder an ihr entdecken wollte.
Dass er die Frau entdeckte, schien mir zunächst selbstverständlich zu sein. Doch bald begann ich zu zweifeln, ob ich nicht etwas voreilig geurteilt hatte.
Auch an Karl Strebelow schrieben wir einen Gruß aus der Bucht von Gagra.
Ich wählte zunächst eine Karte, auf der ein Pionierpalast zu sehen war, begann schon zu schreiben, zerriss sie dann aber. Mir fiel ein, dass mich Karl sofort nach der Rückkehr fragen würde, ob ich in dem Pionierhaus gewesen sei, vielleicht Verbindung aufgenommen habe zwecks Briefwechsels und Austausches. Schließlich müsse man solche Möglichkeiten nützen, an Ort und Stelle Kontakte zu knüpfen. Gut und richtig. Nur ich war zu faul und träge, war wunschlos glücklich in diesen Tagen, und Karl das zu erklären wäre sinnlos gewesen.
In Karls Augen war es eine Todsünde, derartige Gelegenheiten zu versäumen. Er, da hätte ich wetten können, hätte diesen Pionierpalast besucht und eine Verbindung hergestellt. Fotos und anderes Material hätte er nach Hause geschleppt, Vereinbarungen wären getroffen worden. Karl war immer erfüllt von seiner pädagogischen Aufgabe. Darin besaß er eine entwaffnende Hartnäckigkeit. Einer seiner Aussprüche, in Abwandlung eines Lenin-Zitats, lautete: „Dranbleiben, dranbleiben – und immer wieder dranbleiben, das ist schon der halbe Erfolg, Genossen und Kollegen.“
Das Strebelow-Zitat wollte ich nicht hören und mich nicht dem darin enthaltenen Vorwurf aussetzen. Ich wählte eine Karte, auf der ein Sonnenuntergang hinter dem Kap zu sehen war. Ich schrieb, dass es uns gut gehe, dass ich nicht genug rühmen könne, was mir der Urlaub hier bedeute, zumal ich dadurch von allen Vorbereitungen auf das neue Schuljahr verschont bliebe. – Aber ich werde das schon wieder gutmachen, Karl, schrieb ich. Dann wollte ich Karl noch etwas über Andrej Plantonowitsch und seine Frau Galja mitteilen, beide Lehrer aus Moskau, ließ das aber auch sein. Was hätte ich schreiben können, um Karls Interesse zu wecken? Denn Andrej Plantonowitsch und ich hatten uns bis dahin noch nicht allzu oft über Schulprobleme unterhalten.
Also schrieb ich: „Bis bald, Karl.
Es grüßen Dich herzlich Herbert und Eva.“
Wie an jedem Abend schwamm ich mit Andrej Plantonowitsch ziemlich weit raus, und Andrej begann zu singen.
Auf diese Weise war er uns auch aufgefallen, gleich am ersten Abend. Eva hatte mich auf den Balkon geholt. „Hör doch mal.“
Vom Wasser herauf schallte kräftiger, getragener Gesang. Ein Mann trieb auf dem Rücken und sang aus voller Kehle.
Bald sangen abends Andrej Plantonowitsch und ich abwechselnd. Manchmal auch gemeinsam, wenn wir uns auf ein bestimmtes Lied geeinigt hatten. Zum Beispiel „Kaiinka“ oder „Abendglocken“ oder „Durchs Gebirge, durch die Steppe zog unsere kühne Division“.
An Andrej Plantonowitsch hätte, da war ich sicher, auch Manfred Just Gefallen gefunden. Wir hätten ein gutes Trio abgegeben auf dem Wasser in der Bucht von Gagra, Andrej Plantonowitsch, Just und ich.
Drei Tage vor unserer Abreise kauften wir am Bahnhof einige Zeitungen aus der Heimat, natürlich älteren Datums.
Gleich zu Beginn unseres Urlaubs hatten wir eine Selbstbedienungsgaststätte entdeckt, in der auch pechschwarzer, heißer und süßer türkischer Kaffee verkauft wurde, das Tässchen für zehn Kopeken.
Während Eva nach dem Kaffee anstand, hatte ich zwei Stühle besetzt und blätterte in einer der Zeitungen. Dabei stieß ich auf die Todesanzeige, in der mitgeteilt wurde, dass der Oberlehrer Manfred Just, Träger von staatlichen Auszeichnungen, im Alter von 35 Jahren verstorben sei. – L., am 12. August – Schulleitung – Gewerkschaftsleitung – Schulparteiorganisation. Die Urnenbeisetzung habe in Berlin stattgefunden.
Ich las den lakonischen Text, las ihn noch einmal halblaut und musste dann einschen, dass es unser Manfred Just war; dass er nicht mehr lebte.
Ich bemerkte Eva erst, als sie die Kaffeetassen auf der Marmorplatte absetzte. Ich habe sie sicher sehr verstört angesehen, denn sie fragte, ob mir nicht gut sei, ob ich meine Kreislauftropfen mithätte.
Ich schob ihr die Zeitung hinüber. Sie reagierte wie ich wenige Augenblicke zuvor, brauchte auch eine Weile, bis sie begriff.
„Manfred ist tot?“, sagte sie tonlos.
„Warum haben sie nicht telegrafiert?“, fragte ich heftig und wusste im selben Augenblick, dass sie uns den Urlaub nicht verderben wollten. Was hätte das Telegramm geändert? Unser Urlaub hätte sich geändert. Und ich wusste nun wieder einmal, wie trügerisch so eine wunschlos glückliche Zeit sein kann.
Eva und ich dachten wohl dasselbe, nur Eva sprach ihre geheime Sorge aus, dass ein Zustand, wie unser makelloser Urlaub es gewesen sei, sie immer in Unruhe versetze.
„Ich hab dann Angst“, sagte sie, „ich weiß, das entspricht überhaupt nicht einem aufgeklärten Menschen, der ich immer sein will. Schicksal. So ein Unsinn. Und doch habe ich Angst. Zuviel Schönheit, so ein Frieden. Und wieder ist etwas passiert. Was ist ihm bloß zugestoßen, unserem Manfred?“
Das blieb unsere Frage, da ereiferten wir uns verzweifelt, da mutmaßten wir und wussten doch nur wenig über das, was zu Hause geschehen war.
Ich meinte, dass er vielleicht mit seinem Motorrad verunglückt sei.
„Manchmal fuhr er ja wie ein Verrückter“, sagte ich erbittert. Nahm das aber wieder zurück. Just fuhr zügig, aber sicher, ich war einige Male mit ihm gefahren. Doch auch ohne wie ein Verrückter zu fahren, kann man verunglücken. Ein anderer, vielleicht ein Betrunkener, fährt dir in die Seite. Aus.
Was sollte denn sonst passiert sein? Infarkt? Ausgeschlossen. Bei Manfred doch nicht. Der lebte sportlich und gesund. Wie das blühende Leben sah er aus.
Eine Weile saßen wir am Marmortisch, die Zeitung mit dem schwarzumrandeten Text lag zwischen uns. Wir hatten die Umwelt vergessen.
Erst als wir den heißen Kaffee tranken, nahmen uns allmählich wieder das bunte, laute Treiben an einem südlichen Strand, die grellen, überdeutlichen Farben, die scharfen Gerüche gefangen.
Todesfurcht hatte uns gestreift, wie das immer ist, wenn man einen nahestehenden Menschen verliert. Bei Fremden empfindet man die Tatsache, dass man selbst lebt, stärker, man hört vom Tod eines anderen mit der etwas seltsamen Genugtuung, dass man lebt, dass es weit weg ist, was da geschah.
Als wir unser Ferienheim betraten, das uns in diesem Augenblick besonders vertraut vorkam, waren wir uns einig, dass dort in der Heimat etwas Tragisches geschehen sein musste.
Das ganze Ausmaß der Tragik ahnten wir nicht.
Wir wussten, in den letzten drei Tagen unseres Urlaubs würde uns Manfred Justs Tod beschäftigen, diese letzten Tage im schönen Gagra würden von der Trauer um Manfred Just überschattet sein. Wir spürten, dass uns dieser eigenartige Mensch viel näher gestanden hatte, als wir es uns bisher eingestehen wollten. Er lebte ja mit uns, war unbekümmert, spöttisch, lustig, grundehrlich, manchmal verdammt hilflos. Und man konnte großartig mit ihm streiten.
An diesem Abend schwamm ich nicht mit Andrej Plantonowitsch auf das Meer hinaus, um zu singen. Er und seine Frau verstanden gut, wie uns zumute war. Es blieb still auf dem Wasser.
Wir saßen auf dem Balkon. Eva hatte den Tisch beiseite geschoben, wahrscheinlich wollte sie, dass wir uns näher waren als sonst.
Wir tranken roten Wein.
Bis tief in die Nacht saßen wir dort.
Vor uns entstand noch einmal das Bild des Manfred Just, wie wir ihn gekannt hatten. Wir spürten, dass er uns manches Rätsel aufgab. Wir ergänzten das Bild auf unsere Weise, es sollte unser Abschied sein von ihm, wir ahnten ja nicht, dass er uns nach unserer Rückkehr noch sehr beschäftigen würde.
Vor zwei Jahren, Mitte August, war Manfred Just in der kleinen Stadt L. an unserer Schule aufgetaucht. Er war nicht zu übersehen, schon sein Äußeres sorgte dafür. Das gefiel mir nicht besonders. Auch Karl Strebelow teilte meine Meinung. Oder ich seine. Ich weiß nicht mehr genau, sprachen wir zunächst über Justs Äußeres oder über seine für unsere Begriffe hemmungslose Neugier, mit der er Kollegen, Schüler, Wandzeitungen, die Einrichtungen des Lehrerzimmers, überhaupt alles in unserer Schule musterte und begutachtete.
Sein Äußeres? Weiße Flanellhosen, zitronengelbes Hemd, offener Kragen und ein buntes Seidentüchlein um den Hals gebunden. Die Haare blond und für einen Lehrer etwas zu lang. In dieser Aufmachung stand er da oder schlenderte umher, sah sich alles an und hatte immer ein leichtes Lächeln im Gesicht.
Unser Schulbetrieb lief an wie immer, der Stundenplan musste unter Dach und Fach gebracht werden, eine Menge Arbeit war zu bewältigen.
Karl Strebelow stellte den Neuen im Kollegium vor.
Manfred Just, Oberlehrer, Geschichte, Geografie, Staatsbürgerkunde. Wird in diesen Fächern unterrichten. Freuen uns auf die Zusammenarbeit. Erfahrungen aus einer erweiterten Oberschule sind ohne Zweifel interessant und werden dem Lehrerkollegium bestimmt von Nutzen sein.
Da wussten wir nun, woher der Neue kam. Von einer Erweiterten, die einen berühmten Namen trug, aus der Stadt P., die eine halbe Bahnstunde von L. entfernt war. Aber weshalb er kam, das war von Karl Strebelow nicht einmal angedeutet worden. Das sichtbare Aufmerken im Kollegium blieb unbeachtet, musste unbeachtet bleiben, denn Strebelow konnte nichts sagen.
Er hatte mich vorher informiert.
„Der Kollege kommt von der Einstein-Schule.“
„So? Irgendetwas gewesen?“, fragte ich.
Für mich verband sich diese Mitteilung sofort mit dem Gedanken, dass ein derartiger Wechsel nur durch irgendwelche Unannehmlichkeiten in Gang gekommen sein konnte. So ist man in seinem Urteil festgelegt. Aber es sind auch Erfahrungen.
„Ob was gewesen ist, weiß ich nicht, aus der Beurteilung jedenfalls geht nichts hervor“, meinte Strebelow sichtlich unwillig und klopfte auf einen schmalen Heftordner, in dem offenbar das Dienstleben unseres neuen Kollegen festgehalten war.
„Eine gute Beurteilung übrigens. Dickes Lob“, fügte Strebelow hinzu.
„Und was sagt er?“
„Ich habe ihn gefragt, er hat meine Frage überhört“, sagte Karl Strebelow.
Ich wusste, das war ein schlechter Beginn in den Beziehungen zwischen Karl Strebelow und Manfred Just.
Ich kenne Karl schon sehr lange, man kann sagen, dass wir ein herzliches Verhältnis haben, das entstanden ist in den vielen Jahren gemeinsamer Arbeit an unserer 6. Oberschule in L. Zu einer Freundschaft ist es nicht gekommen, dazu haben wir in einigen Fragen zu unterschiedliche Ansichten.
Ich konnte mir gut vorstellen, was in Karl Strebelow vorgegangen war, als Just seine direkte Frage einfach nicht beantwortet hatte. Karl nahm alles sehr genau, er duldete keine Unklarheit. Er besaß eine ungeheure Zähigkeit im Verfolgen dunkler, undurchsichtiger Vorgänge. Nichts hasste er so sehr wie Verschwommenes und Verworrenes. Diese Eigenschaft prägte seinen Arbeitsstil, damit erreichte er solide Verhältnisse an seiner Schule, die sich deutlich zeigten im gleichmäßig guten Leistungsstand. In der Mitte der Fünfzigerjahre hatte Karl Strebelow diese Schule übernommen. Ich hatte mit ihm angefangen. Damals war das Gebäude neu, und wir waren froh und stolz gewesen, dass uns die Ehre zugefallen war, dort zu arbeiten.
Der geradlinige, fleißige Karl Strebelow bestimmte von Anfang an den Kurs. Das war unzweifelhaft richtig; ich stand immer hinter ihm und unterstützte ihn, wo ich nur konnte. Später wurde ich einer seiner Stellvertreter. Viel später allerdings kam mir manchmal der Gedanke, dass ein alles beherrschender Ernst, eine immerwährende Anspannung, wie sie Karl Strebelow praktizierte, sehr anstrengend sind und wenig Raum für pädagogische Versuche und für ein Eingehen auf neue Fragen und Situationen geben. Dieses Gefühl verstärkte sich bei mir mit den Jahren.
Hier aber muss ich einfügen, dass es natürlich auch genügend Veränderungen gab in jener Zeit, da ja vieles in Bewegung war. Wir gingen den Lauf der Dinge mit unter der Leitung von Karl Strebelow, erfüllten unsere Pflicht, in manchem oft mehr als das. Doch Diskussionen über Schulpolitik, pädagogische Theorie, auch Praxis gab es nur im abgesteckten Rahmen. Karl verabscheute „unfruchtbares Spinnen“, wie er es nannte, er forderte dafür äußerst gründliche Beschäftigung mit realen, gesicherten Erkenntnissen auf unserem Gebiet.
Karl Strebelows kleines Haus am Waldrand, in der Nähe der Autobahn, und der Garten davor und dahinter waren Musterbeispiele von Ordnung und Sauberkeit. Sein Leben verlief untadelig und pflichtbewusst. Und seine Prinzipien übertrug er konsequent auf die Schule, die er leitete.
Vielleicht verfahre ich etwas einseitig in der Beurteilung von Karl Strebelow, wahrscheinlich hat sich im Laufe der Zeit dieses Bild bei mir hergestellt, vielleicht sah ich alles schärfer durch diesen Manfred Just.
Und es muss auch noch gesagt werden, dass Karl Strebelow meiner Beurteilung im Wesentlichen zugestimmt hätte, denn mit diesen Begründungen hatte er seine Auszeichnungen in den letzten Jahren erhalten.
Seine Betroffenheit verstand ich also gut, als er von Just keine Antwort erhielt auf die Frage, warum er sich von der berühmten Einstein-Schule in P. ausgerechnet zu uns nach L., an unsere stinknormale Schule, versetzen ließ.
„Arroganz kann ich nicht ausstehen“, sagte Strebelow.
Ich teilte seine Meinung. Wie sollte man sonst die Haltung des neuen Kollegen nennen?
Natürlich begegneten auch die anderen Kolleginnen und Kollegen dem Neuen mit Neugier und Erwartung, es war doch ungewöhnlich, dass jemand auf diesem Wege unsere Reihen verstärkte.
Schon nach wenigen Tagen bemerkte ich, unsere Frauen achteten plötzlich mehr als zuvor auf ihre Kleidung; da wurde sichtbar, dass hübsche und gut gekleidete Kolleginnen an unserer Schule arbeiteten.
Noch war Spätsommer, es gab genug Gelegenheit, Kleider, Röcke, Kostüme im Wechsel zu zeigen. Erstaunlich, was sich da den Blicken unserer Männer darbot.
Und das war dem Neuen zu verdanken, der unbekümmert in seinen zitronengelben, roten, schwarzen, grünen Hemden, den wechselnden Seidentüchern um den Hals umherlief und damit einen unübersehbaren Farbpunkt in unsere bescheiden und korrekt gekleidete Männerwelt setzte.
Den ersten Schlagabtausch führte ich mit Just noch in den letzten Ferientagen. Ich war verantwortlich für die Anleitung der Klassenleiter und für deren Einsatz und hatte Just mitzuteilen, dass er eine achte Klasse übernehmen werde. Die bisherige Klassenleiterin sei schwanger und falle bald aus, so sei es günstig, wenn er gleich zu Beginn des Schuljahres dort einsteige. Was er davon halte, fragte ich.
„Bisschen düster, nicht wahr“, sagte er.
„Was meinen Sie damit?“, fragte ich verblüfft, bezog seine Äußerung zunächst auf meine Frage.
„Das Zimmer hier“, sagte er.
Das Direktorzimmer lag an der Nordseite. Ein schmaler Raum, einfach möbliert, zweckmäßig der Schreibtisch, dahinter Aktenschränke. So war Strebelows Einstellung zu seiner Funktion, nüchtern, bescheiden.
„Ich könnte hier nicht arbeiten“, fügte Just hinzu.
„Das sollen Sie ja auch nicht“, sagte ich.
„Hier rein muss ich aber. Das wirkt auf meine Stimmung. Und die Schüler, die zum Direktor kommen müssen, werden ähnlich empfinden.“
„Das ist kein Klubraum, Kollege Just.“
Just schüttelte den Kopf, sah mich offen an. Er hat blaue Augen, dachte ich, tatsächlich solche, wie man sie sich vorstellt, wenn von blauen Augen die Rede ist. Völlig ungezwungen sitzt er auf dem Stuhl, hat schon sein Urteil über den Arbeitsraum des Direktors abgegeben, mehr noch, er hat seine Kritik geäußert. Wird ja heiter werden mit dem Herrn, dachte ich, betrachtete sein seidenes Halstuch und konnte nicht umhin festzustellen, dass der Mann gut aussah.
Ach, zum Teufel, hier wird nicht über die Direktorklause geredet, es geht um die Übernahme einer Klasse durch einen Lehrer. Die Zeit ist knapp, ganz besonders kurz vor Beginn eines neuen Schuljahres. Das sollte der Kollege Oberlehrer auch wissen.
Doch der ließ nicht locker.
„Sie werden aber zugeben, Kollege Kähne, dass ein Raum erzieht.“
„Selbstverständlich“, sagte ich nicht gerade freundlich, „der hier, in dem wir beide so angeregt plaudern, erzieht zur Bescheidenheit und nüchternen Arbeit.“
Aufmerksam sah er mich an. In den Augen begann das Lächeln, verbreitete sich über das ganze Gesicht. Ein strahlendes, entwaffnendes Lächeln, mit dem wir es noch oft zu tun haben sollten.
„Auf diese Weise parieren Sie? Na gut, ich habe das gern. Aber geschlagen gebe ich mich nicht. In dieser Richtung werden Sie noch manches von mir zu hören bekommen.“
„Ich möchte zur Klassenübernahme etwas von Ihnen hören, Kollege Just“, sagte ich bewusst trocken.
Sein Lächeln verschwand, er war wieder ganz Aufmerksamkeit.
„Eine achte Klasse. Ich habe bisher nur ab neunte unterrichtet.“
„Ich weiß. Nur, dann hätten Sie bleiben sollen, von wo Sie gekommen sind.“
„Sie haben mich doch nach meiner Ansicht gefragt“, sagte er kühl.
„Ich nahm an, Sie würden sich nach der Klasse erkundigen, die Sie übernehmen sollen“, sagte ich und hob das Klassenbuch an, das ich schon zurechtgelegt hatte.
„Darf ich mal reinschauen?“, fragte er.
„Das sollen Sie sogar.“
Er schlug das Buch auf. In Ruhe konnte ich sein Gesicht betrachten. Ein ausdrucksstarkes Gesicht, leichte Fältchen um die Augen und den Mund. Nur vom Lachen? Ich bereute schon, dass ich so schroff gewesen war, das war sonst nicht meine Art.
Beim Lesen kniff Just die Augen leicht zusammen.
Lass dir eine Brille verschreiben, Junge, dachte ich, sei nicht eitel. Du siehst dann bestimmt auch sehr gut aus.
Ich lächelte wohl bei diesen Überlegungen, und meine Stimmung pendelte sich wieder ein.
Da hob Just den Blick vom Buch und sagte: „Ziemlich hoher Durchschnitt. Liegt der nicht ein bisschen zu hoch für eine Achte?“
Mein Stimmungspendel schlug heftig aus.
„Wie wollen Sie das beurteilen, ohne die Klasse zu kennen?“
„Meine Erfahrungen. Ich habe zu oft erlebt, dass Schüler mit einer guten und auch sehr guten Durchschnittsnote zu uns kamen und dann den Anforderungen einer neunten Klasse an unserer EOS nicht entsprachen.“
„Wir haben unsere Erfahrungen“, sagte ich ziemlich heftig, „und Sie sind ja nun bei uns und nicht mehr dort.“
Er sah ins Buch.
„Na schön. Lars, Birgit, Ramona, und wie euch eure Eltern noch benannt haben, wir werden uns ja bald kennenlernen. Dann werden wir ja sehen, wie es so mit euch steht.“
Er legte das Buch behutsam auf den Tisch zurück.
Der war nicht zu fassen, der zahlte auf seine Art heim, der schlug eine geschickte Klinge.
Später einmal kamen wir auf diese erste Begegnung zu sprechen, und Just sagte: „Du hast auf dem Strebelow-Sessel wie Mars persönlich gehockt. Mein Gott, hast du ein angestrengt finsteres Gesicht gemacht. So was reizt mich, entschuldige bitte, immer zum Lachen. War auch unsere Rettung, Alter, sonst hätten wir uns vielleicht noch geprügelt in Strebelows Allerheiligstem.“
Hatten wir also nicht, waren in ein betont sachliches Gespräch gekommen, dem anzumerken war, dass jeder nach einem für ihn einigermaßen akzeptablen Abgang suchte. Dass Just dabei innerlich über mich lachte, das hatte ich nicht gemerkt. Vielleicht verhielt es sich auch nicht ganz so, wie er das später auslegte. Just war ein Mann, der Fantasie besaß, die manchem von uns, aber auch ihm selbst oft arg zu schaffen machte.
Merkwürdigerweise berichtete ich Karl Strebelow nichts von dem Gerangel, ich teilte nur mit, dass Just einverstanden sei, die Achte zu übernehmen, und sich nun, soweit es ginge, über die Situation dort informiere.
„Du bleibst dann dran an ihm, ja?“, sagte Karl Strebelow.
„Dir liegt er wohl nicht?“, fragte ich.
Das gab Karl nicht zu. Ich hätte mir das auch verkneifen können, wusste ich doch von dem Gespräch der beiden, in dem eine Frage Karls unbeantwortet geblieben war.
Damit Karl seine Ruhe wiederfand, sagte ich: „Wird schon in Ordnung gehen, klar.“
So blieb logischerweise der nächste Schlagabtausch zwischen Just und mir nicht aus.
Es geschah am ersten Tag im neuen Schuljahr.
Das Wetter war plötzlich umgeschlagen. Der Herbst kündigte sich früh an, als sollte dadurch uns und den Schülern der Abschied vom heißen Feriensommer leicht gemacht werden.
Karl Strebelow redete auf dem Appellplatz gegen den böigen Wind an, kürzte aber keineswegs seine Ansprache ab; nein, das wäre gegen seine Prinzipien gewesen. Was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Das bisschen Wind, der leichte Regen. Was denn? Da waren wir ganz andere Sachen gewöhnt.
Er stellte auch den neuen Lehrer, den Herrn und Kollegen Just, vor.
Das muss man sich vor Augen führen, der weite Schulhof, im Viereck die Klassen angetreten, ein paar Schritt vor der Fahnenstange der Direktor. Zwar ein gewohntes Bild, aber der Regen, die treibenden Wolken aus Nordwest. Unsere Schule liegt gleich hinter der Autobahn, für die hier ein Damm aufgeschüttet ist. Die Regenwolken sprangen geradezu in ununterbrochener Folge über den Autobahndamm hinweg.
Neben Strebelow, der einen wetterfesten Anorak trug, stand Just in einer braunen Wildlederjacke. Im Kragenausschnitt leuchtete das zitronengelbe Hemd, an seinem Hals wehte ein Seidentüchlein. Er versuchte immer wieder das Tuch zu bändigen, was ihm aber nicht so recht gelingen wollte.
Vor dem düsteren Hintergrund wirkte Just wie ein verlorengegangener bunter Vogel, der sich aus einer fernen, warmen Gegend in kalte Breiten verirrt hat.
Strebelow hielt unbeirrt seine Rede. Just war schutzlos dem Wind ausgesetzt, und ich wunderte mich, dass er nicht den Rücken krümmte oder die Hände in die Taschen schob. Mit seinen etwas zu langen Haaren hatte er auch beträchtliche Schwierigkeiten, der Wind trieb sie ihm immer wieder ins Gesicht.
Ich empfand keine Schadenfreude. Im Gegenteil, der Just tat mir leid. So was wünscht man ja nicht seinem ärgsten Feind, geschweige einem wenn auch etwas eigenwilligen Kollegen, den man gewillt war zur Bescheidenheit und Zurückhaltung zu erziehen.
Eine geschlagene halbe Stunde stand Just neben Strebelow. Nach zwei Sätzen, die seiner Vorstellung dienten, trat er einen Schritt vor, stand ein paar Sekunden so und trat dann wieder neben den Direktor.
Es war zu sehen, dass Just mit dem Manöver nicht so recht zurande kam, anscheinend hatte er derartiges noch nie mitgemacht. Oder er war im kalten Regenwind erstarrt, so hölzern und staksig wirkten Gang und Haltung.
Nach Schluss des Appells wartete ich auf ihn, ich sollte ihn in seiner neuen Klasse einführen.
„Sie hätten sich ein bisschen wärmer anziehen sollen“, tadelte ich.
„Wer hat das ahnen können. Gestern noch habe ich auf einer Waldwiese gelegen und in den blauen Himmel geträumt. Heute Polarluft.“ Er zog die Wildlederjacke aus und schlug die Regennässe ab, knüpfte das Seidentuch neu, es lag wieder schwungvoll um den Hals.
Im Schulgebäude herrschte der normale, nicht vermeidbare Lärm, den ein paar hundert Kinder und junge Leute verursachen, die sich nach den Ferien ungeheuer viel mitzuteilen haben. Man soll den überhaupt nicht unterdrücken, es sei denn, man hält so eine Art Krankenhausstille für den idealen Zustand an einer Schule.
Ich muss noch Justs Tasche erwähnen. Sie war aus robustem Leinenstoff und stammte aus Polen. Sie wirkte nicht sehr groß, konnte aber unwahrscheinlich viel aufnehmen und war bequem an einem Riemen über der Schulter zu tragen. Ein Lehrer mit so einer Campingtasche in der Schule? Ungewöhnlich. Jedenfalls bei uns ungewöhnlich. Seriöse Aktentasche war die stillschweigend vereinbarte Ausrüstung, daran hielten sich auch die Frauen, die sowieso bei uns in der Mehrheit sind.
So passierte es auch am letzten Konferenztag vor Schulbeginn, dass Karl Strebelow mit ausgestrecktem Arm auf diese blaue Leinentasche wies, die an einem Haken hing, und unüberhörbar missbilligend fragte: „Wem gehört dieser Beutel da?“
„Die Tasche gehört mir“, hatte Just gleichmütig geantwortet. Und weiter geschah nichts. Der Beutel oder die Tasche hing bis zum Schluss der Arbeitsberatung am Kleiderhaken, zog aber immer wieder die Blicke auf sich.
Die umstrittene Tasche hatte Just umhängen, als er vor mir die Treppe hochstieg, leichtfüßig und mehrere Stufen auf einmal nehmend, so dass ich Mühe hatte, ihm zu folgen. Wenn man auf die Fünfzig zugeht, kann man nicht mehr ganz so schnell, das ist nun mal so.
Oben wartete Just auf mich.
„Pardon“, sagte er, „Sie sehen, ich bin ungeduldig. ,Ran an die Arbeit!‘ ist die Losung.“
War das Ironie? Es war keine, seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen. Doch bei diesem Mann war ich mir nicht sicher.
„Und wie wollen wir jetzt verfahren?“, fragte er.
„Ich stelle Sie vor.“
„Machen Sie’s bloß nicht so feierlich.“
„Ich sehe gar keinen Anlass.“
„Was wollen Sie denn sagen?“