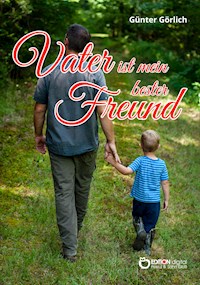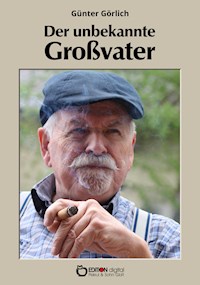7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das erste Mal begegnen sich Robert und Anke an einem heißen Sommertag auf einer berühmten Berliner Baustelle in der Nähe der Kommode, der früheren Königlichen Bibliothek – also von einer Begegnung kann eigentlich noch keine Rede sein: das Mädchen hatte eine Lücke im Bauzaun entdeckt und fotografierte die Fassade des damals noch kriegszerstörten Gebäudes in der Straße Unter den Linden. Dann begab sie sich wieder außerhalb des für Fremde verbotenen Bereichs: In diesem Moment war Robert angekommen. Er sprang durch die Zaunlücke und blickte dem Mädchen nach. Er sah vom schwachen Luftzug leicht bewegtes blondes Haar, eine schlanke Figur, schlenkernde Arme. Zeit hat sie, das Bauwerk hat sie fotografiert, und nun läuft sie weiter, anderen Sehenswürdigkeiten, anderen Erlebnissen auf der Spur. Die Männer, die sie auf der Baustelle für einen Augenblick gesehen hat, wird sie bald oder schon jetzt vergessen haben: den Langen, der so komisch seinen zerkratzten Schutzhelm vor ihr schwenkte, den Untersetzten, der die Brechstange wie ein Spielzeug in der Hand hielt, und auch den Älteren, der eine schwarze Weste trug an diesem heißen Julitag. Nicht gesehen hatte sie dagegen Robert, der ihr durch die Zaunlücke nachschaute und wie manchmal dachte, etwas versäumt zu haben. Aber dann entschloss er sich doch, auf die andere Straßenseite zu den beiden Humboldts vor der Universität zu wechseln und sich neben das verwunderte Mädchen auf den Sockel von Alexander zu setzen. Ihren Namen kannte er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Er weiß nur, dass sie vielleicht das schönste Mädchen ist, das ihm je begegnet ist. Sie verabreden sich für einen Besuch im Café mit den bunten Sonnenschirmen, und Robert, der bisher außer mit Monika wenig Erfahrungen mit Mädchen hat, fühlt sich jetzt in einer verwandelten Welt. Alles scheint sich so zu entwickeln, wie sich das ein junger Mann vorstellt, der das wahrscheinlich schönste Mädchen kennengelernt hat, das ihm je begegnet ist – von dem er kaum etwas weiß und zugleich schon so viel. Manches aber weiß er eben nicht von Anke, und deshalb passiert noch manches Überraschende, er bekommt zwei Briefe und braucht den Anstoß eines Kollegen und dessen Motorrad als Leihgabe, um zunächst eine große Entfernung zwischen den beiden jungen Leuten zu überwinden. Und es gibt noch eine andere große Entfernung zwischen Robert und Anke und trotzdem auch eine Fortsetzung dieser hübschen, mit lockerer Hand geschrieben Sommergeschichte – eine Jugendliebe zu DDR-Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Günter Görlich
Eine Sommergeschichte
ISBN 978-3-96521-723-2 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1969 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1
Das dritte Mal ging Robert zum Hydranten und schüttete sich einen Eimer Wasser über den Kopf. Er beneidete Marschke, der bei fünfundzwanzig Grad im Schatten nicht einmal die schwarze Zimmermannsweste auszog, die streifte er höchstens ab, wenn die Perlmuttknöpfe oder die silberne Uhrkette in Gefahr gerieten. Die Kette und die Uhr daran waren berühmt. Die Kette sollte hundert Jahre alt sein; Marschkes Großvater, der auch Zimmermann gewesen war, hatte sie auf seiner Wanderschaft in Dänemark von einem Trödler erworben, und der wieder hatte sie von einem Mann gekauft, dessen Vorfahren Seeräuber waren. So jedenfalls erzählte Hermann Marschke. Weniger weit zurück reichte die Geschichte der Uhr. Die hatte den Soldaten Marschke vor dem Tode bewahrt, an ihrem Nickelgehäuse war im letzten Krieg eine Kugel abgeprallt und in den Unterarm gedrungen statt in den Bauch, die Uhr aber war nicht einmal stehengeblieben …
Unter dem kalten Wasserguss ging Robert ein Lied durch den Kopf: Ohne Wasser, merkt euch das, wär’ unsre Welt ein leeres Fass. Er füllte noch einen Eimer.
Als er sich tropfend und prustend aufrichtete, sah er an der Lücke im Bauzaun das Mädchen. Der Fotoapparat an ihrem Hals deutete darauf hin, dass sie in dieser Stadt nicht zu Hause war. Sie hatte genau genommen schon die Baustelle betreten, obwohl doch Marschke das Schild „Betreten verboten“ an den Zaun genagelt hatte und er, Robert, es mit frischer Farbe hatte nachmalen müssen, damit es von keinem übersehen werde. „Mach das bloß anständig“, hatte Marschke gesagt, „kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sich hier so ein neugieriger Gentleman das Bein bricht oder sonstige Gräten?“
Das Mädchen aber hatte das Schild nicht beachtet.
Anscheinend war sie vom Anblick der Kommode gefesselt. Kommode, das war früher die Königliche Bibliothek, seit über zwanzig Jahren eine ausgebrannte Ruine und im Augenblick eine Baustelle. Eigentlich existierte von dem Gebäude nur noch die rußgeschwärzte Fassade. Die Sandsteinfiguren oben auf dem Sims sahen aus, als wollten sie jeden Augenblick in die Tiefe springen. Hin und wieder polterte ein Stück Putz oder ein Ziegelbrocken herab. Brüchig, brüchig, die ganze Sache. Aber die Kommode hatte eine Geschichte, wusste Robert, eine recht bewegte Geschichte. Besonders überrascht hatte ihn, als er in der Schule erfuhr, dass hier Lenin die Werke von Marx in der Originalsprache studiert hatte, unter den Augen der preußischen Beamten sozusagen. Hinzu kam, dass es das letzte Gebäude Unter den Linden war, das noch an den Krieg erinnerte. Ohne Zweifel auch ein Grund für Touristen, die Baustelle zu betrachten.
Das Mädchen trat noch ein paar Schritte vor, kletterte auf einen Stapel schwerer Betonteile und schaute sich von dieser Höhe aus um. Dann fotografierte sie die Fassade.
Robert bemerkte, dass das Geräusch der Motorwinde verstummt war, am Bohrbock wurde nicht mehr gearbeitet. Peter Glomm schwenkte seinen Schutzhelm mit komischen Bewegungen, als wollte er die Fremde auf dem Betonstapel grüßen. Robert hörte Gelächter und konnte sich gut vorstellen, was der lange Glomm jetzt rief. Hallo, Kleine! vielleicht, oder hallo, Süße! In dieser Hinsicht war sein Wortschatz etwas dürftig, doch ihm machte es Spaß, wenn darüber gelacht wurde. Triumphierend schaute er dann in die Runde, als wollte er sagen: Na, wie bin ich? Der große Don Juan Peter Glomm hatte zu Hause eine Frau und vier Kinder.
Dieter Schmidt dagegen, zwei Kopf kleiner als Glomm, hatte sich den Schutzhelm auf die Nase geschoben und stützte sich auf eine Brechstange. Seine Bemerkungen in solchen Situationen waren anderer Art. Über die lachte man eine Weile später, weil einem erst dann ihre hintergründige Frechheit aufging. Robert bedauerte sehr, dass er im Augenblick zu weit entfernt war und Schmidts Lästerreden nicht verstehen konnte. Er hätte auch gern selbst etwas zur allgemeinen Belustigung beigesteuert. Es war sozusagen ungeschriebenes Recht der Leute auf den Baustellen, sich auf diese Weise von Zeit zu Zeit eine kleine Unterhaltung zu verschaffen.
Hermann Marschke allerdings teilte diese Ansicht nicht. Er hatte einmal gesagt: „Ich möchte auch nicht angepflaumt werden, wenn ich irgendwo vorbeikomme. Und wenn ich an eure Frauen denke und an meine Tochter? Na, Leute. Man macht sich ja ein Bild von uns.“
Marschkes Haltung beeinträchtigte das Vergnügen, zumal man zugeben musste, dass er Recht hatte, und da er außerdem der Brigadier war, versuchte man sich zu zügeln. Heute aber war es zu heiß, heute kochte das Blut, heute brauchte man ein Ventil. Und das Mädchen auf dem Stapel war was Besonderes. Auch Marschke konnte sie nicht übersehen, schließlich stand sie mit ihren schönen Beinen auf recht gefährlichem Terrain, hatte das frischgemalte Verbotsschild einfach nicht zur Kenntnis genommen, und Arbeitsschutz war schon immer Marschkes Steckenpferd.
Robert sah, wie sich Marschke dem Stapel näherte, die Daumen in die Weste eingehakt, was immer ein Zeichen dafür war, dass er Kritik anbringen wollte. Glomm und Schmidt begleiteten ihn, offensichtlich erwarteten sie nun doppeltes Vergnügen. Außerdem konnten sie den hübschen Eindringling aus der Nähe betrachten. Nur Norbert Bogner blieb auf dem ausrangierten Wohnzimmerstuhl neben der Bohrwinde sitzen und lächelte. Was die unternahmen, war ihm alles zu anstrengend. In dieser Hitze! Lächeln genügte.
Robert streifte sich das Wasser vom Körper und aus dem Haar und rannte zur Bauzaunlücke. Er hörte, dass Marschke der Fremden etwas zurief. Die blickte von ihrem Stapel auf die Männer hinab, drehte sich dann um und sprang ganz leicht auf der anderen Seite herunter. Die drei starrten auf den leeren Stapel, Glomm kletterte sogar hinauf, dabei hätte er nur einen Schritt zur Seite zu treten brauchen, um das Mädchen am Bauzaun zu entdecken, schon außerhalb der Baustelle. Nun verletzte sie keine Sicherheitsbestimmungen mehr, und für Hermann Marschke war der Fall erledigt. Er sagte zu Glomm, der noch immer auf dem Plattenstapel stand: „Brich dir bloß nicht das Genick. Denk an deine Kinder.“
Schmidt schulterte die Brechstange und bemerkte: „Den erwischt’s doch immer gleich so stark. Dem fallen bald die Augen aus, als hätte der arme Hund noch nie ’ne Frau gesehen.“
„Na hör mal“, sagte Glomm.
Das Mädchen musterte die Männer noch einmal und entfernte sich dann zur Straße.
In diesem Moment war Robert angekommen. Er sprang durch die Zaunlücke und blickte dem Mädchen nach. Er sah vom schwachen Luftzug leicht bewegtes blondes Haar, eine schlanke Figur, schlenkernde Arme. Zeit hat sie, das Bauwerk hat sie fotografiert, und nun läuft sie weiter, anderen Sehenswürdigkeiten, anderen Erlebnissen auf der Spur. Die Männer, die sie auf der Baustelle für einen Augenblick gesehen hat, wird sie bald oder schon jetzt vergessen haben: den Langen, der so komisch seinen zerkratzten Schutzhelm vor ihr schwenkte, den Untersetzten, der die Brechstange wie ein Spielzeug in der Hand hielt, und auch den Älteren, der eine schwarze Weste trug an diesem heißen Julitag. Vielleicht hat ihr Blick auch noch den Bohrbock gestreift, das herumliegende Arbeitsgerät, die Winden, den Betonmischer, vielleicht hat sie das alles in Zusammenhang gebracht mit der eingehend betrachteten Ruine und hat gedacht: Man baut auf. Vielleicht ist ihr Blick eine Weile sogar an Norbert Bogner hängengeblieben, weil er auf dem ausrangierten Wohnzimmerstuhl saß und lächelte.
Nur ihn, Robert, der vom Hydranten herbeigestürzt kam, hat sie nicht gesehen. Er blickte ihr nach und hatte wie schon manchmal das Gefühl, etwas versäumt zu haben. So viele Menschen gingen täglich an ihm vorüber, die er nur flüchtig sah, die aber vielleicht für ihn etwas bedeuten könnten. Er lehnte am Bauzaun, an dem Plakat, das für die Zentrum-Warenhäuser warb, und dachte: Bald ist sie im Gewühl der Straße verschwunden. Und ich weiß nicht, wer sie ist. Ich weiß nur, dass sie jung ist, blondes Haar hat, wie eine Katze klettert, die Männer aufmerksam ansieht, wenn die auch nicht sehr höflich sind.
Das Mädchen überquerte die Fahrbahn, verweilte einen Augenblick auf dem Mittelstreifen und ging dann hinüber zur Universität. Hinter Robert begann die Winde zu kreischen, der Bohrmeißel knirschte im Rohr; die Bohrung war schon tief im Erdboden.
Robert zog sein Hemd über den nassen Körper und lief an die Straße. Er sah das Mädchen vor dem Universitätsportal stehen und unschlüssig von einem Humboldt zum anderen schauen, bis es sich für den Alexander entschied und sich auf dem Sockel niederließ. Ein Doppelstockbus hielt und nahm Robert die Sicht. Er rannte hinüber, er befürchtete, das Mädchen würde in den Bus steigen und davonfahren, aber es saß noch unter der Marmorfigur. Robert setzte sich auch auf den Sockel, es war genug Platz.
Verwundert blickte ihn das Mädchen an. Sein Aussehen war ja auch seltsam hier auf der von vielen Touristen belebten Straße. Die betonbespritzte Arbeitshose, das nasse Hemd, seine wirren Haare. Robert verlor unter dem prüfenden Blick allen Mut. Doch er schwor sich, nun gerade aufs Ganze zu gehen. Zudem sah er, dass seine Nachbarin sehr jung und sehr hübsch war. Hübsch war vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Was ihn überraschte, waren ihre dunklen Augen. Eigentlich passten zu solch blondem Haar nur blaue Augen. Das Gesicht war kühl und hell, aber die dunklen Augen belebten es mit einem ungewöhnlichen Feuer.
„Haben wir Sie sehr geärgert?“, fragte Robert.
„Geärgert? Sie? Wie kommen Sie darauf?“
„Ich gehöre zu denen da drüben“, sagte er und wies zur Baustelle hinüber, dort schwenkte gerade der Stauchbohrer, glänzte feucht in der Sonne. Seine Leute waren vom Bauzaun verdeckt, nur die Brechstange schwang durch die Luft. Da war Schmidt am Werk.
„Ach so, Sie gehören zu denen. Ich hab Sie aber nicht gesehen.“
Er hatte also recht gehabt, sie hatte ihn nicht gesehen.
Sie betrachtete ihn jetzt genauer. Wieder dieser prüfende Blick, der ihn verlegen werden ließ. Es kostete ihn Mühe, seine Befangenheit abzuschütteln.
„Sie müssen es uns nicht übelnehmen, wenn wir flachsen. Das ist so üblich, wenn’s auch nicht schön ist. Aber stellen Sie sich mal vor, bei der Hitze! Und Faulschlamm holen wir raus. Eine Brühe! Man wundert sich, auf was für einem Zeug diese Stadt steht. Na, und dann kommen Sie und klettern auf die Betonteile. Das schmeißt einen ja um. Da muss was gesagt werden.“
Sie lachte. „Wer sagt Ihnen denn, dass ich was übelnehme?“
„Na, ich weiß nicht“, sagte Robert, „Sie haben so einen Blick.“
„Ich hab so einen Blick? Aber ich muss mir doch die Leute ansehen, mit denen ich es zu tun habe.“
„Klar. Das müssen Sie. Wär ja auch schade, wenn Sie das nicht täten.“
Das Mädchen schaute ihn nachdenklich an. Robert kratzte einen Betonfleck von der Hose, obwohl das natürlich unsinnig war, denn wollte er alle Flecke beseitigen, hätte er zwei Tage damit zu tun gehabt.
„Und Sie sind mir nachgelaufen, um mir das zu sagen?“
„Was ich sagen wollte, wusste ich nicht, aber ich wollte Sie sehen. Ich war nämlich gerade ein Stück abseits, als Sie auf den Betonteilen herumturnten. Ich bin zu spät gekommen. Sie sprangen so schnell runter. Wissen Sie, ich hätt’s nicht ertragen, Sie nur von Weitem zu sehen. Eine schlimme Sache, diese Neugier.“
Nach einer Weile sagte das Mädchen: „Nun haben Sie mich ja aus der Nähe gesehen.“
„Ja“, sagte Robert.
„Und jetzt müssen Sie wieder an die Arbeit gehen.“
„Ja, das muss ich. Marschke, unser Brigadier, wird schon warten. Der ist genau. Aber ich erzähl ihm von Ihnen, dann verzeiht er mir. Und dann hau ich ran und hol alles auf.“ Er schlug sich auf die Schenkel, als wollte er das Gesagte bekräftigen. Eine Zementstaubwolke stieg auf. Das Mädchen verzog keine Miene.
„Entschuldigung“, sagte Robert, „ich bin ein Hammel. Müssen Sie nicht niesen?“
„Sie sehen, ich muss nicht.“
Ein Bus stoppte an der Haltestelle, er neigte sich ein wenig zur Seite.
„Das sieht ja gefährlich aus“, meinte das Mädchen.
„Ist aber nicht. Sind Sie schon mal oben gefahren?“
„Nein.“
„Das müssen Sie unbedingt. Als Kind war’s eins meiner schönsten Erlebnisse. Hätt ich Zeit, würde ich Sie einladen zu einer Rundfahrt. Sind sie zum ersten Mal hier?“
„Ja, zum ersten Mal. Ein paarmal durchgefahren bin ich zwar schon. Dabei lernt man aber keine Stadt kennen. Das zählt ja nicht.“
„Und? Wie gefällt Ihnen Berlin?“
„Ich bin den ersten Tag hier“, sagte das Mädchen. „Unter den Linden wollte ich mit meiner Exkursion beginnen. Nun bin ich eine Stunde unterwegs und schon müde.“
„Sie müssen sich in den Schatten setzen“, meinte Robert, „im Universitätshof stehen Bäume.“
Drüben über dem Bauzaun tauchte am Bohrbock erneut der Stauchbohrer auf, auch die Brechstange blitzte, und Robert meinte den hellen Klang zu hören, der erzeugt wird, wenn Metall auf Metall schlägt, obgleich das doch völlig unmöglich war bei dem Verkehr und dem Lärm auf der Straße. Marschke würde schon unruhig sein. Und er saß hier auf dem Sockel und tat, als hätte er Urlaub. Da sah er einen Eisverkäufer und sprang auf.
„Warten Sie einen Augenblick. Ich bin gleich wieder hier. Halten Sie den Platz frei. Wenn es einer wagen sollte, sich an Ihre Seite zu setzen, warnen Sie ihn. Ich setze ihn dem Humboldt auf den Schoß.“
Robert fand in seiner Tasche ein Markstück und kaufte für das Mädchen eine Waffel zu sechzig und für sich eine zu vierzig. Der Platz auf dem Sockel war noch frei.
„Bitte“, sagte Robert und verbeugte sich, „von einem Berliner Bauarbeiter. Ist das nichts?“
„Das ist viel“, sagte das Mädchen, „schönen Dank auch.“
Das Eis schmolz schnell. Roberts Nachbarin hatte vollauf damit zu tun. Er betrachtete sie verstohlen, und er hätte jetzt schwören können, sie sei das schönste Mädchen, das ihm jemals begegnet war.
Ein Schatten störte ihn, und er blickte unwillig auf. Ein Mann, behängt mit zwei Kameras, beugte sich herab und sagte: „Tun Sie mir den Gefallen, rücken Sie etwas zusammen. Ein entzückendes Motiv. Reuter ist mein Name, Bildreporter. Also bitte, eine Kleinigkeit nur.“
Robert rückte näher an das Mädchen heran. Der Fotograf kniete zehn Schritt entfernt auf den Steinen, mit dem freien Arm Passanten verscheuchend, die in sein Schussfeld hineinlaufen wollten. Er knipste, drehte und knipste, und die beiden saßen da, die Eiswaffeln in der Hand, und blinzelten in die Sonne. Der Bildreporter Reuter sagte im Ton tiefer Befriedigung: „Das wär mal wieder gelaufen. Prächtig, prächtig. Die Kontraste, das Motiv. Unter dem ehrwürdigen Alexander von Humboldt zwei junge Menschen. Sie blond, er dunkel. Also, schönen Dank.“
Die beiden Fotomodelle sahen sich an und lachten. „Und Sie glauben, das ist was geworden?“, fragte Robert.
Reuter hantierte an seiner Kamera, holte ein fertiges Bild heraus und gab es Robert.
„Überzeugen Sie sich. Ich schenk’s Ihnen. Ich bin sicher, das zweite ist genauso geworden, wenn nicht besser. Adieu!“
Und Bildreporter Reuter entfernte sich eilig.
Robert hielt das Foto in der Hand. Das Mädchen neigte sich herüber. Tatsächlich, das Bild war gelungen. So eng hatten sie vor wenigen Minuten nebeneinandergesessen.
„Es sieht so aus, als gehörten wir zusammen“, sagte Robert.
„Ich finde aber, es sieht so aus, als gehörten wir nicht zusammen. Da ruhen sich zwei Leute aus und schlecken Eis, und jeder denkt an irgendwas, das nur ihn allein angeht.“
„Wieso“, protestierte Robert, „es können zwei zusammengehören und an was Verschiedenes denken. Kommt alles vor.“
„Aber wir wissen, wie es in Wirklichkeit ist.“
Er schwieg eine Weile.
„Wer darf’s nun behalten?“, fragte er.
Das Mädchen nahm es ihm aus der Hand.
„Ganz nett, wäre ein schönes Andenken.“
„Ich schenk’s Ihnen“, sagte er.
Jetzt lachte sie laut. „Sie sind unheimlich großzügig. Wir können ja das Los entscheiden lassen.“
„Ich verzichte“, sagte er, „Sie haben dann wenigstens eine Erinnerung an den komischen Kerl, der Ihnen hier eine Weile auf den Wecker gefallen ist.“
„Komisch sind Sie nicht, eher lustig.“
„Freut mich, Tatsache, freut mich“, sagte er, „Sie behalten also unser Foto? Wie heißen Sie denn?“
„Anke.“
Er sah sie an. „Der Name passt zu Ihnen.“
„Meinen Sie?“
„Natürlich passt er zu Ihnen.“
„Und wie heißen Sie?“
„Mein werter Name ist Robert.“
„Sie haben aber auch einen passenden Namen.“
Robert lächelte. „Das sagt meine liebe Mama ebenfalls. Und ich glaub’s natürlich auch. Ist es nicht schön, wie übereinstimmend unsere Gedanken sind?“
„Das ist’s. Aber Sie denken jetzt sicher wie ich, dass Sie rüber müssen zu Ihren Leuten.“
„Wollen Sie mich loswerden?“
„Ich nehme an, dass Sie ein pflichtbewusster Mensch sind.“
„Das stimmt auffallend. Und doch ist es schade, dass ich jetzt rüber muss. Sehr schade.“
Robert rieb wieder mechanisch an den Flecken seiner Arbeitshose. „Warum sind Sie vorhin auf den Betonstapel geklettert? Interessiert Sie das alte Bauwerk wirklich so sehr?“
„Natürlich. Aussicht, dass mir jemand eine Portion Eis spendiert, hatte ich noch nicht.“
Robert sagte: „Ich mach Ihnen einen Vorschlag. Ich zeig Ihnen nach Feierabend die Kommode. Sie sollen sie aus nächster Nähe sehen.“
„Das wollen Sie machen?“
„Selbstverständlich. Für liebe Gäste unserer Stadt ist mir nichts zu viel. Aber einen Helm brauchen wir für Sie. Welche Kopfgröße?“
„Kopfgröße? Dreiundfünfzig, glaub ich.“
„Dreiundfünfzig“, wiederholte Robert und überlegte: „Wir haben größere Schädel. Na, wir werden die Sache schon schaukeln. Ich verpasse Ihnen einen schönen Helm.“
„Wann ist denn Feierabend?“
Robert schlug vor: „Um drei treffen wir uns hier am Onkel Humboldt.“
„Und zeigen Sie mir alles dort drüben?“
„Ich verspreche es hoch und heilig.“ Er sprang auf und legte die Hand aufs Herz. Dann rief er: „Tschüs. Bis dann!“
Er lief über die Straße, sah erneut die Brechstange über dem Bauzaun aufblitzen. Das mahnte ihn zur Eile. Am Zaun aber drehte er sich noch einmal um. Der Sockel war leer.
Als er die Baustelle betrat, nahm keiner von ihm Notiz, der Stauchbohrer hatte sich verklemmt, und die Winde war blockiert. Robert packte mit zu. Es war eine Schinderei, und sie fluchten schrecklich.
„Der krumme Hund kommt auf den Schrott“, sagte Schmidt. Das half, die gemeinsame Anstrengung und das Fluchen.
Marschke zündete sich eine Zigarette an und sagte: „Besser aufpassen, dann passiert so was nicht.“
Dagegen war nichts einzuwenden, und so erwiderte auch keiner etwas auf diese Bemerkung. Robert ließ seine Zigarettenschachtel reihum gehen. Marschke betrachtete ihn nachdenklich, es sah aus, als wollte er etwas sagen, doch dann ging er beiseite und prüfte eingehend die Bohrwinde. Schmidt aber blinzelte zu Robert hoch und sagte: „Willst du sie heiraten, die Hübsche?“
„Du bringst mich auf einen Gedanken“, meinte Robert, „so was hab ich noch gar nicht ausprobiert.“
Er stieß Glomm an. „Wie ist denn das, du hast doch Erfahrungen, wird man ein besserer Mensch, wenn man verheiratet ist?“
Glomm döste in der Hitze, hatte entweder die Frage nicht verstanden oder dachte über sie nach, denn sie berührte ein Grundproblem seines Daseins.
Schmidt half ihm auf seine Art. „Was fragst du denn? Jeder sieht doch, was für ein guter Mensch er ist. Er teilt die Mark selbstlos durch sechs. Und du? Du bist ein miserabler Egoist.“
„Da habt ihr’s ganz genau“, sagte Glomm.
Marschke war wieder herangekommen und sagte: „Heute haben wir Montag. Am Freitag bauen wir hier ab. Wir fangen am Alex an. Es ist nun so weit.“
„Und hier?“, fragte Bogner, „wer macht das hier zu Ende?“
Marschke sah Bogner an und sagte: „Wir. Bis Freitag.“
„Ist das zu schaffen?“
„Das müssen wir schaffen, wird aber nicht leicht sein.“
„Schicken wir ein Telegramm an den Wetterboss“, schlug Schmidt vor. „Soll seinen Brutofen abschalten.“
Robert dachte an Anke. Wie groß ist sie eigentlich? Ist sie größer als ich? „Na, dann mal ran“, hörte er Glomm sagen.
Wie viele Bohrpfähle hatten sie hier noch in den Erdboden zu treiben? Marschke sagte: „Träum nicht, Robert.“
Gegen Mittag sprang das Seil oben am Bohrbock aus der Rolle, und Robert kletterte hinauf, um den Schaden zu beheben. Als er die Arbeit beendet hatte, blickte er zur Universität hinüber, zum Denkmal Alexander von Humboldts. Der Sockel besaß anscheinend starke Anziehungskraft, er war wieder besetzt. Was hatten die Leute dort zu suchen? Er würde ein Schild anfertigen: Reserviert.
Und wenn sie nicht käme?
Von unten pfiff es gellend. So konnte nur Schmidt pfeifen. Robert kletterte nach unten.
„Das nächste Mal steigst du hoch“, sagte er zu Schmidt. Der grinste: „Warum? Dir hat’s doch gut gefallen da oben.“
„Kümmere dich mal um den Mischer“, sagte Marschke, „da ist was nicht in Ordnung. Wir können uns keine Panne erlauben beim Betonieren.“
Robert ging zum Mischer hinüber. Es war erst Mittag. Jetzt saß sie vielleicht in einem Café. Eiskaffee war genau das richtige bei diesen Temperaturen. Wenn sie aber nicht im Café saß, wenn sie schon über alle Berge war? Für sie konnte die kleine Episode längst vergessen sein. Da hatte sich einer neben sie gesetzt und dusslig gequatscht, so was war ihr bestimmt nicht zum ersten Mal passiert.
Wütend schlug er mit dem Hammer auf die Mischertrommel ein. „Die muss sauber gemacht werden“, brüllte er und riss die abgeschlagenen Betonreste heraus.
Marschke kam herüber.
„Warst du nicht Freitag am Mischer?“
Robert kroch fast in die Trommel hinein und kratzte schweigend.
2
Eigentlich wollte er bis drei Uhr warten und dann hinüberschlendern zur Universität, ganz ruhig und gelassen; aber er hielt es nicht aus, er kletterte auf das Dach des Arbeitswagens, die spöttischen Bemerkungen seiner Kumpel störten ihn nicht, er musste zur Universität hinübersehen. Anke war noch nicht dort. Und es war schon halb drei.
Wie ein Film rollte das Leben drüben auf der Straße vor seinen Augen ab. Eine Menge Autos gab es zu sehen und eine regelrechte Sommermodenschau. Aber die Hauptperson fehlte. Und so war der Film eben schlecht.
Die Enttäuschung konnte er nicht verbergen. Sie äußerte sich darin, dass er Dieter Schmidt zu einem Bier einlud. Er wollte sich bei dessen spöttischen Bemerkungen über das weibliche Geschlecht trösten.
Aber Schmidt sagte: „Es ist ja noch eine halbe Stunde Zeit. Mein Gott, in einer halben Stunde läufst du zweimal die Linden auf und ab.“
Er hatte recht, und Robert war ihm dankbar. Dann wunderte er sich aber, wieso Schmidt denn wusste, dass er sich mit der hübschen Fremden um drei verabredet hatte. War er ihm nachgeschlichen und hatte, verborgen hinter dem Humboldt, gelauscht?
Als alle im Aufbruch waren, sagte Marschke zu Robert: „Vergiss nicht abzuschließen.“ Dann fragte er: „Sehen wir uns heute noch?“
Robert hatte nicht richtig hingehört, er stand vor dem halb blinden Spiegelrest und kämmte sich mit einer Sorgfalt, als müsste er irgendwo als Schlagerstar auftreten. „Heute? Kaum.“
Da ging auch Marschke. Später erst wurde Robert der Sinn der Frage klar, aber das half dann auch nichts mehr.
Robert wohnte in Hermann Marschkes Nachbarschaft. Schon immer. Marschke kannte Robert schon, da war der noch ein Schuljunge. Er besorgte Robert die Lehrstelle als Brunnenbauer nach der 10. Klasse. Es ging auch ums Geld dabei. Roberts Mutter war Marschke sehr dankbar. Sie wohnten im Stadtteil Prenzlauer Berg in einer Nebenstraße. Von ihrer Wohnung, Hinterhaus vier Treppen, konnte er Marschkes Küchenfenster sehen, auch Hinterhaus vier Treppen im Nachbarhof, und dazu noch ein Fenster, das für ihn zeitweise eine gewisse Bedeutung hatte. Dort dehnte und reckte sich an manchem Morgen und manchem Abend Marschkes Tochter Monika. Sie gehörte in ihrem Betrieb der Gymnastikgruppe an. Als Kinder hatten Robert und Monika eine Morseverbindung mit Taschenlampen geschaffen. Monika war es schwergefallen, das Morsealphabet zu erlernen. Später erzählten sie sich auf diesem Wege allerhand Unsinn, und es machte großen Spaß. Die Morseverbindung brach ab, als Monika in ein Internat kam. Sie hatte Aussichten, sportliche Ehren zu erlangen. Berechtigte Aussichten. Vor einem Jahr war sie dann plötzlich zurückgekommen und baute seitdem Kofferradios zusammen. Was da an der Sportschule gewesen war, erfuhr Robert nicht. Seine Besuche bei Marschkes wurden in den letzten Monaten wieder häufiger. Doch die erprobte Morseverbindung hatten Monika und er nicht wieder aufgenommen. -
Kurz vor drei schloss Robert den Arbeitswagen ab. Als er durch die Lücke im Zaun die Baustelle verließ, waren die Zweifel wieder da. Wenn sie ihn nun bequem abgehängt hatte? Das wäre nur recht. Was sollte der Zirkus?
Dann sah er sie. Er rannte über die Straße, ein Wolga hupte. Sie saß auf dem Sockel unter dem Alexander und lehnte sich an den Marmor. Robert ging langsamer, suchte Deckung hinter einer Touristengruppe, die sich um ihren Führer scharte.
Sie war also doch gekommen. Warum auch nicht?
Er blieb eine ganze Weile ein paar Meter von ihr entfernt stehen. Sie erkannte ihn nicht. Vielleicht blendete sie die Sonne, oder sie erwartete, ihn in Arbeitshose und nassem gelbem Hemd zu sehen. Er trat auf sie zu und sagte: „Sind Sie eingeschlafen?“
Überrascht und auch ein bisschen verwirrt blickte sie auf.
„Da sind Sie ja! Stehen Sie schon lange so vor mir?“
„Ja“, sagte er, „ich wollte Ihre Ruhe nicht stören.“
Sie musterte ihn.
„Ich hab Feierabend“, sagte er.
„Ja natürlich. Vorhin sahen Sie anders aus. Ist ja klar.“
Sie standen voreinander, und der selbstbewusste Robert war plötzlich am Ende seines Lateins.
„Und was nun?“, fragte sie.
„Ich zeige Ihnen unsere Baustelle.“
„So war’s abgemacht.“
Sie überquerten die Straße, Robert achtete sorgsam auf die Autos, und diesmal brauchte kein Wolga zu hupen.
An der Bauzaunlücke betrachtete sie das Schild, auf dem „Betreten verboten“ geschrieben stand.
„Das hab ich heute Vormittag schon gesehen. Ich konnt’s aber nicht lassen, auf den Stapel zu klettern. Von dort hat man einen schönen Überblick.“
„Also eine bewusste Übertretung“, sagte er, „sind Sie sich klar, dass es hierauf eine Geldstrafe bis zu tausend Mark geben kann?“
„Tausend Mark? Hilfe! Ich bin arm wie eine Kirchenmaus.“
„Dann werden Sie eingelocht. Ohne Gnade.“
„Wo ist das Gefängnis? Dort gibt’s bestimmt jeden Tag Erbsensuppe. Die esse ich aber nicht.“
„Wir haben unsere eigene Justiz“, sagte Robert, „zwei Wochen Arrest in unserem Arbeitswagen sind für Täter Ihrer Art vorgesehen. Sie müssen uns Kaffee kochen, Bier holen, für unseren lieben Glomm Pfannkuchen. Wehe, Sie bringen nicht die richtigen. So was verschärft das Strafmaß.“
„Ist das alles?“, fragte sie.
„Nein. Noch lange nicht. Sie müssen Karten spielen lernen. Skat steht an erster Stelle.“
„Skat kann ich.“
„Keine Angst, es gibt noch andere Aufgaben. Wenn wir schlechter Laune sind, müssen Sie uns was vorsingen oder Witze erzählen. Im Übrigen, denken Sie nicht etwa, dass Sie uns hier entkommen. An Ihrem Fußgelenk wird ein Drahtseil befestigt. Wo Sie auch hingehen, wir haben Sie immer an der Strippe.“
„Ich sehe ein, ich bin verloren, denn singen kann ich nicht, und über Witze muss ich zwar lachen, aber ich behalte sie nicht.“
Robert lachte und sagte: „Wir wollen mal nicht so sein und Sie begnadigen.“
„Danke“, sagte sie, „und jetzt will ich hier von Ihnen was wissen.“
Sie standen am Arbeitswagen. Auf der Baustelle war es still, nur hinter der Fassade arbeiteten Maurer am Ausbau des alten Gebäudeteils. Robert hätte gerne noch so weiter gealbert. Damit konnte er am besten seine Verlegenheit verbergen. Doch er gab sich einen innerlichen Ruck und begann: „Was Sie hier vor sich sehen, ist die Kommode. Das heißt, diesen Namen hat der Berliner geprägt, früher war hier die Königliche Bibliothek.“
„Seien Sie nicht böse“, unterbrach Anke, „das weiß ich. Das steht alles in meinem Reiseführer.“
„Dann ist es ja gut. Da wissen Sie vielleicht mehr als ich.“ Er schwieg unsicher.
Sie betrachtete ihn aufmerksam.
„Was machen Sie denn hier, Sie und lhre Freunde?“
„Was wir hier machen?“, fragte er verblüfft, „es wird Sie langweilen, wenn ich Ihnen das erzähle.“
„Da irren Sie sich aber.“
„Wir bohren Löcher in die Erde und gießen Beton rein. Das ist alles.“
„Und warum?“
„Damit die alte Kommode nicht umfällt. Morsch ist das Ding sowieso. Und der Boden ist hier nicht gerade fest. Sieht man ihm nicht an. Aber es ist so. Sieht alles solide aus. Aber ohne unsere Betonplomben ist nichts mehr zu machen.“
„Betonplomben?“
Oh, sie war hartnäckig.
„Hab ich erfunden. Kein Fachausdruck.“
„Aber treffend.“
Sie sah sich neugierig um. Robert fiel auf, dass sie alles ruhig tat. Ihr Blick ging ohne Hast von einem Gegenstand zum anderen.
„Und das hier ist Ihr Wagen? Warum haben Sie ein so großes Schloss vor der Tür? Sind Schätze da drinnen?“
„Wie man’s nimmt. Gummistiefel zum Beispiel, mein nasses Hemd, Spielkarten und so was.“
Robert hatte schon die Befürchtung, sein Gast könnte den Wunsch äußern, sich den Arbeitswagen von innen anzusehen. Bei dem Gedanken wurde ihm heiß. Das Wageninnere war eine schwache Seite der Brigade.
Marschke hatte es noch nicht geschafft, seine Leute zur Ordnung zu erziehen. Warum war Robert bloß vorhin nicht auf den Gedanken gekommen aufzuräumen? Er nahm sich vor, einen solchen Wunsch einfach zu überhören. Der Wagen blieb tabu. Der Schlüssel würde nicht zu finden sein. Aber Anke interessierte das mächtige Vorhängeschloss.
„Das ist ja bemalt. Eine rote Teufelsfratze. Haben Sie auch Künstler in Ihrer Brigade?“
„Ja, einen bedeutenden sogar. Dieter Schmidt heißt er. Er ist heute Vormittag auch auf Sie zumarschiert, um Sie von unserem heiligen Boden zu vertreiben. Der mit der Brechstange, der kleine Dicke.“
„Ach der“, sagte Anke, „der hat zu mir hochgeblinzelt. Das sah recht lustig aus.“
Sieh an, dachte Robert, der Schmidt, der Frauenverächter, blinzelt dieses Wesen hier an.
„Hat er die Fratze gemalt, um Einbrecher abzuschrecken?“
„Nicht gerade. Das war ein politischer Akt sozusagen.“
„Ein politischer Akt? Weshalb ist der rote Teufel politisch?“
Und Robert erzählte ihr die Geschichte mit dem Vorhängeschloss. Sie passierte im vergangenen Sommer. Sie waren zehn Tage in Westberlin eingesetzt. Das heißt, genau genommen war das nicht Westberlin. Sie befestigten Uferanlagen am Reichstagsufer. Das Gebiet gehört zur Republik. Es fanden sich jeden Tag dieselben Neugierigen ein. „He, ihr, Zigaretten gefällig? Tafel Schokolade? Bleibt bei uns. Wir brauchen solche wie euch. Könnt klotziges Geld verdienen bei uns.“
Das Übliche. Die Marschkes reagierten nicht, wie sie es abgesprochen hatten, bis dann eines Tages jemand an den Wagen geschmiert hatte: „Freiheit“ und „Brüder“ und „Nieder mit den Kommunisten“. Den Wagen hatten sie aufgebrochen und alles durcheinandergeworfen. Da hielt sich Dieter Schmidt nicht mehr an die Disziplin, die Marschke ihnen ans Herz gelegt hatte: „Nicht provozieren lassen. Einfach Ruhe bewahren. Die lassen’s sein, wenn sie merken, dass bei uns nichts zu ernten ist.“