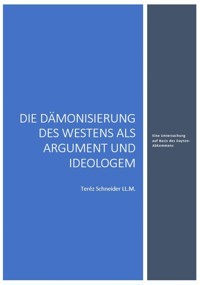
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus der Geschichte lernen, die gleichen Fehler niemals wiederholen, im Einklang mit moralischen Werten und Normen leben. Leben und leben lassen, Frieden zu wahren und Konflikte erkennen, bevor sie zu Krisen oder Kriegen werden. All dies wird weltweit als eine Art Mindeststandard kommuniziert, in die Schulbildung integriert, und ist das höchste und erstrebenswerteste Ziel von Staatsoberhäuptern, Regierungen, Behörden, Verfassungen. Theoretisch zumindest. Ab 1990, mitten in Europa, brachen Kriege aus. Unverständlich für die einen, unvermeidlich für die anderen. Durch eine starke Intervention der NATO, der EU und den USA wurde die Region ex-Jugoslawien mehrmals "befriedet". Bosnien wurde mit dem Dayton-Abkommen Ende 1995 in den friedlichen Wiederaufbau entlassen. Faktisch wurde aber lediglich der Krieg gestoppt und ein seitdem anhaltender, eingefrorener Konflikt gestaltete und gestaltet noch immer die Gegenwart und damit auch die Zukunft des Landes. Als im Jahr 2022 Russland in die Ukraine einfiel, wurden viele Erinnerungen wach, viele Parallelen zu den Balkankriegen der 1990er Jahre erkannt. Egal ob in Jugoslawien oder in der Ukraine, diese Kriege kamen nicht aus dem Nichts, sie waren vorhersehbar und im Vorfeld durch eine aggressive Kommunikation eingeläutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teréz Schneider LL.M.
Die Dämonisierung des Westens als Argument und Ideologem
Eine Untersuchung auf Basis des Dayton-Abkommens
Inhalt
1. Einleitung
1.1. Zur qualitativen Basis der Studie
1.2. Ableitung der ideologisierenden historischen Ereignisse in der betrachteten Region
1.3. Das Abkommen von Dayton
1.4. Studien von Božo Skoko als Erklärungsversuch zur politischen Wechselwirkung der involvierten Ethnien
2. Agitation, Kriegsdemagogie, nationalistische Ideologeme als Kriegswaffe
2.1. Dämonisierung in der Politik und der orthodoxen Kirche als Auslöser des Dehumanisierungsprozesses
2.2. Die Rolle der lokalen Hauptakteure des Krieges
2.3. Wann begann der Krieg in Bosnien – drei hemmende Datierungen als Hindernisse für die Aufarbeitung
2.4. Die politischen Rollen von Kroatien und Serbien während des Krieges in Bosnien
3. Von Dämonen zur Dämonisierung
3.1. Frühzeitliche Darstellung von Dämonen in der Geschichte
3.2. Dämonen und Dämonisierung in der christlichen Literatur
3.3. Definition und interdisziplinäre Erklärungsversuche der Dämonisierung
3.4. Von Dämonisierung zur Vernichtung
3.5. Geopolitischer Ausblick auf die Region Westbalkan aus der Perspektive der dehumanisierenden und dämonisierenden Narrative der Gegenwart
4. Betrachtung und Analyse der nationalen / nationalistischen Propaganda und die Funktion von Feindallegorien als Movens
4.1. Die Rolle von Feindbildern in Jugoslawien zwischen 1459-1990
4.2. Die Figur der Dämonisierung des Westens
4.3. Die Soldatenmatrix: gut oder böse als binäre Opposition im Krieg
4.4. Kriegsmythologie als Kulturgut
4.5. Dehumanisierung der anderen und die eigene Opferrolle
4.6. Dämonisierung als Instrument der Mobilisierung
4.7. Dämonisierung als Instrument der Schuldverlagerung
5. Betrachtung und Analyse der mutuellen Dämonisierung und Dehumanisierung der Ethnien vor dem Daytoner Abkommen
5.1. Dämonisierung und Propaganda in Serbien / Republika Srpska
Betrachtung und Analyse der Propagandafälle:
„Zelena Transverzala“
„Die bosnischen Mudschaheddin“
"EU- Das Vierte Reich und die Vatikanische Verschwörung"
"Prijedor Monster Doctors"
"Die Markale-Verschwörung"
„Löwen Zoo Sarajevo“
5.2. Dämonisierung und Propaganda in Kroatien
Betrachtung und Analyse der Propagandafälle:
„Vranica-Fall“
„Das Karađorđevo - Meeting“
5.3. Dämonisierung und Propaganda in Bosnien
Auswertung „Balkan Media in War and Peace“ des Journalisten Kemal Kurspahić.
6. Post-Dayton Agitation der Republika Srpska und Serbien als illegitimer Hebelgriff an der bosnischen Verfassung
6.1. Die juristischen Streitfragen bezüglich Verherrlichung von Kriegsverbrechern, Leugnen von Kriegsverbrechen als Hemmung der Aufarbeitung der Kriegsereignisse
6.2. Die Abwesenheit der tiefergreifenden Thematisierung der „Versöhnung / Aufarbeitung der Ereignisse“ im Daytoner Abkommen und die dadurch in Erscheinung tretende politische Komplikationen in Bosnien
6.3. Die kontrovers diskutierte Rolle des Hohen Repräsentanten und seine Wahrnehmung in Teilen der Bevölkerung und Politik als hemmende Instanz
7. Analysen und Theorien
7.1. Kritische Analyse des Daytoner Abkommens
7.2. Phasenmodell der diametralen Kriegspropaganda und Agitation in Jugoslawien als politisch instrumentalisierte Dehumanisierung
7.3. Dehumanisierung und Dämonisierung als Werkzeug in einem intranationalen / internationalen Konflikt und die Akteure die sie nutzen
7.4. Erkennen - Einschätzen – Entschärfen: Lösungsansätze für Bosnien für die Bekämpfung der Agitation, Dehumanisierung, Dämonisierung, ethnischen Konflikte
Ausgang des Russland-Ukraine-Krieges als Lösungsansatz
Gemeinsame wirtschaftlichen Interessen als Lösungsansatz
Local Ownership als Lösungsansatz
Auslagerung der Gerichtsbarkeit als Lösungsansatz
Der Generationswechsel der lokalen Politiker als Lösungsansatz
Modell „Lombok“ als Lösungsansatz
Modell „Ho’oponopono“ als Lösungsansatz
Demystifizierung der serbischen nationalistischen Literatur als Lösungsansatz
Schaffung einer gemeinsamen Opferidentität als Lösungsansatz
Sezession der RS als Lösungsansatz
Die dritte Entität als Lösungsansatz
Die Abkehr von der Idee die Westbalkan-Länder in die EU zu integrieren als Lösungsansatz
Sanktionen als Lösungsansatz
Ausarbeitung eines „Dayton 2.0“- Abkommens als Lösungsansatz
Täter-Opfer-Ausgleich als Lösungsansatz
Restorative Justice als Lösungsansatz
Gemeinsame Medien als Lösungsansatz
Ein neuer „Jahrhundertvertrag“ als Lösungsansatz
Kulturwandel von der Dämonisierung zu der „tragischen Sicht“ als Lösungsansatz
8. Zusammenfassung der Erkenntnisse / Fazit
Anhang I: Interviews
Impressum
1. Einleitung: Forschungsfrage und Motivation
Aus der Geschichte lernen, die gleichen Fehler niemals wiederholen, im Einklang mit moralischen Werten und Normen leben. Leben und leben lassen, Frieden zu wahren und Konflikte erkennen, bevor sie zu Krisen oder Kriegen werden. All dies wird weltweit als eine Art Mindeststandard kommuniziert, in die Schulbildung integriert, und ist das höchste und erstrebenswerteste Ziel von Staatsoberhäuptern, Regierungen, Behörden, Verfassungen. Theoretisch zumindest.
Ab 1990, mitten in Europa, brachen Kriege aus. Unverständlich für die einen, unvermeidlich für die anderen. Durch eine starke Intervention der NATO, der EU und den USA wurde die Region ex-Jugoslawien mehrmals „befriedet“. Bosnien wurde mit dem Dayton-Abkommen Ende 1995 in den friedlichen Wiederaufbau entlassen. Faktisch wurde aber lediglich der Krieg gestoppt und ein seitdem anhaltender, eingefrorener Konflikt gestaltete und gestaltet noch immer die Gegenwart und damit auch die Zukunft des Landes.
Als im Jahr 2022 Russland in die Ukraine einfiel, wurden viele Erinnerungen wach, viele Parallelen zu den Balkankriegen der 1990er Jahre erkannt. Egal ob in Jugoslawien oder in der Ukraine, diese Kriege kamen nicht aus dem Nichts, sie waren vorhersehbar und im Vorfeld durch eine aggressive Kommunikation eingeläutet. Die Forschungsfrage, die aus dieser weltpolitischen Gemengelage entstanden ist, beschäftigt sich mit folgenden Theorien: inwieweit ist es möglich, die Phasen der Demagogie/Agitation im Vorfeld eines Krieges zu sequenzieren, analysieren, bewerten und skalieren; des Weiteren welche adäquaten Maßnahmen könnten die Eskalationsspirale stoppen, noch bevor sie sich von der verbalen Ebene in die Phase der bewaffneten Gewaltausbrüche steigert.
Als Ende der 1970er Jahre im ehemaligen Jugoslawien geborene Stellvertreterin mehrerer Minderheiten, ist in meinen Erinnerungen die aggressive Kommunikation im Land kurz vor dem Krieg noch immer lebendig. Auch die Hoffnung, dass aus dieser Katastrophe eine Lehre gezogen werden muss für die Zukunft. Als Soldatin der Bundeswehr und damit Mitglied des NATO-Verbandes war ich in den 2000ern in mehrere Krisenregionen entsandt worden, auch auf den Balkan. Durch meine Sprachkenntnisse erreichte mich die ungefilterte und unverfälschte Stimmungslage in diesen Ländern, die Schuldverlagerung der Täter, die Rachegefühle der Opfer, eine allgegenwärtige Abwesenheit jeglicher Aufarbeitung der Ereignisse; von einer Vergebung oder Versöhnung ganz zu schweigen. Die Frage, die mich seitdem bewegt ist: gibt es ein „Lessons-learned-Effekt“ fast 30 Jahre nach dem Dayton-Abkommen? Könnten hierdurch zukünftige Kriege verhindert werden? Gab es etwaige politische Denkfehler im Inland oder Ausland, die eine Verschlechterung der Lage herbeigeführt haben?
Aus der Erforschung dieser Fragen könnte im optimalen Fall ein universales Phasenmodell der Kriegsrhetorik entstehen, bei dem ein „point of no return“ identifiziert wird, den es in der Zukunft erkennen, und mit allen geeigneten Maßnahmen zu verhindern gilt.
Treffend für Bosnien aber auch für viele Konfliktländer der Welt sind zwei Aussagen von Albert Einstein: „Der Krieg ist gewonnen, aber nicht der Frieden“ und „Frieden kann nicht erzwungen werden; er wird nur durch Verständnis erreicht“.
1.1. Zur qualitativen Basis der Studie
„Es gibt nichts auf der Welt, was man nicht in Zahlen fassen könnte“.
(Frei nach einer BWL-Vorlesung aus 2013 an einer Bremer Hochschule).
Erkenntnistheoretisch und ontologisch hatte die Unterscheidung zwischen quantitativen und qualitativen Analysevorgehen ihre Wurzeln in der sogenannten positivistisch-interpretativen Spaltung. Diese Spaltung entstand, als Sozialwissenschaftler die Idee in Frage stellten, dass die Sozialwissenschaften nach dem Vorbild der Naturwissenschaften gestaltet werden sollten. In der Geschichts- und Sozialtheorie gewannen seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts qualitativ-interpretativen Methoden Vorrang, um der Aufgabe des Verstehens menschlichen Handelns und Verhaltens auf der Basis des Erfassens seiner subjektiven Erfahrung nachgehen zu können. Während in den letzten Jahren zwar einerseits eine Spaltung zwischen quantitativen und qualitativen Methoden weniger strikt gedacht und durch methodische Kombinationen integriert wird, stehen jedoch in der Frage der Analyse des Umgangs mit Konflikten quantitative Ansätze im Vordergrund.
Nicht zuletzt lässt sich unter dem Stichwort der (post-)qualitativen Forschung eine Perspektivveränderung feststellen. Diese folgt der Beobachtung, dass Konflikte in konfliktären Prozessen Veränderungen durchlaufen, zum Teil nur schwer zu “objektivieren” sind. Ferner folgen sie der Einsicht, dass Forscher in der Analyse von Konflikt Überführungen in eigene Wissenssysteme leisten, die zwar erlauben, Konflikte zu typisieren und Interventionen zu formulieren, jedoch die Ursachen selbst oft zudecken.
Die hier erfolgte Entscheidung zu einem qualitativen Ansatz folgt dabei auch der Beobachtung, dass in den Dynamiken von politischen Konflikten Werte und Emotionen, Einstellungen und Handlungsdynamiken in Wechselverhältnissen stehen, die sich quantitativ nicht abbilden lassen.
Die vorliegende Studie sucht "Repräsentationslogiken“ aufzudecken. Ziel ist die Rekonstruktion von Bedeutungszusammenhängen. Während die quantitative Erfassung und Darstellung einzelner Problemfelder erlaubt, Theorien durch quantifizierbare Ergebnisse hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit zu prüfen, soll der qualitativer Forschungsansatz, der hier im Zentrum steht, einen Ausgangspunkt für die Beleuchtung der Wechselwirkungen von Agitation, Demagogie, Dämonisierung, Kriegspropaganda in all deren Facetten in einem geschichtlich und politisch volatilen Umfeld wie z.B. Bosnien eröffnen. Durch Inhaltsanalysen von unzähligen Protokollen, Steno-Niederschriften, Tonbandaufnahmen, Archivdaten (auf serbisch, kroatisch, bosnisch, englisch, ungarisch und deutsch) aber auch aus intensiven Gesprächen und Interviews und lokalen wie internationalen Literaturquellen entstand ein belastbares Lagebild, das eine wissenschaftliche Ableitung, Auswertung und Analyse der Umstände erlaubt. Rückblickend wie auch in die Zukunft gerichtet könnten so immer wiederkehrende Prozesse, Abläufe, Konflikte identifiziert werden.
Die Inhaltsanalyse wurde zuerst in den Kommunikationswissenschaften angewandt, um große Mengen von gesammelten Texten (Zeitungsartikel, Protokolle, Analysen von schriftlichen Unterlagen, usw.) zielorientiert zu verarbeiten. (Vgl. Merten 1995). Die Werkzeuge der qualitativen Inhaltsanalyse sind in der Zwischenzeit in den meisten geisteswissenschaftlichen Bereichen (u.a. Politologie, Geschichtswissenschaften, Psychologie, Soziologie) zu einer Standardmethode der Textanalyse geworden. Es wurde ein hoher Bedarf an umfassenden Analysemethoden erkannt, um die bei Recherchen gesammelte großen Mengen an Informationen effektiv verarbeiten zu können (Vgl. Mey/Mruck 2010).
Mayring kategorisierte die qualitative Inhaltsanalyse in drei übergeordnete Felder: Zusammenfassungen, die Texte auf das wesentliche reduzieren; Explikationen die unklaren Texte verständlich machen und Strukturierungen, die das Material systematisieren (Vgl. Mayring 2010). Durch diese systematisch zusammenfassende und erklärende Art der Textinterpretation bietet die qualitative Inhaltsanalyse eine belastbare, überprüfbare und auswertbare Datenbasis für komplexe Textmengen. Je nach Forschungsfrage sind hier unterschiedliche Herangehensweisen möglich, mit dem gleichen Kern einer systematischen Erschließung und qualitativen Interpretation der Textsammlungen.
Wenn wir bei Mayring bleiben, ist der Ablauf einer qualitativen Inhaltsanalyse in zehn Schritte aufgeteilt. Zuerst wird das Material eingegrenzt und festgelegt, nach einer klassischen Recherche der vorhandenen Literatur, Experteninterviews oder anderen gesammelter Daten. Die in Frage kommenden Texte und Daten werden überprüft und die Quellen verifiziert, damit die Entstehungsumstände der Daten geklärt sind. Das formale Charakteristikum des Materials wird analysiert und systematisiert, des Weiteren die Fragestellung der Forschung und die dadurch vorliegende Richtung der Textanalyse identifiziert. Die theoretische Differenzierung der Fragestellung grenzt die Forschungsfrage thematisch ein und setzt für die Inhaltsanalyse einen präzisen Fokus. Die passende Analysetechnik wird festgelegt, ein Kategoriensystem und ein Ablaufmodell gesetzt und Analyseeinheiten definiert. Wenn all diese Grenzen gesetzt sind, wird eine systematische, an das Ablaufmodell angepasste Analyse durchgeführt. Die Ergebnisse werden ausgewertet, gebündelt und anhand inhaltsanalytischer Gütekriterien bewertet (Vgl. Mayring 2010).
Für eine qualitative Analyse eignen sich nebst Textanalysen auch bestimmte Interviewarten mit dem dafür in Frage kommenden Personenkreis. Fraglich ist, ob eine einheitliche Definition benannt werden kann, bezüglich wer Experte ist und wer nicht. Daher gibt es auch unterschiedliche Definitionen und Arten von Experteninterviews. Allein der Bezug zu der Forschungsfrage lässt eine Kategorisierung in Experten / keine Experten zu (Vgl. Littig 2005). In dieser Arbeit wird die Definition von Meuser / Nagel adaptiert, bei der die interviewte Person und der Interviewer sich auf einer Ebene des Fachwissens begegnen, ohne die Biografie oder die Person der „Quelle“ in den Vordergrund zu stellen (Vgl. Meuser / Nagel 1991). Die Interviews der Arbeit fallen des Weiteren in die Unterkategorie des ero-epischen Gespräche nach Girtler. Roland Girtler formulierte in seinen 10 Geboten der Feldforschung als 7. Gebot das ero-episches Gespräch:
„Du sollst die Muße zum „ero-epischen" (freien) Gespräch aufbringen. Das heißt, die Menschen dürfen nicht als bloße Datenlieferanten gesehen werden. Mit ihnen ist so zu sprechen, dass sie sich geachtet fühlen. Man muss sich selbst als Mensch einbringen und darf sich nicht aufzwingen. Erst so lassen sich gute Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle erstellen“ (Girtler 2001).
Girtler setzt auf eine gleichberechtigte Kommunikation zwischen Forschenden und den Experten, um eine höhere Nähe zum Alltag und gleichzeitig keine künstlich distanzierte Interviewsituation zu schaffen. An diesem Punkt wird das klassische Konzept eines Experteninterviews unterwandert und eine narrative Art unterbunden, um eine höhere Qualität von unverfälschten Daten zu erhalten. Das Interview gleicht eher einen Alltagsgespräch, bei den sich zwei Individuen zu einem Thema austauschen, bei dem der „Sender“ einen Wissenstransfer auf den „Empfänger“ vollzieht (Vgl. Girtler 2001). Die Kernbereiche für die Interviews in dieser Arbeit wurden nach dem 7-W-Prinzip geplant und definiert:
Auswahl des Experten / Gesprächspartners (WER)
Zeitraum des Interviews (WANN)
Setting des Interviews (WO)
Art des Interviews (WIE) (Persönlich, telefonisch, online, schriftlich…)
Welche Interviewform wird angewandt (WAS)
Leitfaden des Interviews (WARUM)
Aufzeichnung des Interviews (WOMIT) (Audio, Video, Protokollierung…)
Für meine Arbeit wählte ich als Experten Herrn Professor Emeritus Thomas Elbert von der Universität Konstanz, der in der Klinischen- und Neuropsychologie mitunter im Bereich mentale Gesundheit in Konflikt- und Krisenregionen forschte. In einer Kooperation mit Prof. Dr. Frank Neuner und Dr. Maggie Schauer entwickelte er die sogenannte Narrative Expositionstherapie (NET), mit der eine Stress-Symptom-Reduktion bei traumatisierten Überlebenden organisierter Gewalt (Krieg, Folter, Vergewaltigung etc.) erreicht werden kann. Er betrieb hierzu Feldstudien in asiatischen und afrikanischen Krisengebieten. Seine ausführlichen Erklärungen ergänzten diese Dissertation bei den Fragen zu dem psychischen Background der Kriegsverbrecher, den kollektiven Verdrängungsmechanismen und den Aufarbeitungsmöglichkeiten der Traumatisierung der Opfer und Täter. Als weiterer Experte stellte sich ein langjähriger Begleiter der politischen Transformation der Balkan-Staaten zur Verfügung, der maßgeblich an der Ausarbeitung und Umsetzung von EU-Gesetzen und Regelwerken (die auch Bosnien betrafen)beteiligt war und noch immer ist. Im Rahmen der non-Attribution wird er in der Arbeit als Experte 2 geführt.
Auch intensive Gespräche mit Tätern und Opfern, die ich während meiner Einsätze als Bundeswehrsoldatin führen konnte; sowie eigene Erfahrungswerte und Beobachtungen als in Serbien wohnhafte, jugoslawische Staatsangehörige in der Zeit zwischen 1977-1997 flossen als Informationen in die Arbeit ein.
1.2. Ableitung der ideologisierenden historischen Ereignisse in der betrachteten Region
Im Zeitraum von 1990 bis 1999 ereigneten sich auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens (Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, SFRJ) mehrere bewaffnete Zusammenstöße zwischen den ehemaligen Teilstaaten, die unter dem Oberbegriff „Jugoslawienkriege“ zusammengefasst werden. Diese Kriegsserie wird als gewalttätigste Reihe von Auseinandersetzungen in Europa seit dem zweiten Weltkrieg betrachtet. Kriegsverbrechen aller Art, bis zu Massakern, Völkermord und ethnischen Säuberungen hinterließen ihre Spuren in Kroatien, Bosnien und Kosovo. Innerhalb von neun Jahren wurden in drei Kriegen nachweislich ca. 200.000 Menschen getötet (Dunkelziffer womöglich viel höher). Mehrere Millionen Kriegsflüchtlinge und Vertriebene flohen nach Serbien oder in das benachbarte europäische Ausland.
Auslöser für das Entbrennen der Konflikte in Jugoslawien waren Separationsambitionen der Teilstaaten, die Ende der 1980er Jahre nach dem kalten Krieg den Zerfall der Sowjetunion miterleben konnten. Beide Staaten, die Sowjetunion wie auch Jugoslawien waren künstliche Konstrukte, Vielvölkerstaaten mit unterschiedlichen Sprachen, Religionen, Kulturen, die seit der jeweiligen Staatsgründung Konfliktpotenzial hatten. Jugoslawien bestand aus sechs Teilstaaten (Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro (Crna Gora), Serbien, Mazedonien) und zwei autonomen Gebieten (Vojvodina an der ungarischen Grenze, Kosovo an der albanischen Grenze). Im Jahr 1981 waren 36.3 % der Bewohner Jugoslawiens Serben, 19.8 % Kroaten, 8.9 % slawische Muslime (Bosnier, Goranen, Torbesch), 7.8 % Slowenen, 7.7 % Albaner, 6 % Mazedonier, 2.6 % Montenegriner, 1.9 % Ungaren. 5.4 % identifizierten sich als „Jugoslawen“ ohne konkrete Nationalitäten zu nennen, da bei der Volkszählung im Jahr 1981 auch die Möglichkeit „Jugoslawe“ wählbar war. 2.5 % setzten sich aus Roma, Türken, Slowaken, Rumänen, Bulgaren, Walachen, Russinen, Tschechen und Italienern zusammen. Es gab sehr wenige Gebiete in Jugoslawien, in den geografisch betrachtet keine ethnische Bevölkerungsmehrheit einer der großen Ethniengruppen herrschte.{1}
Serbien war von der Größe und der Machtstellung die dominanteste föderative Einheit. Lediglich 60 % der Serben lebten in Serbien, 40 % in den benachbarten Teilstaaten. Diese Tatsache begünstigte die Entstehung der Jugoslawienkriege. Als in 1980 Josip Broz Tito, der Staatschef von Jugoslawien starb, wurde beschlossen, dass die 8 Entitäten nach einem jährlich wechselnden Rotationsprinzip das Präsidium (bestehend aus 8 Mitgliedern, jeweils einer aus den 6 Teilrepubliken und 2 autonomen Gebieten) führen werden.
Als in 1988 der Serbe Slobodan Milošević zum Präsidenten ernannt worden ist, leitete er ein neues politisches Zeitalter ein, indem er eine zentralistische Führung für Jugoslawien etablieren wollte, in dem Serbien die Dominanz und Entscheidungsgewalt innehalten sollte. Unter diesem Leitziel subsumierte er auch die Pläne, Regionen auch außerhalb von Serbien, in den die Bevölkerung mehrheitlich serbisch ist zu einem Großserbien zusammenzuführen. In einem ersten Schritt forderte er mit Nachdruck Schutz für alle Serben außerhalb des Mutterlandes.{2} Als in 1990 die Vorbereitungen für das Abspaltungsprozess der Teilstaaten schon weit vorangeschritten waren, eskalierten die Konflikte zu bewaffneten Auseinandersetzungen, die zu den Jugoslawienkriegen führten.
Der Zehn-Tage-Krieg in Slowenien (1991)
Als Auftaktkrieg galt der lediglich knapp zwei Wochen dauernder Krieg in Slowenien. Nachdem Ende 1990 in einem Referendum 88 % und damit die Mehrheit der slowenischen Bevölkerung für die Unabhängigkeit Sloweniens stimmte, erfolgte am 25.06.1991 die Unabhängigkeitserklärung. Am 27.06.1991 sind Kämpfe ausgebrochen zwischen den slowenischen Streitkräften und der jugoslawischen Volksarmee (Jugoslovenska Narodna Armija - JNA). Stein des Anstoßes waren die Grenzen von Slowenien, die nun von den slowenischen Streitkräften bewacht worden sind. Der Grund für die Kürze des Krieges findet sich in der ethnisch homogenen Zusammensetzung der slowenischen Bevölkerung; leidglich eine vernachlässigbare Minderheit von Serben, Kroaten oder Bosniaken lebten dort. Das innerstaatliche Konfliktpotenzial war damit sehr niedrig. Mit dem Brioni-Abkommen am 07.07.1991 wurde unter Vermittlung der Europäischen Gemeinschaft (Vorgänger der EU) ein Waffenstillstand und damit auch das Ende des Krieges vereinbart.{3} Die jugoslawische Volksarmee zog aus Slowenien ab.
Der Kroatienkrieg (1991-1995)
Nachdem in Kroatien, ähnlich wie bevor in Slowenien, in 1991 bei einem Referendum 94.7 % der Kroaten für die Unabhängigkeit gestimmt hatten, revoltierte die serbische Bevölkerung in Kroatien (12 % der Gesamtbevölkerung). Bereits das Referendum wurde von den Serben boykottiert, da sie sich in der Verfassung des neugegründeten Staates Kroatien in der Rolle einer ethnischen Minderheit wiedergefunden haben und nicht mehr explizit erwähnt worden sind.{4} Am 25.06.1991 verkündete Kroatien ihre Unabhängigkeit, am gleichen Tag wie der Nachbarstaat Slowenien. Der Unterschied zu der Lage in Slowenien war, das bereits einen Jahr vor der Unabhängigkeitserklärung von Kroatien vereinzelte innerstaatliche Konflikte zwischen Serben und Kroaten wahrnehmbar waren. Immer öfter wurden in einigen Gebieten kroatische Polizeikräfte von serbischen Paramilitärs überfallen.{5} Die beteiligten Parteien im Kroatienkrieg waren die kroatischen Streitkräfte und die Soldaten der selbsternannten „Republik Serbische Krajina“ (Republika Srpska Krajina – RSK) die ca. 30 % des kroatischen Staatsgebietes unter die eigene Kontrolle brachte und bis 1995 besetzte. Die RSK erhielt massive personelle und materielle Unterstützung von der jugoslawischen Volksarmee und serbischen Söldnern (Freiwilligengarde, paramilitärische Einheiten, etc.). Die Situation eskalierte rasch und führte zu großen Schlachten an der Peripherie von Kroatien zu Jugoslawien (wie zum Beispiel die Schlacht um Vukovar im Norden oder die Schlacht um Dubrovnik im Süden von Kroatien). Das Massaker in Škabrnja (bei Zadar) erfolgte im Rahmen der ethnischen Säuberungen von Dörfern mit kroatischer Mehrheit, serbische Paramilitärs und endete mit 82 getöteten Zivilisten. Der Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) verurteilte im Jahr 2004 und 2008 zwei Führer der kroatischen Serben, mitunter auch für das Massaker.{6},{7}
Erst mit dem Erdut-Abkommen im Jahr 1995 wurde der Krieg in Kroatien für beendet erklärt.{8}
Der Bosnienkrieg (1992-1995)
Bei der Volkszählung im März 1991 haben sich 43.5 % der Bevölkerung als Muslimisch-Bosnisch identifiziert, 31 % als Serben, 17 % als Kroaten und 5.5 % als Jugoslawen. Die weiteren Minderheiten lagen jeweils unter der 1 % Marke. Insgesamt 22 bosnische Nationalitäten wurden bei dem Zensus erwähnt.{9} Damit war diese jugoslawische Teilrepublik die ethnisch vielfältigste von allen. Eine einheitliche politische Richtung einzuschlagen war daher fast unmöglich. Nach den ersten freien Mehrparteienwahlen im Jahr 1990 kristallisierte sich eine von serbischen, bosnischen und kroatischen nationalistischen Parteien dominierte Staatsführung aus. Die gemeinsame Regierung bestand aus einem bosnischen Präsidenten, einen serbischen Parlamentspräsidenten und einen kroatischen Ministerpräsidenten. Parallel mit dem Kriegsbeginn in benachbarten Kroatien intensivierten sich die interethnischen Spannungen auch in Bosnien. Es folgte ein politischer Sprint, wer zuerst seine Separations-/Sezessionsbekundungen verkünden wird. Die Serben waren die schnellsten, und riefen am 09.01.1992 die „Republik des serbischen Volkes in Bosnien-Herzegowina“ aus (Republika Srpskog Naroda u BiH) mit dem Präsidenten Radovan Karadžić.{10}
Bei einem Referendum in Bosnien im März 1992 haben sich 99.4 % der Gesamtbevölkerung für die Unabhängigkeit entschieden. Die Serben boykottierten das Referendum. Am 03.03.1992 erklärte sich Bosnien zum unabhängigen Staat und folgte damit Slowenien und Kroatien. Als im April die Unabhängigkeit von Bosnien seitens der USA und der EU international anerkannt worden ist, begannen die bewaffneten Zusammenstöße zwischen den bosnischen Streitkräften und den bosnischen Serben (die wie bereits in Kroatien geschehen, eine massive personelle und materielle Unterstützung von der jugoslawischen Volksarmee und serbischen Söldnern - Freiwilligengarde, paramilitärische Einheiten, etc. - erhalten haben). Das serbische Militär kesselte Sarajevo für drei Jahre ein, allein bei dieser Belagerung starben über 10.000 Menschen.
Die ethnischen Säuberungen der muslimischen und kroatischen Dörfer und Regionen in Bosnien erreichten ihren Höhepunkt zwischen den 11.07. und 19.07.1995, als in der nur 5 km von der Grenze Serbiens liegenden Ortschaft Srebrenica über 8000 muslimische Männer im Alter zwischen 13 und 78 massakriert worden sind. Federführend für diese Aktion war General Ratko Mladić von der Armee der Republika Srpska (Vojska Republike Srpske – VRS) mit Unterstützung von Söldnern der serbischen Freiwilligengarde. Die Massenexekutionen erfolgten, nachdem die Männer für mehrere Tage interniert worden sind ohne Nahrung oder Wasser zu erhalten. Mit dieser Maßnahme sollten mögliche Widerstände auf dem Weg oder bei der Exekution verhindert werden. Zusätzlich wurden die Männer gefesselt und mit Augenbinden versehen. Die Leichen der entkräfteten, gefesselten und damit an Flucht und Widerstand gehinderten Männer sind nach der Exekution in Massengräber verscharrt worden.
Dieses systematisch geplante und ausgeführte Genozid an der muslimischen Bevölkerung in Srebrenica, das als schwerste Kriegsverbrechen nach dem zweiten Weltkrieg bewertet wurde, erzeugte nach Bekanntwerden Ende Juli 1995 ein starkes mediales Echo im Ausland. Der Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) klagte Ende 1995 General Ratko Mladić {11} und den Präsidenten der Republika Srpska, Radovan Karadžić {12} wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit (auch im Srebrenica-Fall) an.
Erst mit dem Dayton-Abkommen vom 14.12.1995 endete der Krieg in Bosnien.{13}
Der Kosovokrieg (1998-1999)
Das ehemals autonome Selbstverwaltungsgebiet Kosovo erlebte in 1998 radikale Ausschreitungen, die albanisch dominierte Bevölkerung forderte mit Nachdruck eine Unabhängigkeit von Serbien. Bereits Ende der 1980er Jahre hob Präsident Slobodan Milošević das Autonomiestatus Kosovos auf, gefolgt von einer systematischen Verdrängung der Albaner aus allen öffentlichen Ämtern. Ab 1994 kämpfte die Kosovarische Befreiungsarmee UÇK (Ushtria Çlirimtare Kombëtare) für die Unabhängigkeit. Der Freiwilligenansturm in die UÇK erlebte ihren Höhepunkt im Jahr 1998. Im Sommer des gleichen Jahres hielt die UÇK bereits ein Drittel des Kosovo unter ihre Kontrolle. Die jugoslawische Armee (VJ) und die serbischen Söldner setzten zu einem harten Gegenschlag an, es entwickelte sich ein Bürgerkrieg. Mehrere Waffenstillstände wurden gebrochen, Friedensbemühungen scheiterten, die Massaker eskalierten immer weiter. Die NATO entschloss sich ab den 24.03.1999 aktiv einzugreifen und führte bis 10.06.1999 Bombardements gegen neuralgische Militärziele der Serben in Kosovo, Montenegro und Serbien durch. Dieser Eingriff brachte die Serben dazu, den Kumanovo-Abkommen am 09.06.1999 zu unterschreiben und damit den Bürgerkrieg im Kosovo zu beenden.{14}Nach dem Krieg wurdeKosovo unter das Protektorat der Vereinten Nationen gestellt und erklärte final ihre Unabhängigkeit am 17.02.2008.{15}
Die Konflikte in Mazedonien (2001)
Mazedonien erklärte ihre Unabhängigkeit mit 96.4 % der Stimmen nach einem Referendum am 08.09.1991. Obwohl die serbischen und albanischen Minderheiten im Land das Referendum boykottiert haben, konnte eine friedliche Separation verbucht werden. Ein Krieg fand daher in Mazedonien nicht statt. Innerstaatlich kam es immer wieder zu Spannungen, die im Jahr 2001 ihren Höhepunkt erreicht haben; als die mazedonischen Streitkräfte gegen die paramilitärisch organisierte „Nationale Befreiungsarmee“ der albanischen Mazedonier (Ushtria Çlirimtare Kombëtare) interveniert haben. Die aufständischen albanischen Separatisten verübten davor mehrere Anschläge. Dieser Konflikt, der als „albanischer Aufstand in Mazedonien“ bezeichnet worden ist, fand mit dem Ohrid-Abkommen am 13.08.2001 ein Ende.{16}
1.3. Das Abkommen von Dayton
Nach mehrwöchigen Verhandlungen in Dayton, auf der Wright-Patterson Airbase, beschlossen am 21.11.1995 die Vertreter von Kroatien, Serbien und Bosnien in Paris das Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Es war durch massive Vermittlung der USA und EU ausgehandelt worden, entstanden aus der Notwendigkeit, das mehrjährige Blutvergießen in Bosnien zu stoppen, das im Genozid von Srebrenica gipfelte. Die Situation im Land war durch militärische Eigendynamik und einer chaotischen Gemengelage gekennzeichnet, von den involvierten Ethnien der Kroaten, Serben und Bosnier wollten lediglich die Bosnier den Fortbestand der multiethnischen Gesellschaft. Die bosnischen Kroaten und Serben strebten die Gründung von eigenen, ethnisch homogenen Teilrepubliken an; des Weiteren den Anschluss dieser Gebiete an die Mutterländer Serbien und Kroatien. Die EU unterstützte mitsamt der UNO die Idee der Bosnier, das multiethnische Land weiter aufrechtzuerhalten. Dies scheiterte jedoch an den zu diesem Zeitpunkt bereits massiv vorangeschrittenen Aktionen der ethnischen Säuberungen, die von den Serben (und teilweise auch von Kroaten) durchgeführt worden sind.{17}Die erwähnte chaotische Gemengelage im Land führte zu vorzeitigen Scheitern von mehreren Friedensplänen (Carrington-Cutilero-Plan im Februar 1992, Vance-Owen-Plan im Januar 1993, Owen-Stoltenberg-Plan im August 1993, Kontaktgruppen-Plan in 1994).
Als sich in 1995 eine militärische Patt-Situation im Land angedeutet hatte, versuchten die beteiligten Ethnien die bis dato erreichten Landgewinne zu festigen und vertraglich festzuhalten. Da sich durch die ethnischen Säuberungen homogene serbische, kroatische und bosnische Regionen gebildet hatten, des Weiteren die kroatische und bosnische Seite eine Föderation geschlossen hatte, waren die Voraussetzungen günstig für einen neuen Anlauf von Friedensverhandlungen. Nicht zu vergessen ist zu diesem Zeitpunkt das aktive Eingreifen des USA als „Motivators“ für den Frieden in Bosnien (mitsamt des UN-Mandates, welches Lufteinsätze der NATO auf dem Plan rief).
All diese Ereignisse führten zu der Unterzeichnung des Friedensabkommens von Dayton am 14.12.1995 in Paris, besiegelt mit den Unterschriften von Slobodan Milošević (Präsident von Jugoslawien, stellvertretend für die bosnischen Serben), Franjo Tuđman (Präsident von Kroatien, stellvertretend für die bosnischen Kroaten) und Alija Izetbegović (Vorsitzender des Präsidiums von Bosnien-Herzegowina). Bezeugt wurde das Abkommen von Stellvertretern der Länder Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.
Das Friedensabkommen gliedert sich auf 58 Seiten in 11 Artikel und 12 Anhänge (Anhang 1 wird in 1A und 1B untergliedert).{18} Die ersten beiden Anhänge, Annex 1-A /Annex 1-B und Annex 2 beinhalten die militärischen Aspekte des Friedensabkommens und der regionalen Stabilisierung. Konkret im Annex 1-A: hier wird die sofortige Einstellung aller kriegerischen Handlungen und ein Waffenstillstand gefordert, damit die Möglichkeit zur Rückkehr zum normalen Leben im Land durch Kooperation aller Entitäten (auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien). Die Implementierung einer Resolution zur Aufrechterhaltung des Friedens durch Entsendung von NATO- und/oder nicht NATO-Soldaten ins Land im Rahmen der Mission der IFOR (multinational Military Implementation Force), welche die Umsetzung des Friedensvertrages überwachen. Alle im Krieg involvierte, fremde militärischen und paramilitärischen Kräfte (aus Serbien, Kroatien, Drittländern) sollten innerhalb der nächsten 30 Tage die Hoheitsgebiete von Bosnien verlassen.
Im Annex 1-B: Einführung aller nötigen Maßnahmen, um eine Stabilisierung in der Region zu gewährleisten. Hierzu werden die drei Entitäten im Land dazu verpflichtet, innerhalb von sieben Tagen Verhandlungen miteinander aufzunehmen, unter der Beratung der OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe); mit dem Ziel Vertrauen untereinander zu schaffen und das Risiko eines erneuten Aufflammens der Konflikte zu unterbinden. Diese Verhandlungen sollten innerhalb eines Zeitraumes von 45 Tagen effektive Maßnahmen definieren und ausformulieren, um Verbote von militärischen Aktivitäten durchzusetzen (wie z.B. Restriktionen von Militärübungen oder Verlegungen von Einheiten in bestimmten Bereichen, Verbot von Eingliederung von Söldnern aus Drittländern, Verbot der Aufstellung von schweren Waffen, Rückzug der eigenen Kräfte / Waffen in die davor vorgesehenen Kasernen, etc.). Die Parteien sind damit einverstanden, dass mit Unterstützung der OSCE ein Repräsentant benannt wird, der alle militärischen Fragen des zwischenethnischen Zusammenlebens analysieren und klären wird. Im Annex 2 ging es um die Geografie der interethnischen Trennungslinien zwischen der Republika Srpska und der bosnischen Föderation.
Die Bereiche Annex 3 bis Annex 11 regeln die zivilpolitischen Punkte und Aspekte des Friedensabkommens. In diesem Bereich geht es um die Definition eines neuen administrativen Aufbaus im Land, die von einer neu geschaffenen territorialen Struktur bedingt wird. Die Spielregeln einer staatspolitischen Neuausrichtung wurden auch festgehalten. Im Annex 3 werden die Wahlen im Land geregelt und die Rolle der OSCE bezüglich der Wahlen. Im Annex 4 wurden die neue Landesverfassung und die Rechte der Bevölkerung definiert. Hier wird festgehalten, dass es sich um einen Zentralstaat handelt, welcher jedoch in zwei Entitäten aufgeteilt ist (Republika Srpska und die Föderation Bosnien Herzegowina). Die Föderation besteht mehrheitlich aus ethnischen Kroaten und Bosniern, die Republika Srpska aus ethnischen Serben. Mit diesem Friedensabkommen wurde damit eine dauerhafte Trennung der Entitäten vollzogen. Durch die breitgefächerte politische Infrastruktur in Bosnien wurde die komplexeste und komplizierteste Regierungsform in Europa (womöglich sogar in der Welt) erschaffen.
Im Annex 5 wird in einer Rekordkürze von nicht mal einer halben Seite auf die Schlichtung zwischen den Entitäten eingegangen, indem auf die Paragrafen 2.4 und 3 des Genfer Abkommens von 08.09.1995 hingewiesen wird (Paragraph 2.4.: The two entities will enter into reciprocal commitments (…) to engage in binding arbitration to resolve disputes between them. Paragraph 3.: The entities have agreed in principle to the following: (…) The design and implementation of a system of arbitration for the solution of disputes between the two entities.").{19}
Im Annex 6 werden die Menschenrechte und deren Instanzen zur Wahrung definiert, im Annex 7 die Themenkomplexe Rechte der Flüchtlinge und Vertriebene. Im Annex 8 wird der Erhalt der Nationaldenkmäler formuliert, im Annex 9 die Implementierung von öffentlichen Körperschaften und Punkten zum Thema Wiederaufbau.
Fast am Ende des Friedensvertrages, im Annex 10, wird die Rolle des Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina definiert. Dieser wurde mit Hilfe der UN-Resolution 1031 benannt, mit dem Sitz in Sarajevo (Büro des Hohen Repräsentanten, oder Office of the High Representative, OHR). Der OHR hat dank der sogenannten Bonner Befugnisse aus 1997 weitreichende Vollmachten und kann damit in die nationale Gesetzgebung in Bosnien eingreifen. Er darf notfalls Beamte entlassen oder Gesetze beschließen. Der OHR wird aus einem Gremium der Außenministerien der UN-Mitgliedsstaaten ernannt. Faktisch ist Bosnien durch die Wirkung des OHR innerhalb der Regierung kein selbstständiger Staat.{20}
Im Annex 11 wird abschließend die Rolle der internationalen Polizei und deren Präsenz im Land geklärt, des Weiteren die Einrichtung der UNCIVPOL, auch als U.N. International Police Task Force (IPTF) bekannt. Der OHR wird durch die IPTF unterstützt.
Rückblickend bleibt es festzuhalten, dass die militärischen Forderungen aus dem Friedensabkommen (Annex 1-A, 1-B, 2) umgesetzt worden sind, so dass es zum Waffenstillstand und Einstellung aller kriegerischen Aktivitäten in Bosnien kam. Anfang 1996 fand in Wien die „Konferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen“ statt. Die Verhandlung zu Abrüstung der Kriegsparteien wurde im Juni 1996 in Florenz abgehalten, die Ergebnisse des Abrüstungsplans wurden (nicht ohne Zwischenfälle aus der Republika Srpska) bis 1997 durchgesetzt.
Die Umsetzung der zivilpolitischen Forderungen aus dem Friedensplan gestaltete sich als kompliziert und langwierig. Die Problematik des Umganges mit den Kriegsverbrechern ist nur eine der vielen Streitpunkte, die bis heute zu Spannungen zwischen den Entitäten führen und damit einen erfolgreichen Abschluss aller Maßnahmen auch 30 Jahre nach dem Abkommen in Dayton vereiteln.
1.4. Studien von Božo Skoko als Erklärungsversuch zur politischen Wechselwirkung der involvierten Ethnien
Quantitative Untersuchungen zu Einstellungen der Konfliktparteien oder deren Feindmuster, wie die von Božo Skoko aus 2009, folgen die Muster einer statistischen Beobachtung, die ohne Hinterfragung der Repräsentativität der Erhebungen eine Stabilität von Einstellungsmustern durch die starre, quantitative Untersuchung präsentieren. Skoko führte seine Erhebung mit einer Stichprobe von 6.087 Befragten zum Thema „Kroatien und ihre Nachbarn“ durch.{21} Befragt worden sind Bürger aus den ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro und Nord-Mazedonien. Ein Kapitel der Befragung beleuchtet die Frage der Schuld an den Balkan-Kriegen der 1990er Jahre. Als diese Umfrage entstand, waren die Kriege bereits seit 14 Jahren beendet. Nach wie vor waren aber die Auswirkungen bei der Bevölkerung spürbar, so dass die ethnischen Spannungen als große Last empfunden worden sind. Dr. Skoko merkte in seinen Ausführungen an, dass die Thematik der retrospektiven Betrachtung der Kriege von zwei unterschiedlichen Einstellungen der Bevölkerung gezeichnet ist: die einen sehen es als Tabu darüber nachzudenken oder zu reden, die anderen instrumentalisieren sie zu einem unüberwindbaren Hindernis auf dem Weg einer möglichen Aufarbeitung der Geschehnisse.
Die Schuldfrage brachte vielfältige Antworten, bei den die höchste Zustimmung die folgenden Antwortmöglichkeiten erhalten haben (Mehrfachnennung möglich):
Die Schuld tragen
damalige jugoslawische Politiker
(sagten von den Befragten 26 % der Bosnier, 45 % der Montenegriner, 38 % der Mazedonier, 10 % der Slowenen, 50 % der Serben)
Die Schuld trägt der damaliger serbischer
Präsident Slobodan Milošević
(sagten von den Befragten 34 % der Bosnier, 25 % der Montenegriner, 29 % der Mazedonier, 28 % der Slowenen, 18 % der Serben)
Die Schuld tragen
generell Serben
(sagten von den Befragten 37 % der Bosnier, 9 % der Montenegriner, 25 % der Mazedonier, 31 % der Slowenen, 4 % der Serben)
Die Schuld trägt die
EU / Westen
(sagten von den Befragten 28 % der Bosnier, 17 % der Montenegriner, 23 % der Mazedonier, 1 % der Slowenen, 36 % der Serben)
Die Schuld trägt der damaliger kroatischer
Präsident Franjo Tudjman
(sagten von den Befragten 23 % der Bosnier, 21 % der Montenegriner, 15 % der Mazedonier, 7 % der Slowenen, 21 % der Serben)
Die weiteren angebotenen Möglichkeiten für die Schuldfrage waren: generell die Kroaten (11 % aller Befragten), der damalige Präsident von Bosnien Alija Izetbegović (11 %), unbekannt/weiß nicht (10 %), eine Kombination von unglücklichen Umständen (9 %), die Muslime / Bosnier (7 %), andere (6 %), die Albaner (5 %), die jugoslawische Volksarmee JNA (5 %). (Siehe Tabelle 1)
Der Vollständigkeit halber wurde eine nachträgliche Erhebung auch in Kroatien durchgeführt mit den gleichen Fragen, die Kroaten sahen für die Schuldfrage zuständig an den ersten zwei Stellen generell die Serben (53 %) und den damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milošević (29 %).
Damit lässt sich festhalten, dass für die Slowenen und Kroaten die Serben (Milošević und die Serben generell) die Schuld tragen; auch für die Mazedonier liegt die Schuld bei den Serben (ehemalige jugoslawischen Politiker, Milošević und die Serben generell). Bei den Bosniern (Serben generell, Milošević, die EU/Westen) und den Serben (ehemalige jugoslawischen Politiker und die EU /Westen) wird die Nennung des Westens deutlich. Betrachten wir die Fakten, dass in Bosnien die Hälfte der Bevölkerung ethnisch gesehen serbisch ist, kann der Tenor „die EU / der Westen trägt die Schuld“ mehrheitlich den Serben zugeordnet werden. 36 % der Serben, und damit jeder dritte Befragte sieht die Schuldigen in der EU / den Westen.
Ein weiterer, durchaus aussagekräftiger Punkt in der Erhebung von Skoko beschäftigt sich mit interethnischen Stereotypen. Verglichen werden z.B. zwei Befragungen, die in Serbien durchgeführt worden sind in 1987 (vor den Kriegen) und 1997 (kurz nach Ende der Kriege). Die Serben sind befragt worden, mit welchen Attributen sie die Kroaten am besten beschreiben könnten. Die Antworten waren (Mehrfachnennung war möglich):
„sie sind ein sauberes Volk“ mit 20 % im Jahr 1987 und
73 %
in 1997
„sie sind intelligent“ mit 19 % im Jahr 1987 und
55 %
in 1997
„sie sind ein kulturelles Volk“ mit 42 % im Jahr 1987 und
66 %
in 1997
„sie sind fleißig“ mit 14 % im Jahr 1987 und
64 %
in 1997
„sie sind ein nicht aufrichtiges Volk“ wurde nur in 1997 erhoben mit 76 %
„sie sind heimtückisch“ wurde nur in 1987 erhoben mit 15 %
„sie mögen keine anderen Völker“ mit 22 % im Jahr 1987 und
74 %
in 1997
„sie sind egoistisch“ mit 18 % im Jahr 1987 und
70 %
in 1997
Es bleibt also anhand der Ergebnisse festzuhalten, dass alles, was die Serben über die Kroaten dachten in 1987, sich bis 1997 gefestigt und verstärkt hatte. Vor allem die negativ mit Kroaten verbundenen Attribute haben sich in der breiten serbischen Bevölkerung etabliert. Dr. Skoko erwähnt hier, dass die einfache, weniger gebildete, ländliche Bevölkerung in Serbien geneigter ist in Stereotypen zu denken. Vor allem serbische Rentner (76 %) und einfache Schichtarbeiter (75 %) definieren ihr Umfeld in Stereotypen.
Bei der Befragung in 1997 in Serbien wurde auch nach „generell unerwünschten Gruppen, die von Serben abgelehnt werden“ gefragt. Eine interessante Mischung aus politischen, sozialen und ethnischen Gruppen wurde aufgelistet. Die Serben lehnten ab (Mehrfachnennung war möglich):
Faschisten (86 %)
HIV-Positive (69 %)
Homosexuelle (65 %)
Alkoholiker (59 %)
Albaner (58 %)
(nichtserbische) Nationalisten (55 %)
Muslime (53 %)
Kroaten (52 %)
Hiernach folgten Geisteskranke, Kommunisten, Monarchisten, Zigeuner, Juden, Invaliden und Jugoslawen. Die Ergebnisse zeigen eine generelle Ablehnung von vielen Randgruppen und Minderheiten, die in Serbien vertreten waren. Minderheiten, Kranke und Suchtkranke, anderen Religionen zugehörige Menschen waren nach den Kriegsjahren weder erwünscht noch geduldet. Dr. Skoko erklärt, dass die meisten Stereotypen in bestimmten Momenten der Geschichte für bestimmte politischen Zwecke kreiert werden. Im Kapitel „Sichtweisen und Stereotypen der serbischen intellektuellen über Kroatien und den Kroaten in der Geschichte“ wird näher auf die Aussagen und Bestrebungen eingegangen, durch Schaffung von Stereotypen den Verlauf der Geschichte beeinflussen zu wollen. Hier sind die Repräsentanten der nationalen intellektuellen Elite und die politischen Führer gleichermaßen Schöpfer von Stereotypen, da sie mit diesem Werkzeug die öffentliche Meinung der Bevölkerung beeinflussen können.
Mit der Pauschalisierung / Dämonisierung eines gesamten Volkes (besser gesagt, zwei Völker: der katholischen Kroaten und der muslimischen „Albaner/Bosnier“, auch beschrieben als die „zwei primären Feinde“) konnte die serbische intellektuelle Elite unterschiedliche Bedrohungsszenarien erschaffen, mit religiösen oder nationalen Kernpunkten. Diesen „feindlichen“ Völkern wird die Souveränität abgesprochen. Die Kroaten werden in der serbischen Literatur des XIX. Jahrhunderts folgendermaßen beschrieben: „serbische Stämme“, „Serben und Kroaten sind ein Volk mit zwei Namen“, „sind keine Kroaten, sondern Serben“, „zum Katholizismus assimilierte Serben“.
Ähnlich wurden Muslime /Bosnier /Albaner als im Laufe der osmanischen Besatzung konvertierte, abtrünnige und damit illoyale Serben betrachtet. Als Beispiel: bei einer Volkszählung in 1948 konnten die bosnischen Muslime, die damals nicht als eigenständige Volksgruppe anerkannt waren, sich lediglich als Serben oder Kroaten eintragen lassen, unter „Serben muslimischer Konfession“ oder „Kroaten muslimischer Konfession“. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die Mehrheit der bosnischen Muslime bei dieser Auswahl dazu entschlossen hatte, sich einer Einordnung zu enthalten.{22} 788.403 Muslime waren „nicht zugeordnet“, lediglich 25.000 wurden als Kroaten und 72.000 als Serben gezählt. Bei dieser Volkszählung entstanden verzerrte Bilder der Ethnien in Bosnien, da sich von 2.5 Millionen erfassten Einwohnern fast 800.000 keiner Ethnie zuordnen ließen. Vor und während der Kriege in den 1990er Jahren zeigten die serbischen und kroatischen Politiker gerne auf diese Ergebnisse und bestritten damit die historische Existenz einer muslimischen Ethnie in Bosnien.
Ähnlich wurde damals in 1948 in den autonomen Gebieten Vojvodina (ehemals ungarische / deutsche Mehrheit) und Kosovo Metohija (albanische Mehrheit) gezählt, in den offiziellen Statistiken wurden weder Ungaren noch Deutsche oder Albaner erfasst oder irgendwie vermerkt, so ergaben sich krumme und nicht repräsentative Zahlen. In der Vojvodina sind von den erfassten 1.663.212 Bewohnern am Ende 560.273 Personen „verschwunden“ und nur 1.102.939 unter einer der wählbaren Ethnien „Serben, Kroaten, Slowenen, Makedonier, Montenegriner, nichtzugeordnete Muslime, Bulgaren, Tschechen, Slowaken“ wiederzufinden.
Die Reste der in 1941 noch gezählten ungarischen und deutschen Mehrheit im Gebiet Bácska (45% Ungaren, 20% Deutsche in der Volkszählung in 1941) waren sieben Jahre später nirgendwo mehr erfasst, dadurch de jure nicht existent. Kurz vor der Volkszählung in 1948 wurden massiv Serben und Montenegriner in die von vertriebenen Deutschen enteignete Häuser umgesiedelt. Dadurch wurde die Vojvodina innerhalb weniger Jahren ethnisch neu umgestaltet.{23} Noch gravierender ist die Lage in der Volkszählungsliste in Kosovo in 1948: aus 727.820 Bewohnern sind 511.973 Menschen und damit die Mehrheit der Bevölkerung nirgendwo erfasst.{24} Die albanische 2/3 Mehrheit – statistisch nicht existent.
Skoko beschreibt drei, durch serbische Intellektuelle geschaffene Arten von Stereotypen: die unterentwickelten „Untermenschen“ (z.B. Albaner), die Politischen- oder Kriegsgegner (mit nur diesen Gruppen zugeschriebenen psychologischen Eigenschaften ergo Dämonisierung oder Dehumanisierung), und als dritte Gruppe der Stereotyp eines kulturell zwar entwickelten Europäers, der aber seine Entwicklung für seine negativen Interessen nutzte (wie z.B. Hitler, oder später (im Augen der Serben) generell alle führenden europäischen Politiker).{25}Obwohl sich die Zeiten mit den Generationswechseln ändern (damit auch die intellektuellen Eliten) hinterlassen sie (wenn wir der Erhebung von Skoko folgen) viele Stereotypen bis heute im kollektiven Bewusstsein der Bevölkerung der ehemaligen jugoslawischen Teilstaaten und beeinflussen damit die gegenwärtige Politik vor allem in Serbien, Kroatien und Bosnien.
Tabelle 1: Schuldfrage Krieg
Die im Gegensatz zu statistischen Untersuchungen (wie die von Skoko) gewählte qualitative Perspektive folgt hingegen der Idee, dass in den einzelnen Generationen, als weitere Parameter neben den sich dynamisch ändernden Subjekten auch Bosnien als Objekt und Wissensgegenstand einer stetigen Änderung unterliegt. Die Wechselwirkung zwischen Objekt und Subjekt sollte daher aus einer dynamischen wissenschaftlichen Perspektive erforscht werden.
2. Agitation, Kriegsdemagogie, nationalistische Ideologeme als Kriegswaffe
2.1. Dämonisierung in der Politik und der orthodoxen Kirche als Auslöser des Dehumanisierungsprozesses
(Alle in diesem Kapitel aufgeführten Aussagen von serbischen Politikern wurden von der Autorin aus den Originalprotokollen der Sitzungen transkribiert und aus dem Serbischen ins Deutsche übersetzt. Die Übersetzung erfolgte zum großen Teil wortgemäß, da am sonsten essenzielle Aussagen fehlgedeutet werden könnten. Aus diesem Grunde sind die Sätze der Abgeordneten getreu der serbischen Sprache teilweise verschachtelt und nicht immer dem deutschen Satzbau getreu niedergeschrieben worden).
Am 14.10.1991, bei einer regulären Sitzung des Parlaments in Bosnien, sendete Radovan Karadžić eine mahnende Botschaft an bosnische Politiker und generell an die nicht-serbische Bevölkerung in Bosnien: „Der Weg, auf den sie Bosnien führen, ist die gleiche Autobahn Richtung Hölle, auf der Slowenien und Kroatien schon gegangen sind. Glauben sie nicht, dass sie Bosnien nicht in die Hölle stoßen werden, und das muslimische Volk vielleicht ins Verschwinden, weil das muslimische Volk sich nicht wehren kann, wenn es hier zum Krieg kommt “.{26}
Der damaliger Bosnischer Präsident, Alija Izetbegović, entgegnete ihn: „Ihr Vortrag, und ihre Art wie sie diesen Vortrag und ihre Aussagen rübergebracht haben, erklärt am besten, wieso wir vielleicht doch nicht in Jugoslawien bleiben möchten. Es erklärt auch wieso andere nicht in so einem Jugoslawien leben möchten. Das Jugoslawien, was Herr Karadžić gerne hätte, gibt es nicht mehr. (…) Diese Drohungen der Serben untergraben die Meinungen über das serbische Volk. Das muslimische Volk wird nicht verschwinden, das sage ich Ihnen, Herr Karadžić“.{27} Nach dieser Aussage verließen alle Abgeordnete der bosnischen Serben demonstrativ den Sitzungssaal.
Am 24.11.1991 kam es zu einer ersten Versammlung des „Klubs der serbischen Repräsentanten aus dem Parlament von Bosnien Herzegowina“ (Klub srpskih poslanika u Skupštini BIH), auch bekannt unter den Namen „Erste Sitzung des Parlaments des serbischen Volkes in Bosnien“ (Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini). Neben den serbischen Politikern waren auch Entsandte der orthodoxen serbischen Kirche anwesend, des weiteren Vertreter der nationalistischen serbischen demokratischen Partei SDS (Srpska Demokratska Stranka), und der selbsternannten serbischen autonomen Gebiete Krajina, Herzegowina, Romanija und Semberija. Der Grund dieser ersten Versammlung im rein serbischen Rahmen wurde bei der feierlichen Eröffnungsrede von Prof. Vojislav Maksimović {28} folgendermaßen beschrieben: „Die jetzige Zeit hat die dramatische Charakteristik einer Ausnahmesituation auf unseren (serbischen) Gebieten und gibt unserer Arbeit im Klub eine andere, viel wichtigere Rolle und Verpflichtung, als die bisherige es war. Eine schwere Phase unserer Arbeit als Mitglieder in Parlament von Bosnien Herzegowina endet mit dem heutigen Tag, es fängt ein neues Zeitalter an, in dem unsere Aufgaben neu definiert und unsere Ziele neu gesteckt werden“ {29}. Heute wissen wir, an diesem Tag erfolgte ein erster radikaler Schritt der serbischen Politiker in Bosnien, in die Richtung der Abspaltung und Gründung eines eigenen Staates, mitten in Bosnien.
Radovan Karadžić sah den stufenweisen Zerfall von Jugoslawien durch zwei Mächte ausgelöst, wie er es bei der Sitzung äußerte: „(…) Die Endphase der Zerstörung von Jugoslawien geht nicht ohne unsere traditionellen Gegner, der großdeutschen Expansion und den heimischen Faschismus. Jetzt ist es vollkommen klar, hinter der Zerstörung von Jugoslawien steht ein großdeutscher Plan. Alles, was in Europa passiert, passiert nach dem gleichen Stereotyp; weil es sich um die gleichen Völker, gleichen Vorhaben und gleichen Pläne Richtung Osten handelt. Europa handelt nun genauso, wie sie in 1939 gehandelt hatte, als Deutschland die Tschechoslowakei verschlungen hatte.
Europa hatte damals die Tschechoslowakei geopfert in der Hoffnung, dass Deutschland danach aufhören würde. Wie wir wissen, hörte Deutschland nicht auf; danach kam Polen an die Reihe, danach brach der zweite Weltkrieg aus. Hoffen wir, dass Jugoslawien (oder mindestens ein Kern Jugoslawiens in Form des serbischen Volkes und ihr zugeneigten Völker) eine härtere Nuss ist als die Tschechoslowakei in 1939. Alles, was innerhalb des Landes passiert (in Bosnien), ist auch nicht unbekannt. Das sind die gleichen Uniformen, die gleichen Persönlichkeiten die damals auch Seite an Seite mit dem faschistischen Deutschland standen. (…) Die großgermanische Macht führt mit Hilfe der Faschisten in Kroatien den Endschlag auf Jugoslawien aus, so wie sie das in 1939 auf die Tschechoslowakei verübt haben. Die westlichen Länder, damals wie jetzt von der Stärke der deutschen Macht eingeschüchtert, opfern Jugoslawien dem großgermanischen Machthunger. Die inländischen zerstörerischen, faschistischen Kräfte üben einen Angriff auf die politische und geistliche Einheit unseres (serbischen) Volkes aus!“. {30}
Innerhalb der nächsten acht Wochen nach der ersten Sitzung erfolgten drei weitere Sitzungen des „Parlaments des serbischen Volkes in Bosnien“. Der Tenor bezüglich der Rolle der EG (Europäische Gemeinschaft) wurde bei diesen Sitzungen deutlich negativ. Prof. Aleksa Buha {31}äußerte bei der 4. Sitzung: „(…) auch wenn dieses Parlament des serbischen Volkes in Bosnien erst seit kurzem existiert, wird es alle Hände voll zu tun haben. Darum kümmern sich unsere Partner in der Regierung aber auch die Vertreter der muslimischen und kroatischen Gemeinschaft. Dem Ruf der europäischen Minister folgend verlieren sie nicht nur den politischen Verstand, sondern vergessen auch noch jegliche bis jetzt wichtige Regel der gegenseitigen Rücksichtnahme. Vom Versprechen geblendet, das es ausreicht, rechtzeitig die Dokumente der Selbstständigkeitserklärung einzureichen (auch wenn diese auf falschen Grundlagen basieren), vergessen einige von ihnen, wer sie sind und wo sie sind. (…)
Die Stellungnahme der EG hat den Machthunger einiger nur erhöht und neue Unruhe in die Situation gebracht. Wie könnte es denn anders sein, hatte doch die EG vielen mehr geboten, als in den gewagtesten Träumen möglich wäre. Natürlich alles auf Kosten von anderen (auf Kosten von Jugoslawien), vor allem auf Kosten des serbischen Volkes, nicht auf eigene Kosten. Wegen der politischen Aggression der EG (…) und wegen des direkten Angriffes auf das serbische Volk in Jugoslawien müssen wir in dieser Versammlung die Deklaration der EG (über die Zulassung der Einreichung der Dokumentation für die Anerkennung der Selbständigkeit von Bosnien) ablehnen und entschieden dagegen protestieren (…) die EG generiert mit ihrer Haltung neue Zusammenstöße in Jugoslawien. (…) Ich kann es nicht kommentarlos stehen lassen; wenn die europäischen Länder schon die Rechte von anderen nicht achten, sollte man sie an die Worte eines großen Deutschen und Antifaschisten erinnern: „wenn Deutschland nicht europäisch gemacht wird, wird Europa deutsch gemacht“. Man sollte sie warnen: wenn sich die EG als Institution sieht, die diesen politischen und wirtschaftlichen Riesen (Deutschland) bei Vernunft halten sollte, wie lange werden sie nach all diesen Erfahrungen noch bereit sein dies zu tun“.{32}
Miodrag Simović {33}ergänzte: „Die EG hatte mit ihrer Deklaration keine gute Tat für unser Land erwiesen, weil sie in einem „Bündel der guten Taten“ die Zerstörung unseres Landes angeboten hatte. Eines Landes, für deren Gründung und in deren Fundament Millionen Menschenopfer investiert worden sind“.{34}
Rabija Šubić {35}





























