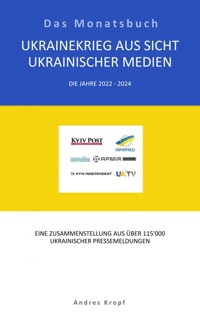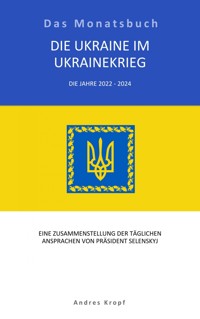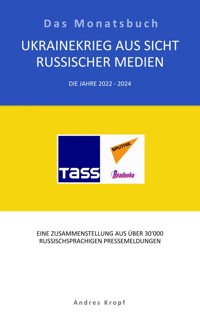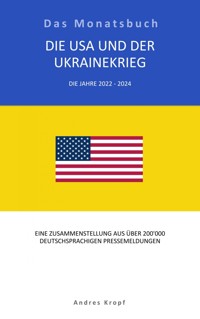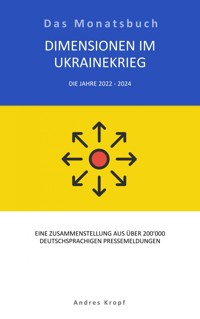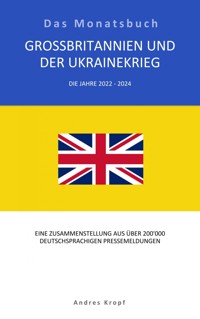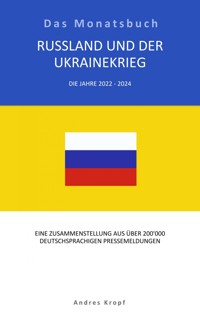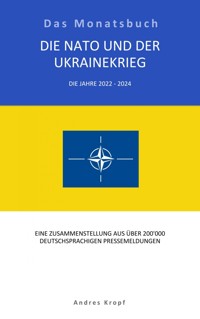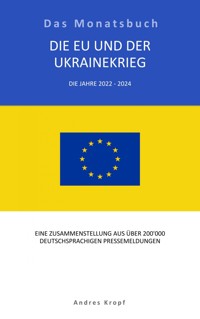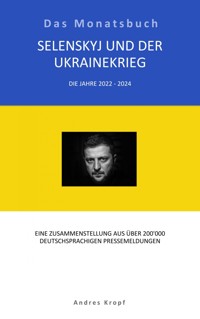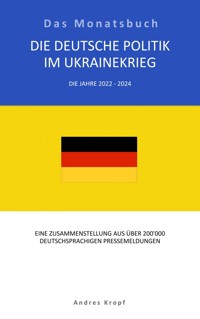
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure. Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen. Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der deutschen Ukraine-Politik seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200'000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet. Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure.
Die Publikationsreihe «Das Monatsbuch» fordert auf, die Informationsflut der Medien nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern als Ausgangspunkt für eine eigene differenzierte Analyse zu nutzen. Sie ermutigt den Leser, aktuelle Nachrichten nicht nur zu konsumieren, sondern im Kontext zugrunde liegenden Interessen und politischen Agenden zu verstehen, und eigenständig zu bewerten.
Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen.
Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der deutschen Ukraine-Politik seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200’000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien sowie zwei renommierte schweizerisches Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet.
Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung der NATO-Rolle und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
In der digitalen Ära prägt die mediale Berichterstattung massgeblich die öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindung. Die Art der Nachrichtenpräsentation kann gezielt zur Steuerung von Narrativen und zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses eingesetzt werden. Propaganda ist die systematische Verbreitung von Informationen zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Sie wirkt sowohl in Kriegszeiten als auch im Alltag durch verschiedene Manipulationstechniken:
Die emotionale Ansprache nutzt gezielt Ängste, Hoffnungen oder Wünsche, um Reaktionen zu steuern.
Die bewusste Wahl von Begriffen und Bildern beeinflusst die Wahrnehmung komplexer Sachverhalte - beispielsweise erzeugen die Bezeichnungen «Flüchtling» oder «Asylant» unterschiedliche emotionale Resonanz.
Desinformation verbreitet gezielt irreführende oder falsche Informationen, um bestimmte Narrative zu stützen.
Die kontinuierliche Wiederholung von Botschaften verstärkt deren Wirkung und fördert ihre Akzeptanz als vermeintliche Wahrheit.
Die Berichterstattung zum Irakkrieg 2003 demonstrierte beispielhaft die Macht medialer Meinungsbildung: Basierend auf nicht verifizierten Geheimdienstinformationen berichteten führende Medien über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen. Diese später widerlegte Darstellung diente als zentrale Rechtfertigung für die militärische Intervention.
Diese Art von Beeinflussung zeigt, wie wichtig es ist, kritisch mit Informationen umzugehen. Folgende Tipps können helfen, sich davor zu schützen:
Systematische Prüfung von Quellen und Kontexten
Nutzung verschiedener Informationskanäle für eine ausgewogene Perspektive
Faktentreue Verifizierung wichtiger Informationen
Bewusstsein für emotionale Beeinflussungsversuche
Impressum
Texte: © Copyright Andres Kropf
Andres KropfHöheweg 3eCH-3053 Münchenbuchsee (Schweiz)[email protected]
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 BerlinKontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Februar 2022+++ Sicherheitspolitische Zeitenwende +++
Die über Wochen eskalierende Spannungssituation zwischen Russland und der Ukraine gipfelte in einem offenen militärischen Angriff Russlands auf seinen Nachbarstaat - ein Ereignis, das die deutsche Politik vor grundlegende Richtungsentscheidungen stellte und einen tiefgreifenden Wandel in der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik einleitete.
Zu Beginn des Monats stand noch die Diplomatie im Vordergrund. Kanzler Scholz versuchte, eine vermittelnde Rolle in der Krise einzunehmen und reiste zunächst nach Washington, um sich mit US-Präsident Biden abzustimmen. Vor diesem Treffen wurden in Deutschland die Rufe nach deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine immer lauter, doch die Bundesregierung hielt zunächst an ihrer ablehnenden Haltung fest. Während des Besuchs bei Biden im Weissen Haus drohte der US-Präsident Russland mit dem Aus für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 im Falle einer Eskalation. Scholz selbst vermied jedoch eine klare Positionierung zu diesem Thema, was ihm sowohl aus den eigenen Reihen als auch von der Opposition Kritik einbrachte. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil verteidigte hingegen die zurückhaltende Kommunikationsstrategie des Kanzlers.
Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen Scholz und Putin fand am 15. Februar in Moskau statt. Beide Staatsmänner setzten nach dem Gespräch auf Dialog, doch die Situation blieb angespannt. Scholz wies während seines Besuchs Putins Behauptung zurück, in der Ostukraine finde ein "Genozid" statt - eine Aussage, die bereits als möglicher Vorwand für eine militärische Intervention gedeutet wurde. Nach seiner Rückkehr schätzte der Kanzler die Lage als "schwierig, aber nicht aussichtslos" ein.
Im Rahmen seiner diplomatischen Bemühungen sicherte Scholz dem Baltikum deutsche Unterstützung zu und stellte eine Truppenverstärkung in der Region in Aussicht. Verteidigungsministerin Lambrecht kündigte die Entsendung zusätzlicher Soldaten nach Litauen an. Der Kanzler lud zudem den französischen Präsidenten Macron und den polnischen Präsidenten Andrzej Duda zu Ukraine-Gesprächen ins Kanzleramt ein, um die europäische Diplomatie zu koordinieren.
Mitte Februar reiste Scholz nach Kiew, wo er der Ukraine finanzielle Unterstützung in Höhe von 150 Millionen Euro zusagte. Bei der anschliessenden Pressekonferenz betonte er: "Niemand sollte an der Entschlossenheit Deutschlands zweifeln." Dennoch forderte die ukrainische Regierung weiterhin Waffenlieferungen aus Berlin, was die Bundesregierung nach wie vor ablehnte.
Die Spannungen nahmen jedoch rasch zu: Am 21. Februar erkannte Putin die selbsternannten "Volksrepubliken" in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten an. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann bezeichnete die Rede des russischen Präsidenten als "Kriegserklärung". Bundeskanzler Scholz verurteilte die Überlegungen zur Anerkennung der Separatistengebiete scharf und warnte, Putin suche einen Vorwand zur Besetzung der ganzen Ukraine.
Die Reaktionen auf die Eskalation fielen in Deutschland unterschiedlich aus. Während die AfD-Fraktion Sanktionen gegen Russland ablehnte und teilweise Verständnis für Putins Vorgehen zeigte, forderte die SPD weiterhin eine diplomatische Lösung. CDU-Chef Merz sah die Freiheit in Europa in Gefahr, und Grünen-Chef Nouripour plädierte für schrittweise Sanktionen. Der CDU-Politiker Jürgen Hardt forderte das sofortige Aus für Nord Stream 2.
Am 22. Februar reagierte Bundeskanzler Scholz auf die Anerkennung der Separatistengebiete mit der Aussetzung des Genehmigungsverfahrens für Nord Stream 2. Er bezeichnete die Lage als dramatisch und warnte: "In Europa droht wieder ein Krieg." Wirtschaftsminister Habeck nannte die Pipeline rückblickend "einen Klumpen Risiko" und meinte, es wäre klüger gewesen, Nord Stream 2 gar nicht zu bauen.
Der entscheidende Wendepunkt kam am 24. Februar, als Russland einen grossangelegten Angriff auf die Ukraine startete. Scholz verurteilte die russische Invasion als "eklatanten Bruch des Völkerrechts" und als "Putins Krieg". Er nannte den Tag einen "furchtbaren Tag für die Ukraine und einen dunklen Tag für Europa". Vizekanzler Habeck erklärte, Europa stehe "kurz vor einem massiven Landkrieg".
Die deutsche Regierung kündigte harte Sanktionen gegen Russland an. Finanzminister Lindner versprach "für Russland auch schmerzhafte Sanktionen", und Scholz betonte: "Wir werden die russische Wirtschaft hart treffen." Allerdings verzichtete Deutschland zunächst auf den Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT, was Kritik hervorrief.
Der russische Angriff löste auch eine intensive Debatte über die deutsche Verteidigungspolitik aus. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil verlangte ein Umdenken in der Sicherheitspolitik. Der CDU-Politiker Kiesewetter begrüsste, dass Scholz Nord Stream 2 "begraben" hatte, während AfD-Fraktionschefin Weidel den Stopp der Pipeline kritisierte.
Bemerkenswert war auch die Reaktion des ehemaligen SPD-Kanzlers Schröder, der als Lobbyist für Gazprom tätig war. Er forderte Russland auf, den Krieg schnellstmöglich zu beenden, was jedoch viele als unzureichend empfanden. Die Kritik an Schröders Verbindungen zu russischen Energieunternehmen nahm zu, und SPD-Politiker bezeichneten sein Verhalten als "obszönen Lobbyismus".
Eine wichtige Wende in der deutschen Ukraine-Politik vollzog sich am 26. Februar, als Deutschland entgegen seiner bisherigen Haltung beschloss, doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Der ukrainische Präsident Selenskyj lobte diese Entscheidung mit den Worten: "Weiter so, Kanzler Olaf Scholz."
Die Entwicklungen führten auch zu einer neuen Debatte über den deutschen Energie- und Verteidigungssektor. Selbst bei den Grünen wurden Stimmen laut, die angesichts der Krise den Kohle- und Atomausstieg infrage stellten. Habeck erklärte, es gebe "keine Denktabus" in Energiefragen. Aus der CDU kamen Forderungen nach einer Wiedereinführung der Wehrpflicht, was Verteidigungsministerin Lambrecht jedoch ablehnte.
Der Krieg in der Ukraine löste auch eine grosse Solidaritätswelle in Deutschland aus. Am 27. Februar versammelten sich mindestens 100’000 Menschen in Berlin zu einer Friedensdemonstration. Der litauische Präsident Gitanas Nausėda demonstrierte ebenfalls in Berlin mit den Worten: "Wenn die Ukraine heute fällt, steht Putin morgen vor unserer Tür."
Den historischen Höhepunkt des Monats bildete die Sondersitzung des Bundestags am 27. Februar. In einer wegweisenden Rede verkündete Bundeskanzler Scholz eine "Zeitenwende" in der deutschen Sicherheitspolitik und kündigte ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an. Er bekräftigte zudem den mittlerweile beschlossenen SWIFT-Ausschluss Russlands. Die Ampel-Fraktionen und die Union forderten, weitere Militärhilfen für die Ukraine zu prüfen.
Finanzminister Lindner erklärte sich bereit, für die Bundeswehr neue Schulden aufzunehmen, und kündigte an, Deutschland solle "eine der schlagkräftigsten Armeen in Europa" bekommen. CDU-Chef Merz bot der Regierung Unterstützung in ihrer Russland-Politik an und richtete mahnende Worte an Putin: "Genug ist genug, das Spiel ist aus."
Die beschlossenen Waffenlieferungen an die Ukraine waren nach Angaben von Verteidigungsministerin Lambrecht Ende Februar "bereits auf dem Weg". Der designierte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sah in den Ereignissen eine Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik. Auch international wurde der deutsche Kurswechsel wahrgenommen: Paris lobte Berlin für die angekündigte Erhöhung der Verteidigungsausgaben.
Am letzten Tag des Monats beantragte der ukrainische Präsident Selenskyj die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union, während sich das deutsche Sicherheitskabinett mit der russischen Drohung beschäftigte, Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen.
Der Februar wird als historischer Wendepunkt in die deutsche Geschichte eingehen - ein Monat, in dem die jahrzehntelange deutsche Zurückhaltung in Verteidigungsfragen angesichts der russischen Aggression einer neuen sicherheitspolitischen Realität weichen musste. Die "Zeitenwende"-Rede von Bundeskanzler Scholz markierte das Ende einer Ära der deutschen Nachkriegspolitik und den Beginn eines neuen sicherheitspolitischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik inmitten einer fundamentalen Krise der europäischen Friedensordnung.
März 2022+++ Embargodiskussionen auf Energieimporte aus Russland +++
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine prägte den März in Deutschland fundamental und führte zu tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. Bundeskanzler Scholz sprach von einer "Zeitenwende" und kündigte eine massive Aufrüstung der Bundeswehr an, während Deutschland gleichzeitig mit einer Flüchtlingswelle und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert wurde.
Die SPD musste ihre jahrzehntelange Russlandpolitik kritisch hinterfragen. SPD-Politiker Matthias Platzeck trat vom Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums zurück. Innerhalb der Partei wuchs die Kritik an Altkanzler Schröder wegen seiner engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Putin und seinen Posten bei russischen Energieunternehmen. Schröder verlor vier seiner Mitarbeiter, und Fussball-Bundesligist Borussia Dortmund entzog ihm die Ehrenmitgliedschaft. SPD-Chef Klingbeil stellte fest: "Schröder ist in der SPD komplett isoliert." Die Partei strich ihn sogar aus der Liste grosser Sozialdemokraten. Schröders Ehefrau Soyeon Schröder-Kim sowie seine Ex-Frau Doris Schröder-Köpf verteidigten ihn jedoch öffentlich.
Mitte März unternahm Schröder einen privaten Vermittlungsversuch und reiste nach Moskau, um mit Putin zu sprechen. Diese Initiative wurde von einigen SPD-Politikern begrüsst, vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk jedoch als gescheitert erklärt. In mehreren SPD-Verbänden wurden Anträge auf Parteiausschluss Schröders gestellt. Gesundheitsminister Lauterbach äusserte, Schröder sei ihm "an der Grenze zur Witzfigur" peinlich.
Der Ukraine-Krieg hatte unmittelbare wirtschaftliche Folgen für Deutschland. Finanzminister Lindner (FDP) stellte fest: "Der Rubel ist in freiem Fall." Er kündigte an, "höchstmöglichen Druck auf Russland" ausüben zu wollen und nahm bei den Sanktionen auch Kryptowährungen ins Visier. Als Reaktion auf steigende Energiepreise schlug Lindner einen Tankrabatt vor, der jedoch von führenden Ökonomen und vom Tankstellenverband kritisiert wurde.
Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) warnte vor den Folgen eines sofortigen Embargos auf Energieimporte aus Russland: "Der nächste Winter bereitet mir noch ein bisschen Sorgen." Ende März rief Habeck die Frühwarnstufe des Notfallplans für die Gasversorgung aus, nachdem Russland die Bezahlung von Gas in Rubel gefordert hatte. Er bezeichnete dies als Vertragsbruch und erklärte: "Wir müssen uns von der Klammer russischer Importe befreien." Deutschland könne bis Jahresmitte die Ölimporte aus Russland halbieren und bis Herbst unabhängig von russischer Kohle werden.
Die G7-Staaten lehnten laut Habeck die Energiezahlung in Rubel ab. Scholz bekräftigte in einem Telefonat mit Putin: "Das ist so, das wird auch so bleiben", bezüglich der Bezahlung in Euro oder Dollar. Bei einem weiteren Gespräch versicherte Putin, dass die Umstellung auf Rubel keine Nachteile bringen solle.
Besonders kontrovers diskutiert wurde die Frage eines vollständigen Energie-Embargos gegen Russland. Während CDU-Aussenpolitiker Röttgen und der frühere Bundestagspräsident Schäuble einen sofortigen Stopp russischer Öl- und Gaslieferungen forderten, warnte Scholz: "Ein Importstopp von russischem Gas würde Hunderttausende Jobs gefährden" und könnte zu einer Wirtschaftskrise führen. Habeck räumte ein, ein Energie-Embargo könnte den Krieg möglicherweise "in drei Tagen beenden", sah aber die Gefahr von Hamsterkäufen bei einem abrupten Lieferstopp.
Die militärische Unterstützung der Ukraine war ein weiteres zentrales Thema. Verteidigungsministerin Lambrecht (SPD) kündigte die Lieferung von 2’000 Panzerfäusten an die Ukraine an und verteidigte später die Geheimhaltung der Waffenlieferungen. Der ukrainische Botschafter Melnyk kritisierte jedoch, dass eine Waffenbestellung seit einem Monat ohne Antwort geblieben sei. Er forderte zudem die Lieferung schwerer Waffen und Patriot-Flugabwehrsysteme.
Am 17. März wandte sich der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videobotschaft an den Bundestag. Er forderte Deutschland auf, "eine Führungsrolle zu übernehmen" und mehr Unterstützung zu leisten. Selenskyj zog Parallelen zur Berliner Mauer und forderte: "Zerstören Sie diese Mauer." Nach der Rede ging der Bundestag ohne Aussprache zur Tagesordnung über, was auf Kritik stiess. Später räumte Scholz ein, dass der Verzicht auf eine Debatte "nicht richtig" gewesen sei.
Die Frage nach einem möglichen NATO-Eingreifen in den Konflikt wurde wiederholt diskutiert. Scholz schloss konsequent einen Militäreinsatz der NATO aus. CDU-Chef Merz schwankte in seiner Position: Zunächst schloss er einen NATO-Einsatz nicht mehr aus, besonders bei Angriffen auf Atomkraftwerke, später warnte er jedoch vor einem "Hineingezogenwerden" der NATO in den Krieg. Der russische Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja, bei dem laut Scholz ein Verwaltungsgebäude in Brand geriet, hatte die Debatte angefacht.
In einem Telefonat mit Putin warnte Scholz vor dem Einsatz biologischer oder chemischer Waffen, was er als "Sakrileg" bezeichnete. Bemerkenswert war auch Scholz' klare Warnung an Putin bezüglich eines möglichen Angriffs auf NATO-Staaten: "Wage es nicht." Gleichzeitig stellte er klar, dass weder die NATO noch US-Präsident Biden einen Regimewechsel in Russland anstrebten.
Die massive Fluchtbewegung aus der Ukraine stellte Deutschland vor grosse Herausforderungen. Berlin wurde zum zentralen Ankunftsort: Täglich trafen bis zu 13’000 Geflüchtete am Berliner Hauptbahnhof ein. Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping erklärte: "Wir gehen für die ganze Bundesrepublik in Vorleistung." Ende März wurde der frühere Flughafen Tegel als Ankunftszentrum in Betrieb genommen.
Bundesinnenministerin Faeser (SPD) setzte sich für eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Deutschlands ein, lehnte aber die von der Union geforderte Registrierung aller Flüchtlinge ab. Berlin begann, Geflüchtete auf andere Bundesländer zu verteilen. Bundesaussenministerin Baerbock (Grüne) kündigte den Aufbau von Logistikdrehkreuzen an, um die Flüchtlinge in der EU zu verteilen. Sie sicherte auch ukrainischen Journalisten und Künstlern Hilfe zu, während Bundesgesundheitspolitiker Janosch Dahmen (Grüne) eine Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in die gesetzliche Krankenversicherung vorschlug.
Bundespräsident Steinmeier besuchte das Ankunftszelt für ukrainische Kriegsflüchtlinge am Berliner Hauptbahnhof und dankte den zahlreichen Helferinnen und Helfern. Ende März lud er gemeinsam mit den Berliner Philharmonikern zu einem Solidaritätskonzert für die Ukraine ein. Der Bundestag gedachte mit einer Schweigeminute des Holocaust-Überlebenden Boris Romantschenko, der bei einem Luftangriff in Charkiw getötet worden war.
Die Deutsche Bahn setzte Sonderzüge für Ukrainer ein, die zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) pendelten, und brachte Containerzüge mit Hilfsgütern auf den Weg in die Ukraine. In Berlin engagierten sich zahlreiche Freiwillige für die Flüchtlingshilfe, und Tierärzte kümmerten sich um die Haustiere der Geflüchteten.
Die Europäische Union und deren Rolle im Ukraine-Konflikt war ein wichtiges Thema. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen traf mit Scholz zusammen und stellte die Ukraine auf einen langwierigen Prozess zum möglichen EU-Beitritt ein. Die EU leitete die Prüfung des ukrainischen Antrags auf einen Beitritt ein, machte jedoch keine Zusagen für einen raschen Beitritt. SPD-Chef Klingbeil sprach sich hingegen für eine schnelle Aufnahme der Ukraine in die EU aus.
Die Kaukasus-Republik Georgien beantragte ebenfalls die Aufnahme in die EU. Scholz und der österreichische Bundeskanzler sprachen sich für eine schnellere EU-Anbindung des westlichen Balkans aus.
Die EU beschloss weitere Sanktionen gegen Russland, darunter Massnahmen gegen russische Politiker und Oligarchen. China könnte laut EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell eine Schlüsselrolle zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zukommen. Ende März fand ein virtuelles Gipfeltreffen zwischen China und der EU statt.
Zum angekündigten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr erklärte FDP-Generalsekretär Djir-Sarai "Die Bundeswehr muss eine der schlagkräftigsten Armeen in Europa werden." Die SPD-Linke lehnte zunächst die Militärpläne von Kanzler Scholz ab, trug sie später aber mehrheitlich mit.
Verteidigungsministerin Lambrecht besuchte Soldaten in Rumänien und bekräftigte bei einem Besuch in Washington eine neue Rolle Deutschlands in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Sie versprach, die Bundeswehr-Mittel sparsam einzusetzen: "Kein Kaufrausch". Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann verteidigte Lambrecht gegen Kritik und stellte fest, die Beschwichtigungspolitik sei "komplett gescheitert".
Ende März erwog Scholz den Kauf eines neuen Raketenschutzschirms für Deutschland und bestätigte entsprechende Pläne. Sowohl CDU-Chef Merz als auch SPD-Chefin Esken sprachen sich für den Kauf einer Raketenabwehr aus. Ein Unions-Verteidigungsexperte forderte ein neues Raketenabwehrsystem, und die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger befürwortete den Ausbau und die Modernisierung eines Flugabwehrsystems der Bundeswehr. Strack-Zimmermann hielt die Lieferung eines Luftabwehrsystems durch Israel für möglich.
Gegen die Aufrüstungspläne formierte sich jedoch auch Widerstand: Hunderte Prominente und Politiker stellten sich mit einem offenen Brief gegen Scholz' Rüstungspläne. Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse forderte die Friedensbewegung angesichts des russischen Angriffs zum Umdenken auf.
Die AfD positionierte sich gegen die Mehrheit im Bundestag: Sie kritisierte Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland und rang um Distanzierung zu Russlands Krieg. Der Sprecher der Grünen Jugend warnte vor Aktionismus.
Die deutsche Diplomatie war intensiv: Scholz telefonierte mehrfach mit Putin und drängte ihn zu einer sofortigen Waffenruhe. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron forderte er Putin in einem Telefonat auf, den "Blutvergiessen in der Ukraine" ein Ende zu setzen. US-Präsident Biden beriet sich in einer spontanen Schalte mit Scholz, Macron und dem britischen Premierminister Boris Johnson.
Scholz reiste zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei und forderte gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan einen sofortigen Waffenstillstand. Er traf sich mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett, der zuvor in Moskau war, und vereinbarte einen engen Austausch.
Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, war nach einem Gespräch mit Scholz enttäuscht. Ein Selenskyj-Berater kritisierte Scholz' "Unentschlossenheit". Wladimir Klitschko, Bruder des Bürgermeisters von Kiew, besuchte Berlin und traf sich mit Vizekanzler Habeck.
Die deutsch-russischen Beziehungen waren auf einem Tiefpunkt. Der Berliner Senat wollte dennoch an der Städtepartnerschaft mit Moskau festhalten. Im Berliner Tiergarten wurden Weltkriegspanzer am Sowjetischen Ehrenmal mit ukrainischen Fahnen verhüllt.
Der frühere Vertreter der Heinrich-Böll-Stiftung in Kiew, Sergej Sumlenny, trat aus Protest gegen die deutsche Aussenpolitik bei den Grünen aus. Deutschlands östliche Partner verloren die Geduld mit Berlins Russlandpolitik.
Finanzminister Lindner warnte vor übertriebenen Erwartungen an Wirtschaftshilfen des Staates in der Ukraine-Krise, sagte aber der Ukraine langfristige Hilfe beim Wiederaufbau zu. Er bezifferte ein Entlastungspaket auf rund 17 Milliarden Euro. Habeck erwog, einen 150 Milliarden Euro schweren Coronafonds für den Ukrainekrieg umzuwidmen.
Insgesamt markierte der März 2022 einen fundamentalen Wandel in der deutschen Politik. Die "Zeitenwende" führte zu einer Neubewertung der Beziehungen zu Russland, einer massiven Aufrüstung der Bundeswehr und einer verstärkten Rolle Deutschlands in der europäischen Sicherheitspolitik. Die Aufnahme und Integration der ukrainischen Flüchtlinge stellten eine grosse humanitäre Herausforderung dar, während die wirtschaftlichen Folgen des Krieges zunehmend spürbar wurden.
April 2022+++ Balanceakt zwischen Waffen, Sanktionen und Energieabhängigkeit +++
Der April 2022 stand ganz im Zeichen der deutschen Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der die gesamte deutsche Politik erschütterte und zu heftigen Diskussionen um Waffenlieferungen, Energieembargos und die historische Verantwortung Deutschlands führte.
Zu Beginn des Monats dominierten die Berichte über die Gräueltaten in Butscha die Schlagzeilen. Bundeskanzler Scholz verurteilte das "Massaker" scharf und machte das russische Militär für die Kriegsverbrechen verantwortlich. "Russische Soldaten haben Massaker an Zivilisten verübt", erklärte Scholz und kündigte als Konsequenz weitere Sanktionen gegen Russland an. Die Europäische Union betonte ihre Unterstützung bei der Untersuchung der mutmasslichen Gräueltaten, während die deutsche Politik kontrovers über die richtigen Konsequenzen diskutierte.
Die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine prägte den gesamten Monat. Während Verteidigungsministerin Lambrecht zunächst die Lieferung deutscher Schützenpanzer verweigerte, forderten immer mehr Stimmen aus FDP und Grünen eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine. Anton Hofreiter (Grüne) und Strack-Zimmermann (FDP) wurden zu den schärfsten Kritikern der zögerlichen Haltung des Kanzlers. "50 Jahre meiner politischen Agenda haben sich in Luft aufgelöst", bekannte FDP-Vize Kubicki angesichts des Krieges.
Mitte April spitzte sich der Konflikt innerhalb der Ampel-Koalition zu. Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, kritisierte: "Es wäre schön, der Kanzler würde sein Schweigen brechen" und deutlicher kommunizieren, welche Waffen Deutschland liefern wolle. Auch Hofreiter verschärfte den Ton: "Das Problem ist im Kanzleramt." Die Grünen-Spitze ging jedoch auf Distanz zu Hofreiter und verteidigte Scholz.
Ein diplomatischer Eklat ereignete sich, als der ukrainische Präsident Selenskyj einen geplanten Besuch von Bundespräsident Steinmeier in Kiew ablehnte. Wirtschaftsminister Habeck bezeichnete dies als "diplomatischen Fehler" und betonte: "Die Ausladung Steinmeiers ist auch eine Ausladung Deutschlands." Die Absage wurde mit Steinmeiers früherer Russland-Politik als Aussenminister begründet.