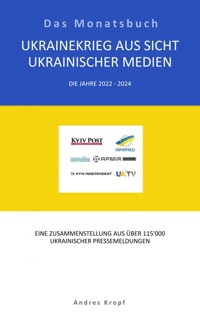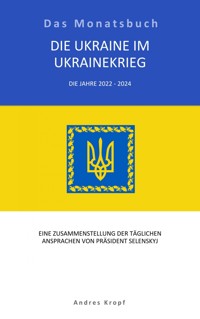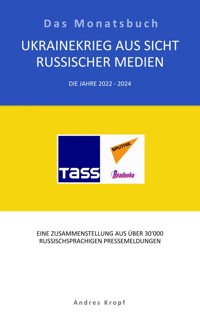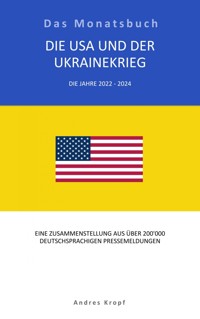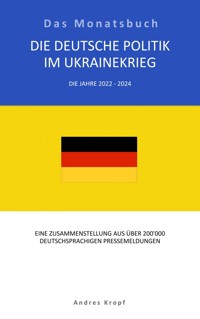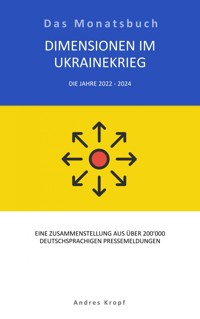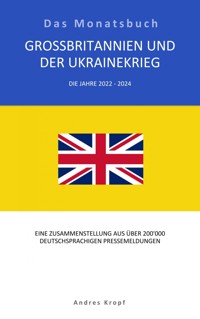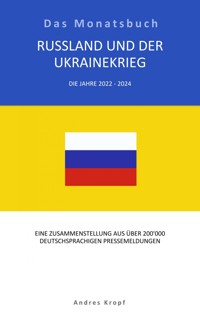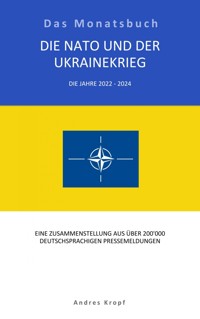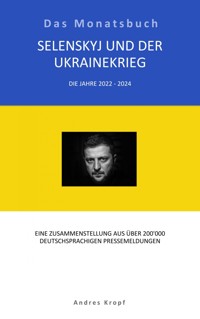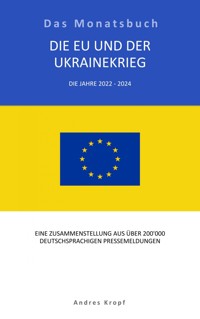
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure. Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen. Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle der EU seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200'000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet. Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 68
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure.
Die Publikationsreihe «Das Monatsbuch» fordert auf, die Informationsflut der Medien nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern als Ausgangspunkt für eine eigene differenzierte Analyse zu nutzen. Sie ermutigt den Leser, aktuelle Nachrichten nicht nur zu konsumieren, sondern im Kontext zugrunde liegenden Interessen und politischen Agenden zu verstehen, und eigenständig zu bewerten.
Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen.
Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle der EU seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200’000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien, sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet.
Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
In der digitalen Ära prägt die mediale Berichterstattung massgeblich die öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindung. Die Art der Nachrichtenpräsentation kann gezielt zur Steuerung von Narrativen und zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses eingesetzt werden. Propaganda ist die systematische Verbreitung von Informationen zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Sie wirkt sowohl in Kriegszeiten als auch im Alltag durch verschiedene Manipulationstechniken:
Die emotionale Ansprache nutzt gezielt Ängste, Hoffnungen oder Wünsche, um Reaktionen zu steuern.
Die bewusste Wahl von Begriffen und Bildern beeinflusst die Wahrnehmung komplexer Sachverhalte - beispielsweise erzeugen die Bezeichnungen «Flüchtling» oder «Asylant» unterschiedliche emotionale Resonanz.
Desinformation verbreitet gezielt irreführende oder falsche Informationen, um bestimmte Narrative zu stützen.
Die kontinuierliche Wiederholung von Botschaften verstärkt deren Wirkung und fördert ihre Akzeptanz als vermeintliche Wahrheit.
Die Berichterstattung zum Irakkrieg 2003 demonstrierte beispielhaft die Macht medialer Meinungsbildung: Basierend auf nicht verifizierten Geheimdienstinformationen berichteten führende Medien über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen. Diese später widerlegte Darstellung diente als zentrale Rechtfertigung für die militärische Intervention.
Diese Art von Beeinflussung zeigt, wie wichtig es ist, kritisch mit Informationen umzugehen. Folgende Tipps können helfen, sich davor zu schützen:
Systematische Prüfung von Quellen und Kontexten
Nutzung verschiedener Informationskanäle für eine ausgewogene Perspektive
Faktentreue Verifizierung wichtiger Informationen
Bewusstsein für emotionale Beeinflussungsversuche
Impressum
Texte: © Copyright Andres Kropf
Andres KropfHöheweg 3eCH-3053 Münchenbuchsee (Schweiz)[email protected]
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Strasse 154a, 10997 BerlinKontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Februar 2022+++ Weitreichende Sanktionen gegen Russland +++
Im Februar 2022 dominierten die dramatischen Entwicklungen rund um den russischen Angriff auf die Ukraine und die darauffolgenden EU-Sanktionen gegen Russland die Schlagzeilen. Zu Beginn des Monats forderte der französische Präsident Macron noch "gezielte Sanktionen" der EU gegen Moskau, während die Union zunächst mit konkreten Massnahmen zögerte. Die Diskussion über mögliche Sanktionen intensivierte sich, als Russland die Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannte. Die EU kündigte daraufhin erste Strafmassnahmen an und drohte mit weiteren Konsequenzen.
Die Situation eskalierte rasch, und die EU-Mitgliedstaaten zeigten sich geeint in ihrer Reaktion. EU-Ratspräsident Michel bekräftigte in einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die volle Solidarität der EU mit der Ukraine. Nach den USA kündigten auch Japan und Australien Sanktionen gegen Russland an. Die EU plante zunächst Sanktionen gegen hochrangige russische Regierungsmitglieder, darunter Verteidigungsminister Schoigu, während Präsident Putin zunächst noch von direkten Sanktionen ausgenommen wurde.
Mit dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine reagierte die EU mit einem umfassenden Sanktionspaket. Bei einem Sondergipfel einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf weitreichende Massnahmen, die darauf abzielten, es dem Kreml "so schwer wie möglich zu machen, seine aggressive Politik zu finanzieren". Die Sanktionen zielten insbesondere auf den Zugang Russlands zu den europäischen Finanzmärkten ab.
In einer bedeutenden Eskalation der Massnahmen beschloss die EU, die Vermögenswerte von Präsident Putin und Aussenminister Lawrow einzufrieren. Diese Entscheidung wurde kurz darauf auch von der US-Regierung übernommen. Die EU brach damit ein diplomatisches Tabu, da es ungewöhnlich ist, aktive Staatsoberhäupter direkt zu sanktionieren.
Gegen Ende des Monats verschärfte die EU ihre Massnahmen weiter. Russische Banken wurden aus dem Swift-Finanzsystem ausgeschlossen, und die EU beschloss erstmals in ihrer Geschichte, Waffen und Ausrüstung für die Ukraine zu finanzieren. Zudem wurden Sanktionen gegen russische Staatsmedien verhängt. Die Schweiz, die traditionell neutral ist, schloss sich in einer bemerkenswerten Entscheidung den EU-Sanktionen an.
Die EU zeigte sich auch solidarisch bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine, wie der Grünen-Co-Vorsitzende Nouripour hervorhob. Darüber hinaus wurden Gespräche über eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Ukraine in Aussicht gestellt. Am Ende des Monats wurden weitere Sanktionen gegen russische Oligarchen und die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, und auch Belarus wurde mit Sanktionen belegt.
März 2022+++ EU verschärft Sanktionen und unterstützt die Ukraine +++
Zu Beginn des Monats beschloss die EU den Ausschluss von sieben russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT, wobei einige der grössten Institute zunächst ausgenommen blieben. Diese Entscheidung war Teil eines umfassenden Sanktionspakets, das die wirtschaftliche Isolation Russlands zum Ziel hatte.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich in einer emotionalen Rede an das Europäische Parlament und forderte eine EU-Mitgliedschaft seines Landes. Die EU reagierte darauf mit der Einleitung der Prüfung des Beitrittsantrags, dämpfte jedoch gleichzeitig die Erwartungen an einen schnellen Beitrittsprozess. Als unmittelbare Unterstützung beschloss die EU weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Wert von 500 Millionen Euro.
Im Bereich der Medienregulierung verhängte die EU ein sofortiges Verbreitungsverbot für die russischen Staatsmedien RT und Sputnik. Zusätzlich wurden Massnahmen gegen gezielte Desinformation beschlossen. Die EU-Mitgliedstaaten einigten sich auch auf einen vorübergehenden Schutzstatus für ukrainische Kriegsflüchtlinge und entwickelten einen Zehn-Punkte-Plan zur Koordinierung der Flüchtlingsaufnahme.
Die Energieversorgung wurde zu einem zentralen Thema. Die EU präsentierte Pläne zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischen Energieimporten. Konkret wurde das Ziel formuliert, die Gasimporte aus Russland um zwei Drittel zu reduzieren. Die Internationale Energieagentur (IEA) legte einen Zehn-Punkte-Plan vor, der aufzeigte, wie die EU ihre Gasimporte aus Russland schnell drosseln könnte. Als Reaktion darauf wurden Mindestfüllstände für Gasspeicher vorgeschrieben und Vereinbarungen über zusätzliche Flüssiggas-Lieferungen aus den USA getroffen.
Die Sanktionen gegen Russland wurden im Laufe des Monats weiter verschärft. Die EU setzte zusätzliche russische Oligarchen auf die Sanktionsliste, darunter auch den Formel-1-Fahrer Nikita Mazepin. Das Vermögen des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch wurde eingefroren. Polen ging noch weiter und schlug der EU einen vollständigen Handelsstopp mit Russland vor.
Gegen Ende des Monats beschloss die EU die Einrichtung einer neuen militärischen Eingreiftruppe und die Schaffung eines Solidaritätsfonds für die Ukraine. Die EU-Kommission unter Von der Leyen kündigte zusätzliche Flüssiggas-Lieferungen aus den USA an und arbeitete an Plänen für einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine. Auch die Anbindung der Ukraine an das westliche Stromnetz wurde vorangetrieben.
Die EU warf Russland offiziell Kriegsverbrechen und Verstösse gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Als Reaktion auf Putins Forderung, Gaslieferungen künftig in Rubel zu bezahlen, riet der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba der EU, nicht darauf einzugehen. Die EU begann auch mit der Prüfung der «Goldenen Pässe» sanktionierter Russen und verstärkte die Zusammenarbeit mit den G7-Staaten bei der Verfolgung von Oligarchen.
Die einzige verbliebene direkte Eisenbahnverbindung zwischen Russland und der EU war die Strecke St. Petersburg-Helsinki, die zu diesem Zeitpunkt noch in Betrieb war. Die EU-Staaten zeigten sich in dieser Phase des Konflikts weitgehend geschlossen, wie auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte, der die NATO und die EU "zu weiterem gemeinsamen Handeln" gegen die russische Aggression aufrief.
Diese Ereignisse markierten einen historischen Wendepunkt in der europäischen Politik, da die EU eine bisher nicht gekannte Geschlossenheit und Entschlossenheit in ihrer Reaktion auf die russische Aggression.