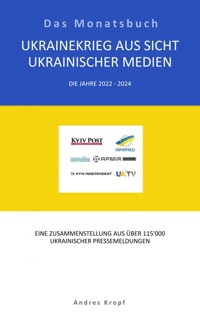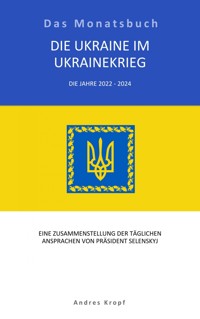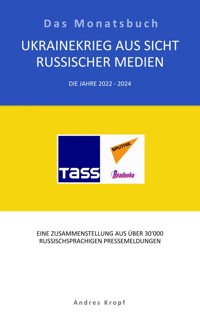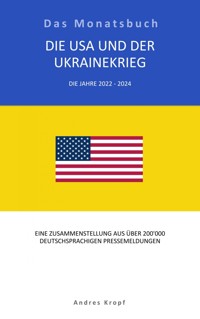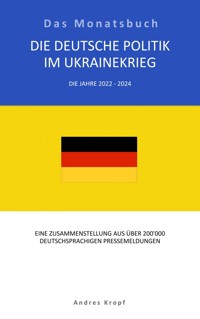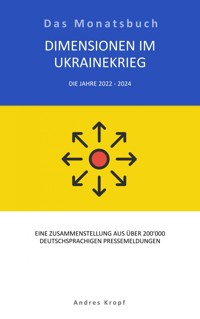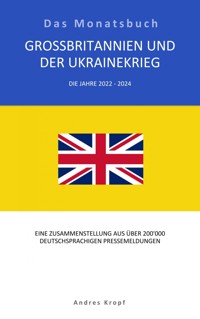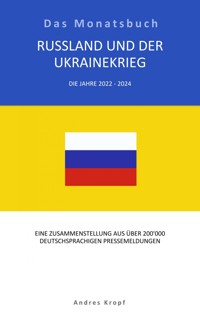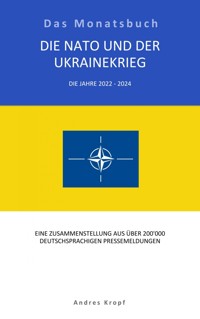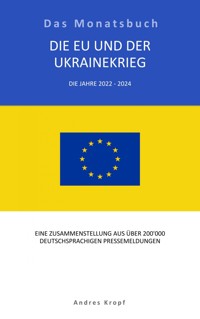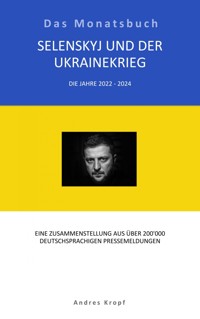
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure. Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen. Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle Selenskyjs seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200'000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet. Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure.
Die Publikationsreihe «Das Monatsbuch» fordert auf, die Informationsflut der Medien nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern als Ausgangspunkt für eine eigene differenzierte Analyse zu nutzen. Sie ermutigt den Leser, aktuelle Nachrichten nicht nur zu konsumieren, sondern im Kontext zugrunde liegenden Interessen und politischen Agenden zu verstehen, und eigenständig zu bewerten.
Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen.
Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle Selenskyjs seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200’000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien, sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet.
Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
In der digitalen Ära prägt die mediale Berichterstattung massgeblich die öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindung. Die Art der Nachrichtenpräsentation kann gezielt zur Steuerung von Narrativen und zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses eingesetzt werden. Propaganda ist die systematische Verbreitung von Informationen zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Sie wirkt sowohl in Kriegszeiten als auch im Alltag durch verschiedene Manipulationstechniken:
Die emotionale Ansprache nutzt gezielt Ängste, Hoffnungen oder Wünsche, um Reaktionen zu steuern.
Die bewusste Wahl von Begriffen und Bildern beeinflusst die Wahrnehmung komplexer Sachverhalte - beispielsweise erzeugen die Bezeichnungen «Flüchtling» oder «Asylant» unterschiedliche emotionale Resonanz.
Desinformation verbreitet gezielt irreführende oder falsche Informationen, um bestimmte Narrative zu stützen.
Die kontinuierliche Wiederholung von Botschaften verstärkt deren Wirkung und fördert ihre Akzeptanz als vermeintliche Wahrheit.
Die Berichterstattung zum Irakkrieg 2003 demonstrierte beispielhaft die Macht medialer Meinungsbildung: Basierend auf nicht verifizierten Geheimdienstinformationen berichteten führende Medien über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen. Diese später widerlegte Darstellung diente als zentrale Rechtfertigung für die militärische Intervention.
Diese Art von Beeinflussung zeigt, wie wichtig es ist, kritisch mit Informationen umzugehen. Folgende Tipps können helfen, sich davor zu schützen:
Systematische Prüfung von Quellen und Kontexten
Nutzung verschiedener Informationskanäle für eine ausgewogene Perspektive
Faktentreue Verifizierung wichtiger Informationen
Bewusstsein für emotionale Beeinflussungsversuche
Impressum
Texte: © Copyright Andres Kropf
Andres KropfHöheweg 3eCH-3053 Münchenbuchsee (Schweiz)[email protected]
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Strasse 154a, 10997 BerlinKontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Februar 2022+++ Von der Friedenshoffnung zum Kriegsausbruch +++
Zu Beginn des Monats Februar 2022 zeigte sich der ukrainische Präsident Selenskyj noch betont gelassen angesichts der wachsenden Kriegsgefahr. Er versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen und erklärte öffentlich, dass es keinen grossen Krieg gegen die Ukraine geben werde. Diese Haltung irritierte westliche Beobachter, die die Bedrohung durch den russischen Truppenaufmarsch als deutlich ernster einschätzten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hielt Selenskyj eine eindringliche Rede, in der er den Stopp von Nord Stream 2 forderte und "Sicherheitsgarantien" für sein Land verlangte. Er warf Russland die Verletzung der ukrainischen Souveränität vor, betonte aber gleichzeitig: "Wir haben keine Angst vor nichts und niemandem."
Die Situation eskalierte dann dramatisch mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Selenskyj verkündete den Kriegszustand und ordnete eine Generalmobilmachung an. Er rief die Bevölkerung zum Widerstand auf und forderte eine weltweite "Anti-Putin-Koalition". Seine vergeblichen Versuche, Putin telefonisch zu erreichen, dokumentierten den endgültigen Zusammenbruch der diplomatischen Beziehungen. In einer emotionalen Ansprache warnte er vor einem "neuen Eisernen Vorhang" in Europa.
Die persönliche Gefährdung Selenskyjs rückte in den Fokus, als bekannt wurde, dass er von russischer Seite als "Ziel Nummer eins" markiert wurde. Die US-Regierung und die Bundesregierung äusserten grosse Sorge um sein Leben. Selenskyj lehnte jedoch amerikanische Angebote ab, ihn aus Kiew in Sicherheit zu bringen. Stattdessen zeigte er sich demonstrativ in Videoaufnahmen auf den Strassen Kiews mit der Botschaft "Alle sind hier" und "Ich bin hier", was seine Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, in der Hauptstadt zu bleiben.
In der zweiten Monatshälfte intensivierte Selenskyj seine diplomatischen Bemühungen. Er bat den israelischen Ministerpräsidenten Bennett um Vermittlung und forderte die sofortige Aufnahme der Ukraine in die EU. In Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wurde der mögliche EU-Beitritt der Ukraine diskutiert. Selenskyj reichte offiziell den Antrag auf EU-Mitgliedschaft ein. Er verklagte Russland vor dem Internationalen Strafgerichtshof und warf Moskau "Genozid" vor.
Die militärische Lage verschärfte sich zunehmend. Selenskyj meldete mehr als 100’000 russische Soldaten in der Ukraine, betonte aber, dass Kiew und Umgebung unter ukrainischer Kontrolle seien. Besorgniserregend waren Berichte der "Times" über 400 russische Söldner, die nach Kiew geschickt worden sein sollen, um Selenskyj zu ermorden. Trotz der existenziellen Bedrohung setzte der ukrainische Präsident seine Appelle an die internationale Gemeinschaft fort und erklärte: "Jeder von uns ist ein Soldat." Er wandte sich auch direkt an die russische und belarussische Bevölkerung und rief sie zum Protest gegen den Krieg auf.
Eine wichtige diplomatische Entwicklung war die deutsche Entscheidung, der Ukraine doch Waffen zu liefern, was Selenskyj ausdrücklich lobte. Er stimmte ausserdem Gesprächen mit Russland an der belarussisch-ukrainischen Grenze zu, lehnte aber Belarus selbst als Verhandlungsort ab. Zum Monatsende hin hatte sich Selenskyj als zentrale Führungsfigur des ukrainischen Widerstands etabliert und wurde international zunehmend als "Verteidiger der freien Welt" wahrgenommen. Seine Appelle an die EU, die Ukraine als gleichberechtigtes Mitglied aufzunehmen, unterstrichen seinen Wunsch nach einer stärkeren westlichen Integration seines Landes.
März 2022+++ Selenskyjs Kampf um internationale Unterstützung +++
Im März 2022 intensivierte der ukrainische Präsident Selenskyj seine diplomatischen Bemühungen und wandte sich in einer Reihe eindringlicher Videoansprachen an internationale Parlamente und Institutionen. Zu Beginn des Monats sprach er vor dem Europaparlament und bat die EU eindringlich um Hilfe. Er verurteilte den russischen Angriff auf Charkiw als Staatsterrorismus und warnte, dass "das Böse gestoppt werden muss."
Die persönliche Gefährdung Selenskyjs blieb weiterhin akut. Berichten zufolge wurden binnen weniger Tage drei Attentatsversuche auf ihn vereitelt, darunter einer durch eine tschetschenische Einheit. Mutmasslich russische Raketenfragmente verfehlten sein Privathaus. Trotz der Bedrohungslage blieb Selenskyj in Kiew und führte seinen Widerstand fort.
In seiner historischen Rede vor dem US-Kongress zog Selenskyj Parallelen zum Pearl Harbor-Angriff und 9/11, um die Dramatik der Situation zu verdeutlichen. Er bat eindringlich um eine Flugverbotszone oder alternativ um Flugzeuge und Luftabwehrsysteme. Vor dem Deutschen Bundestag erinnerte er an die Berliner Mauer und kritisierte die zögerliche Haltung Deutschlands. Die anschliessende Rückkehr zur Tagesordnung im Bundestag ohne Aussprache sorgte für Kritik, die Bundeskanzler Scholz später als Fehler einräumte.
Selenskyj wandte sich auch an weitere Parlamente und Institutionen, darunter das britische Unterhaus, das kanadische Parlament, die französische Nationalversammlung und die Knesset in Israel. Bei der israelischen Regierung warb er besonders um Raketenabwehrsysteme. In einer Videobotschaft an die Schweiz kritisierte er namentlich den Konzern Nestlé und forderte Banken zum Handeln auf.
Die humanitäre Situation verschärfte sich im März dramatisch. Selenskyj berichtete von einem Bombenangriff auf eine Kinderklinik in Mariupol, den er als Kriegsverbrechen bezeichnete. Er beklagte, dass sich noch hunderte Menschen unter den Trümmern des zerstörten Theaters in Mariupol befänden. Seine Frau Olena Selenska schrieb einen emotionalen offenen Brief, in dem sie dem Kreml "Massenmord an ukrainischen Zivilisten" vorwarf.
In den Friedensverhandlungen zeigte sich Selenskyj zu Kompromissen bereit. Er erklärte, die Ukraine strebe nicht mehr unbedingt einen NATO-Beitritt an und sei bereit, über den Status des Donbass und der Krim zu verhandeln. Gleichzeitig betonte er, dass die Ukraine keine russischen Ultimaten akzeptieren werde. Über mögliche Kompromisse mit Russland wollte er das ukrainische Volk in einer Volksabstimmung entscheiden lassen.
Die militärische Lage blieb angespannt. Selenskyj warnte vor einer russischen Grossoffensive im Osten des Landes und forderte vom Westen wiederholt die Lieferung schwerer Waffen. Er kritisierte die NATO für die Ablehnung einer Flugverbotszone und bat um "ein Prozent der Panzer" der Allianz. In einer symbolträchtigen Aktion besuchte er verwundete Soldaten im Krankenhaus.
Gegen Ende des Monats wurden die russischen Truppen aus der Region um Kiew zurückgezogen, was Selenskyj aber nicht als Entspannung wertete. Er warnte vor einer Verstärkung der russischen Offensive im Donbass und forderte weitere Sanktionen gegen Russland. In einem Interview mit russischen Journalisten, dessen Veröffentlichung der Kreml zu verhindern suchte, kritisierte er den respektlosen Umgang mit gefallenen russischen Soldaten.
Selenskyj entwickelte sich im März zunehmend zu einer globalen Symbolfigur des ukrainischen Widerstands. Internationale Medien bezeichneten ihn als "Churchill in Fleecejacke" und "mutigsten Mann der Welt". Seine täglichen Videoansprachen, oft in olivgrünem T-Shirt vor dem Hintergrund der ukrainischen Flagge, wurden zu einem wichtigen Element der Kriegskommunikation. Der frühere Schauspieler nutzte seine kommunikativen Fähigkeiten, um die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren und den Widerstandswillen seines Volkes zu stärken.
April 2022+++ Zwischen diplomatischen Bemühungen und Kriegsrealität +++
Der Monat begann mit der erschütternden Entdeckung von Gräueltaten in Butscha, woraufhin Selenskyj die Stadt persönlich besuchte und die Geschehnisse als Genozid bezeichnete. In einer emotionalen Reaktion lud er die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy nach Butscha ein, um sich die Folgen ihrer früheren Russland-Politik vor Augen zu führen.
In einer bedeutsamen Rede vor dem UN-Sicherheitsrat stellte Selenskyj die Funktionsfähigkeit der Organisation grundsätzlich infrage und forderte Russlands Ausschluss aus dem Gremium. Er warnte wiederholt vor weiteren russischen Attacken, insbesondere im Donbass und im Süden des Landes, und prangerte an, dass abziehende russische Truppen "ein komplettes Desaster" hinterliessen.