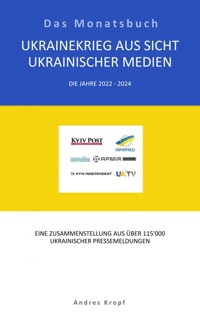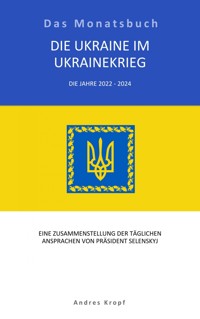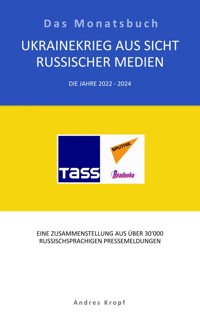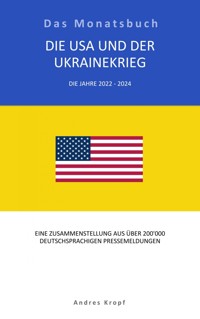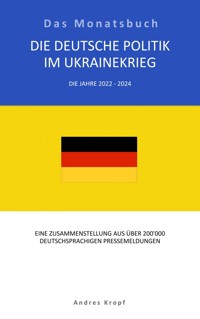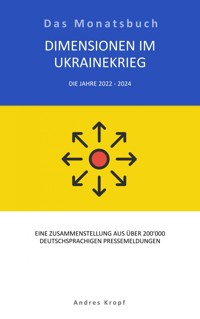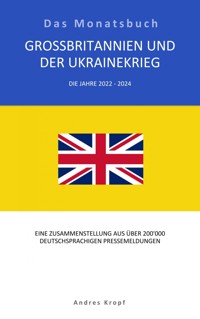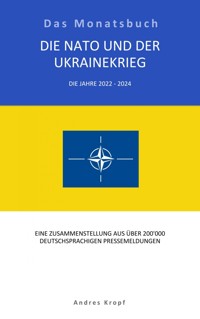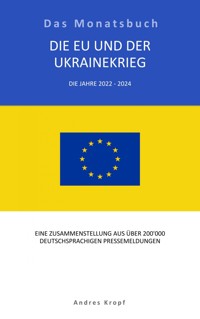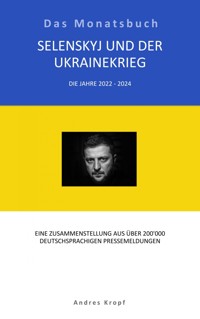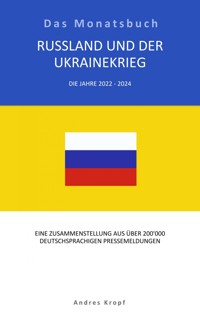
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure. Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen. Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle des Kremls seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200'000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet. Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
«Das Monatsbuch» ist eine Publikationsreihe, die zur kritischen Auseinandersetzung mit der medialen Berichterstattung anregt. Statt die tägliche Informationsflut passiv zu konsumieren, werden die Leser ermutigt, Nachrichten als Ausgangspunkt für eine eigenständige Analyse zu nutzen. Die Informationen sollen im Kontext ihrer Entstehung betrachtet werden: Welche Interessen und politischen Agenden prägen die Berichterstattung? Welche alternativen Perspektiven bleiben möglicherweise unberücksichtigt? Am Beispiel des Ukraine-Krieges zeigt die Reihe, wie eine solche kritische Reflexion zu neuen Erkenntnissen über komplexe politische Dynamiken führen kann. Besonders beleuchtet wird dabei das strategische Zusammenspiel der verschiedenen politischen Akteure.
Die Publikationsreihe «Das Monatsbuch» fordert auf, die Informationsflut der Medien nicht unreflektiert zu übernehmen, sondern als Ausgangspunkt für eine eigene differenzierte Analyse zu nutzen. Sie ermutigt den Leser, aktuelle Nachrichten nicht nur zu konsumieren, sondern im Kontext zugrunde liegenden Interessen und politischen Agenden zu verstehen, und eigenständig zu bewerten.
Die eigene Analyse ermöglicht es, vergangene Berichte aus heutiger Perspektive kritisch zu reflektieren, alternative Sichtweisen zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken am Beispiel des Ukraine-Krieges zu gewinnen.
Diese Ausgabe bietet eine Zusammenstellung zum Teilaspekt der Rolle des Kremls seit Kriegsbeginn, basierend auf einer Selektion aus über 200’000 deutschsprachigen Pressemeldungen. Der Fokus liegt auf der Berichterstattung aus Deutschland, welches als zentraler europäischer Akteur politisch, wirtschaftlich, sozial und militärisch direkt vom Konflikt betroffen war und ist. Als Quellen dienten sieben führende deutsche Medien, sowie zwei renommierte schweizerische Tageszeitungen. Es wurden keine Illustrationen wie Bilder oder Tabellen verwendet.
Die vorliegende Publikation konzentriert sich auf die Entwicklungen seit Februar 2022, ohne die vorhergehende Entstehungsgeschichte des Konflikts zu behandeln. Der Fokus liegt auf der medialen Darstellung und nicht auf einer reinen militärischen Sichtweise.
In der digitalen Ära prägt die mediale Berichterstattung massgeblich die öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindung. Die Art der Nachrichtenpräsentation kann gezielt zur Steuerung von Narrativen und zur Beeinflussung des öffentlichen Diskurses eingesetzt werden. Propaganda ist die systematische Verbreitung von Informationen zur gezielten Beeinflussung der öffentlichen Meinung. Sie wirkt sowohl in Kriegszeiten als auch im Alltag durch verschiedene Manipulationstechniken:
Die emotionale Ansprache nutzt gezielt Ängste, Hoffnungen oder Wünsche, um Reaktionen zu steuern.
Die bewusste Wahl von Begriffen und Bildern beeinflusst die Wahrnehmung komplexer Sachverhalte - beispielsweise erzeugen die Bezeichnungen «Flüchtling» oder «Asylant» unterschiedliche emotionale Resonanz.
Desinformation verbreitet gezielt irreführende oder falsche Informationen, um bestimmte Narrative zu stützen.
Die kontinuierliche Wiederholung von Botschaften verstärkt deren Wirkung und fördert ihre Akzeptanz als vermeintliche Wahrheit.
Die Berichterstattung zum Irakkrieg 2003 demonstrierte beispielhaft die Macht medialer Meinungsbildung: Basierend auf nicht verifizierten Geheimdienstinformationen berichteten führende Medien über angebliche irakische Massenvernichtungswaffen. Diese später widerlegte Darstellung diente als zentrale Rechtfertigung für die militärische Intervention.
Diese Art von Beeinflussung zeigt, wie wichtig es ist, kritisch mit Informationen umzugehen. Folgende Tipps können helfen, sich davor zu schützen:
Systematische Prüfung von Quellen und Kontexten
Nutzung verschiedener Informationskanäle für eine ausgewogene Perspektive
Faktentreue Verifizierung wichtiger Informationen
Bewusstsein für emotionale Beeinflussungsversuche
Impressum
Texte: © Copyright Andres Kropf
Andres KropfHöheweg 3eCH-3053 Münchenbuchsee (Schweiz)[email protected]
Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 BerlinKontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Februar 2022+++ Von Pendeldiplomatie bis zum Angriffskrieg +++
Der Februar 2022 war geprägt von einer dramatischen Eskalation der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die schliesslich in einem offenen Kriegsausbruch mündete. Zu Beginn des Monats standen noch diplomatische Bemühungen im Vordergrund, um eine friedliche Lösung zu finden. Verschiedene westliche Staatsoberhäupter, darunter der deutsche Bundeskanzler Scholz und der französische Präsident Macron, führten intensive Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Diese Verhandlungen fanden vor dem Hintergrund eines massiven russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze statt.
Die erste Monatshälfte war von einer «Pendeldiplomatie» westlicher Politiker gekennzeichnet. Macron reiste nach Moskau und führte lange Gespräche mit Putin, wobei die beiden Staatsmänner aufgrund von Corona-Bedenken einen auffällig grossen Abstand einhielten. Auch Scholz traf Mitte Februar mit Putin in Moskau zusammen. Die westlichen Staaten drohten Russland mit harten Sanktionen für den Fall einer Invasion. Der britische Premierminister Boris Johnson warnte, dass Strafmassnahmen greifen würden, sobald "die erste russische Schuhspitze" ukrainisches Territorium betrete.
Die Situation verschärfte sich dramatisch, als Putin am 21. Februar 2022 die selbsternannten "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" in der Ostukraine als unabhängige Staaten anerkannte. In einer TV-Rede bezeichnete er die Ukraine als "historisches russisches Gebiet" und stellte ihre Eigenstaatlichkeit grundsätzlich infrage. Er ordnete die Entsendung russischer Truppen in diese Gebiete an, was international als klarer Völkerrechtsbruch verurteilt wurde.
Der entscheidende Wendepunkt kam am 24. Februar 2022, als Putin eine grossangelegte Militäroperation gegen die Ukraine befahl. Russische Truppen drangen von mehreren Seiten in das Land ein, während Raketen auf militärische und zivile Ziele abgefeuert wurden. Der ukrainische Präsident Selenskyj verhängte den Kriegszustand und rief zur Bildung einer «Anti-Putin-Koalition» auf. Seine Versuche, Putin telefonisch zu erreichen, blieben erfolglos.
Die internationale Gemeinschaft reagierte mit scharfer Verurteilung und weitreichenden Sanktionen gegen Russland. Die EU und die USA beschlossen Strafmassnahmen, die sich auch direkt gegen Putin und seinen Aussenminister Lawrow richteten. Ihre Vermögenswerte im Westen wurden eingefroren. Die NATO verstärkte ihre Präsenz an der Ostflanke, während gleichzeitig betont wurde, dass man nicht militärisch in der Ukraine eingreifen werde.
In Russland kam es trotz drohender Repressionen zu Antikriegsprotesten, bei denen zahlreiche Menschen festgenommen wurden. Auch international gab es Demonstrationen gegen den Krieg, wie etwa in Berlin vor der russischen Botschaft. Die Auswirkungen des Konflikts waren auch im Sport zu spüren: Die Formel 1 strich den Grossen Preis von Russland und der internationale Judo-Verband suspendierte Putin als Ehrenpräsidenten.
Gegen Ende des Monats erhöhte Putin weiter den Druck, indem er die russischen Atomstreitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzte - ein Schritt, der im Westen als gefährliche Eskalation wahrgenommen wurde. Die ukrainischen Streitkräfte leisteten unterdessen unerwartet starken Widerstand gegen die russische Invasion, wodurch sich der von Putin offenbar erhoffte schnelle Sieg nicht einstellte.
Der Krieg hatte auch unmittelbare wirtschaftliche Folgen, etwa Turbulenzen auf dem Weizenmarkt, da sowohl Russland als auch die Ukraine wichtige Getreideexporteure sind. Die westlichen Sanktionen zielten darauf ab, Russlands Wirtschaft zu schwächen und das "oligarchische System Putin" auszutrocknen. Der Kreml kündigte Gegenmassnahmen an und verbot unter anderem die Ausfuhr von Devisen.
Der Februar 2022 endete damit als einer der dramatischsten Monate der jüngeren europäischen Geschichte, in dem sich die geopolitische Lage fundamental veränderte. Was als diplomatische Krise begann, mündete in den ersten grossen Krieg in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit weitreichenden Folgen für die internationale Ordnung, die Wirtschaft und die Sicherheitsarchitektur Europas.
März 2022+++ Zunehmende Isolierung von der Weltgemeinschaft +++
Die Weltgemeinschaft reagierte mit scharfer Kritik und weiteren Sanktionen gegen Russland und Präsident Putin persönlich.
Zu Beginn des Monats zeigte sich die internationale Ablehnung von Putins Kriegskurs durch symbolische Aktionen: Das Pariser Wachsfigurenkabinett Musée Grévin entfernte die Statue des russischen Präsidenten, der Taekwondo-Weltverband entzog Putin seinen schwarzen Gürtel, und zahlreiche Kultureinrichtungen beendeten die Zusammenarbeit mit kremlnahen Künstlern. So wurde etwa der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, wegen seiner Putin-Nähe entlassen.
Die militärische Situation in der Ukraine verschärfte sich im Laufe des Monats. Russische Truppen intensivierten ihre Angriffe auf wichtige Städte wie Mariupol, Charkiw und Kiew. Besonders kritisch wurde die Lage in Mariupol, wo die Zivilbevölkerung unter katastrophalen humanitären Bedingungen ausharren musste. Die russische Armee setzte dabei auch international geächtete Waffen wie Vakuumbomben und Clustermunition ein. Der Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja und des Holocaust-Mahnmals Babyn Yar sorgte international für Entsetzen.
Die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts blieben weitgehend erfolglos. Zwar kam es zu mehreren Gesprächsrunden zwischen ukrainischen und russischen Delegationen, unter anderem in der Türkei, jedoch ohne durchschlagende Erfolge. Der französische Präsident Macron und andere westliche Staatschefs führten zahlreiche Telefonate mit Putin, konnten aber keine substantiellen Zugeständnisse erreichen. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte wiederholt direkte Gespräche mit Putin, die dieser jedoch ablehnte.
Die westlichen Sanktionen gegen Russland wurden im März 2022 weiter verschärft. Die USA verhängten ein Importverbot für russisches Öl und Gas. Die EU diskutierte intensiv über mögliche Energiesanktionen, konnte sich aber nicht auf ein vollständiges Embargo einigen. Putin reagierte mit der Ankündigung, künftig Gaslieferungen nur noch gegen Bezahlung in Rubel zu akzeptieren, was von den westlichen Staaten als Vertragsbruch zurückgewiesen wurde.
Innerhalb Russlands verschärfte der Kreml die Kontrolle über Medien und Opposition. Ein neues Gesetz stellte die Verbreitung angeblicher "Falschnachrichten" über den Krieg unter Strafe. Unabhängige Medien wie der Radiosender Echo Moskwy wurden geschlossen, soziale Netzwerke wie Facebook blockiert. Dennoch kam es zu Protesten gegen den Krieg, bei denen tausende Menschen festgenommen wurden. Auch prominente Persönlichkeiten wie der frühere Kreml-Berater Anatoli Tschubais kehrten Russland den Rücken.
Die USA und ihre Verbündeten verstärkten ihre militärische Präsenz an der NATO-Ostflanke. US-Präsident Biden bezeichnete Putin mehrfach als "Kriegsverbrecher" und "Schlächter" und löste mit der Äusserung "dieser könne nicht an der Macht bleiben" diplomatische Irritationen aus. Die NATO lehnte die von der Ukraine geforderte Flugverbotszone ab, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden.
Gegen Ende des Monats deutete sich eine mögliche Änderung der russischen Kriegsstrategie an. Nach schweren Verlusten und stockendem Vormarsch kündigte Moskau an, sich auf die "Befreiung" des Donbass zu konzentrieren. Westliche Geheimdienste vermuteten, dass Putin von seinen Beratern nicht vollständig über die militärischen Rückschläge informiert wurde.
Die humanitäre Situation in der Ukraine verschlechterte sich dramatisch. Millionen Menschen flohen vor den Kämpfen, die meisten in die westlichen Nachbarländer. Die EU aktivierte erstmals die «Massenzustrom-Richtlinie», um Geflüchteten unbürokratisch temporären Schutz zu gewähren. Das UN-Welternährungsprogramm warnte vor den globalen Auswirkungen des Krieges auf die Nahrungsmittelversorgung.
Der Krieg führte zu einer bisher nicht gekannten Einigkeit des Westens. Deutschland vollzog unter Bundeskanzler Scholz eine historische Kehrtwende in seiner Verteidigungspolitik und kündigte massive Investitionen in die Bundeswehr an. Auch traditionell neutrale Länder wie die Schweiz schlossen sich den Sanktionen gegen Russland an.
China hielt sich mit Kritik an Russland zurück und betonte seine "felsenfeste Freundschaft" mit Moskau, vermied aber eine zu deutliche Unterstützung Putins. Berichten zufolge hatte China den Kreml gebeten, den Angriff auf die Ukraine erst nach den Olympischen Winterspielen zu beginnen.
Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges und der Sanktionen trafen Russland hart. Der Rubel verlor massiv an Wert, westliche Unternehmen zogen sich in grosser Zahl aus dem Land zurück. Der Kreml räumte ein, dass die Sanktionen einen "schweren Schlag" für die Wirtschaft darstellten, und ergriff Massnahmen wie ein Verbot der Ausfuhr von Fremdwährungen über 10’000 USD.
Zum Monatsende zeichnete sich ab, dass der Krieg in eine neue Phase eintreten könnte. Bei Friedensgesprächen in Istanbul signalisierte Russland Bereitschaft zu einer Reduktion seiner militärischen Aktivitäten um Kiew, während die Ukraine Vorschläge für einen neutralen Status vorlegte. Westliche Beobachter blieben jedoch skeptisch hinsichtlich der russischen Absichten.
Der März 2022 markierte damit eine weitere Eskalation des Konflikts mit weitreichenden geopolitischen Folgen. Die Hoffnungen auf eine schnelle diplomatische Lösung schwanden, während sich die Fronten zwischen Russland und dem Westen weiter verhärteten. Die dramatischen Auswirkungen des Krieges auf die Ukraine, aber auch auf die globale Wirtschaft und Sicherheitsarchitektur, wurden immer deutlicher sichtbar.
April 2022+++ Spekulationen über Putins Gesundheitszustand +++
Die Gräueltaten in der ukrainischen Stadt Butscha führten zu einer weiteren Verschärfung der Sanktionen gegen Russland und persönlich gegen Präsident Putin. US-Präsident Biden bezeichnete Putin mehrfach als "Kriegsverbrecher" und warf ihm später sogar "Völkermord" vor. Die ehemalige UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte forderte einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten.
Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges zeigten wenig Erfolg. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer traf zwar als erster EU-Regierungschef seit Kriegsbeginn Putin in Moskau, kehrte aber mit "keinem optimistischen Eindruck" zurück. Das Gespräch sei "offen und hart" gewesen. Auch UN-Generalsekretär António Guterres reiste Ende April 2022 nach Moskau, um mit Putin über die humanitäre Lage in der Ukraine zu sprechen.
Die russische Kriegsführung änderte ihre Strategie: Nach dem Rückzug aus der Region um Kiew konzentrierte sich der russische Angriff auf den Donbass und die Südukraine. Die Hafenstadt Mariupol wurde zum Symbol des erbitterten Widerstands, wo sich ukrainische Kämpfer im Asow-Stahlwerk verschanzten. Putin ordnete keine Erstürmung, sondern eine vollständige Blockade des Werks an.