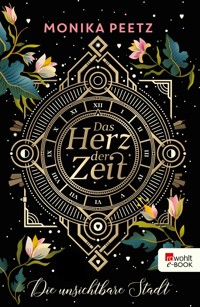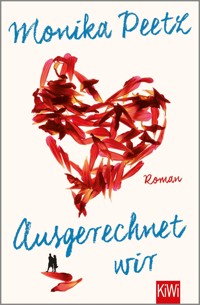Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die-Dienstagsfrauen-Romane
- Sprache: Deutsch
Landlust bei den Dienstagsfrauen – der nächste Bestseller von Monika Peetz Eine für alle, alle für eine: Genervt von schlechter Luft, ewiger Parkplatzsuche und Baulärm vor ihrer Kölner Wohnung beschließt Kiki, mit ihrer zweijährigen Tochter Greta aufs Land zu ziehen. Nicht irgendwohin, nein, Kiki hat natürlich einen Plan: Auf einer Reise durch Mecklenburg-Vorpommern hat sie sich in ein leerstehendes Schulgebäude mit Türmchen verliebt. Und sofort ist ihr klar: Hier will ich hin, hier eröffne ich mein Bed & Breakfast für gestresste Stadtleute wie mich und meine Freundinnen. Auf halber Strecke zwischen Berlin und Hamburg gelegen, entpuppt sich das Haus als eine komplette Bauruine. Drei Wochen vor der Eröffnung muss Kiki einsehen: Sie schafft es nicht alleine. In den Gästezimmern sieht es aus wie Kraut und Rüben, dafür herrscht auf den Beeten, in denen Bio-Gemüse für die Gäste wachsen soll, noch gähnende Leere. Da hilft nur eines: die Dienstagsfrauen-Clique. Statt zur feierlichen Eröffnung reisen sie nun an, um tatkräftig anzupacken. Jede schleppt natürlich ein Stück von ihrem Alltag mit. Außer Caroline, die hat gleich einen Mann im Schlepptau, der ihr allerdings gar nicht geheuer ist …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Peetz
Die Dienstagsfrauen zwischen Kraut und Rüben
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Monika Peetz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Monika Peetz
Monika Peetz ist die Autorin der Bestseller »Die Dienstagsfrauen« und »Sieben Tage ohne«. Beide Romane um die fünf Freundinnen verkauften sich allein im deutschsprachigen Raum über eine Million Mal. Ihre Bücher erscheinen in 24 Ländern und sind auch im Ausland Bestseller. Alle drei »Dienstagsfrauen«-Romane wurden erfolgreich verfilmt mit Ulrike Kriener, Saskia Vester, Nina Hoger, Inka Friedrich u.a.
Monika Peetz ist Jahrgang 1963, sie studierte Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Philosophie in München. Nach Ausflügen in die Werbung und ins Verlagswesen war sie Dramaturgin und Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1998 ist sie Drehbuchautorin in Deutschland und den Niederlanden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Alles muss anders werden: Genervt von schlechter Luft, ewiger Parkplatzsuche und Baulärm vor ihrer Kölner Wohnung beschließt Kiki, mit Max und ihrer einjährigen Tochter Greta aufs Land zu ziehen. Erst vor Kurzem hat sie sich auf einer Reise durch die Mecklenburgische Seenplatte frisch verliebt: in ein leer stehendes Schulgebäude mit Türmchen. Sofort war ihr klar: Hier eröffne ich ein Bed & Breakfast für gestresste Stadtbewohner. Das Haus entpuppt sich allerdings als komplette Bauruine. Drei Wochen vor der Eröffnung muss Kiki einsehen, dass sie es nicht allein schafft. In den Gästezimmern sieht es aus wie Kraut und Rüben, dafür herrscht auf den Beeten, in denen Biogemüse für die Gäste wachsen soll, gähnende Leere. Wie gut, dass die Dienstagsfrauen ihr mit Rat, Tat und unbremsbarem Heimwerkertrieb zur Seite stehen. Statt zur feierlichen Eröffnung reisen die vier Freundinnen an, um kräftig mitanzupacken. Jede bringt ein Stück von ihrem Alltag mit. Außer Caroline, die hat einen Mann im Schlepptau, der ihr nicht geheuer ist.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Kurt Steinhausen
ISBN978-3-462-30742-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
Leseprobe »Ausgerechnet wir«
Für Pia und Paula Rehklau
1
Es hatte so einfach ausgesehen: Türen ausbauen, Schubladen rausziehen, den Korpus aus Birkenholz hochwuchten und dann im Schneckentempo das Treppenhaus nach unten. Schritt für Schritt. Zweiundvierzig Stufen. Von da waren es nur noch ein paar Meter bis zum Umzugswagen.
Die kleine Wohnung, die ewige Parkplatzsuche, Lärm und Abgase: Kiki hatte viele gute Gründe, vom Kölner Eigelstein wegzuziehen. Im Umzugsstress fiel ihr kein einziger mehr ein. Wo blieb Max nur? Wie lange konnte es dauern, Greta zu Oma und Opa zu bringen? Max’ Eltern hatten sich bereit erklärt, am Umzugstag auf ihre siebzehn Monate alte Enkelin aufzupassen. Seit Max das Designstudium abgeschlossen hatte, übernahm er ab und an Aufträge für die Firma seines Vaters. Ein explosives Gegengeschäft.
»Das ist bei denen wie bei Krieg und Frieden«, sagte Kiki immer. »Viel Krieg, wenig Frieden. Waffenstillstand gibt’s bloß, wenn sie auf Greta aufpassen dürfen.«
Die Großeltern Thalberg unterhielten ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Beinahe-Schwiegertochter, die wie ein Blitz in das Leben ihres Sohnes eingeschlagen war. Vermutlich bombardierten sie Max gerade mit gut gemeinten Ratschlägen, um ihn zu überzeugen, sich die Sache mit dem Umzug noch mal zu überlegen.
Kiki war froh, dass die Dienstagsfrauen ihr beim Umzug zur Seite standen. Caroline half Kiki beim schweißtreibenden Abstieg mit Kommode, Eva zerlegte Bücherregale, und Judith verstaute das kunterbunte Sammelsurium von Kikis Besitztümern in Kartons. Nur Estelle, die in ihrem figurbetonten Overall am ehesten nach Möbelpacker aussah, war verschwunden. Höchstwahrscheinlich kontrollierte sie in der Küche, ob der mitgebrachte Champagner bereits die richtige Temperatur für eine Pause hatte.
»Jeder so, wie er kann«, hatte Kiki als Losung ausgegeben.
Estelle konnte nicht viel und wollte noch weniger. Normalerweise täuschte die reiche Apothekersgattin reflexartig familiäre Verpflichtungen vor, bevor jemand das Wort »Umzugshilfe« auch nur ausgesprochen hatte. Seit Stiefsohn Alexander jedoch samt angetrauter Stiefschwiegertochter nach Köln gezogen war, um Estelles Mann bei der Führung des Unternehmens zu unterstützen, erschien ihr jeder Umzug attraktiver als ein Familientreffen.
Von der Straße schallte aufgeregtes Stimmengewirr. Auf dem Bürgersteig diskutierte Zekeriya, Kikis türkischer Nachbar vom Brautmodengeschäft, mit den Besuchern des benachbarten Wettbüros über die zweckdienliche Beladung des Umzugswagens. Eigentlich hatten sich die Wettkönige in spe nur zum Rauchen auf der Straße versammelt. Das hielt sie nicht davon ab, dezidierte Meinungen zu vertreten. Zu wetten gab es an diesem frühen Sonntagmorgen nichts, zu palavern umso mehr. Zekeriya beharrte darauf, Diesel im Blut und deswegen grundsätzlich recht zu haben. Sein Opa, Vater, Bruder, sämtliche Onkel und Schwager verdienten ihr Geld im Im- und Exportgeschäft. Es war ihm eine Ehre gewesen, für Kiki und Max kostengünstig einen Lkw zu organisieren. Außer einem Zehnersatz »Leuchtbild Wasserfall mit realistischem 3-D-Bewegungseffekt« war der Laster leer. Immer noch. Kiki und Caroline waren mit der Kommode auf der ersten Biegung im Treppenhaus hängen geblieben. Da half kein Drehen, kein Wenden, kein Fluchen und Lamentieren. Kiki klemmte zwischen Geländer und Schrank fest. Das Gewicht der Welt lastete auf ihren Unterarmen. Es ging weder vor noch zurück.
»Aufs Land ziehen? So ein Unsinn!«, schimpfte sie. »Welcher Dämon hat mir bloß ins Ohr geflüstert, dass ich meinem Leben einen neuen Dreh geben muss? Ich schaff noch nicht mal die Kurve im Treppenhaus.«
»Rein theoretisch kann das Ungetüm nie in deiner Wohnung gewesen sein«, stöhnte Caroline mit hochrotem Kopf. Mit letzter Kraft stemmte sie die Kommode ein Stück höher.
»Mehr nach links. Nach links. Meine Hand«, brüllte Kiki. Die Kanten des Schranks schnitten ihr scharf ins Fleisch. »Wer sagt, dass man nicht auch in einer Stadtwohnung Kinder großziehen kann. Notfalls im Treppenhaus«, ächzte sie.
Bei Caroline machte sich zunehmend Verzweiflung breit: »Tu irgendwas, dreh um!«
»Geht nicht«, schrie Kiki zurück. »Ich stecke fest.«
Ihre panischen Stimmen hallten bis auf die Straße.
»Ihr hättet die Kommode hochkant nehmen müssen«, meldete sich Judith aus dem Hintergrund. Sie verkannte, dass in dieser Lage alles gebraucht wurde, nur kein guter Ratschlag. Die Kraftausdrücke und Verwünschungen, die augenblicklich aus Carolines Mund auf sie niederprasselten, waren ein zarter Abglanz des rüden Umgangstons, den Carolines Klienten in die Kanzlei der Strafverteidigerin trugen. Im Treppenhaus brachten sich die selbst ernannten Umzugsexperten vom Bürgersteig in Position, um ihrer zukünftigen Exnachbarin Kiki zu zeigen, wo es langging. Qua Kommode. Rein theoretisch jedenfalls.
2
Judith flüchtete ins Schlafzimmer. Zu Estelle.
Die hatte sich in der letzten Ecke verbarrikadiert und versuchte, so unsichtbar wie möglich zu wirken, während im Treppenhaus der dritte Balkankrieg ausbrach.
»Ich drücke mich nicht«, verteidigte Estelle sich präventiv. »Ich kümmere mich um den artgerechten Transport der Topfpflanzen.«
Hingebungsvoll wickelte sie einen überdimensionierten Stachelkaktus in Noppenfolie. »Den bekommst du sonst nicht nach unten«, erklärte Estelle. »Es sei denn, du stehst auf botanische Tätowierungen.«
»Ich wundere mich, dass das Gewächs bei Kiki überlebt hat«, bemerkte Judith. »Kiki hatte noch nie Interesse an Grünzeug.«
Estelles Vermutungen waren eindeutig: »Der sieht aus wie ein Dildo. Vielleicht liegt es daran.«
Kikis Männerverschleiß war in der Dienstagsrunde legendär. Doch seit Kiki den dreizehn Jahre jüngeren Max Thalberg kennengelernt hatte und Mutter geworden war, war alles anders geworden. Die Großstadtpflanze hatte beschlossen, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Tschüss, lange Abende am Brüsseler Platz, auf Wiedersehen, Hallmackenreuther, E-Werk, Sixpack und King Georg, bye bye, »Coffee to go«, adieu, Dienstagsfrauen. Und das alles für einen höheren Zweck.
»Greta soll nicht in der Stadt aufwachsen und glauben, Milch wächst bei REWE im Kühlregal«, hatte Kiki ihren radikalen Schritt begründet. Das Honorar, das sie für ihren Designauftrag für die Kaffeehauskette »Coffee to go« erhalten hatte, investierte sie in ein neues Leben. Kiki und Max waren glückliche Neubesitzer einer Hypothek und einer renovierungsbedürftigen alten Schule mit ausreichend Land für grüne Selbstversorgerträume. In Mecklenburg-Vorpommern. Zu etwas anderem hatten die Finanzen der jungen Familie nicht gereicht.
»Neunzig Minuten nach Berlin, neunzig Minuten nach Hamburg, neunzig zum Meer«, begeisterte sich Kiki.
Die Entfernung zwischen Köln und ihrem neuen Wohnort ließ sie im Ungenauen. Kiki hatte das alte Schulgebäude auf einer Reise durch Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Hinter dem Haus befand sich ein 3.400 Quadratmeter großes Grundstück mit altem Obstbaumbestand, eigenem Seezugang samt pittoresker Fischerhütte und einer eingefallenen Scheune, die abgerissen werden durfte. Aber wozu etwas abreißen, aus dem sich noch etwas machen ließ? Kiki war von dem geschichtsträchtigen Ort auf den ersten Blick begeistert gewesen. Ihre Bank weit weniger. Freiberufler? Kein gesichertes Einkommen? Noch nicht mal verheiratet? Und das Eigenkapital – war das alles? Was Kiki für unermesslichen Reichtum hielt, weckte in der Kreditabteilung der Sparkasse am Eigelstein ein müdes Lächeln. Selbst Kikis brillante Geschäftsidee, die alte Schule zu einem Bed & Breakfast für ruhebedürftige Großstädter und Ökotouristen auszubauen, hatte die Zahlenfetischisten bei der Bank nicht überzeugt. Erst Estelles Zusage, für ein halbes Jahr eine bestimmte Anzahl von Zimmern für eines ihrer Charityprojekte anzumieten, hatte die Bank gnädig gestimmt. Das lag vor allem daran, dass Estelle diese Zusicherung mit einer Vorauszahlung untermauern würde. Estelle begeisterte die Aussicht, Kindern aus sozial schwachen Familien zu kostenlosen Ferienaufenthalten bei Kiki zu verhelfen. Sie liebte ihre Charityarbeit. Solange das Engagement nicht mit körperlichem Einsatz verbunden war.
Die Dienstagsfrauen hatten alle fünf Kontinente bereist, sie hatten als Weltbürger die exotischsten Landstriche durchstreift. Die Mecklenburger Seenplatte kannte keine. Was könnte exotischer sein, als zwischen Hühnern, Kühen und Stadtflüchtlingen ein neues Leben zu beginnen?
Es war bald zwanzig Jahre her, dass sich die fünf Frauen bei einem Französischkurs am Kölner Institut français kennengelernt hatten. Bis heute kamen sie an jedem ersten Dienstag im Monat zusammen. Doch jetzt würde alles anders werden. Der Umzugstag fiel auf den elften November. Selbst die Pappnasen, die auf dem Weg zum Neumarkt waren, um die Karnevalssession zu eröffnen, konnten dem trüben grauen Tag keinen heiteren Anstrich verleihen. Mit jedem Karton, der geschlossen, mit jedem Möbelstück, das vom Umzugswagen verschluckt wurde, entschwand Kiki ein Stück mehr aus dem Leben der Dienstagsfrauen.
Judith bewunderte Kiki für ihren Mut. Sie selbst war nach den zahlreichen Veränderungen in ihrem Leben, die sie in den letzten Jahren durchlitten hatte, allergisch gegen allzu viel Neubeginn. Judith hasste Abschiede jeder Art. Die Mittagspause fand bereits in einem halb leeren Wohnzimmer statt. Ohne Kikis fröhliche Einrichtung offenbarte die Wohnung ihre ursprüngliche Hässlichkeit. Die Freundinnen machten es sich mit den verbliebenen Sofakissen auf dem Boden bequem. Als Tisch diente eine Umzugskiste mit dem kecken Aufdruck »Ruhe im Karton«. Darunter war in Kikis Handschrift »Küche unwichtig« vermerkt. Es war die Sorte Karton, die gemeinhin von Keller zu Keller umzog und später von Erben unbesehen entsorgt wurde. Doch Kiki hatte aussortiert. »Küche unwichtig« ging direkt zum Sozialkaufhaus in Nippes, wo die abgedankten Haushaltsgegenstände für einen guten Zweck verkauft wurden.
Kiki hatte sich vorgenommen, vernünftiger mit eigenen und fremden Ressourcen umzugehen.
»Der Mensch braucht dreihundert Gegenstände zum Leben«, verkündete sie. »Ich hatte mindestens 10.000. Das meiste habe ich nie benutzt.« Kiki war entschlossen, ein einfacheres, ehrlicheres Leben zu führen. »In und mit der Natur«, betonte sie.
Judith konnte weder etwas essen noch sagen. Genau wie ihre Freundinnen hatte sie Mühe, Kiki ziehen zu lassen. Bei thailändischem Curry vom Imbiss und französischem Champagner redeten die Dienstagsfrauen alle ein bisschen lauter und schneller als notwendig, als wollten sie die leeren Räume ein letztes Mal zum Klingen bringen.
Eva hatte Tränen in den Augen. »Zu scharf, das Curry«, log sie.
Caroline war wie üblich weniger zurückhaltend: »So wie früher wird es nie wieder sein«, seufzte sie wehmütig.
»Gott sei Dank«, meinte Kiki unbeeindruckt. »Ich sehne mich nicht nach meinen unordentlichen Jahren zurück. Wer will schon noch mal zwanzig sein?«
»Ich«, entgegnete Estelle nüchtern. »Dafür verzichte ich gerne auf die Altersweisheit.«
Kikis iPad wurde herumgereicht. Kritisch begutachtete Judith die neuesten Fotos vom zukünftigen Zuhause der kleinen Familie.
»Wir ziehen in die Lehrerwohnung im Dachgeschoss. Und dann fangen wir im Mitteltrakt an«, erklärte Kiki und wies auf den hohen Giebel mit Türmchen und alter Schuluhr, der das zweistöckige Gebäude in zwei gleiche Hälften teilte. »Der Frühstücksraum und die Küche kommen in die ehemalige Aula, die Fischerhütte und die Klassenzimmer werden nach und nach zu Fremdenzimmern umfunktioniert.«
Der Plan war einfach: In der Hauptsaison war die Frühstückspension für Einzelgäste reserviert, in den anderen Monaten sollte sie zu einem reduzierten Preis Estelles Stiftung zur Verfügung stehen. Kiki begeisterte der Gedanke, dass die Sandkrugschule nicht allein Besserverdienenden vorbehalten blieb. Schon im nächsten Sommer sollte ihr Bed & Breakfast eröffnen.
Wie immer bei Verliebtheiten war es schwierig, das unsichtbare Wunder in Worte zu verpacken und anderen zu vermitteln. Keine der Freundinnen wagte, einen kritischen Kommentar abzugeben. Man musste kein Bauexperte sein, um zu begreifen, dass die Gebäude unter die Kategorie »einstürzende Altbauten« fielen.
Kiki verstand auch so, was die betroffenen Mienen bedeuteten: »Es steht seit acht Jahren leer«, sagte sie betont munter. »Es gibt einiges zu renovieren.«
»Ich hätte den Mut nicht«, gab Eva ehrlich zu. Als vierfache Mutter und Ärztin in Teilzeit lavierte sie jeden Tag aufs Neue an der Grenze der eigenen Belastbarkeit. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie Kiki das schaffen wollte. Ein Baby? Die freiberufliche Arbeit als Designerin? Und dann noch mal so eben 475 Quadratmeter Nutzfläche von Grund auf renovieren? Vom selbst angebauten Gemüse, das zu Kikis Traum vom Leben auf dem Lande unabdingbar dazugehörte, ganz abgesehen.
Estelle konnte der Idee, ein Bed & Breakfast zu führen, durchaus etwas abgewinnen. »Ich habe das auch: Bei jedem Urlaub denke ich, ich sollte ein Hotel im Süden eröffnen. Palmen, Sonne, Strand, Urlaub für immer. Fünf Minuten nach der Landung zu Hause hab ich’s wieder vergessen.«
Während die Dienstagsfrauen nur vorsichtig Zweifel äußerten, fand Max’ Vater zum Abschied deutliche Worte. Als Umzugshelfer und Babysitter am späten Nachmittag am vollen Lkw für eine letzte Umarmung aufeinandertrafen, brach es aus ihm heraus.
»Ich gebe euch ein Jahr, dann seid ihr wieder in Köln«, prophezeite er.
Das Urteil von Johannes Thalberg fiel vernichtend aus. Der Designpapst hielt das meiste von dem, was sein Erstgeborener Max veranstaltete, für eine Schnapsidee. Die Verbindung mit seiner ehemaligen Angestellten Kiki gehörte dazu. Und Schrottimmobilien im Osten sowieso.
»Ich weiß gar nicht, wie ihr das stemmen wollt«, sagte er.
Als Chef einer international renommierten Designfirma hatte er Übung darin, eine schlechte Idee auch eine schlechte Idee zu nennen.
»Das Rad, das Auto, der erste Computer: Ohne Schnapsideen wären wir immer noch im Mittelalter«, meinte Max lässig.
»Das ist noch kein Grund, sich dorthin zurückzukatapultieren«, entgegnete Thalberg. Max’ Eltern war die Vorstellung, dass ihr diplomierter Sohn nach vier Jahren Designstudium in London auf einer kleinen Scholle im Osten den Hobbybauern, Teilzeitselbstversorger und Pensionswirt geben wollte, zutiefst suspekt.
»Selbst Michelle Obama züchtet im Weißen Haus Karotten«, sprang Caroline dem jungen Paar bei. »Das will was heißen.«
Max startete den Motor: »Im Sommer ist alles fertig«, rief er durch das Fenster, »dann kommt ihr uns alle besuchen.«
Kiki drückte ihren Freundinnen noch schnell ihre nagelneuen Visitenkarten in die Hand.
»Nicht verwechseln mit Bierkowo«, warnte Kiki. »Das liegt in Hinterpommern.«
»Birkow, Hirtenweg 4«, las Judith. Das klang nach Abgeschiedenheit und Einöde.
»Von dort kann es nicht mehr weit nach Hinterpommern sein«, meinte Estelle.
Greta lachte auf. Sie thronte auf Kikis Arm und quietschte fröhlich ob der Luftschlangen, die ein paar Karnevalisten auf sie niederregnen ließen.
Kiki fiel es schwer, sich loszureißen. »Auf dem Land können wir uns viel besser um Greta kümmern«, betonte sie. »Mit dem Bed & Breakfast sind Max und ich unabhängig von Aufträgen.«
Ihre Stimme wackelte. Seit Wochen hatte Kiki mit Feuereifer den Plan vorangetrieben. Jetzt, wo es ernst wurde, sah sie aus, als wollte sie in Tränen ausbrechen.
»Bloß weil Kiki nicht mehr jeden Monat ins Le Jardin kommt, heißt das noch lange nicht, dass die Dienstagsfrauen aufhören zu bestehen«, betonte Caroline.
»Es wird einfach anders«, tröstete Kiki ihre Freundinnen. Wie das aussehen sollte, konnte sich keine so recht vorstellen.
Eine letzte Umarmung, ein letztes Winken, und dann war es vorbei. Mit lautem Gehupe bog der Lkw vom Eigelstein Richtung Hansaring ab. Kiki verschwand aus ihrem Leben, einem unbekannten Ziel entgegen. Köln wirkte gleich ein Stück grauer.
»Ein Gutes hat es«, meinte Estelle und schluckte schwer. »Es wird in diesem Jahr keine Diskussion geben, wohin der Jahresausflug der Dienstagsfrauen gehen soll.«
3
Normalerweise diskutierten die Dienstagsfrauen einen ganzen Abend, um sich auf einen Urlaubsort für den jährlichen Ausflug zu einigen. Das Ziel war diesmal nicht das Problem, dafür benötigten sie ein geschlagenes halbes Jahr, um einen gemeinsamen Termin zu finden.
»Andere bekommen in der Zeit ein Kind«, übertrieb Judith. Fakt war, dass sie in den vergangenen Monaten oft die Einzige gewesen war, die am ersten Dienstag im Monat Zeit hatte. »Es bleibt alles beim Alten«, hatten sich die Dienstagsfrauen am Umzugstag versprochen. Und dann war alles anders geworden. Fast unmerklich war die Runde auseinandergefallen. Caroline war in einem spektakulären Entführungsfall zur Pflichtverteidigerin ernannt worden, Estelle rund um die Uhr damit beschäftigt, ihren Mann aufzubauen, der nach einem Schwächeanfall kürzertreten musste, und Eva ruderte an allen Fronten. Eine SMS von Kiki gab letztendlich den Anstoß, Nägel mit Köpfen zu machen: »Wenn ihr zufällig Zeit habt, ich könnte ein paar helfende Hände gebrauchen. Schnell.« Eva kannte Kiki seit ihrem achtzehnten Lebensjahr. Kiki hatte das unschätzbare Talent, in allen und allem immer nur das Beste zu sehen. So eine SMS bedeutete: Land unter. Und zwar ganz akut.
Plötzlich ging alles ganz schnell. Die Woche vor Pfingsten wurde als Reisetermin festgelegt, am Freitag wollten sie aufbrechen. Eva freute sich, dass es endlich losging. Sie hatte alles so weit unter Kontrolle, dass sie dem Ausflug der Dienstagsfrauen gelassen entgegensehen konnte. Ihre Ältesten, David und Lene, waren inzwischen siebzehn und sechzehn, Frido jr. vierzehn und die Kleinste, Anna, auch schon zwölf. Die Kinder waren vorgewarnt, Ehemann Frido räumte bereits den Supermarkt leer, um Vorräte für eine Woche ohne Eva zu horten, und ihre Mutter Regine, die Eva gerne für sich vereinnahmte, übte sich auf Lanzarote mit einem indischen Guru in schamanischer Zupfmassage. Nach Dienstende wollte Eva mit Estelle und Judith im Gartencenter ein paar grüne Mitbringsel kaufen. Dann war alles geregelt. Nichts sollte mehr dazwischenkommen. Nichts außer einem Anruf vom Erzbischöflichen Gymnasium. Er ereilte sie im Krankenhaus, zehn Minuten vor Dienstende. Ihre vier Kinder besuchten alle die gleiche Schule. Allein der Anblick der Nummer auf dem Display des Telefons setzte Evas Fantasie in Gang. Die Bandbreite der Schreckensmeldungen, die bei solchen Telefonaten auf sie zukamen, variierte von »Wir brauchen jemanden, der beim Sommerfest hilft« über »Ihr Kind hat den Elternbeitrag zur Klassenfahrt nicht bezahlt« bis zu »Es gab da ein Unglück beim Sportunterricht«. Heute war es besonders schlimm. Heute fehlte die Angabe von Gründen. Am anderen Ende der Leitung wartete die Schulsekretärin mit der nüchternen Mitteilung auf, dass Herr Krüger sie am Nachmittag zu einem Termin bat. Eva kannte den neuen Rektor des Gymnasiums nur von einem Vortrag, bei dem er über den »3-D-Cyber-Classroom« der Zukunft doziert hatte. Worum es konkret ging, wollte die Sekretärin nicht enthüllen, nur das eine: »Es ist dringend. Sehr dringend.« Frido hatte wie üblich keine Zeit. Sie durfte sich Krüger alleine stellen.
»Was ist in der Schule los?«, schrieb Eva in einer SMS an alle vier Kinder. Die Straßenbahn zuckelte gemächlich durch die Stadt Richtung Gymnasium und gab ihren mütterlichen Schuldgefühlen ausreichend Zeit, sich zur Stelle zu melden. Eva klickte durch ihre Mails. Außer Einladungen zu Klassenabenden, Elternstammtischen und der pädagogischen Gesprächsrunde des Elternbeirats gab es keine Mail, die etwas mit Schule zu tun hatte. In Evas Kopf mahlte es. Auswahl an Themen gab es reichlich: David hatte zwei Verweise wegen chronischen Zuspätkommens kassiert, Lenes Leistungen bewegten sich, seit sie einen Freund hatte, in den unteren Kellerregionen, ihre Jüngste, Anna, lag im offenen Clinch mit der Mathelehrerin, und Frido jr. brachte mit seiner Besserwisserei das ganze Lehrerkollegium auf die Palme. Dass er tatsächlich vieles besser wusste als seine studierten Lehrer, machte die Sache nicht einfacher.
Wie lange brauchte die Straßenbahn bloß für die kurze Strecke? Auf der Suche nach Ablenkung wanderte Eva auf ihrem Smartphone zu Kikis Blog, der mit der kecken Überschrift »Bauruine gesucht und gefunden« versehen war. »41 Fenster, 19 Räume und große Pläne« stand in Kikis erstem Beitrag. »Strom, Gas und Wasser lassen wir vom Fachmann machen, der Rest wird Eigenleistung.«
Eva wurde schummrig angesichts der Bilder von entkernten Räumen, schiefen Decken, fehlenden Fußböden und lose im Raum hängenden Leitungen. Stil Dresden 1945 lautete die selbstironische Bildunterschrift. Uns geht es großartig.
»Das heißt gar nichts«, hatte Estelle den Eintrag bei einem der Dienstagstreffen kommentiert. »Kiki fände es selbst auf der Titanic großartig. Wann begegnet man schon mal einem Eisberg?«
Neue Einträge und Fotos gab es schon lange nicht mehr. Nach den euphorischen Posts über den Anfang der Renovierungsarbeiten blieb es still in Mecklenburg-Vorpommern. Der Satz »Hast du was von Kiki gehört?« war längst zum Mantra der Dienstagsfrauen geworden. Jedes Telefonat, jede zufällige Begegnung, jedes Treffen begann und endete bei der Freundin. Wann immer Eva Kiki angerufen hatte, musste Greta gerade ins Bett, in die Badewanne oder zum Kinderarzt. Noch öfter war was mit der Telefonverbindung, Mauern mussten mit Lehm verputzt werden, Decken verkleidet, Wände gestrichen, Fußböden ausgesucht und verlegt, feuchte Stellen bekämpft oder ein Etappenabschnitt gefeiert werden. Es war höchste Zeit, persönlich in Birkow nach dem Rechten zu sehen. Wenn sie nur schon diesen Termin in der Schule hinter sich gebracht hätte.
Eva war bereits ein Nervenbündel, als sie die imposante Eingangshalle der Schule betrat. Statt des typischen Schulgeruchs, einer Melange aus Reinigungsmitteln, Holzbänken, nassen Kinderjacken und muffigen Hausschuhen, die ihre eigene Schulzeit geprägt hatte, empfing sie eine moderne Eingangshalle mit einer digitalen Anzeigetafel. »Alle Zugänge zum Schulcomputer bleiben bis auf Weiteres gesperrt«, blinkte es dort in großen Lettern. Krügers neue Technik schien nicht ohne Tücken zu sein.
»Sie wissen, warum ich Sie einbestellt habe?«, schrie der Rektor sie an. Er musste laut werden, denn im Speichergeschoss kümmerten sich Handwerker geräuschvoll darum, die Klimaanlage vor dem Sommer einer längst fälligen Generalüberholung zu unterziehen. Eva konnte wahrlich Kühlung gebrauchen. Nach drei Treppen und tausend Schreckgespenstern im Kopf rann ihr der Schweiß in einem kleinen Bächlein den Rücken herunter. Wenn sie wenigstens den dicken Tweedblazer ausziehen könnte. Doch das ging leider nicht. In der morgendlichen Hektik hatte sie es gerade mal geschafft, die Vorderseite ihrer Bluse aufzubügeln. Sie ahnte, dass dieser Tag nicht zu retten war. »Einbestellt«, das Wort alleine.
Eva versuchte, einen möglichst kompetenten und gelassenen Gesichtsausdruck aufzusetzen, der vermitteln sollte, dass sie das Familienleben, ihre Teilzeitstelle im Krankenhaus, die vier Kinder und die Bügelwäsche im Griff hatte. Wieso ließ sie sich von jemandem beeindrucken, der ihr Sohn hätte sein können? Der Mann, der ihr an einem schweren Holzschreibtisch gegenübersaß, war mindestens zwanzig Jahre jünger als sie. Mit exaktem Scheitel im lockigen Haar, Sechzigerjahre-Brille und einem Anzugensemble aus schlammfarbenem Cord wirkte er, als hätte er sich nur als Schulleiter verkleidet. Vielleicht mischte er deswegen seiner voluminösen Stimme diese Prise väterlichen Tadels bei, die Eva bei Lehrern so hasste. Noch bevor das Vergehen bekannt war, fühlte man sich bereits als Delinquent.
»Um was geht es eigentlich?«, fragte Eva ungehalten.
»Ihr Sohn hat noch nicht mit Ihnen gesprochen?«, setzte Krüger seine Quizshow fort.
Der 50:50-Joker: Anna und Lene schieden also als potenzielle Übeltäter aus. Blieben David oder Frido jr. Welchem ihrer Söhne hatte sie diesen Auftritt zu verdanken? Der Rektor legte eine Kunstpause ein, um ihr Gelegenheit zu geben, zu beweisen, wie gut sie mit ihren Teenagern kommunizierte. Eva schielte auf ihr Handy. Ihre elektronische Rundfrage, was sie in der Schule zu erwarten hätte, war unbeantwortet geblieben. Kein Wunder. SMS schreiben fanden ihre Kids so was von 2010. Heute kommunizierte man über WhatsApp. Wenn man in der Lage war, sich diese App herunterzuladen. War sie aber nicht.
»David ist heute Morgen wieder zu spät gekommen«, riet Eva, nur um eine Sekunde später festzustellen, dass sie die falsche Antwort gegeben hatte. Bis zu ihrer vorschnellen Bemerkung hatte der übereifrige Herr Krüger Davids schriftliches Attest auf dem Briefpapier des Krankenhauses für ein Original gehalten. Genauso wie Evas unleserliche Unterschrift. Eva fühlte sich mit einem Schlag unendlich müde. Viele Paare wünschten sich Kinder. Keiner wünschte sich Teenager. Am allerwenigsten Eva. Wenn es stimmte, dass Gehirne von Halbwüchsigen in der Pubertät umgebaut wurden, lebte Eva auf einer familiären Großbaustelle. Eines ihrer vier Kinder fand sich immer bereit, das Wohnzimmer zu vermüllen, den letzten Hausschlüssel zu verlieren, mit den vierzehn besten Freunden den Kühlschrank zu leeren oder Schulatteste zu fälschen. Sie nahm sich vor, gleich heute Abend das Elternbuch über die Pubertät zur Hand zu nehmen, das ihre wohlmeinende Mutter Regine ihr mitgebracht hatte. Vielleicht verriet der Ratgeber, wie man Tage wie diese überlebte. Wenn sie wenigstens etwas im Magen hätte. Schon beim Frühstück im Hause Kerkhoff war es drunter und drüber gegangen. David war nicht aus dem Bett gekommen, Lene beschwerte sich unter Verweis auf ihr stolzes Alter von sechzehn Jahren, dass sie nicht mit ihrem Freund übers Wochenende nach Amsterdam fahren durfte, und der kleinen Anna war um Viertel vor acht eingefallen, dass sie heute Stricknadeln und Wolle mitbringen musste. Als David beim dritten Weckruf die anstehende Mathearbeit mit dem Argument »Ich will Rapper werden, da braucht man kein Abitur« als sinnlos abtat, fragte sie sich, ob sie den Kampf um die Schulbildung ihres Erstgeborenen aufgeben sollte. Vielleicht musste sie akzeptieren, dass ihr Sohn Gefahr lief, die Frage nach dem ersten Menschen im Weltall mit Captain Kirk zu beantworten und Michelangelo für einen der Ninja Turtles zu halten. Nur Frido jr. hatte am Morgen geschwiegen. Wie üblich brütete er hinter seinem Computer über endlosen Zahlenkolonnen. Eva hatte darauf verzichtet, ihren täglichen Vortrag über den Esstisch als bildschirmfreie Zone zu halten, und entschied sich, stattdessen die Bluse für den Arbeitstag aufzubügeln. Auch wenn die Zeit nur noch für die Vorderseite reichte.
Krüger fächerte einen Stapel selbst gebrannter DVDs vor ihr auf. Die kopierten Cover zeigten ineinandergeknotete asiatische Frauen mit blanken Busen und gespreizten Beinen. Dazu ein beeindruckendes Arsenal an Samuraischwertern und viel Blut. Eva vermutete, dass die japanischen Schriftzeichen im Titel etwas wie »Kettensägenmassaker« oder »Massenmord im Bordell« heißen mussten. Sie hätte Frido jr. fragen können. Der lernte seit zwei Jahren Japanisch an der Schule.
»Gemeinhin nennt man diese Filme Asienschocker«, erläuterte der Rektor. »Ihr Sohn macht sich darum verdient, seinen Mitschülern fernöstliche Kultur zu vermitteln.«
Das Ziel des Japanischunterrichts am Erzbischöflichen Gymnasium war, nach drei Jahren sprachlich den Alltag im Land der aufgehenden Sonne zu bewältigen. Frido jr. hatte diese banale Herausforderung längst hinter sich gelassen.
»Erst hat Ihr Sohn die Filme verliehen«, erklärte Krüger. »Leider war die Nachfrage so groß, dass er sich einen neuen Vertriebsweg ausdenken musste.«
Es dauerte einen Moment, bis sich die Geschichte bei Eva zusammensetzte. Frido jr. war nach Aussage von Krüger nicht nur perfekt in Japanisch, sondern zudem ein überaus talentierter Computerspezialist, dem eine große Karriere bevorstand. Bedauerlicherweise lebte er sein technisches Können am Schulserver aus, den er zur Abspielstation für Filme zweifelhafter Herkunft und noch zweifelhafterer künstlerischer Qualität umfunktioniert hatte. Frido jr. besaß den ökonomischen Verstand seines Vaters und hatte bereits vierunddreißig Abonnenten für seinen illegalen Kanal gewonnen. Kein Wunder, dass sein Bruder David sich keine Sorgen wegen seiner Mathearbeit machte. Wofür hatte man einen Hacker in der Familie?
»Ihr Sohn ist sehr begabt«, gab der Rektor zu. »Aber das ist noch keine Garantie für ein gelungenes Leben.«
Ein heftiger Schlag aus dem Obergeschoss untermalte donnernd seine warnenden Worte. Leise rieselte Putz von der Decke und legte einen weißen Schleier über die direktoralen Locken. Das bisschen Baustaub hielt Krüger nicht davon ab, sich in aller Breite über die Erziehungsziele des Erzbischöflichen Gymnasiums auszulassen, über Moral und gesellschaftliche Verantwortung zu dozieren, wobei er den ein oder anderen Philosophen und ein paar aktuelle pädagogische Ansätze zitierte. Eva rutschte nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Ihre Muskeln verkrampften sich, ihr Herz pumpte das Blut immer schneller durch den Körper. Im Gesicht und am Hals spürte sie hektische rote Flecken aufblühen. Aus dem oberen Stock klangen die Schläge der Handwerker, im Kopf dröhnte der immer gleiche Satz durch ihre Gehirnwindungen. Ihre Existenz reduzierte sich auf ein einziges Problem, das ihr Denksystem in Beschlag nahm. Plötzlich und unerwartet war sie aufgetaucht, diese alles entscheidende Frage, die über Sein und Nichtsein entschied: Habe ich heute Morgen eigentlich das Bügeleisen ausgemacht?
»Es freut mich, dass Sie den Ernst der Lage erkennen«, lobte Krüger, der das Entsetzen, das Eva ins Gesicht geschrieben stand, fehlinterpretierte.
Eva dachte nur noch eins: Sie musste nach Hause. Jetzt sofort. Es gab Wichtigeres im Leben als die Verfehlungen eines Vierzehnjährigen, der seinen Schulalltag mit wahnwitzigen Geschäftsideen belebte. Eva konnte Krüger keine Sekunde länger zuhören. Die Vorahnung der nahenden Katastrophe wurde zur inneren Gewissheit. Die Kinder waren längst zu Hause. Würden die vier einen Schwelbrand im Schlafzimmer bemerken? Kohlenmonoxid war ein hinterhältiger Mörder.
»Wir bestehen darauf, dass Frido Mitwisser und Kunden preisgibt«, wetterte Krüger. »Wir verlangen die lückenlose Klärung aller Vorgänge.«
Was interessierte sie der Strafkatalog, den Krüger herunterbetete? Was bedeutete ein drohender Schulverweis? Ihr mütterlicher Instinkt verkündete, dass es um Leben und Tod ging. Sie spürte es körperlich. Eva war egal, was Krüger sagte und dachte. Nichts hielt sie mehr auf diesem Stuhl, in diesem Raum.
»Ich muss los«, grätschte Eva in Krügers Rede, die sich gerade den juristischen Implikationen und den damit verbundenen Kosten näherte. Sie griff wahllos ein paar der Filme, um ihre Bereitschaft zu signalisieren, sich mit den Verfehlungen ihres Sohnes auseinanderzusetzen, sprang wie von der Tarantel gestochen auf und machte einen Schritt in Richtung Tür. Weiter kam sie nicht, denn genau in dieser Sekunde löste sich ein drei Meter großes Stück Deckenplatte. Eine Tonne Baumaterial krachte nieder und traf den Stuhl, auf dem Eva gerade noch gesessen hatte.
4
»Sie ist doch sonst so pünktlich«, wunderte sich Judith.
Am Tag vor Reisebeginn hatten sie sich zu dritt bei Estelle verabredet. In der Nähe der Heinemann’schen Villa gab es ein exklusives Gartencenter, wo sie ein Geschenk für Kiki kaufen wollten. Sobald Eva da war.
»Vielleicht ein Notfall«, klang Estelles Stimme dumpf aus dem begehbaren Kleiderschrank. Während die Freundin mit der Auswahl der passenden Urlaubsgarderobe beschäftigt war, brütete Judith über ihren Wahrsagekarten. Schauer jagten über ihren Rücken. Das Blatt, das sie vor sich ausbreitete, verhieß nur Schlechtes für den gemeinsamen Ausflug. In der obersten Reihe lagen die Karten, die für Reise, Veränderung und Todesfall standen, direkt nebeneinander. Keine gute Kombination. Judith schob die Karten auf Estelles Schminktisch zwischen Kristallfläschchen, mit Strass besetzten Dosen und edlen Flakons hin und her. Im vergoldeten Doppelspiegel konnte sie verfolgen, wie Estelle im Hintergrund zum vierten Mal den Koffer für Birkow umpackte.
»Versuchst du dich immer noch als Hellseherin?«, fragte Estelle.
»Ich glaube, der Mann hat mir die Karten ganz bewusst zugespielt«, antwortete Judith. »Der wusste, dass ich Talent habe. Ich muss nur begreifen, wie sie funktionieren.«
Vor ein paar Wochen hatte ihr ein Gast im Le Jardin eine Karte aus einem Wahrsageset hinterlassen. Leider anstatt die Rechnung von 50,40 Euro zu begleichen. Zunächst war Judith wütend auf den Zechpreller gewesen, der sie mit einem antiquierten Fleißkärtchen abspeiste. Die Illustration stammte aus dem 19. Jahrhundert und zeigte ein rotwangiges blondes Mädchen im ordentlichen Schürzenkleid mit Rüschenunterrock und Schnürschuhen, das ein Goldfischglas in Händen trug. Im Hintergrund wartete ein kleiner Kavalier mit Blumenstrauß, in der rechten oberen Ecke stand »Nº17. Geschenk bekommen«. Der Querstrich auf dem m deutete die Verdoppelung des Konsonanten an. Dass es sich nicht um herkömmliche Fleißkärtchen handelte, entdeckte Judith am nächsten Tag, als sie in ihrer esoterischen Stammbuchhandlung auf ein mysteriöses Buch stieß. Du weißt mehr, als du denkst lautete der Titel. Auf dem Cover war dieselbe Karte abgebildet. Es war ein Nachschlagewerk für den Gebrauch von biedermeierlichen Kipperkarten, mit denen man die Zukunft vorhersagen konnte. Ihr vorgebliches Fleißkärtchen gehörte zu einem Set von sechsunddreißig nummerierten Wahrsagekarten, auf denen Ereignisse, Personen oder Charaktereigenschaften abgebildet waren. Ähnlich wie beim Tarot sagte jede Karte einzeln und auch als Teil einer Legekombination etwas über den Fragesteller aus. Aufgeregt schlug sie die Bedeutung der zurückgelassenen Karte nach: »›Nº17. Geschenk bekom–en‹ steht für neue Arbeitsangebote außerhalb der bisherigen Tätigkeit«, las sie. Judith verstand es als Zeichen und Verpflichtung.
Wie oft sah sie vor ihrem inneren Auge Situationen vor sich, die Tage, Monate, manchmal Jahre später passierten? Es waren leise Vorahnungen, schwache Bilder. Judith war nie sicher, ob sie ihrer eigenen Intuition trauen konnte. Bis die Biedermeierkarten ihren Weg zu ihr fanden. Wenn das Leben Sinn und Logik hatte, musste es Instrumente geben, beides zu entschlüsseln. Judith war davon überzeugt, dass die Karten ein wirkungsvolles Hilfsmittel sein konnten, zu formulieren, was im Innersten längst zum Abruf bereitlag und nur einen äußeren Anstoß brauchte, um die Oberfläche des Bewusstseins zu erreichen.
»Auch das werden wir überleben«, hatte Caroline nüchtern konstatiert, als Judith die Kipperkarten zum ersten Mal ins Le Jardin mitgebracht hatte. Judith nahm es gelassen. Es gab Menschen, die spürten Regen auf ganz besondere Weise, andere, wie Caroline, wurden einfach nur nass. Judith verstand es als ihre lebenslange Aufgabe, Caroline und den Dienstagsfrauen den Zugang zu einer spirituellen Welt aufzuzeigen.
»Kannst du deine Karten fragen, wo Eva bleibt?«, erkundigte sich Estelle.
Seit sie sich Judith an jenem Dienstagabend im Le Jardin als Versuchsperson zur Verfügung gestellt hatte, zweifelte Estelle, ob die Karten nicht doch eine Aussagekraft hatten.
»Du bekommst ein Kind«, hatte Judith zögernd und unsicher aus Estelles Blatt herausgelesen. Sie drehte und wendete und interpretierte und konnte doch nichts an der Vorhersage ändern. Der Rest ihrer Prophezeiung war in hysterischem Gegacker untergegangen, nachdem Judith darauf bestanden hatte, dass es Zwillinge würden. Am selben Abend eröffnete Estelles Mann seiner überrumpelten Gattin, dass er kürzertreten werde und seinen Sohn und die Schwiegertochter in die Unternehmensführung berufen hatte. Bis die beiden eine passende Bleibe gefunden hatten, würden Alexander und seine frischgebackene Ehefrau Sabine bei ihnen wohnen. In ihren Businessanzügen sahen sie aus wie Zwillinge. Estelle war das Lachen vergangen. Sie hatte nie den Wunsch verspürt, Mutter zu werden. Noch viel weniger Stiefmutter.
Judith verbuchte das Erscheinen der Stiefkinder als Durchbruch. Sie war auf dem richtigen Weg. Das spürte sie. Die Kunst war, die Botschaften des Unterbewussten noch genauer zu interpretieren. Aus der Kombination, die auf Estelles Schminktisch lag, konnte selbst die blühendste Fantasie nichts Gutes herauslesen. Alle negativen Karten schienen sich in dem Legemuster zu einer großen Katastrophe zu vereinen.
Judith fegte die Karten energisch zu einem Stapel zusammen, mischte neu und fragte Estelle um Hilfe: »Zieh neun Karten.«
Estelle griff beherzt und ohne nachzudenken zu. Mit feierlicher Miene und angemessenem Ernst drehte Judith die Karten um. Der Einzige, der sich für ihre spirituellen Künste interessierte, war Oskar, Estelles schneeweißer Königspudel. Mit vollem Namen hieß er »Oskar von Caniche der IV«. Das Französische klang hochtrabend, hieß aber auch nur Pudel. Der edel getrimmte Vierbeiner schaute Judith so erwartungsvoll in die Karten, als würde er tatsächlich etwas davon verstehen.
Estelles Fragen an die Zukunft waren momentan eher praktischer Natur: »Was glaubst du? Brauche ich einen Föhn? Bademantel? Handtücher? Schlafsack? Zelt? Sollen wir Verpflegung mitnehmen?«
Estelle gehörte zu den statistischen 21 Prozent, die auch 24 Jahre nach der Wende noch nie in den Osten der Republik gereist waren.
»Wir fahren nicht in die hintere Mongolei. Wir fahren nach Mecklenburg-Vorpommern. Das zählt zur zivilisierten Welt«, meine Judith.
»Ich habe nachgesehen«, korrigierte Estelle. »Nach EU-Standard gilt das Gebiet als unbesiedelt. 78 Einwohner auf einen Quadratkilometer.«
»Dafür 18.000 Seen«, ergänzte Judith.
Estelle, die gerade den Reißverschluss des Koffers zugezogen hatte, verschwand wieder in ihrem Ankleidezimmer. »Ich hab die Badesachen vergessen.«
»Du kannst jederzeit nackt ins Wasser springen. Das ist die ehemalige DDR. Die stehen auf FKK«, erklärte Judith.
»Ich bin über dreißig«, meinte Estelle, »da braucht man seinen Ganzkörperbikini.«
Oskar, der das Kartenset beschnüffelte, jaulte herzzerreißend auf. Judith konnte ihm nur recht geben.
»Und? Was erwartet uns?«, fragte Estelle und drängte sich neben Judith. Stand ihre Reise wirklich unter einem schlechten Stern?
»Die Karten stammen aus der Zeit des Biedermeier«, stammelte Judith. »Da kann man schon mal Probleme haben, die Bilder zu deuten.«
Estelle verunsicherte Judiths Ausweichmanöver. Sie bestand darauf, den Befund zu hören: »Ich habe ein Recht darauf, mein eigenes Schicksal zu erfahren«, betonte sie.
Das Klingeln des Telefons erlöste Judith von den inquisitorischen Fragen. Estelle nahm ab. Ihr Lächeln erstarb. »Es ist Eva«, flüsterte sie. »Sie hatte einen Unfall. Beinahe.«
»Das ist die Macht der Intuition«, bemerkte Judith beeindruckt, nachdem sie gehört hatte, was in der Schule passiert war. »Eva hatte längst begriffen, dass etwas nicht stimmt. Ihr Körper ist spontan der Gefahr ausgewichen, bevor das Gehirn überhaupt angesprungen ist.«
Evas Geschichte bewies eindrucksvoll, wie wichtig es war, die innere Stimme zu trainieren. Judiths Blick fiel wieder auf das Blatt, das einen Vorgeschmack auf die Reise nach Mecklenburg-Vorpommern geben sollte. Einem glücklichen Ausgang der gemeinsamen Unternehmung stand vor allem die Karte »Nº8. Falsche Person« entgegen. Dazu gesellten sich die Unheilsboten »Diebstahl« und »Traurige Nachricht«.
Nach Harmonie sah das nicht aus.
»Ein Mann wird unsere Freundschaft auf die Probe stellen«, versuchte Judith sich an einer Erklärung.
»Max?«, erkundigte sich Estelle.
»Eher ein fremder Mann«, meinte Judith.
Estelle ging ins Ankleidezimmer und öffnete erneut den Koffer: »Vielleicht sollte ich was Schickes mitnehmen«, sagte sie. »Man weiß ja nie, bei fremden Männern.«
5
»Und? Was war?«, fragte Caroline am Telefon. »Hast du das Bügeleisen angelassen?«
Sie saß noch immer an ihrem Schreibtisch in der Anwaltskanzlei, als Evas Anruf sie erreichte.
»Natürlich nicht«, klang Evas Stimme fröhlich aus dem Hörer. »Ich hatte heute gleich mehrere Schutzengel im Einsatz.«
Als ob sie Carolines kritischen Blick durch die Telefonleitung spürte, verteidigte Eva sich sofort. »Ich bin katholisch. Da darf man an himmlischen Einfluss glauben.«
Caroline war zu sehr Anwältin, um diese Ansicht zu teilen: »Das ist Pfusch am Bau, da muss man etwas unternehmen.« Ihre Erfahrung lehrte, dass es besser war, sich weder auf Gottes Fügung zu verlassen noch auf einen höheren Plan des Schicksals oder metaphysische Fledermäuse, die einen aus Notsituationen retten. Engel waren unzuverlässige Gestalten. Abends wenn ich schlafen geh, vierzehn Engel um mich stehn: Selbst in dem berühmten Abendlied, in dem sich vierzehn wachsame Engel um das Bett drängelten, waren zwei davon abgestellt, einen umgehend in den Himmel zu geleiten.
Eva wollte sich auf keine Diskussion über die juristischen Aspekte ihres Beinaheunfalls einlassen. »Mir ist nichts passiert. Es bleibt wie abgesprochen. Wir fahren zu Kiki. Morgen früh«, beendete sie das Telefongespräch. Sie klang atemlos und hektisch. Caroline vermutete, dass die Freundin unter Schock stand.
»Frau Seitz, Frau Seitz …«, hörte Caroline eine aufgeregte Stimme auf dem Gang rufen. Im selben Moment flog ihre Bürotür auf. Ein leichenblasses, durchsichtiges Wesen mit wallendem Umhang, weiß geschminktem Gesicht, tiefdunklen Augen und lila Lippen schwirrte in ihr Zimmer. Das Gespenst hieß Nora und war Carolines neuer Azubi. Ihre Noten waren erstklassig, Umgangsformen und Geschmack gewöhnungsbedürftig. Noras Vorstellung von ihrem neuen Beruf als Anwaltsgehilfin war von amerikanischen Serien beeinflusst, der Alltag in der Kanzlei bislang eine einzige große Enttäuschung. Zu viel Papier, zu wenig Adrenalin. So engagiert wie heute hatte Caroline das Mädchen noch nie erlebt. Aufgeregt wedelte sie mit einem Brief.
Caroline erkannte die Machart auf den ersten Blick. Ein Drohbrief. Mal wieder.
»Ich mach dich tot« stand auf dem Papier. Die Schrift war rot zerlaufen.
»Ist das Blut?«, platzte Nora aufgeregt heraus. Sie war sichtlich begeistert, dass endlich etwas passierte, was mit CSI mithalten konnte.
»Roter Edding«, meinte Caroline nach einer kurzen Geruchsprobe.
Nora sackte enttäuscht in sich zusammen. »Aber das ist doch eine ernst zu nehmende Drohung, oder?«
Caroline spielte den Vorfall herunter: »Was glauben Sie, wie viele solcher Schreiben die Kanzlei im Lauf der Jahre erhalten hat? Ganze Ordner voll.« Sie versuchte, so neutral wie möglich zu klingen. Wer Mörder und andere Schwerverbrecher verteidigte, musste damit rechnen, selbst zur Zielscheibe zu werden.
»Gehen Sie ins Kino und vergessen Sie den Mist«, empfahl sie. »Wir sehen uns nach meinem Urlaub.«
Nora entschwand desillusioniert. Caroline atmete tief durch. Seit dem Beginn ihrer Karriere kannte sie die Situation, bedroht, beschimpft und angegriffen zu werden. Das war alles nichts gegen die Hetzkampagne, die sie in den letzten Monaten aushalten musste. Caroline war in einem aufsehenerregenden Entführungsfall zur Pflichtverteidigerin berufen worden. Ein kleines Mädchen war am helllichten Tag aus einem öffentlichen Schwimmbad verschwunden und zwei Tage später vollkommen verwirrt in einem Straßengraben aufgefunden worden. Caroline hatte für den mutmaßlichen Kidnapper einen Freispruch mangels unwiderlegbarer und stichhaltiger Beweise erwirkt. Der Verdächtige war vorbestraft, das Opfer niedlich und der Volkszorn gegen die Verteidigerin gewaltig. Caroline wurde überspült von Beschimpfungen und Drohungen. Per E-Mail, Telefon und Brief, selbst auf der Straße gingen Fremde sie an. Vor drei Tagen hatte Caroline eine halb verweste Ratte in ihrem Briefkasten gefunden. »Deine Zeit läuft ab. Ich komme dich bald besuchen« stand auf dem beiliegenden Zettel. Geschrieben mit blutrotem Edding. Das Gefühl, selbst zu Hause nicht mehr sicher zu sein, hatte ihr den Rest gegeben. Die unsichtbare Gefahr begleitete sie vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
Als sie am Abend zu ihrem Auto ging, fiel ihr auf, wie unübersichtlich und schlecht beleuchtet der Parkplatz ihrer Kanzlei war. Tagsüber spielten Kinder auf dem Stück Brachland, abends führten Hundebesitzer ihre kleinen Lieblinge aus, die mit manch heimlichem Liebespaar um einen Platz im Dunkel der Büsche konkurrierten. Überall konnte sich jemand in dem undurchdringlichen Gestrüpp verborgen haben. Du bist paranoid, Caroline, sagte sie sich und beschleunigte trotzdem ihren Schritt. Sie konnte mit offenen Auseinandersetzungen umgehen, mit verbalen Scharmützeln und Konflikten. Der unsichtbare Gegner zermürbte sie zunehmend. Sie lauschte in die Finsternis, spähte in die dunklen Ecken und probierte, tanzende Schatten zu deuten. Der Verstand befahl ihr, Ruhe zu bewahren. Die Drohbriefe, das sagte ihre Erfahrung, kamen von jemandem, der die direkte Konfrontation scheute, jemand, der Angst hatte, ihr in die Augen zu sehen und die Beschimpfungen zu wiederholen. Ein Feigling, der den direkten Kontakt fürchtete. Nichts würde passieren. Ihrem Angstzentrum waren solche Gedankengänge egal. Das Dauerfeuer an Kritik, dem sie ausgesetzt war, hatte sie dünnhäutig gemacht. Caroline hatte schon fast das Auto erreicht, als sie in ihrem Rücken Schritte hörte. Kleine, schnelle Schritte. Da lief jemand. In ihre Richtung. Hektisch kramte sie in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel. Ihre Finger suchten hilflos zwischen Unterlagen, Terminkalender, Kopfschmerztabletten, Taschentüchern, Handcreme und der Post von vier Tagen, bevor sie endlich den Schlüssel ertasteten. Die Schritte in ihrem Rücken klangen schon ganz nah. In dem Moment, in dem sie den Schlüssel ins Schloss steckte, traf sie etwas am Hinterkopf. Hart. Schmerzhaft. Plötzlich. Caroline versuchte sich zu orientieren. Sie brauchte ein paar Sekunden, um zu merken, dass es nur ein Fußball war, der sie mit voller Wucht getroffen hatte. Sie drehte sich blitzschnell um. In der Hecke raschelte es verdächtig. Ein weißes Gesicht leuchtete aus dem Blättermeer. Caroline war so wütend, dass sie direkt auf den Schützen zuging und den Verursacher mit eiserner Hand am Schlafittchen aus dem Dunkel zerrte. Es war ein Junge, kaum vierzehn Jahre alt. Er hatte rote Haare, rote Sommersprossen und war ziemlich untersetzt.
Caroline verlor die Beherrschung: »Was glaubst du, was das ist? Ein Computerspiel, bei dem man Leute abknallt?«
In den Augen des Jungen stand nackte Panik. Er roch nach Pommes und Schweiß.
»Ich wollte das nicht«, stammelte er. »Ich wollte die Mülltonne treffen. Nur die Mülltonne. Ich bin nicht gut in Fußball. Fragen Sie den Trainer. Ich sitze die meiste Zeit auf der Bank.«
»Wissen deine Eltern, dass du dich so spät noch auf der Straße rumtreibst?«
Carolines Schädel brummte. Sie konnte nicht beurteilen, wie laut sie sprach.
»Ich hab Pommes gegessen. Am Kiosk. Hab ich selber bezahlt. Vom Taschengeld.«
Der Junge brach in Tränen aus. Er trug das grün-weiße Fußballshirt, das Caroline noch von früher kannte. Ihr Sohn Vincent hatte als Kind beim SC Borussia Lindenthal-Hohenlind gespielt, jetzt kickten Evas Söhne bei dem Kölner Traditionsverein. Wie oft war Vincent zu spät nach Hause gekommen, weil er auf dem Heimweg vom Fußballtraining drei Filialen von McDonald’s passieren musste? Caroline ließ schuldbewusst von dem kleinen Fußballspieler ab.
Der heulte einfach weiter: »Sie dürfen meinen Eltern nicht verraten, dass ich an der Imbissbude war. Ich muss immer zum Diätschwimmen. Weil ich zu dick bin.«
Caroline fühlte sich schlecht. Seit Wochen stand sie unter Druck und nun ließ sie ihren Ärger an einem Jungen aus, der ihr nichts entgegenzusetzen hatte als Stammeln, Stottern und Schluchzen.
»Es bleibt unter uns«, versprach sie.
Sie hatte überreagiert. Wegen eines verirrten Fußballs. Was konnte dieser arme Junge für ihre Probleme? Der kleine Sportler murmelte eine Entschuldigung und machte sich so schnell wie möglich vom Acker.
Müde ließ Caroline sich auf den Fahrersitz fallen. Ihr Schädel brummte. Ihr Gehirn hatte sich vom Schlag noch nicht erholt, der Nacken schmerzte. Das Telefon klingelte. Erschöpft nahm sie ab.