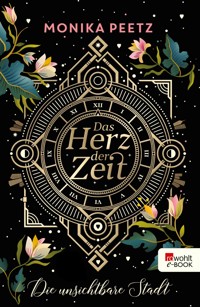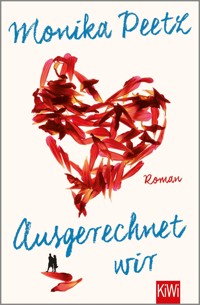9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die-Dienstagsfrauen-Romane
- Sprache: Deutsch
Die Fortsetzung des Bestsellers »Die Dienstagsfrauen« Die Dienstagsfrauen gehen fasten. Fünf ungleiche Freundinnen, ein gemeinsames Ziel: Entschleunigen, entschlacken, abspecken, so lautet das Gebot der Stunde. Zu ihrem jährlichen Ausflug checken die Dienstagsfrauen im einsam gelegenen Burghotel Achenkirch zum Heilfasten ein. Sieben Tage ohne Ablenkung. Kein Telefon, kein Internet, keine Männer, keine familiären Anforderungen und beruflichen Verpflichtungen. Leider auch sieben Tage ohne Essen. Theoretisch jedenfalls. Quälender Heißhunger, starre Regeln und nachreisende Probleme führen zu immer neuen Heimlichkeiten und gefährden jeden Therapieerfolg. Statt Entspannung gibt es Missverständnisse, Streit und schlaflose Nächte. Die schwerste Prüfung jedoch steht Eva bevor. Hinter den dicken Burgmauern begibt sie sich auf die Suche nach ihrem unbekannten Vater. Sie entdeckt, dass man manche Familiengeheimnisse besser ruhen ließe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Monika Peetz
Sieben Tage ohne
Die Dienstagsfrauen gehen fasten
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Monika Peetz
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Monika Peetz
Monika Peetz, geboren 1963, Studium der Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Philosophie an der Universität München. Nach Ausflügen in die Werbung und das Verlagswesen von 1990–98 Dramaturgin und Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, Redaktion Fernsehfilm. Seit 1998 Drehbuchautorin in Deutschland und den Niederlanden. Jüngste Filmprojekte: »Und weg bist du« (2012) mit Christoph Maria Herbst, Annette Frier und Emma Schweiger. »Deckname Luna« (gemeinsam mit Christian Jeltsch), in den Hauptrollen: Anna Maria Mühe, Götz George und Heino Ferch (2012).
Monika Peetz’ Debütroman »Die Dienstagsfrauen« verkaufte sich innerhalb eines halben Jahres über 700.000 Mal, steht seit Monaten unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde erfolgreich verfilmt mit Ulrike Kriener, Nina Hoger, Inka Friedrich und Saskia Vester. Übersetzungsrechte an »Die Dienstagsfrauen« wurden in 13 Länder verkauft.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Fortsetzung des Bestsellers »Die Dienstagsfrauen«
Die Dienstagsfrauen gehen fasten.Fünf ungleiche Freundinnen, ein gemeinsames Ziel: Entschleunigen, entschlacken, abspecken, so lautet das Gebot der Stunde. Zu ihrem jährlichen Ausflug checken die Dienstagsfrauen im einsam gelegenen Burghotel Achenkirch zum Heilfasten ein. Sieben Tage ohne Ablenkung. Kein Telefon, kein Internet, keine Männer, keine familiären Anforderungen und beruflichen Verpflichtungen. Leider auch sieben Tage ohne Essen. Theoretisch jedenfalls. Quälender Heißhunger, starre Regeln und nachreisende Probleme führen zu immer neuen Heimlichkeiten und gefährden jeden Therapieerfolg. Statt Entspannung gibt es Missverständnisse, Streit und schlaflose Nächte. Die schwerste Prüfung jedoch steht Eva bevor. Hinter den dicken Burgmauern begibt sie sich auf die Suche nach ihrem unbekannten Vater. Sie entdeckt, dass man manche Familiengeheimnisse besser ruhen ließe …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2012, 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Barbara Thoben, Köln
ISBN978-3-462-30536-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
Zum Schluss
Leseprobe »Ausgerechnet wir«
Für Heide und Karl-Heinz Peetz
1
Es war einer dieser Tage. Eva hatte den Frühdienst in der Klinik hinter sich, die vier Kinder stritten lautstark, wer an den Computer durfte, und Ehemann Frido, der versprochen hatte, sich um das Abendessen zu kümmern, war im Büro hängen geblieben. In eineinhalb Stunden musste sie im Le Jardin sein, bei »ihrem« Franzosen. Seit Tagen freute Eva sich auf den entspannten Abend mit den Dienstagsfrauen. In sechzehn gemeinsamen Jahren war aus den fünf Frauen, die zu Beginn nichts verband außer dem Wunsch, am Kölner Institut Français Französisch zu lernen, eine eingeschworene Gemeinschaft geworden. Die Dienstagsfrauen hatten Stürme, Schicksalsschläge und eine gemeinsame Pilgerreise nach Lourdes überstanden. Es war nicht immer einfach, mit den Freundinnen auszukommen. Heute hatte Eva das Problem, überhaupt zu ihnen hinzukommen.
Eva kämpfte sich durch eine endlose Liste an Aufgaben und die sechsfache Terminplanung ihrer Familie. Sie hatte nach der Pilgerreise wieder angefangen, als Ärztin zu arbeiten. Leider hatte das Wasser aus der heiligen Quelle weder Ehemann Frido in einen Küchenprinzen verwandelt noch drei pubertierende Teenager und eine Zehnjährige zu willigen Haushaltshilfen umgeformt. Als die Türklingel schrillte, schwante Eva nichts Gutes. Jeder regelmäßige Gast in ihrem Leben wusste, dass die Haustür immer offen stand. Reine Selbstverteidigung bei vier Kindern mit chronischer Neigung zum Verlegen ihrer Schlüssel und ausgeprägtem Sozialleben. Es gab nur einen Menschen, der grundsätzlich klingelte und erwartete, dass die Tür höchstpersönlich für ihn geöffnet wurde. Eva stöhnte auf. Kein Zweifel, das konnte nur ihre Mutter sein. Seit Regine vor eineinhalb Jahren die Rente eingereicht hatte, war sie voll und ganz für Eva da. Zu voll. Zu ganz. Auf kleinbürgerliche Rituale wie die vorherige telefonische Anmeldung von Besuchen verzichtete sie.
Regine klingelte nicht, Regine sandte Morsezeichen, die an den Triumphmarsch aus Aida erinnerten. Eva liebte ihre Mutter. Nur nicht immer. Und ganz sicher nicht an einem ersten Dienstag im Monat, wenn sie wie seit sechzehn Jahren mit ihren Freundinnen im Le Jardin verabredet war. Eva wünschte sich, sie könne entschieden Nein sagen. Stattdessen rang sie sich ein Lächeln ab und öffnete. In der Tür lehnte lässig ein zweiundsechzigjähriges Hippiemädchen in bodenlangem, groß geblümtem Rüschenrock, um den Hals unzählige Ketten mit riesigen Anhängern. Unter einem ausladenden Sommerhut lugten lange blonde Zöpfe hervor. Dazu trug Regine indische Ledersandalen.
»Deine Großmutter hat all meine Sachen von früher aufgehoben«, erklärte Regine. »Das Zeug hat so lange auf dem Dachboden gelegen, dass es wieder modern ist.«
Regine bewohnte seit Jahren das ererbte Elternhaus in Bergisch Gladbach. Als Neu-Rentnerin latent unausgelastet, richtete sich ihr Tatendrang gegenwärtig auf den übervollen Speicher, der jahrzehntelang im Dornröschenschlaf gelegen hatte.
»Typisch Kriegsgeneration. Deine Oma Lore konnte nichts wegwerfen«, sagte Regine. »Alles noch da, meine ganze Vergangenheit. Na, sag schon, wie findest du mein Outfit?«
»Ich muss in einer Stunde im Le Jardin sein«, wehrte sich Eva schwach. Regines Mitteilungsbedürfnis überstieg ihr Einfühlungsvermögen. Sie winkte mit einem vergilbten Ratgeber.
»Ich hab auf dem Speicher ein altes Buch von mir gefunden. Traditionelle chinesische Heilkunst. Sehr erhellend«, sagte Regine und stolperte in Richtung Küche.
»Habe wohl abgenommen«, meinte sie, zog den Rock höher und musterte Evas schlabbrigen Jogginglook. Der Blick genügte, um Evas schlechtes Gewissen zu wecken. Seit Jahren befand sich Eva im täglichen Kampf mit Kalorien, Kilos und dem Konterfei, das ihr aus dem Spiegel entgegenblickte. Eva war glücklich, wenn sie die Hälfte ihrer täglichen Aufgabenliste bewältigt hatte. Grundsätzlich auf der Strecke blieben Programmpunkte wie ›mit dem Fahrrad in die Klinik fahren‹‚ ›anmelden im Fitnesscenter‹ oder ›endlich mit der Ananasdiät anfangen‹. Ihr Kleiderschrank glich einem Museum, gewidmet dem dünnen Mädchen, das sie einst gewesen war. Dummerweise hatte sie von der dünnen Eva nicht viel mitgekriegt. Selbst als sie noch schlank war, hatte sie sich dick gefühlt. Gesellige Einkaufsbummel mit den Dienstagsfrauen waren für Eva eine Qual. Umkleidekabinen ohne Spiegel, Labels, die nur Größe 36 führten, und Hosen, die selbst in XXL kniffen. Während ihre Freundinnen mit vollen Tüten nach Hause kamen, kehrte Eva in der Regel mit einer Sonnenbrille, einem Schal und einem Blech Butterkuchen zurück.
»Von einer Frau, die man liebt, kann man nie genug haben«, tröstete Frido, wenn Eva den Reißverschluss am Kleid nicht mehr zubekam. Ihre Mutter war in der Regel weniger zurückhaltend. Heute beließ sie es bei einem Blick. Sie hatte ein anderes Thema.
»Mir war nicht klar, wie viele Ressourcen der Westen brachliegen lässt«, ereiferte sich Regine. »Unsere Gesellschaft geht zugrunde. Und alles nur, weil wir einen falschen Blick auf das Thema Krankheit haben.«
Eva war es egal, woran das Abendland unterging. Bevor sie ins Le Jardin konnte, musste der Abwasch aus der und die Dreckwäsche in die jeweilige Maschine. Wenn sie sich der Schmutzwäsche nicht vor dem Abendessen widmete, stand Frido jr. morgen früh in Unterwäsche beim Sportunterricht und Frido sr. ohne Hemd in der Vorstandssitzung.
»Ich habe mich informiert«, fuhr Regine fort. »Man kann eine Zusatzausbildung in Chinesischer Naturheilkunde machen. Berufsbegleitend. Das wär was für dich.«
Eva hatte unzählige Seminare besucht, um ihre medizinischen Kenntnisse auf den neuesten Stand zu bringen. Der pure Gedanke an eine weitere Fortbildung ließ sie fast zusammenbrechen.
»Ich fülle die Waschmaschine, du machst dich frisch«, schlug Regine vor, deren Adleraugen den bereitstehenden Wäschekorb erspäht hatten. »Wir trinken eine Tasse Tee, und dann verschwinde ich.« Regine zog ein Päckchen aus ihrem bunt bestickten Stoffbeutel.
»Tee der heiteren Ungezwungenheit«, las sie vor. »Extra besorgt für dich.«
Eva war eine geschätzte Ärztin, sie konnte Patienten beruhigen, aufgeregte Familienangehörige trösten, sie managte neben einer Arbeitszeit von 19,25 Stunden einen sechsköpfigen Haushalt – gegen ihre Mutter war sie wehrlos.
Während sie sich hastig im Schlafzimmer umzog, lauschte sie angestrengt, was Regine in der Küche anstellte. Man konnte nie sicher sein, ob sie nicht nebenbei die Ordnung in den Schränken optimierte. Regine beriet Eva in allen Lebenslagen. Gratis und ungefragt. Bunte Wortgirlanden täuschten darüber hinweg, wie massiv ihre Mutter sich einmischte. Reginesätze begannen mit Floskeln wie: »Du weißt, ich bin tolerant, aber wenn ich dir einen Tipp geben darf …«
»Du musst das natürlich so machen, wie du willst. Ich gebe allerdings zu bedenken …«
Regines Spontanbesuche bei Eva entfalteten die Wirkung eines mittleren Tornados. Sie tauchte überfallartig aus dem Nichts auf, fegte durch Evas Leben und hinterließ ein emotionales Trümmerfeld. Bis zum nächsten Mal. Das Schlimmste war: Regine meinte es wirklich gut mit Eva. Nach zwei gescheiterten Kurzehen, traurigen Affären und dem Ende ihrer krummen beruflichen Laufbahn hungerte Regine danach, für jemanden wichtig zu sein.
Flapp, flapp, flapperdiflapp platschten Regines Sandalen über die Küchenfliesen, begleitet vom beständigen Geklimper der Halsketten. Eva hörte, wie Schubladen auf- und zugingen, Wasser rauschte, der Kessel aufgesetzt wurde. Dann quietschte die Kellertür. Regine stieg fröhlich vor sich hin pfeifend die Treppe hinunter zur Waschküche. Plötzlich ein Fluchen, ein markerschütternder Schrei, das Geräusch des fallenden Wäschekorbs, der gegen das Geländer schlug, dumpfes Gepolter, und dann nichts mehr. Kein Schritt. Kein Ton. Nichts. Evas Herz setzte aus. Sie rannte aus dem Schlafzimmer und stürzte zur Treppe, ein Bein schon in der Jeans, das andere Hosenbein schleifte über den Boden hinter ihr her.
»Mama«, schrie sie Richtung Keller. »Sag was. Mama.«
Eva fühlte, wie ihre Beine wegsackten. Regine war anstrengend, aber immer voller Pläne und Leben. Das durfte jetzt nicht passieren. Nicht jetzt. Nie. Warum hatte sie sich nicht einfach mit ihrer Mutter in die Küche gesetzt und Tee getrunken? Warum hatte sie Regine die Wäsche überlassen?
Das monotone Geräusch des Computerspiels, typisches Hintergrundgeräusch vieler Nachmittage, war verstummt. Die vier Kinder hatten sich in der Diele versammelt. Oft kamen sie Eva groß und erwachsen vor. Jetzt blickte sie in vier Paar verängstigte Kinderaugen.
»Ihr bleibt hier«, befahl Eva kurzerhand. Dabei machte keines der Kinder Anstalten, in den Keller zu gehen, um nachzusehen, was mit Oma war.
Diese entsetzliche Stille. Wenn ihr nur nichts passiert war. Wenn nur alles gut war mit Regine. Aus den Tiefen von Evas Unterbewusstsein stieg ein überraschender Gedanke empor: Jetzt werde ich nie mehr erfahren, wer mein Vater ist. Eva erschrak über sich selbst, während sie mit zittrigen Knien in den Keller stieg. Seit Jahren überkam Eva die Frage nach der eigenen Herkunft wie Ebbe und Flut. Es gab Zeiten, da war sie so beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, dass es ihr unwichtig vorkam, unter welchen Umständen es begonnen hatte. Dann gab es Phasen, in denen sie glaubte, nicht wachsen zu können, ohne ihre Wurzeln zu kennen. Als Teenager hatte sie ihren Vater schmerzlich vermisst. Dabei kannte sie nicht einmal seinen Namen. Regine erstickte jede Frage mit hartnäckigem Schweigen. War es Enttäuschung, die Regine verstummen ließ? Wut? Trauer? Waren es verletzte Gefühle? Warum wollte ihr Vater kein Vater sein? Es war erstaunlich, wie viele Gedanken gleichzeitig in den winzigen Moment passten, bis sie ihre Mutter erreichte.
Regine lag am Ende der Treppe in merkwürdig verdrehter Haltung. Jäh wurde Eva klar, dass sie ohne Regine nie mehr eine Antwort auf ihre Lebensfrage bekommen würde. Eine Sekunde später fiel ihr ein, dass es auch mit Regine keine Klärung geben würde.
Ihre Mutter krümmte sich vor Schmerzen. Das linke Bein war nach außen gedreht, Regine konnte weder liegen noch sitzen oder stehen. Nur schimpfen: »Ich gehe nicht ins Krankenhaus«, tönte es höchst lebendig, als Eva sich über Regine beugte. »Auf keinen Fall.«
»Ruft einen Krankenwagen«, schrie Eva nach oben.
Eva vergaß, dass es Dienstag war. Der erste Dienstag im Monat. Sie war plötzlich ganz ruhig. Als Ärztin wusste sie, was zu tun war.
2
»Wo bleiben die Damen nur?«, fragte Luc. Ratlos blickte der Besitzer des französischen Restaurants Richtung Tür. Judith war die Einzige, die zur abgesprochenen Zeit im Le Jardin erschienen war. Judith hatte weder Familie noch einen Partner oder einen anspruchsvollen Beruf. Sie hatte nichts und niemanden, der sie davon abhielt, pünktlich zu sein. Alleine an einem eingedeckten Fünfertisch zu sitzen, war eine Qual für Judith. Nervös rutschte sie auf ihrem Stuhl herum. Sie fühlte die mitleidigen Blicke der anderen Gäste. Wenn sie wenigstens ein Smartphone hätte. Wer online war, wirkte beschäftigt und wichtig. Judith besaß nur ein altes Telefon, mit dem man nichts anderes tun konnte als Anrufe tätigen und SMS senden und empfangen. Und selbst das schaltete sie nur selten ein. Wegen der Strahlung – und weil es sinnlos war. Seit ihr Mann Arne gestorben war, schwieg das Telefon die meiste Zeit.
»Soll ich dir schon was bringen?«, fragte Luc.
Judith schüttelte den Kopf. Sie hasste es, alleine zu essen.
»Caroline muss jeden Moment da sein«, tröstete Luc. »Die ist immer pünktlich.«
»Caroline trifft vermutlich noch einen Mandanten«, meinte Judith.
Die erfolgreiche Strafverteidigerin arbeitete seit der Pilgerreise mehr denn je.
»Ich frage mich, ob Caroline überhaupt auffällt, dass sie von ihrem Mann getrennt lebt«, witzelte Estelle manchmal.
Judith lachte nicht. Sie war die Letzte, der es zukam, Scherze über Caroline zu reißen. Schließlich hatte Judith ihren unrühmlichen Anteil am Scheitern der Ehe von Philipp und Caroline. Als Arne an Krebs starb, hatte sie Trost in den Armen von Carolines Ehemann gesucht. Philipp war erst ihr Hausarzt, dann freundschaftlicher Berater, schließlich ihr Geliebter. Auf der Pilgerreise war die geheime Affäre aufgeflogen. Wie sich herausstellte, war sie weder seine exklusive noch die letzte Geliebte. Philipp verschwand aus Judiths Leben. Das schlechte Gewissen blieb ihr täglicher Begleiter. Leider ihr einziger.
Luc stellte ihr einen kleinen Vorspeisenteller hin. Er war einfach wunderbar. Seit der Lourdes-Reise arbeitete Judith vier Tage die Woche im Service des Le Jardin. Am ersten Dienstag des Monats aber ließ sie sich als Gast bedienen. Früher galt ein Job in der Gastronomie als stressig. Heute erschien ihr das Le Jardin als Insel der Glückseligen. Judith hatte als Kellnerin einen der wenigen Jobs, in dem das Wort Feierabend noch eine Bedeutung besaß. Sie musste nicht, wie die Freundinnen, ständig, überall und rund um die Uhr E-Mails beantworten oder für Rückfragen zur Verfügung stehen. Selbst Estelle, die es sich als reiche Apothekersgattin gönnte, auf echte Arbeit zu verzichten und alle unangenehmen Aufgaben zu delegieren, hatte Stress. Wider besseres Wissen hatte sie sich einspannen lassen, bei der großen Charity-Gala des Golfclubs in verantwortlicher Funktion mitzuarbeiten. Seitdem stand sie unter Strom. Allein die Frage, was sie zu diesem Anlass tragen sollte, kostete sie den letzten Nerv.
»Sie kommen schon noch«, tröstete Luc, als er ein zweites Glas Prosecco brachte. »Geht aufs Haus.«
Zu schade, dass sie sich nicht in Luc verlieben konnte. Ein einziges Mal hatte Judith versucht, ihm von ihren Problemen zu erzählen. Davon, dass sie oft das Gefühl hatte, nicht mit den Freundinnen mithalten zu können.
»Ich versteh das«, hatte Luc geantwortet und dabei seinen tiefsinnigsten Blick aufgesetzt. »So geht’s mir auch. Jedes Mal, wenn der 1. FC Köln gegen den FC Bayern aufläuft.«
Judith war froh, dass es wenigstens Kiki gab, die, ähnlich wie sie selbst, um Balance im Leben rang. Kiki, die Designerin, hatte neben dem erfolgreichen Entwurf einer Vasenserie ein besonderes Andenken an ihre gemeinsame Pilgerreise mitgebracht. Ihr Andenken hieß Greta, war sechseinhalb Monate alt und der Grund, warum es ausgerechnet mit Max Thalberg ernster geworden war als mit seinen zahlreichen Vorgängern. Dabei war Max erst vierundzwanzig und dazu der Sohn von Kikis Chef. Ex-Chef, mittlerweile. Hatte ihr Liebernichtschwiegervater gehofft, Kiki würde das Leben seines Stammhalters streifen wie eine schwere Bronchitis, heftig, aber vorübergehend, belehrte ihn die schnelle Ankunft von Enkelin Greta eines Besseren. Kiki und Max teilten Bett, Tisch, Haushalt und Geldsorgen. Und waren trotzdem der Meinung, dass Greta das Beste war, was ihnen im Leben passiert war. Judith beneidete ihre Freundinnen um ihre bunten, vollen Leben.
Als sie um halb zehn mit vier Proseccos und einem Teller Brot und Oliventapenade im Magen unverrichteter Dinge nach Hause wankte, entdeckte Judith, dass sie vier neue SMS erhalten hatte. Sie wollte gar nicht lesen, warum keine der Freundinnen es bis ins Le Jardin geschafft hatte. »So geht es nicht weiter«, schrieb sie. »Lasst uns ein paar Tage gemeinsam wegfahren, bevor der Alltag alles verschluckt.«
3
Wegfahren? Jetzt? Mit den Freundinnen? Eva nahm Judiths SMS nur flüchtig wahr. Seit Regines Sturz war sie nicht mehr zum Nachdenken gekommen. Krankenhaus, Notaufnahme, Röntgen – alles musste schnell gehen. Zum Glück hatte Regine sich nicht das Genick gebrochen, sondern nur den Oberschenkelhals. Die Saumlänge, die nicht mehr zur Körperlänge passte und den Sturz ausgelöst hatte, deutete an, was die Untersuchungen der nächsten Tage bewiesen. Auch wenn Regine es nicht einsehen wollte: Es war nicht Evas lebensgefährliche Treppe, sondern eine postklimakterische Osteoporose, die sie ein paar Zentimeter an Körpergröße gekostet und den verhängnisvollen Stolperer verursacht hatte.
»Eine chronische Erkrankung nach den Wechseljahren, in deren Verlauf die Knochenmasse allmählich abnimmt«, erklärte Eva so vorsichtig wie möglich. »Das Skelett wird instabil und porös. Irgendwann brechen die Knochen.«
»Oma hat was am Klimakterium«, postete Evas jüngste Tochter auf ihrem Facebook-Account, nachdem Eva ihrer Familie telefonisch Bericht erstattet hatte. »Aber mit dem schlechten Wetter hat das nichts zu tun.«
»Eine typische Alterskrankheit«, sagte der behandelnde Arzt wenig diplomatisch.
»Von dem inkompetenten Lackaffen lass ich mich nicht behandeln«, beschloss Regine. Lieber ging sie in ein anderes Krankenhaus. Am liebsten dorthin, wo ihre Tochter arbeitete. Dann konnte Eva während der Arbeitszeit öfter bei ihr vorbeisehen.
»Ich kümmere mich darum«, versprach Eva. Sie kümmerte sich um alles. Um die Verlegung, um die organisatorischen Details, um die lange Liste von Dingen, die Regine brauchte, um die Zeit im Krankenhaus zu überstehen, und um den Rock mit den Volants.
»Verbrenn das Teil«, bestimmte Regine, »die ganze Garderobe von früher. Der alte Krempel vom Dachboden muss weg.«
»Deine Großmutter hat all meine Sachen von früher aufgehoben«, klang es in Eva nach, als sie im Auto saß, um Regines Sachen aus Bergisch Gladbach zu holen. »Alles noch da, meine ganze Vergangenheit.«
In früheren Jahren hatte Eva jede Gelegenheit ergriffen, in Regines ungeordneten Unterlagen nach Spuren ihres Erzeugers zu schnüffeln. Sobald ihre Mutter im Urlaub war und Eva sich um Pflanzen und Post kümmerte, stöberte sie in den alten Kartons, in denen Regine Zeugnisse, Atteste und Briefe aufbewahrte. Auf die Idee, in der Hinterlassenschaft ihrer Großeltern zu suchen, war sie nie gekommen.
Bergisch Gladbach fühlte sich für Eva fremd und vertraut zugleich an. Sie hatte ihre ersten fünf Lebensjahre im Bussardweg bei den Großeltern verbracht. Drei Generationen unter einem Dach. Eva war ein uneheliches Kind mit einer minderjährigen Mutter. Das sorgte damals in den Sechzigern durchaus für böses Getuschel unter den Nachbarn. Einen Tag nach ihrem einundzwanzigsten Geburtstag flüchtete Regine mit ihrer kleinen Tochter nach Köln. Es folgte das, was Regine heute mit »meine unordentlichen Jahre« umschrieb. Von unbändigem Lebenswillen getrieben, probierte sie aus, was ihr in den Weg kam: Wohnformen, Jobs, Männer, Ideologien. Vieles war weder jugendfrei noch kindertauglichn. Eva verbrachte nach wie vor viel Zeit bei ihren Großeltern in Bergisch Gladbach. Regine parkte sie oft wochenlang bei Oma Lore und Opa Erich, während sie sich selbst, ihre Mitte und den Sinn des Lebens in indischen Aschrams suchte.
Äußerlich hatte sich die schnörkellose Doppelhaushälfte am Bussardweg seit Evas Kindertagen kaum verändert. Alles an dem Haus war viereckig, gerade und vernünftig: sechsfach unterteilte Sprossenfenster, eine klobige Gaube im groben fensterlosen Satteldach, ein massiver Vorbau mit Treppe und gemauertem Vordach. Schnörkellos, streng und rechtschaffen wie der Großvater, der Chefbuchhalter der Maschinenwerke Anton Dorsch gewesen war. Der Buddha im Garten und die bunte indische Girlande täuschten nicht darüber hinweg, dass der Bau schon einmal bessere Zeiten gesehen hatte.
»Warum streicht Regine nicht?«, fragte Frido jedes Mal, wenn sie auf Besuch kamen.
»Kein Geld, keine Freiwilligen«, fasste Evas die Lage zusammen.
Die Renovierungswut, die die ehemalige Werkssiedlung der Dorsch’schen Maschinenwerke in den letzten Jahren erfasst hatte, war am gräulichen Putz des Hauses spurlos vorübergezogen. Selbst die lauten Gitarrenriffs und das dröhnende Schlagzeug, die aus der Garage nebenan klangen, wirkten wie ein Gruß aus der Vergangenheit: »Love me tender, love me sweet«, säuselte eine tiefe Männerstimme.
Eva hatte den Wagen kaum geparkt, da flog die Garagentür auf. Der Leadsänger der Rentnerband »Schmitz & Friends«, ein Herr Ende sechzig mit schwarzer Hornbrille, Koteletten und Haaren, die im Nacken auf die Schultern fielen, hatte Eva kommen hören: »Was ist los? Ist was mit Regine? Sie ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen.«
Henry Schmitz war ein paar Jahre älter als Regine. Ihre Väter hatten beide in der Maschinenfabrik gearbeitet. Sie hatten schon als Kinder nebeneinandergelebt, als Erben taten sie es wieder. Sie waren gemeinsam jung. Nun wurden sie gemeinsam alt. Jeder in seiner Hälfte des Doppelhauses.
»Regine war gestern nicht beim Grillabend. Wir machen uns große Sorgen«, rief seine Frau, die kugelrunde, kleine Olga Schmitz, aus dem Küchenfenster. Die soziale Kontrolle in der Vogelsiedlung funktionierte tadellos.
Eva kannte das Nachbarsehepaar schon ihr ganzes Leben. Regines Treppensturz und der jähe Gedanke an die fehlende Vaterfigur spülte ihre Vergangenheit hoch. Und Gefühle, die sie längst hinter sich gelassen zu haben glaubte. Sie spürte in sich wieder das kleine Mädchen, das neidvoll auf die Nachbarsfamilie schaute. Die Schmitzens waren die traditionelle Familie, die Eva nie hatte. Vater, Mutter, drei Mädchen, ungefähr in Evas Alter. Die wuselige kleine Frau Schmitz, die schon in jungen Jahren ziemlich rund war, trug immer Schürze. Sie kochte, buk, strickte und nähte, während Henry Schmitz mit den drei Kindern im Garten tobte. Bei Oma Lore wurde aus der Bibel vorgelesen, die Nachbarn sangen Schlager. Ihr Großvater war Verwaltungshengst, Schmitz der Praktiker. Er konnte alles. Lampen anschließen, Baumhäuser bauen und Fahrradreifen flicken.
»So wie die Schmitzens will ich nie leben«, hatte Regine in den Kölner Anfangsjahren oft gesagt. Während sie durch die Weltgeschichte, Kontinente und Lieben segelte, ging Schmitz den Weg aller Schmitzens. Er arbeitete bei Dorsch. Für Regine der Inbegriff bürgerlicher Langeweile: »Der ist gedanklich nie aus dem Bussardweg rausgekommen. Das ganze Leben bei einer Frau und Firma. Entsetzlich.«
Eva fand die beiden wunderbar. Einmal hatte Schmitz sie an einem Regentag in seinem türkisfarbenen Opel Kapitän zu ihrer Kölner Schule gefahren. Da war sie neun und Regine zum ersten Mal für Wochen verschwunden. Eva war stumm geblieben, als ihre neugierigen Mitschülerinnen ihn für den mysteriösen Vater hielten. Sie malte sich aus, dass sie mit der ältesten Tochter vertauscht worden sei. Schließlich war sie viel musikalischer als das Nachbarsmädchen. Heimlich sang sie mit, wenn Schmitz nebenan lauthals mit seinen Kindern Schlager schmetterte. Manchmal, wenn sie jetzt mit ihren vier Kindern im Wohnzimmer saß, David am Klavier, Lene mit der Gitarre und Frido jr. und Anna sangen, erinnerte Eva sich daran, wie sie als Kind sehnsüchtig nach den Liedern gelauscht hatte. Sie war froh, das einsame Mädchen hinter sich gelassen zu haben. Sie war dort angekommen, wo die Musik spielte. In ihrer eigenen Familie.
»Ich backe einen Kuchen«, beschloss Frau Schmitz, nachdem Eva die Geschichte von Regines Sturz erzählt hatte. »Den Mohnkuchen, den mag Regine besonders.«
Frau Schmitz glaubte fest daran, dass mit Kuchen fast alles zu heilen war. »Wir besuchen sie morgen im Krankenhaus«, bestätigte Schmitz.
»Meine Mutter wird sich freuen«, nickte Eva. Es war die Wahrheit. Freunde, Geliebte, Vorlieben, Moden und Jahrzehnte waren an Regine vorbeigerauscht. Die Schmitzens blieben. Die Eheleute von nebenan erwiesen sich im Lauf der Jahre als treue Freunde. Und so spießig, wie Regine früher dachte, waren sie auch nicht. Seit Schmitz pensioniert war, hatte er mit drei ehemaligen Kollegen eine Garagenband gegründet.
»Schmitz & Friends« traten regelmäßig bei Hochzeiten, Familienfesten und Betriebsjubiläen auf. Sie spielten bei Eröffnungen von Drogerieketten, in Fußgängerzonen und Bürgerzentren. Olga Schmitz lieferte die Bühnenoutfits.
»Wenn du Zeit hast«, sagte Schmitz, »wir spielen nächsten Monat in Gummersbach.«
Alles war beim Alten im Bussardweg. Eva ignorierte ihr klingelndes Telefon. Die Dienstagsfrauen, die sich nach Regine erkundigen wollten, mussten warten. Es war an der Zeit, aufzuräumen. Auf dem Dachboden und in ihrem Leben.
4
7600 Generationen lang war das Horten von Gütern die vernünftigste Strategie, für die Wechselfälle des Lebens gewappnet zu sein. Evas Großmutter war auf alles vorbereitet gewesen. In einem alten Schrank hingen Regines Hippieklamotten. In einem anderen lagerte Oma Lores Notfallordner mit wichtigen Ausweis-, Bank- und Impfpapieren für den Krisen- und Kriegsfall, das gebrauchte Geschenkpapier, Reserveschuhbänder in Braun, Blau und Schwarz, günstig erworbene Großpackungen Briefumschläge mit und ohne Fenster, die Weihnachtsdekoration samt dem bleihaltigen Lametta aus den Sechzigern, das Eva als Kind nach den Heiligen Drei Königen hingebungsvoll geglättet und in Zeitungspapier gewickelt hatte. Jeder Brief, jeder Namensanhänger von Weihnachtsgeschenken, jedes offizielle Schreiben, jede Postkarte war sorgfältig archiviert. Eva hoffte, hier auf dem Dachboden etwas über die eigene Herkunft zu erfahren.
Schicht um Schicht tauchte Eva in den Staub der Vergangenheit und die Dokumente aus Regines Kindheit und Jugend ein. Mit jedem Dokument kam Eva dem Zeitpunkt ihrer eigenen Entstehung näher. Der Durchschlag eines Briefs, in dem der Großvater sich bei Anton Dorsch für Regines Lehrvertrag bedankte, lieferte einen ersten Hinweis. Zum 1. 1. 1965 begann Regine im werkseigenen Kindererholungsheim Burg Achenkirch eine Lehre als Hauswirtschafterin. Eva kannte die Geschichte von Anton Dorsch. Wie viele Unternehmer seiner Generation hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, auch jenseits des Betriebs für seine Mitarbeiter zu sorgen. Sein soziales Engagement galt im Besonderen den Kindern seiner Arbeiter und Angestellten. Das von ihm gegründete Kindererholungsheim lag in Franken und wurde von seiner Schwester geführt. Regine schrieb in ihrer Lehrzeit ein paar Postkarten aus Achenkirch. Dann der Paukenschlag: Regine, gerade sechzehn Jahre alt, war schwanger. Mitte der Sechziger war das moralische Bankrotterklärung und gesellschaftlicher Tod in einem: »Einer derart verkommenen Person«, wütete die Direktorin Frieda Dorsch in ihrem Kündigungsschreiben, »kann unmöglich der Umgang mit unseren erholungsbedürftigen Kindern gestattet werden.« Regine verließ Achenkirch mit Schimpf und Schande und kehrte ins Elternhaus zurück. Am 22. Januar 1966 wurde Eva geboren. Auf der Geburtsurkunde fehlte jeder Hinweis auf den Vater.
Eva stellte den Ordner »Briefe« wieder in den Dachbodenschrank zurück, als ihr ein Umschlag auffiel, der nach hinten gerutscht war. Der Brief war an die Großmutter adressiert: Zur Weitergabe an Frau Regine Beckmann. Auf dem verwischten Poststempel war die Jahreszahl zu erkennen. 1993. In dem Umschlag steckten drei Schwarz-Weiß-Fotos aus Regines Achenkirchner Zeit und eine Postkarte mit der Ansicht einer Burg, die hoch über einem Dorf thronte. Das kann kein Zufall sein, liebe Regine, stand auf der Rückseite in einer selbstbewussten und kantigen Männerhandschrift. Ich bin zurück auf Burg Achenkirch, im Radio singt Doris Day, und Emmerich bringt kistenweise alte Fotos für den Subventionsantrag. Und plötzlich sitzt Du wieder im Fenster. Hast Du Lust, Dir unsere neue alte Burg anzusehen? Trotz allem, was passiert ist? Perhaps, perhaps, perhaps. Es grüßt, Dein Leo.
Eva hatte keine Ahnung, ob ihre Mutter den Brief je erhalten hatte.
5
»Warum weinst du, Mama?«, fragte Anna. »Ist das Lied so traurig?«
You won’t admit you love me.
And so how am I ever to know?
You always tell me
perhaps, perhaps, perhaps,
sang Doris Day in einem Video auf YouTube. Ertappt griff Eva nach einem Taschentuch. »Das Lied handelt von Liebenden, die nicht zueinanderfinden, weil sie sich nie die Wahrheit sagen«, erklärte Eva. Hektisch wischte sie die Tränen weg.
»Aber du hast den Papa doch gefunden«, beschwichtigte Anna ihre Mutter mitfühlend.
»Ich schon, aber die Oma …«
Nachdenklich betrachtete Anna die Fotos, die Eva auf dem Dachboden gefunden hatte. Auf dem ersten sah man den Ausschnitt einer mittelalterlichen Fassade. Eine Tür, drei hohe Fenster in einer dicken Mauer. Im mittleren saß Regine und ließ ihre Beine nach draußen baumeln. Das zweite zeigte sie inmitten einer Kinderschar vor einem geschmückten Maibaum. Ein drittes war in einem Gewölbe aufgenommen. Regine stand mit einem Mikrofon auf der Bühne: eine junge Frau, die kokett und unbeschwert in die Kamera lachte. Auf der Rückseite in derselben Männerschrift, die sie schon aus dem Brief kannte, die Zeile: Perhaps, perhaps, perhaps.
»Du hast dieselben Augen. Aber die Oma ist viel magerer«, sagte Anna nachdenklich.
»Vielleicht sehe ich meinem Vater ähnlich«, mutmaßte Eva. »Irgendwas muss ich auch von ihm geerbt haben.«
»Lecker kochen«, schlug Anna vor. »Das kann die Oma gar nicht. Die kocht alles so lange, bis es Brei ist. Am Ende macht sie Gewürze drüber und behauptet, es wäre indisch.«
Konnte ihr Vater kochen? Sah sie ihm ähnlich? Hatte sie seine Charakterzüge? Gegen drei Uhr morgens, als sie sicher sein konnte, dass niemand sie störte, tippte Eva die zwei verhängnisvollen Worte bei Google ein: »Burg Achenkirch«. Eine Sekunde später öffnete sich die Seite von Wikipedia. Nach einer wechselvollen Geschichte als Rittersitz, als Unterschlupf für Räuber und Wegelagerer, als gräfliche Stammburg, Militärbasis, Flüchtlingsunterkunft und Kindererholungsheim hatte die Burg fast zwanzig Jahre leer gestanden. 1988 übernahm der »Zweckverband zur Erhaltung des fränkischen Kulturbesitzes« das Monument, das dem Verfall anheimgegeben war. 1993 wurde die Burg als Hotel wiedereröffnet. Eva klickte weiter auf die Homepage. Statt kalorienhaltiger Kost und Erholung für kriegsgeschädigte Kinder bot die Burg heute ein vielseitiges Programm an. Alles war möglich: Tagungen, Familienfeiern, Hochzeiten, Erholungsprogramme. Es gab Wellnesswochen, Schweige-Seminare, Entschleunigungskurse und Heilfasten. Informationen über das Personal und Pächter fanden sich auf der Website des Hotels nicht. Nur ein Name im Impressum. Leonard Falk.
War das der Mann, den sie suchte? Als Kind hatte Eva sich jeden Abend im Bett Geschichten ausgemalt, in denen ihr Vater auftauchte und mit wohlgesetzten Worten alle Missverständnisse aufklärte: Sie hatte ihn sich als südamerikanischen Rebellenführer erträumt, als Koch auf einem Frachtschiff, als uneigennützigen Entwicklungshelfer in Afrika. Tränen schossen ihr in die Augen. Judith hatte recht. Es war an der Zeit, den jährlichen Ausflug der Dienstagsfrauen anzugehen. Sie alle verdienten eine Pause vom Alltag. Warum nicht in Achenkirch? Eine Woche Heilfasten klang großartig. Und wenn sie in den sieben Tagen so ganz nebenbei etwas über ihre Herkunft erfahren konnte, umso besser.
6
»Heilfasten! Das wäre doch was für uns alle, meint ihr nicht?«, schlug Eva vollmundig vor.
Eine Woche war seit dem Treppensturz vergangen. Judith hatte darauf bestanden, das Treffen nachzuholen, Nägel mit Köpfen zu machen und endlich ein Ziel für den jährlichen Ausflug zu bestimmen, der wegen Greta mehrmals verschoben worden war. Sehr zum Erstaunen aller führte Eva das große Wort in der Runde.
»Heilfasten ist nicht einfach eine Diät, eine Umverteilung von Kalorien«, erklärte Eva, »sondern ein glaubwürdiges Konzept, über mentale Konzentration überflüssige Pfunde abzuwerfen.«
Selbst den passenden Ort hatte sie schon herausgesucht. Achenkirch musste es sein: »Eine Burg im Altmühltal. Abgelegen, einsam, wildromantisch. Ideal für uns«, verkündete sie im Brustton der Überzeugung. »Wir brauchen gar nicht weiterzusuchen.«
Caroline staunte über die Vehemenz, mit der Eva ihren Vorschlag äußerte. Normalerweise war die Jetzt-Wieder-Ärztin Eva absorbiert von ihrem Alltag. Zu längerfristigen Planungen war sie nicht in der Lage.
»Ich schließe mich an«, war Evas Standardsatz, wenn es darum ging, Pläne für den jährlichen Ausflug der Dienstagsfrauen zu schmieden. Im privaten Urlaub richtete sie sich grundsätzlich danach, was ihre vier Kinder oder Ehemann Frido wollten. Eva landete regelmäßig in viel zu teuren Clubhotels, in denen pathologisch gut gelaunte Animateure sie immer dann aufspürten, wenn sie gerade auf ihrer Sonnenliege eingenickt war.
Bei den Dienstagstreffen verteidigte Eva ihre defensive Haltung: »Was nutzt es mir, wenn ich meinen Willen durchsetze und alle anderen sind unglücklich.« Ihr Helfersyndrom verließ sie nie. Selbst im Krankenhaus war sie auf ihrer Station die erste Ansprechpartnerin geworden, wenn es darum ging, im Kollegenkreis für Geburtstage, Hochzeiten und andere Glücks- und Wechselfälle des Lebens zu sammeln.
»Kein Wunder, dass mir das Aufopferungsgen fehlt«, meinte Estelle spitz. »Eva hat es doppelt.«
Die verwöhnte Apothekersfrau war eine Meisterin darin, unangenehmen Aufgaben auszuweichen und sich ausschließlich den schönen Aspekten des Lebens zu widmen: der Pflege des eigenen Selbst. Normalerweise schlug sie für den Jahresausflug der Dienstagsfrauen ein sündhaft teures Rundumsorglos-Hotel mit Verwöhnaroma vor.
Bevor Estelle zu Wort kommen konnte, ratterte Eva ihre Argumente herunter. Wortreich beklagte sie ihren Weihnachtsspeck. Den vom letzten Jahr, der sich bis über den Sommer hinaus an ihren Hüften gehalten hatte, und den vom nächsten Jahr, den sie zweifelsohne bald hinzubekommen würde.
»Bei REWE in Klettenberg liegen schon die ersten Lebkuchen im Regal«, klagte sie. »Im September schmecken die am allerbesten.«
Caroline beunruhigte das verbale Trommelfeuer, das Eva abschoss. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die leidenschaftliche Köchin Eva begeistert von der Vorstellung war, sieben Tage auf Essen zu verzichten. Wegen der paar Kilo? Eva war Ärztin. Sie wusste nur zu gut, dass man das Gewicht, das man in einer Woche Heilfasten verlor, schnell wieder draufhatte. Warum war Achenkirch wichtig für Eva?
Der Gedanke an eine gemeinsame Fastenkur erregte die Gemüter der Dienstagsfrauen so heftig, dass außer Caroline keiner der Freundinnen auffiel, wie merkwürdig Evas Vorstoß war. Beim Thema Gewicht waren die ungleichen Freundinnen sich einig.
»In sieben Tagen auf Size Zero? Ich bin dabei«, erklärte Estelle. Sie kämpfte mit ihrem neuen Chanel-Kostüm, das sie für die große Charity-Gala des Golfclubs ausgesucht hatte: »Im Laden passte es perfekt«, monierte sie. »Nur hinsetzen kann ich mich nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich gleichzeitig atmen will.«
Judith, die Dienstagsfrau mit der spirituellen Ader, hatte keinen eigenen Vorschlag. Stattdessen schwärmte sie von den mentalen Wirkungen der leiblichen Entsagung.
»Fasten soll einen in rauschhafte Zustände versetzen«, begeisterte sie sich. »Ganz ohne Drogen.«
»Ich kann auch ein bisschen weniger gebrauchen«, bestätigte Kiki, die noch immer mit ihren restlichen Schwangerschaftskilos kämpfte.
Bevor Caroline sich einen Reim darauf gemacht hatte, was sich hinter Evas wildem Aktionismus verbarg, überraschte die Freundin sie ein zweites Mal.
»Warum verreisen wir nicht sofort?«, schlug Eva vor. »Gleich nächste Woche.«
»Und deine Kinder?«, fragte Caroline. Sie verstand nichts mehr.
»Es passt sowieso nie«, erklärte Eva lapidar.
Sechzehn Jahre hatte es Caroline unendliche Mühen gekostet, Eva davon zu überzeugen, trotz familiärer Pflichten bei der jährlichen Fahrt der Dienstagsfrauen dabei zu sein. Sechzehn Jahre predigte sie der Freundin, ihre Familie zu mehr Selbstständigkeit zu erziehen. Und jetzt ließ Eva sich zu einer Spontanaktion hinreißen? Keine generalstabsmäßige Vorbereitung? Kein wochenlanges Vorkochen? Keine seitenlangen Anweisungen, die der Familie das Überleben in mutterlosen Krisenzeiten erläuterten? Keine Schuldgefühle? Evas Verhalten war so merkwürdig, dass sich die anderen einschalteten.
»Du willst Frido mit den Kindern alleine lassen? Einfach so?«, wunderte sich Estelle.
»Und deine Mutter?«, hakte Judith nach. Regine lag seit einer Woche mit gebrochenen Knochen und ungebrochenem Nerv-Potenzial im Krankenhaus. Ausgerechnet auf der Station, auf der Eva arbeitete. Die Dienstagsfrauen wussten, wie intensiv sich Eva um ihre Mutter kümmerte.
Nur Kiki schwieg. Max hatte ihr eine E-Mail geschickt. »Sie kann Yoga«, schrieb er. Darunter das Foto einer selig schlummernden Greta. Sie lag auf dem Bauch. Die dicken Babyarme hatte sie vor dem Kopf verschränkt, die Knie angewinkelt, den Windelpo weit in die Höhe gestreckt. Kiki war gerührt. Nie im Leben hätte sie vermutet, dass ein Babyfoto ihr Tränen in die Augen treiben könnte. Auch wenn deutlich zu erkennen war, wo Greta es sich gemütlich gemacht hatte: Sie lag diagonal in Kikis Betthälfte.
»Ich bin für sofortiges Heilfasten«, erklärte Kiki. »Ein paar Kilo weniger, und ich passe locker neben Greta in mein Bett.«
»Wer ist dafür?«, erzwang Eva eine schnelle Entscheidung. Innerhalb einer Sekunde flogen vier Finger in die Luft. Im Hintergrund beeilte sich Luc, eine Flasche Champagner zu entkorken. Die unerwartet schnelle Einigung, die traditionell mit einer Flasche Veuve Clicquot begossen wurde, überrumpelte ihn. In den sechzehn Jahren, in denen die Dienstagsfrauen in sein Lokal kamen, hatten sie es noch nie unter einer Stunde wilder Diskussion geschafft, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen. Caroline war noch nicht mit dem Denken fertig. Irgendetwas stimmte nicht.
»Zum Abnehmen ist Heilfasten nicht geeignet. Doch als Einstieg in ein verändertes Essverhalten und eine gesündere Lebensweise ist es ideal«, erläuterte Eva, als ob es Caroline an Argumenten mangelte.
Seit ihrer gemeinsamen Pilgerreise auf dem Jakobsweg hatte sich Caroline über vieles gewundert, was die Freundinnen taten. Mehr noch war Caroline erstaunt, zu was sie selbst fähig war. Doch darüber sprach sie lieber nicht. Nicht über das merkwürdige Vorgefühl, das sie bei Evas Plan beschlich. Nicht über den Hotelschlüssel, den sie in ihrer Handtasche verbarg. Nicht über den Mann, der im Hotel Savoy auf sie wartete. Stattdessen nickte sie: »Heilfasten? Wieso nicht? Ich kann jede Menge Entschlackung und Entschleunigung brauchen.«
7
»Abbiegen«, rief Eva. »Links. Du musst links. Links!«
Zehn Tage nach dem Treffen im Le Jardin machten die Freundinnen sich auf nach Achenkirch. Ob sie da je ankamen, war fraglich. Der Wagen rauschte in unvermindertem Tempo an der Gabelung vorbei. Caroline, die wie immer am Steuer saß, wenn die Dienstagsfrauen unterwegs waren, trat verbissen aufs Gaspedal. Die Route war nicht kompliziert. Doch Caroline war mit dem Kopf noch in Köln. Genau wie Kiki, die endlich wieder ein Bewerbungsgespräch hatte und erst am Abend zu ihnen stoßen würde.
»Burghotel Achenkirch. Fünfzehn Kilometer. Da stand es doch«, beschwerte sich Eva. Drei verpasste Abzweigungen und das ewige Sich-wieder-neu-orientieren-Müssen auf der unhandlichen Allianz Freizeitkarte Donau-Altmühltal strapazierten ihre Nerven genauso wie die sphärische Entspannungsmusik, die Judith zur Einstimmung auf die gemeinsame Ferienwoche ausgewählt hatte.
»Macht den Singsang aus und das Navi an«, empfahl Estelle. Schlaftrunken guckte sie unter ihrer kühlenden Augenmaske hervor. »Das Leben kann so einfach sein, wenn man anderen die Arbeit überlässt.«
»Das Navi habe ich Philipp zum Abschied geschenkt«, gab Caroline zu. Eine Spitze gegen ihren Nochehemann, der darauf bestand, dass sein angeborener Richtungssinn jede Elektronik schlug. Philipp wusste, wie man den Feierabendstau auf den Kölner Ringen umfuhr, der Dauerbaustelle an der Severinsbrücke entkam oder das versteckte Ferienhaus in Südfrankreich fand. Besser als Caroline und besser als die Tussi vom Navigationsgerät, die ihn mit ihrem penetranten »wenn möglich bitte wenden« aus dem Konzept brachte. Philipp hörte nicht auf Ratschläge, und Philipp wendete nicht. Er hatte seine eigenen Vorstellungen, wie man durch die Stadt und durchs Leben manövrierte. Am Ende war es nicht die Tussi vom Navigationsgerät, die Carolines Ehe den Rest gegeben hatte, sondern die lange Reihe Frauen, mit denen Philipp vom Weg der ehelichen Treue abgekommen war. Carolines Lebensbilanz war ernüchternd: Sie war eine erfolgreiche und berüchtigte Strafverteidigerin, Mutter zweier erwachsener Kinder und seit der Pilgerreise wieder in Steuerklasse eins eingeteilt. »Dauerhaft getrennt lebend«, hieß der Schwebezustand in Beamtendeutsch. Caroline hatte eine Menge zu verarbeiten: Judith, der zuliebe sie überhaupt auf Pilgerreise gegangen waren, Judith, die zarte, frisch verwitwete Kindfrau, ihre langjährige Vertraute und Freundin, hatte sie hintergangen. Sie war eine von Philipps zahlreichen Geliebten gewesen. Das eigentliche Wunder von Lourdes war, dass die Dienstagsfrauen Judiths Verrat überlebt hatten. Von Carolines Ehe konnte man das nicht behaupten.
»Du brauchst Orientierung dringender als ich«, hatte Caroline gesagt, als sie Philipp zum Abschied das Navi auf den Tisch legte. Stattdessen bemühte sie für den jährlichen Ausflug der Dienstagsfrauen die gute alte Landkarte. Erst der A3 von Köln Richtung Nürnberg folgen, dann weiter auf der A9 bis zur Abfahrt Altmühltal. Bei Kipfenberg hätte Caroline abbiegen müssen …
»Da. Da hättest du drehen können. Warum drehst du nicht?«, rief Eva. Caroline war nicht bei der Sache. Mit einer abrupten Bewegung lenkte sie den Wagen auf den »Panoramaparkplatz Achenkirch«.
»Weil man hier den besten Blick über das Tal hat«, log Caroline, dankbar für die unvermutete Ausflucht.
Die Aussicht war atemberaubend.
»Wie ein Bausatz von Märklin«, schrie Estelle. Kräftiger Wind fegte ihr Haare und Herbstlaub um die Ohren. Schattenflecken und Lichtkegel huschten in hohem Tempo über Wiesen, Wälder und Wacholderheiden. In der Talsohle, windstill und geborgen, der Fluss und das Dorf Achenkirch. Dicht an dicht schmiegten sich die weißgrauen Jurahäuser mit ihren flachen Dächern aneinander. Aus den Schornsteinen stieg Rauch, der sich in den bunt leuchtenden Baumwipfeln verlor. Darüber ragten schroffe, spektakulär zerklüftete, schmutzig weiße Kalkfelsen in die Höhe. Auf dem Bergsattel lag das Ziel ihrer Reise: die Burg Achenkirch. Sechshundert Jahre wechselvoller Geschichte materialisierten sich in grün überwucherten dicken Mauern aus grobem grauem Stein, in Zinnen und Schießscharten, Türmchen und schlossähnlichen An-, Aus- und Umbauten. Ein imposanter Bergfried kratzte an eilig dahinziehenden Wolken.
»Sieht nicht sehr heimelig aus«, bemerkte Estelle.
Caroline erkannte an den Mienen der Freundinnen, dass sie der Ankunft auf der Burg mit ebenso gemischten Gefühlen entgegensahen. Entschleunigen, entschlacken, abspecken: Das war das Gebot der Stunde. Caroline freute sich darauf, ihren hektischen Alltag hinter sich zu lassen. Sieben Tage keine dringenden E-Mails und Telefonate, keine schwierigen Klienten und ungeduldigen Richter, keine Aktenberge und Überstunden, kein Last-Minute-Shopping an der Tankstelle, keine Familiengeburtstage, kein Auto, das zum TÜV musste, keine nackten Glühbirnen in der Wohnung. Fünfzehn Monate nach der Trennung von Philipp baumelten die noch immer vorwurfsvoll von den Decken ihrer kleinen Zweizimmerwohnung und riefen Caroline ständig die Tatsachen ins Gedächtnis: dauerhaft getrennt lebend. Sieben Tage ohne Männer und ohne familiäre Verpflichtungen, ohne Bankenkrise, Euroschwäche und Steuerreformen. Leider auch ohne feste Nahrung. Heilfasten war angesagt. Weil Heilfasten angesagt war.
Caroline hatte sich weit mehr vorgenommen als eine Woche Verzicht auf Essen, auf süße Seelentröster und den abendlichen Wein, der sie in den Schlaf wiegte. Wer entschleunigt, gewinnt Mußestunden: Zeit für sich, Zeit für die Freundinnen, Zeit für Gespräche und Geständnisse. Wenn Caroline wollte, dass die Freundschaft der Dienstagsfrauen Bestand haben sollte, musste sie ihren Freundinnen beichten, welch merkwürdige Wendung ihr Leben genommen hatte.
»So ein stolzes Anwesen. Und nicht mal eine anständige Küche«, seufzte Estelle.
»Wie wäre es mit einer Henkersmahlzeit?«, schlug Eva vor. Caroline nickte. Beim Blick auf die leichenblasse Eva ahnte sie, dass sie nicht die Einzige war, die in den kommenden Tagen etwas zu erklären hatte.
8
Das Dorf Achenkirch strahlte verschlafene Gemütlichkeit aus. Von den 1235 Einwohnern, die das fränkische Nest laut Gemeinde-Website bevölkern sollten, waren am frühen Freitagmittag nur wenige zu sehen. Der Postbote drehte seine Runde, zwei Angler standen am Ufer des gemächlich dahinfließenden Flusses. Die Schwimmer trieben nur wenig ab, so langsam floss das Wasser der Donau entgegen. Eingekesselt zwischen zwei Felswänden schlief das Dorf in der Talsohle. Die Bäckerei Josef Fasching, die außer Backwaren Gemüsekonserven, Tütensuppen und eingeschweißte Wurstwaren verkaufte, hatte Mittagspause, der Haarsalon »Kamm und Schere« Betriebsausflug. Ein Aushang verkündete, dass die Belegschaft zum eintägigen Trendseminar ins Wella-Studio nach München gefahren war, um sich dort in der »Königsdisziplin Blond« unterweisen zu lassen. Auf den verwinkelten Dorfstraßen, die weder eine Ampel noch einen Geldautomaten zu bieten hatten, brachten ein paar auffällig junge Mütter ihre Kindergartenkinder zum Mittagessen nach Hause.
»Wenn es ein Restaurant gibt, dann neben der Kirche«, verkündete Caroline und wies auf den Zwiebelturm, der über den Dorfhäusern schwebte. Einmal in Achenkirch