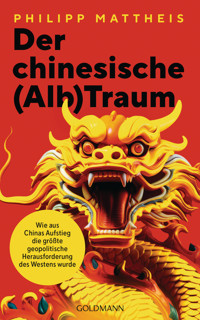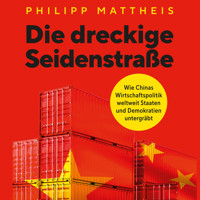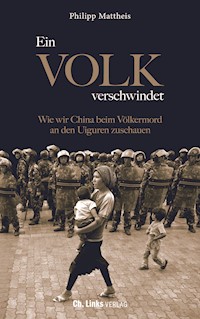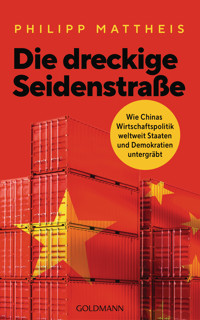
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lange galt China als eine Art sanfter, schlafender Riese. Zwar war das politische System und dessen Menschenrechtsverletzungen nur schwer vereinbar mit westlichen demokratischen Werten, doch man setzte auf das Prinzip »Wandel durch Handel«. China würde sich mit steigendem Wohlstand schon öffnen. Doch das Gegenteil ist eingetreten: China verschließt sich nach außen, hat aber enorm an wirtschaftlichem und politischem Einfluss gewonnen. Bereits seit 2013 schafft die kommunistische Partei mit Krediten, Investitionen und Entwicklungsprojekten neue Absatzmärkte und hat neue Seidenstraßen erschlossen. Wer genauer hinsieht, bemerkt schnell, dass nicht nur chinesische Waren exportiert werden, sondern auch Ideologie, Dominanz und wirtschaftspolitische Abhängigkeiten. Die »neue Seidenstraße« ist ein schmutziges Projekt. Die Kommunistische Partei untergräbt demokratische Regierungen, höhlt schleichend westlich-liberale, kapitalistische Normen aus und unterstützt gleichzeitig autoritäre Regime. Menschenrechte und Umweltschutz spielen keine Rolle. Spätestens seit 2022 mit dem Beginn des Russland-Ukraine-Krieges ist deutlich, wie groß Chinas Einfluss auch in Europa und Deutschland ist. Der Journalist und langjährige China-Korrespondent Philipp Mattheis hat die Länder, durch die die neuen Seidenstraßen verlaufen, bereist: von Kasachstan bis Ungarn, von Sri Lanka bis Georgien, von Griechenland bis Deutschland entlarvt er die Wirkmechanismen und Folgen der chinesischen Wirtschafts- und Geopolitik und fordert zu politischer Verantwortung und zum Umdenken auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Autor
Philipp Mattheis, geboren 1979, hat Philosophie studiert und die Deutsche Journalistenschule besucht. Seit 2011 arbeitet er als Auslandskorrespondent für verschiedene deutsche Medien, darunter den Stern, Capital, die WirtschaftsWoche und den STANDARD. Von 2011 bis 2016 und 2019 bis 2021 lebte er in Shanghai, von 2016 bis 2019 berichtete er aus Istanbul über die Türkei und den Nahen Osten. Er ist Autor mehrerer Bücher. Zuletzt erschien »Ein Volk verschwindet. Wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen« im Januar 2021 beim Ch. Links Verlag. Aktuelle Informationen und Berichte rund um seine Recherchen und Reisen teilt er täglich unter: blingbling.substack.com
PHILIPP MATTHEIS
Die dreckige Seidenstraße
Wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt
Dieses Sachbuch beruht auf Erlebnissen, Recherchen und Aufzeichnungen. Alle Informationen und Angaben in diesem Buch wurden von Autor und Verlag sorgfältig erwogen und geprüft.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Mai 2023
Copyright © 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2023 by Philipp Mattheis
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © FinePic®
Kartenillustrationen: © Sabine Timmann
Karte Seiten 8 und 9: © Sabine Timmann unter Nutzung einer Vorlage von Infrastrukturatlas 2020, Urheber: Appenzeller/Hecher/Sack, Lizenz: CC BY 4.0
Redaktion: Volker Kühn
MP · Herstellung: CF
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30560-4V001
www.goldmann-verlag.de
INHALT
VORWORT
1. AMENDEDERNEUENSEIDENSTRASSE
Athen, Montenegro, Budapest und Hamburg – die Kommunistische Partei Chinas hinterlässt Spuren in ganz Europa.
2. AMANFANGDERNEUENSEIDENSTRASSEODER »YOUNAMEIT«
Mitte 2013 verkündet Xi Jinping das »Projekt des Jahrhunderts« und überschüttet die Welt mit Milliarden-Krediten.
3. VORORTINSRILANKA: WEISSEELEFANTENUNDDIESCHULDENFALLE
Als Sri Lanka in Zahlungsschwierigkeiten gerät, übernimmt China einen Hafen des Landes. Ein Muster?
4. DIEDREHSCHEIBEDERWELT: DIEKORREKTUREINESFEHLERSDERGESCHICHTE
Mit dem Beginn des europäischen Zeitalters verfällt der sagenhafte Reichtum der alten Seidenstraße. Jetzt soll er zurückkehren.
5. VORORTINKENIA: GRAUEELEFANTENUNDCHINASMACHTINAFRIKA
Eine Zugstrecke endet im Nirgendwo. Trotzdem ist das Geld aus Peking auf dem Kontinent gern gesehen.
6. THEGREATGAME I: DIEFABRIKDERWELT
7. VORORTINZENTRALASIEN: VONRUSSLANDSHINTERHOFZUCHINASVORGARTEN
Das »Kronjuwel der neuen Seidenstraße« ist ein eher trister Ort: zu Besuch in Khorgos, dem größten Trockenhafen der Welt.
8. KOLLATERALSCHADENXINJIANG?
Der Beginn der brutalen Unterdrückung der Uiguren fällt zeitlich zusammen mit dem Start der Neuen Seidenstraße.
9. VORORTINVORDER- UNDSÜDASIEN: VOMKARAKORUMHIGHWAYNACHTEHERANUNDISTANBUL – DASSCHWEIGENDERISLAMISCHENWELT
Besonders leicht fallen Peking Geschäfte mit autoritären Regimes – und dort, wo westliche Unternehmen sich zurückgezogen haben..
10. THEGREATGAMEII: AMLÄNGERENHEBEL
Mit der neuen Doktrin der »Zwei Kreisläufe« will China die Kontrolle über den Waren- und Energiefluss behalten.
11. VORORTINMYANMAR: DASMALAKKA-DILEMMA
Eine Pipeline soll China Zugang zum Indischen Ozean verschaffen. Die chinesischen Unternehmen gehen dabei rücksichtslos vor.
12. VORORTINLAOS: SCHLEICHENDEÜBERNAHME
Seit Dezember 2021 verbindet eine Bahnstrecke die laotische Hauptstadt mit China. Und Laos wird allmählich zur chinesischen Provinz.
13. DIEDIGITALESEIDENSTRASSE
Chinesische Internetstandards sollen die Welt entlang der Belt-and-Road-Initiative (BRI) prägen – mit ihnen kommt Überwachungstechnologie aus Peking.
14. THEGREATGAMEIII: KAMPFDEMUS-DOLLAR
Ziel Pekings ist es, den Status des US-Dollars als globale Leitwährung zu untergraben. Dafür spielt auch die Neue Seidenstraße eine wichtige Rolle.
15. CHINASSCHULDENKRISEUNDDIESEIDENSTRASSE 2.0
Immer öfter geraten die Empfängerländer der Neuen Seidenstraße in Zahlungsschwierigkeiten – und China hat eigene Probleme.
16. AMENDE: SONDERFALLDEUTSCHLAND
Duisburg ist der Endpunkt der Neuen Seidenstraße. Warum Deutschland eine Sonderrolle innehat.
17. SCHULDENFALLEODERWIN-WIN?
Peking baut seine Macht entlang der Neuen Seidenstraße aus – und trotzdem stimmt das Motiv vom »bösen Geldverleiher« nicht.
EPILOG: VONIMPERIENUNDFALSCHERÄQUIDISTANZ
DANK
LITERATURVERZEICHNIS
VORWORT
Vor zehn Jahren rief der chinesische Präsident das »geostrategische Jahrhundertprojekt« aus. Er nannte es »die Neue Seidenstraße«, wohl wissend, mit diesem Namen positive Assoziationen an vergangenen Reichtum zu wecken. Etwas weniger glamourös ist die synonyme Bezeichnung »Belt-and-Road-Initiative« (BRI).
Dieses Buch beginnt in Europa und führt den Leser auf eine Reise zu den Empfängerländern des chinesischen Geldes: Es geht über den Karakorum Highway von Xinjiang nach Pakistan, nach Teheran und Istanbul, wo China längst der wichtigste Handelspartner ist und chinesische Unternehmen den Ton angeben. Südostasien bindet Peking mit Zugstrecken und Pipelines immer enger an sich. Und es geht nach Khorgos in Kasachstan, zum größten Container-Trockenhafen der Welt, wo Container aus Chongqing kommend nach Duisburg auf der Schiene transportiert werden.
Entlang der Maritimen Seidenstraße besucht das Buch die Straße von Malakka, Pipeline-Terminals in Myanmar, einen chinesischen Hafen in Sri Lanka und die alte Hafenstadt Mombasa in Kenia; von dort soll ein chinesischer Zug einmal alle großen Hauptstädte Afrikas miteinander verbinden.
Und es geht darum, was das chinesische Geld in diesen Ländern bewirkt und anrichtet. Denn zehn Jahre später ist die Erfolgsbilanz dieses Projekts durchwachsen – aus Sicht der Empfängerländer, um die es in diesem Buch vor allem geht, aber auch für Peking selbst. Aus einem angestrebten Win-win-Verhältnis wurde ein Win-lose oder sogar ein Lose-lose, weswegen das Geld mittlerweile nicht mehr so locker sitzt wie zu Anfang der Neuen Seidenstraße.
In Bukhara und Samarkand, den ehemaligen Zentren der alten Seidenstraße, geht es um die Frage, wie dieser Reichtum verfallen konnte, und um tektonische Verschiebungen des Welthandels. Auf der Digitalen Seidenstraße versucht Peking zur Cyber-Großmacht zu werden und globale Standards für das 21. Jahrhundert zu etablieren.
Die »Neue Seidenstraße« ist ein schmutziges Projekt. Wer genauer hinsieht, merkt schnell, dass hinter Pekings Investitionen etwas anderes steckt als Brücken und Wirtschaftswachstum. Die Initiative ist für das neue China unter Xi Jinping ein Machtinstrument, um seinen Einfluss global auszubauen: Auf den Autobahnen und Zugstrecken werden nicht nur chinesische Waren transportiert, sondern auch Ideologie und Dominanz. Mit Krediten, Netzwerken und Produkten schafft die kommunistische Partei Chinas neue Abhängigkeiten. Telekommunikations-Netzwerke, erbaut von chinesischen Staatsunternehmen wie Huawei, spähen für die KP. Geld macht die – oft korrupten – Entscheider gefügig. Absatzmärkte werden abhängig von chinesischen Billigprodukten. Diktatoren lieben die chinesische Überwachungstechnik und das schnelle Geld, denn Menschenrechte und Umweltschutz spielen dabei keine Rolle. Nach und nach dehnt Peking so seinen Einfluss über die eigenen Landesgrenzen aus, unterstützt autoritäre Regimes und untergräbt Demokratien.
Bei all der Kritik aber ist die Neue Seidenstraße kein maliziöses, boshaftes Projekt, sondern Symptom für veränderte Machtverhältnisse und den Wiederaufstieg Asiens. Oft sind weniger die chinesischen Kredite das Problem als vielmehr der Mangel an Alternativen. Um diese zu schaffen, ist allerdings ein genaueres Hinsehen nötig.
Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zahlreiche Orte und Länder wären dafür noch zu bereisen. Hoffentlich aber kann es einen Beitrag dazu leisten, die Effekte und Wirkungen des chinesischen Geldes vor Ort zu verstehen und sie gleichzeitig in das große Ganze einzuordnen: als Teil eines der größten geostrategischen Projekte der Geschichte.
1. AM ENDE DER NEUEN SEIDENSTRASSE
»Die Initiative ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, es ist keine sentimentale Erinnerung an Marco Polo.«
BUNDESAUSSENMINISTERSIGMARGABRIEL 2018
Die Diplomaten staunten nicht schlecht, als sie im Juni 2017 wie jedes Jahr beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf Klage über die Lage in China erheben wollten. Zu einer gemeinsamen Erklärung kam es nicht, weil ausgerechnet das kleine Griechenland blockierte. »Unproduktive und oftmals selektive Kritik gegenüber bestimmten Ländern erleichtert die Förderung der Menschenrechtslage in diesen Staaten nicht«, lautete die Begründung eines griechischen Diplomaten. Zwar machte man trotz der desaströsen humanitären Situation in Provinzen wie Xinjiang und Tibet gute Geschäfte mit China. Doch auf verbale Kritik an der Menschenrechtssituation in China konnte man sich stets einigen. Das war nun vorbei: Beim EU-China-Gipfel wurden die Menschenrechte nicht öffentlich angesprochen; und auch am 4. Juni, zum Jahrestag des Tiananmen-Massakers, äußerte sich die EU nicht. Der Trend sei »extrem beunruhigend«, urteilte Amnesty International.
Ein Jahr zuvor hatte sich ein chinesisches Staatsunternehmen im griechischen Hafen Piräus eingekauft. Und auch wenn es keinen Beweis für eine direkte Einflussnahme Chinas auf das Abstimmungsverhalten Griechenlands gibt, liegt der Verdacht doch nahe.
»Wir brauchen Investitionen«, sagte Fotis Provatas, der Vorsitzende der griechisch-chinesischen Handelskammer, im Frühjahr 2018. Griechenland besitze keine Industrie und sei hochverschuldet. »Und von den Chinesen bekommen wir sie.« Für ihn ist ein Kampf im Gange. Ein Krieg um 5-G-Technologie und künstliche Intelligenz, um Marktzugänge und eigentlich um die Vormachtstellung im 21. Jahrhundert. Das kleine Griechenland müsse da irgendwie überleben und für sich das Beste herausschlagen.
Vom Fenster seines Büros versperrten damals bereits Kreuzfahrtschiffe die Sicht auf die Ägäis. Bis zu 14 solcher schwimmenden Fabriken können mittlerweile am Hafen anlegen. Die Gäste kommen nicht selten aus China. Denn seit 2017 fliegt Air China direkt von Peking nach Athen. Chinesische Touristikunternehmen bringen zahlungskräftige Kunden, denen die griechischen Inseln als Inbegriff von Romantik überhaupt gelten. Chinesische Immobilienunternehmen wie Wanda bauen dafür die entsprechenden Hotels und Shoppingmalls.
Es sind All-inclusive-Investitionen aus Peking, fast alle finanziert von der China Development Bank, einer der größten Banken Chinas und der Welt, und dabei fest in den Händen der Kommunistischen Partei. Die Unternehmen, die in Griechenland investieren, unterstehen direkt ebenfalls dem chinesischen Staat oder sind Töchter von Staatsunternehmen. Sie bilden ein Cluster, und es ist nur mehr als wahrscheinlich, dass diese Unternehmen sich untereinander absprechen und konzertiert vorgehen. Dahinter steht ein politischer Plan, mit dessen Hilfe chinesische Unternehmen langfristig in Europa Fuß fassen sollen.
Griechenland ist für Peking ein Sprungbrett nach Mitteleuropa und in den südlichen Mittelmeerraum. Die Krise war für die Chinesen eine großartige Kaufgelegenheit. Dabei konzentrierten sie sich auf bestimmte Schlüsselbranchen. Der chinesische Hafenbetreiber China Ocean Shipping Company (Cosco) kaufte sich in zwei Tranchen 2008 und 2016 in den Athener Hafen ein, der im Zuge der Krise privatisiert wurde. Er betreibt nun zwei von drei Terminals. Im Sommer legte Cosco noch einmal nach und besitzt nun 67 Prozent des Hafens. 2017 erwarb der chinesische Netzbetreiber State Grid eine 24-prozentige Beteiligung am griechischen Stromnetz. Außerdem investierten Chinesen in den Tourismus und in Immobilien. Dabei hilft das griechische Golden-Visa- Programm: Wer für mehr als 250.000 Euro eine Immobilie erwirbt, bekommt eine fünfjährige Aufenthaltserlaubnis obendrauf – Schengen-Visa inklusive. Das ist gerade für die chinesische Oberschicht sehr attraktiv.
Die großen und wegen ihrer Staatsnähe berüchtigten Konzerne Huawei und ZTE sind mit Forschungslaboren und Kooperationen mit chinesischen Universitäten im Land vertreten. Zur Frage, ob weitere Investitionen geplant sind, schweigt sich Handelskammerchef Provatas aus. Immer wieder betont er aber, auch die Amerikaner würden ihre Netzwerkdienstleister zur Spionage einsetzen. Warum sollte man das den Chinesen verwehren, schwingt ungesagt darin mit.
Tatsächlich hatte man damals in Griechenland nur wenig gegen die Gäste aus Fernost. Laut einer Umfrage des griechischen Kappa-Instituts von 2017, sagten 40 Prozent der Griechen, man solle die Beziehungen zu China ausbauen – nur die Russen punkten höher. Ein Jahr zuvor bezeichneten 82 Prozent der Griechen die Beziehungen zur EU als freundlich. Mittlerweile ist der Anteil etwas zurückgegangen.
Von der EU und den Amerikanern fühlt man sich dabei eher im Stich gelassen. »Das Problem ist: Von dort bekommen wir keine Investitionen«, sagt Provatas, der früher einmal stellvertretender Bürgermeister von Athen war.
Das Engagement Chinas beim Athener Hafen gilt als Erfolgsgeschichte. Die Menge an umgeschlagenen Containern stieg von 0,8 Millionen 2009 auf 4,9 Millionen 2018. Von 2017 auf 2018 allein nahm die Menge um 190 Prozent zu, wohl weil China Güterströme umgeleitet hatte. Im Mai 2022 vermeldete der Hafen sogar den größten Profit seiner Geschichte. Selbst die Gewerkschaftler, scharfe Gegner jeglicher Privatisierungsprogramme, sagen: Mit dem neuen chinesischen Management komme man eigentlich gut aus. Nick Georgiou, der damalige Präsident der Hafenarbeiter-Gewerkschaft in Piräus, beklagt zwar, dass der neue Betreiber lieber auf Zeitarbeitsfirmen zurückgreife, muss aber zugeben, dass seit der Übernahme niemand entlassen wurde. Tatsächlich wurden sogar mehr Leute eingestellt.
Griechenland ist ein wichtiger Brückenkopf in der von Peking entworfenen Neuen Seidenstraße, jenem Netz von Infrastrukturprojekten und Investitionen, das der chinesischen Wirtschaft den Exportweg über Land und See nach Europa sichern soll. Seit 2014 flutet Peking zentralasiatische Staaten von Kasachstan, Pakistan bis Iran mit Milliardeninvestitionen. Ein Netz aus Häfen, Straßen und Zugstrecken zieht sich langsam über den Kontinent Richtung Nordwesten.
Dabei ist das, was dabei für Griechenland abfällt, eine eher kleine Summe. Knapp zehn Milliarden Euro hat Peking seit 2005 dort investiert. Nach Deutschland floss im selben Zeitraum das Vierfache. Provatas aber ist sich sicher: »Das ist erst der Anfang.«
Einige hundert Kilometer weiter nördlich wurde 2022 mit chinesischem Geld eine Straße fertiggestellt: Mit einer Länge von 41 Kilometern, einer Bauzeit von acht Jahren und Kosten von einer Milliarde US-Dollar gilt die Autobahn in Montenegro als eine der teuersten der Welt. Das liegt auch daran, dass die Strecke über Schluchten, Täler und durch zahlreiche Berge führt. Luftaufnahmen zeigen spektakuläre Szenen: insgesamt 20 Brücken, von denen sich manche in schwindelerregender Höhe durch pittoreske Flusstäler ziehen, und 16 Tunnel. Viele Anwohner freuen sich, dass die Straße im Sommer 2022 eröffnet wurde: Die ehemals beschwerliche Reisezeit über die Berge von Smokovac nach Matesevo verkürzt sich auf 35 Minuten. Zudem seien früher auf der gefährlichen Straße viele Menschen ums Leben bekommen.
Der größere geostrategische Profiteur der Straße ist allerdings das Nachbarland Serbien, das seit jeher gute Beziehungen zu Peking pflegt. Einmal fertiggestellt, verbindet sie die serbische Hauptstadt Belgrad mit der Adria. Damit ist sie ein wichtiger Zugang des Binnenstaats zum Mittelmeer. Montenegro dagegen könne, so hieß es 2014 bei den Verhandlungen mit der chinesischen Export-Import Bank of China (Exim), »ein Transport-Hub der Region« werden.
Für China ist der Süden und Osten Europas so etwas wie die offene Flanke der EU. Chinesische Staatsunternehmen können hier üben«, wie gut sie mit den Standards und Auflagen der Europäischen Union zurechtkommen. Denn während man im Westen der Union eher skeptisch gegenüber Chinas neuen Ambitionen ist, bezeichnete der tschechische Präsident Miloš Zeman sein Land schon als »Chinas unversenkbaren Flugzeugträger«. Der griechische Premierminister Alexis Tsipras bot sein Land 2016 als »Tor nach Europa« an. Und der serbische Bauminister sagte 2017, es sei »nicht vermessen oder falsch zu sagen, Serbien ist Chinas Hauptpartner in Europa«.
Doch blickt man genauer auf die Verbindungsstraße, ist die Bilanz plötzlich nicht mehr so berauschend wie beim Hafen von Piräus. Das Problem: Die restlichen 122 Kilometer nach Belgrad wurden nicht fertiggestellt, und daran dürfte sich so bald nichts ändern. »Wir haben einen Witz«, sagte der ehemalige Justizminister von Montenegro, Dragan Soc 2021. »Das ist eine Straße von Nirgendwo nach Nirgendwo.« Ein Kredit von einer Milliarde, den Montenegro bei Peking aufnahm, mag im bundesdeutschen Haushalt keine große Rolle spielen. In dem kleinen Balkanstaat aber macht er knapp ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus und katapultierte die Verschuldung schlagartig auf 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Erschwerend hinzu kam, dass man sich bei dem Kredit nicht gegen Währungsschwankungen absicherte.
Warum die Straße nicht weitergebaut wird, ist nicht ganz klar. Angesichts der immens hohen Kosten von über 22 Millionen Dollar pro Kilometer fragen sich viele, ob nicht Korruption im Spiel war. NGOs hatten von Anfang an das Projekt wegen mangelnder Transparenz und Umweltschäden kritisiert.
Dieses Muster, eine Mischung aus Fehlplanung, Korruption und plötzlichem Stillstand, wird uns auf der Neuen Seidenstraße noch öfter begegnen.
Auf jeden Fall fehlt Montenegro Geld. Einspringen soll deswegen der Westen. 2022 schloss das kleine Land einen Vertrag mit zwei amerikanischen und einer französischen Bank, den chinesischen Kredit umzuschulden.
Für Probleme sorgt auch eine Bahnstrecke zwischen Serbien und Ungarn. 2017 startete die EU-Kommission eine Untersuchung des Ausschreibungsprozesses für eine Trasse zwischen Budapest und der serbischen Hauptstadt Belgrad. Der Vorwurf lautete: Die ungarische Regierung habe Aufträge ohne ein faires Verfahren an chinesische Unternehmen gegeben. Später eröffnete die EU sogar ein Strafverfahren gegen Budapest und hielt Gelder zurück.
Hinzu kommt: Die Bahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest eine innovative Errungenschaft zu nennen, ist ein Euphemismus. Neun Stunden dauert die Fahrt für die rund 300 Kilometer. In den 1980er Jahren sollen Züge die Strecke in sechs Stunden geschafft haben. Auch von Profitabilität ist sie weit entfernt. Schätzungen zufolge müssten neun Millionen Menschen mindestens einmal im Jahr ein Ticket kaufen. Bei derzeitiger Auslastung würde es mehrere Hundert Jahre dauern, bis sich das Projekt rentiert hat.
Wozu also diese Investition? Beruht sie schlicht auf einer Fehlkalkulation, oder gibt es andere Gründe?
Fünf Jahre später, im Herbst 2022, stehen die Chinesen plötzlich auch vor dem Hamburger Hafen: Mit 35 Prozent will sich das chinesische Staatsunternehmen Cosco in die Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort einkaufen. Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck legt ein Veto ein. Schließlich handle es sich um »kritische Infrastruktur«. Seit dem Ukraine-Krieg ist man in der deutschen Gesellschaft ohnehin sensibler, was Geschäfte mit autoritären Regimes angeht. Und haben die Chinesen nicht auch im fernen Sri Lanka einen Hafen übernommen? Dort nämlich hatte die Regierung mit chinesischem Geld einen Tiefseehafen bauen lassen. Als Sri Lanka in Zahlungsschwierigkeiten geriet, »pachtete« China den Hafen kurzerhand für 99 Jahre.
Andere aber warnen vor dem Gegenteil: »Eine Absage an die Chinesen wäre eine Katastrophe nicht nur für den Hafen, sondern für Deutschland«, so der Vorstand der Hafen Hamburg Marketing, Axel Mattern. Und auch in der Regierung ist man sich uneins. Am Ende kommt es zu einem Kompromiss: 24,9 Prozent dürfen die Chinesen von Tollerort übernehmen.
War das nun die richtige Entscheidung? Hätte man die chinesische Beteiligung besser ganz verbieten sollen, um einer schleichenden Übernahme zu entgehen? Oder hat man am Ende aus kleinlicher Paranoia wertvolle Investoren verprellt, die Deutschland eigentlich in dieser Phase der Globalisierung dringend braucht? Cosco, eine der größten Reedereien der Welt, ist immerhin der wichtigste Kunde des Hamburger Hafens. Was, wenn das chinesische Unternehmen demnächst andere Häfen bevorzugt? Und zeigt das Beispiel Piräus nicht, wie gut das Geld aus China sein kann? Schließlich ist China der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Ohne den gigantischen Aufschwung in Fernost über die vergangenen 20 Jahren wäre auch die Bundesrepublik ein großes Stück ärmer. Mehr Handel, mehr »Konnektivität«, wie es im Business-Neudeutsch heißt, war schließlich noch nie schlecht. Die Neue Seidenstraße, das außenpolitische Kernkonzept von Xi Jinping, soll doch gerade diesen transkontinentalen Handel weiter ausbauen und die Welt enger zusammenwachsen lassen. Oder etwa nicht? Waren es Handel und Globalisierung, die das chinesische Wirtschaftswunder ab 1990 entfachten, so soll nun auch der Rest der Welt wachsen, versichert Peking.
»Geopolitisch geht es auch darum, europäische Volkswirtschaften enger an Peking zu binden als vielleicht an die USA«, sagt Jacob Gunter, Senior Analyst beim Mercator Institut für China Studien (MERICS) in Berlin. »Es geht auch darum, den diplomatischen Einfluss auszubauen. Der Hafen von Piräus ist so ein Beispiel – die Nachfrage nach einem so großen Ausbau war eigentlich nicht da. Aber Griechenland hat eben ein Veto-Recht im Europäischen Rat.«
Neue Seidenstraße, der Name für Chinas Jahrhundertprojekt, ist geschickt gewählt. Im Westen schwingen dabei Bilder von orientalischer Exotik mit, vom Reichtum einer vergangenen Epoche. Mit der Realität hat das jedoch nicht viel zu tun.
»Die Initiative für eine neue Seidenstraße ist ja nicht das, was manche in Deutschland glauben, es ist keine sentimentale Erinnerung an Marco Polo, sondern sie steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren«, sagte der damalige Außenminister Sigmar Gabriel 2018 auf der Münchener Sicherheitskonferenz. »Dabei geht es längst nicht mehr nur um Wirtschaft: China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. China erscheint derzeit als das einzige Land der Welt mit einer wirklich globalen, geostrategischen Idee, und es verfolgt diese Idee konsequent.«
Und bisher hat kein Staat eine Antwort auf dieses Jahrhundertprojekt. Kleinere Staaten des globalen Südens geraten schnell in eine Abhängigkeit. Aber auch den USA und der EU fehlt eine Gegenstrategie zu diesem mal schöngeredeten, mal dämonisierten Projekt, das Xi Jinping vor zehn Jahren in Kasachstan verkündete.
2. AM ANFANG DER NEUEN SEIDENSTRASSE ODER »YOU NAME IT«
»Schulden sind ein mächtiges Instrument, viel besser, als es der Kolonialismus je war. Sie erlauben, die Kontrolle zu behalten, ohne eine Armee losschicken oder eine Verwaltung unterhalten zu müssen.«
Susan George, Politikwissenschaftlerin
Astana, das zwischen 2019 und 2022 zu Ehren des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew Nur-Sultan hieß, ist die Hauptstadt Kasachstans und die zweitgrößte Stadt dieses riesigen, aber nur dünn besiedelten Landes. Hier an der Nasarbajew-Universität hält Xi Jinping, der gerade erst mächtigster Mann der Supermacht geworden ist, im September 2013 eine Rede, die den Startschuss für die Neue Seidenstraße gibt. Die Worte, die Xi dafür wählt, klingen ebenso mächtig wie blumig: »Jahrtausendelang schrieben die Menschen in verschiedenen Ländern entlang der Seidenstraße gemeinsam ein Kapitel der Freundschaft, das bis zum heutigen Tag überliefert wurde. (…) Es ist an der Zeit, in der eurasischen Region engere ökonomische Verbindungen zu schmieden, die Zusammenarbeit zu vertiefen und den Entwicklungsraum auszuweiten. Es ist an der Zeit, entlang der Seidenstraße eine Wirtschaftszone aufzubauen. Dafür ist eine Reihe gemeinsamer Schritte erforderlich, zum Beispiel die Verbesserung der Kommunikation über politische Absichten und die Koordination solcher Schritte, die Stärkung und der Ausbau der Verkehrsverbindungen, die Förderung des unbehinderten Handels und die Stärkung der Geldkreisläufe. Es ist an der Zeit, die Seidenstraßen wiederzubeleben.«
Einen Monat später erwähnt Xi Jinping auf einer Südostasien-Tour auch den Begriff der »Maritimen Seidenstraße«. Die Länder der Region hätten »ein gemeinsames Schicksal« und sollten stärker »von der Entwicklung Chinas profitieren«, sagt Xi vor dem indonesischen Parlament in Jakarta. Und in Malaysia spricht er davon, dass die »Neue Seidenstraße« eine Win-win-Strategie für die Nationen Südostasiens sei. Seit der Antike sei die Region ein wichtiger Umschlagplatz und eine Handelsroute gewesen, auf der China Seide und andere Waren verkaufte.
Einige Jahre später, im Mai 2017, überbietet sich Xi Jinping nochmals: »Die Initiative könnte die Welt verändern. Austausch wird an die Stelle von Entfremdung treten. Gegenseitiges Lernen voneinander wird Zusammenstöße ersetzen, wie Koexistenz Überlegenheitsgefühle.« Die Neue Seidenstraße werde »der menschlichen Zivilisation Glanz verleihen« und gar beim Aufbau einer »neuen Ära der Harmonie und des Handelns« helfen. Er stellt Kredite in Höhe von acht Billionen US-Dollar für 68 Länder in Aussicht – eine unglaubliche Summe. Das neue »chinesische Zeitalter« werde all die Lücken füllen, die in den vergangenen Jahren IWF und Weltbank hinterlassen hätten. Es sei das »Projekt des Jahrhunderts«. Auch Anfang 2023 findet man in der »China Daily«, einem Sprachrohr der Kommunistischen Partei, zum zehnjährigen Jubiläum des Projekts überschwängliche Würdigungen der Neuen Seidenstraße beziehungsweise der Belt-and-Road-Initiative.
Das Projekt deckt sich mit der Regierungszeit des mittlerweile mindestens zweitmächtigsten Mannes der Welt. Sie soll sein geopolitischer Fußabdruck werden und China zurück ins Zentrum der Weltbühne katapultieren.
Xi Jinping hat im Frühjahr 2012 nach einem spektakulären Machtkampf die Spitze des chinesischen Regierungsapparats erklommen. Sein Widersacher Bo Xilai war über ein Mordkomplott an einem britischen Geschäftsmann gestolpert und von Xi politisch eliminiert worden. Kurz darauf begann er, seine Macht mit einer »Anti-Korruptionskampagne« zu festigen, die sich vordergründig gegen bestechliche Kader richtete, aber vor allem zum Ziel hatte, parteiinterne Widersacher loszuwerden. Xi schien zu dieser Zeit den wirtschaftsfreundlichen Kurs der Vorgängerregierungen und die Politik der Öffnung zu garantieren. Erst mit der Zeit wurde Beobachtern im Westen klar, dass Xi nach einer immer größeren Machtfülle strebte und ein neues autoritäres Kapitel in der Geschichte Chinas begonnen hatte. Xi intensivierte die Zensur und machte China zum digitalen Überwachungsstaat. Er ging gegen die wachsende Macht privater Tech-Konzerne vor, zum Beispiel indem er Jack Ma kaltstellte, den Gründer von Chinas größtem IT-Unternehmen Alibaba.1 Vor allem aber machte er sich selbst quasi zum Alleinherrscher: Im Oktober 2022 ließ er vom Parteikongress die in den 1980er Jahren eingeführte Amtszeitbegrenzung des Präsidenten aufheben und sich eine dritte Amtszeit bestätigen. Xi gilt heute als der mächtigste chinesische Präsident seit Mao Zedong. Unter Xi veränderte sich auch das außenpolitische Auftreten Chinas. Peking zeigte sich ab 2012 aggressiver, wenn es um Ansprüche auf unbewohnte Inseln im Ost- und Südchinesischen Meer ging, und verschärfte die Rhetorik gegenüber Taiwan. Die Rüstungsausgaben Chinas steigen ohnehin jedes Jahr um mehrere Prozent. Zugleich wurden Chinas Unternehmen im Ausland immer aktiver. China hatte Geld, viel Geld, und war innerhalb von zwei Jahrzehnten von einem Entwicklungsland zur zweitgrößten Volkswirtschaft gewachsen. Für Xi Jinping ging es darum, diese Macht nach außen zu projizieren. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Doch zunächst wurde Xis Initiative im Ausland weitgehend beklatscht. Von den geopolitischen Spannungen, die 2016 mit der konfrontativen China-Politik von US-Präsident Donald Trump begannen, war noch nichts zu merken. Weltweit, besonders in Deutschland, feierte man die Superlative, die jedes Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Peking vermeldet wurden: mehr Handel, mehr »Konnektivität«, mehr Verbindungen, mehr Straßen, egal ob physischer oder digitaler Natur – all das schien positiv.
Selbst Bestseller-Autoren wie Peter Frankopan ließen sich von dieser Begeisterung anstecken. Er begeistert sich in seinem Buch »Die Neuen Seidenstraßen« für die bei der chinesischen Propaganda so beliebten Zahlenmonster: So lebten entlang der Neuen Seidenstraße »4,4 Milliarden Menschen, mehr als 63 Prozent der Bevölkerung, die 29 Prozent des globalen BIP erwirtschaften.« Und so geht das noch einige Seiten im besten Xi-Jinping-Sprech weiter.
Nun haben es chinesische Projekte so an sich, dass sie stets ebenso wortgewaltig wie blumig getauft werden, dass man darunter alles und nichts verstehen kann. So ist es auch bei der Neuen Seidenstraße. »Was China besonders gut kann, ist, Visionen groß anzukündigen. So war es auch bei der Neuen Seidenstraße«, sagt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking und China-Kenner seit Jahrzehnten. Doch wann immer man versucht, eine dieser Visionen exakt zu definieren, stößt man auf Unklarheiten und Unschärfen.
Das beginnt schon einmal beim Namen Neue Seidenstraße. Denn neu ist die Wiederbelebung des historischen Begriffes nicht: So gab es zum Beispiel zwischen 1988 und 1998 ein Programm der UNESCO namens »Seidenstraße – Straße des Dialogs«, um das historische Erbe des Handelswegs zu pflegen. Ebenfalls in den 90ern initiierte der ehemalige Außenminister der Sowjetunion und damalige Präsident Georgiens, Eduard Schewardnadse, ein Projekt namens »New Silk Road – TRACECA«. Es sollte die Staaten Zentralasiens enger mit Osteuropa verknüpfen. 1994 gründeten 34 Länder der Region eine Seidenstraße-Initiative, um den Tourismus zu fördern. Und 1999 verabschiedete der US-Kongress den »Silk Road Act«, um die Länder des Kaukasus und Anrainer des Kaspischen Meeres zu fördern. 2011 sprach die damalige Außenministerin Hillary Clinton von einer »New Silk Road Initiative«, um Afghanistan besser in die Region einzubinden.
Was genau den Kern von Chinas Jahrhundertprojekt darstellt, lässt sich auch deshalb so schwer fassen, weil verschiedene Namen dafür kursieren. Statt von der »Neuen Seidenstraße« ist genauso oft von der »One-Belt-One-Road-Initiative« zu lesen, kurz OBOR, oder von der Belt-and-Road-Initiative (BRI). Auf Mandarin ist von »Yidai – Yilu« die Rede, »ein Gürtel, eine Straße«. Die Maritime Seidenstraße wird häufig mit MSR für »Maritime Silk Road« abgekürzt. In diesem Buch werden die verschiedenen Begriffe und Abkürzungen weitgehend synonym benutzt. Sie meinen dasselbe: Es geht um Chinas Investitionen im Ausland und um Pekings neuen Einfluss auf die Empfängerländer der vermeintlich großzügigen Kredite.
Die Unschärfe setzt sich fort, wenn man versucht, Xi Jinpings Vision geografisch einzugrenzen. Denn auch hier franst die Neue Seidenstraße aus. Sie entzieht sich einer exakten Definition, je genauer man sie betrachtet.
Die alte Seidenstraße umfasste insbesondere die Länder Zentralasiens. Sie begann im heutigen China, führte über das heutige Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan durch den Iran oder nördlich um das Kaspische Meer herum und endete grob gesagt im heutigen Syrien und der Türkei. Der Seeweg, also das, was sich als »Maritime Seidenstraße« bezeichnen lässt, war eine eher sporadisch genutzte Ausweichroute, wenn der Landweg mal wieder zu gefährlich und teuer geworden war. Außer den gewaltigen Schiffsexpeditionen von Zheng He im 15. Jahrhundert bestand diese aus Etappen, von denen nur die wenigsten Händler alle absolviert haben dürften. Sie führte zunächst nach Süden in Richtung Vietnam, durch die Straße von Malakka, dem heutigen Singapur, nach Indien und Sri Lanka und von dort aus in den Persischen Golf und manchmal auch nach Ostafrika.
Die Neue Seidenstraße aber reicht mal von Chongqing bis nach Duisburg, mal von Hangzhou bis in den Senegal. Mal fallen alle chinesischen Investitionen in Afrika von Madagaskar bis zum kleinen Inselstaat São Tomé e Príncipe darunter. Mal zählen südamerikanische Länder wie Chile und El Salvador dazu, mal geht es nur um den Landweg von China nach Europa. Ebenso unklar ist, ob die Maritime Seidenstraße insbesondere Chinas Investitionen in Südasien meint, oder ob eigentlich die Ölversorgung via Pipelines durch Pakistan und Myanmar im Vordergrund steht, um das Nadelöhr von Singapur zu umgehen.
Derzeit lässt sich nur sagen, dass das Projekt Neue Seidenstraße viel mehr umfasst als die Länder Zentralasiens, durch die die alte Seidenstraße führte. Selbst von einer »Polaren Seidenstraße« ist oft die Rede, wenn es darum geht, Chinas Ambitionen am Nordpol zu beschreiben. Immerhin lässt das Synonym Belt-and-Road-Initiative eine wesentlich breitere geografische Deutung zu. Aber auch die ist unscharf, kann mal alles und dann wieder nichts sein: China hat nie eine offizielle Karte der Routen oder irgendeine Liste von Projekten veröffentlicht. Es gibt weder eine Liste der beteiligten Länder noch offizielle Richtlinien, was eine Mitgliedschaft bedeutet.
Auch zeitlich ist die Neue Seidenstraße längst nicht so eindeutig einzugrenzen, wie es die Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas suggeriert. 2013 benutzte Xi Jinping erstmals den Begriff. Aber eine Landverbindung für den Güterverkehr von Südchina nach Hamburg existierte schon seit 2008 und verlief durch Russland, Belarus und Polen. Auf der oft zitierten Verbindung von Chongqing nach Duisburg via Kasachstan fuhren 2011 die ersten Züge – zwei Jahre vor dem Startschuss der Neuen Seidenstraße. Zudem schloss die Initiative zeitlich lückenlos an die »Go West«-Strategie der Regierung an. Unter dem Namen »Xibu Dakaifa«, übersetzt so viel wie »Entwicklung des Westens«, hatte Peking eine wirtschaftliche Erschließung und bessere Anbindung Zentral- und Westchinas gefördert, nachdem eine große Einkommenslücke zwischen den Metropolen an der Ostküste und dem kaum entwickelten Binnenland klaffte. Diese dann auf angrenzende Nachbarländer wie Kasachstan auszuweiten, lag nahe.
Auch dass chinesische Unternehmen vermehrt im Ausland aktiv sind und investieren, ist nicht wirklich neu. Die Expansion begann schon 1999 als Teil der »Going-out«-Strategie. Zuvor galt die Devise von Deng Xiaoping: »Sich zurückhalten und die eigene Stärke verstecken.« Die beiden staatlichen Banken Exim und die China Development Bank sollten chinesische Firmen dabei unterstützen, im Ausland Fuß zu fassen. Auch hier bestand bereits das Problem der Überproduktion und der sich anhäufenden Währungsreserven. Auch hier war man sich bewusst, dass man sich den Nachschub von Energie und Rohstoffen irgendwie sichern musste. Im Unterschied zur BRI aber waren die meisten der Kredite, die Peking im Ausland vergab, in Renminbi nominiert und nicht selten zinslos. Oft ging das Geld an politische Verbündete und Alliierte. Schon vor Start der Seidenstraße belohnte Peking wohlgesinnte Staaten und Alliierte mit hohen Krediten. Und selbst unter Mao betrieb die Volksrepublik eine aktive Investitionspolitik, wobei damals vielmehr von Entwicklungs- und »sozialistischer Bruderhilfe« die Rede war.
Nachdem die Finanzkrise 2008 die westliche Welt erschütterte, deren Schockwellen später in Form einer Schuldenkrise die Südländer der EU erreichten, nahmen Chinas Investitionen in europäische Infrastruktur zu. So kaufte sich die chinesische Reederei Cosco schon 2009 in den Hafen von Piräus ein (die Mehrheit erwarb sie 2016). Zwar sieht man eine deutliche Zunahme der chinesischen Auslandsinvestitionen gerade in den Jahren 2013 bis 2015. Aber es ist auch nicht so, dass Pekings Investitionen erst mit der Ausrufung der Neuen Seidenstraße begannen.
Mitte 2015 hatte die chinesische Entwicklungsbank China Development Bank (CDB) auf jeden Fall nach eigenen Angaben 890 Milliarden US