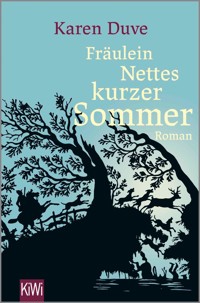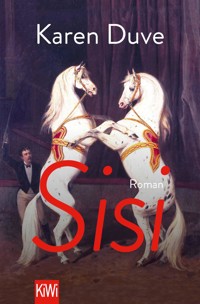9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Drachen, Liebe und anderen Ungeheuern. Wer hätte nicht einmal davon geträumt, Prinzessin zu sein und von einem edlen Prinzen heimgeführt zu werden? Zumal, wenn man als Prinzessin im rauen und trostlosen Nordreich Snögglingduralthorma lebt und eine Delegation aus dem sagenhaft reichen mittelmeerischen Baskarien vor den vereisten Toren der Stadt auftaucht. Doch halt: So einfach ist das in Karen Duves neuem Roman nicht – denn der stets schwarz gekleidete baskarische Prinz Diego will die bettelarme Prinzessin anfangs nur, um seine prestigesüchtige Mutter damit zu kasteien. Und gleich bei seiner Ankunft geraten die Baskarier und Prinzessin Lisvanas Landsleute in Streit. Aus der romantischen Brautwerbung wird eine echte Entführung, die entführte Prinzessin verweigert die Heirat – und im Nordreich sinnt man fortan finster brütend auf Rache ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Karen Duve
Die entführte Prinzessin
Von Drachen, Liebe und anderen Ungeheuern
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Karen Duve
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Karen Duve
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2005), Die entführte Prinzessin (2005) und Taxi (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, in dem sie die Frage aufwarf »Wie viel gönne ich mir auf Kosten anderer?« und damit eine breite Diskussion über unser Konsumverhalten auslöste. Zuletzt erschien von ihr die Streitschrift Warum die Sache schiefgeht (2014). Die Verfilmung ihres Romans Taxi kam im Sommer 2015 ins Kino.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wer hätte nicht einmal davon geträumt, Prinzessin zu sein und von einem edlen Prinzen heimgeführt zu werden? Zumal, wenn man als Prinzessin im rauen und trostlosen Nordreich Snögglingduralthorma lebt und eine Delegation aus dem sagenhaft reichen mittelmeerischen Baskarien vor den vereisten Toren der Stadt auftaucht. Doch halt: So einfach ist das in Karen Duves neuem Roman nicht – denn der stets schwarz gekleidete baskarische Prinz Diego will die bettelarme Prinzessin anfangs nur, um seine prestigesüchtige Mutter damit zu kasteien. Und gleich bei seiner Ankunft geraten die Baskarier und Prinzessin Lisvanas Landsleute in Streit. Aus der romantischen Brautwerbung wird eine echte Entführung, die entführte Prinzessin verweigert die Heirat – und im Nordreich sinnt man fortan finster brütend auf Rache ...
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Christina Hucke unter Verwendung einer Illustration von Petra Kolitsch
ISBN978-3-462-31594-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Schnee und Eis
Der beste aller Sänger
Ritter Bredur verliebt sich nicht
Pedsi und Rosamonde
Bredur und Lisvana
Pennegrillos Heimreise
Der schwarze Prinz
Seeungeheuer
Im Trichter
Der Tanz
Die Entführung
König Leo platzt der Kragen
Die Pastete
Die Gräfin Tolsteran
Geschenke
Der Hügel des Ehrgeizes
Hochzeitspläne
Das Glöckchen
Der Drache
Schmutzige Wäsche
Die Mummel
Der Drachenmarkt
Grendels Kampf
Der Graf von Garten
Die Ohrfeige
Ohne Plan
Die Flucht
Pedro Galbano
Die Goronzien
Sarilissa
Das Unglück
Der Schwan
Die neue Sarilissa
Der Diener
Burg Rudeck
Im Verlies
Grendel fliegt
Der Brief
Am Lagerfeuer
Die Heimkehr
Das Hochzeitsgeschenk
Die Fee
Am Turm
Die Hochzeit
Schnee und Eis
Es war einmal ein Königreich, das hieß Snögglinduralthorma oder so ähnlich, genau weiß das heute keiner mehr. Es wurde schon damals überall bloß ›das Nordland‹ genannt, weil es hoch, hoch im Norden lag – dahinter wohnten eigentlich nur noch Eisbären und Robben – und weil niemand den offiziellen Namen richtig aussprechen konnte. König Rothafur herrschte über das Nordland. Er hatte eine Königin, die ihm als Einzige zu widersprechen wagte, einen Sohn, der den Thron erben sollte, und eine Tochter, die verheiratet werden musste. Die Prinzessin hieß Lisvana und war wunderbar schön. Sie hatte Haare aus lauterem Gold und lilienweiß schimmernde Haut, veilchenblaue, mandelförmige Augen und seidenweiche Brauen und unzählige weitere Vorzüge, aber trotzdem wollte kein Prinz um sie anhalten.
»Was, Lisvana vom Nordland«, sagten die Prinzen, wenn sie die aktuelle Liste heiratsfähiger Königs- und Fürstentöchter durchgingen, »ist das nicht die mit dem goldenen Haar und der popeligen Mitgift? Lass mal sehen!« Und dann blätterten sie weiter zur Mitgift-Seite, und da stand unter
Nordland-Mitgift: siehe Snögglinduralthorma-Mitgift, und unter Snögglinduralthorma-Mitgift: ein Streifen faulig riechendes Moorgebiet am nördlichsten Ende des Reiches, wo sowieso nie jemand hinkommt, vier kleine Truhen voller Silberlöffel zweiter Wahl und zwanzig der einheimischen gelben Pferde, deren Plumpheit das dazugehörige gepunzte und kupferbeschlagene Zaumzeug auch nicht wettmachen kann. Die Pferde haben einfach zu kurze Beine. Außerdem der übliche Wäschekrempel, Handtücher und so weiter. Prinzessin ist allerdings ziemlich hübsch, Goldhaar und so weiter.
Der Verband der fahrenden Sänger, der die Liste herausgab, ließ es sich trotz wiederholten Protests nicht nehmen, die Prinzessinnen und ihre Mitgift zu kommentieren.
»Vier kleine Truhen, zwanzig schlechte Pferde und praktisch kein Land … – so hübsch kann eine Prinzessin ja gar nicht sein, um das auszugleichen«, sagten die Prinzen dann und blätterten zur Namensliste zurück.
Es lag nicht daran, dass König Rothafur geizig gewesen wäre. Er gönnte seiner Tochter alle Schätze der Welt, aber mehr hatte er nicht erübrigen können. Das Nordland besaß äußerst geringfügige Silbervorkommen und noch geringfügigere Kupfervorkommen. Große Vorkommen gab es bloß an blutsaugenden Insekten. Das Landesinnere war voller Geröllfelder, auf denen nichts wuchs. Immer wieder brach irgendwo ein Vulkan aus und verschüttete ein Dorf oder eine der letzten fruchtbaren Weiden. Die Sommer waren kurz und feucht. Sämtliche Nordländer trugen das ganze Jahr über eine langärmelige Oberbekleidung aus gelbem Ponyfell, die sie ›Jacki‹ nannten. Zwar gab es eine Küste und einen Hafen, aber das Meer vor der Küste war bodenlos und tückisch. Es wimmelte nur so von bösartigen Seeungeheuern, solchen mit Wildschweinhauern und solchen mit siebenundzwanzig Fangarmen. Dazu kamen noch unberechenbare Strömungen und Strudel. Das war der eine Grund, warum sich nur wenige Schiffe hier heraufwagten. Der zweite war, dass niemand so recht wusste, warum er die gefährliche Seestraße nach Snögglinduralthorma überhaupt nehmen sollte. Die Nordländer freilich hielten ihr Königreich für das schönste der Welt. Man reiste damals aber auch nicht besonders viel. Immerhin lag zu Weihnachten garantiert Schnee. Und zwar richtiger Schnee, nicht nur so ein bisschen Puderzucker auf den Wegen und weiße Haufen in den Ecken. Er fiel bereits Ende Oktober in weißen, flauschigen Flocken vom Himmel, Flocken, die man in der Hand fangen und lange betrachten konnte, bevor sie schmolzen. In kürzester Zeit trugen alle Häuser, alle Kirchen, Zaunpfähle und Bäume weiße Mützen, und die kleinen gelben Pferde versanken bis zu den Bäuchen und schnaubten missmutig auf die Schneedecke. Ihr Atem fror, und an ihren Nüstern bildeten sich Eiszapfen. Eiszapfen hingen von den Dächern sämtlicher Hütten herunter, Eiszapfen klirrten in den Bärten der Nordlandritter, und wenn sie im Rittersaal vor den Kaminfeuern saßen, tropfte das Schmelzwasser in ihre Trinkbecher. Mit Schnee und Kälte kam die Dunkelheit, schon der November war ein finsteres Loch, das füllte man mit knusprigem Schafsschinken, gebackenen Schweinepfoten und triefenden Kapaunen. Im Schloss musste der Hofzwerg Pedsi täglich seine Purzelbäume schlagen, auf ein Tanzvergnügen folgte das nächste, Honigbier floss in Strömen, der König erzählte Rentierwitze und die Ritter von ihren Ehrenhändeln. Wie die meisten Länder ohne bedeutende Vorkommen an Bodenschätzen hielt sich das Nordland viel auf seinen Stolz und seine Ehre zugute, davon konnte man fördern und fördern, es wurde doch nicht weniger.
Der Dezember kam den Rittern und Hofdamen schon länger vor. Den Zwerg wollte keiner mehr sehen, zum Tanzen hatte man auch immer weniger Lust, und der König ging von Rentier- zu Lemmingwitzen über, die nicht ganz stubenrein waren. Gerade mal zwei Stunden war es noch hell. Hell? Ein träges graues Funzeln schob sich zwischen die nicht enden wollenden Nächte. Immerhin gab es Weihnachten, da war man wieder obenauf. Weiße Weihnacht, darum beneideten einen die Länder des Südens. Dann kam der Januar, und es blieb ein paar Minuten länger Tag, dafür wurde es noch kälter. Das Meer fror zu, am Strand wuchs ein Feenwald aus gläsernen Dreiecken. Die Ritter erlegten ab und zu eine Robbe oder einen Eisbären. Zurück im Schloss kauten sie die Schwarten und fragten ihre Knappen Waffen- und Wappenkunde ab, und wenn einer nicht sofort die richtige Antwort hervorsprudelte, setzte es Tatzen. Die Hofdamen piesackten den Zwerg; sie wetteiferten darin, welche ihn zuerst zum Weinen bringen würde. Wann immer der König versuchte, einen Witz zu erzählen, legte ihm die Königin die Hand auf den Arm und sagte sanft: »Rothafur, bitte, diesen Witz hast du schon zweimal im November und achtmal im Dezember erzählt. Hier, ich habe mitgeschrieben«, und dann holte sie ein kleines rotes Notizbuch aus ihrer Königinnenschürze. »Kommt ein Rentier zum Bader und sagt: Ich habe da so ein Geschwür am Bauch … – hast du am 4.11., am 17.11., am 1.12., am …«
Woraufhin der König so beleidigt war, dass seine Nase ganz und gar in seinem Bart verschwand.
Spätestens im Februar gingen Honigbier und Wein aus, und die Ritter schauten immer melancholischer in ihre Becher. Einige Mutige wechselten zu Eichelschnaps, der bekanntlich auf die Augen schlug. Die Hofdamen traten den Zwerg, wenn sie ihn bloß sahen, die Ritter traten ihre Knappen und den Hofzwerg obendrein. Manchmal verprügelten sie sich auch gegenseitig. Am Ende des Monats hängten sie ihre Schwerter um, banden ihren kurzbeinigen Pferden Schneeschuhe unter und überfielen den einzigen angrenzenden Staat. Er hatte einen noch komplizierteren offiziellen Namen, der vollständig verlorengegangen ist, und wurde wegen seiner unangenehmen Witterung kurz ›Nebelreich‹ genannt. Der König und die Ritter des Nebelreichs warteten schon ungeduldig darauf, dass endlich die Nordlandritter angriffen. Es war die einzige wirkliche Abwechslung im Winter. Man kämpfte etwa eine Woche lang gegeneinander, zum Teil mit Fackeln, damit man überhaupt sah, wem man gerade seine Axt zwischen die Ohren hieb, und dann wurde die Grenze neu verhandelt und – je nachdem – dreihundert Schritt nach Norden oder Süden verschoben. Die Ritter sammelten ihre Toten ein, banden sie auf den Pferden fest und ritten wieder nach Hause. Im März lag weiterhin Schnee, aber es wurde endlich heller. Die Frauen beweinten ihre toten Männer, die Männer, die überlebt hatten, freuten sich gedämpft. Jetzt machte sich der Vitaminmangel bemerkbar. Chronische Erkältungen und entzündete Kampfwunden taten ein übriges, die geschwächten Körper der Nordländer mit chemischen Sensationen zu überfluten. Die Farben und das wiedergekehrte Licht schienen ihnen auf einmal ungewöhnlich intensiv, die Geräusche wirkten überirdisch, wie von Engeln hervorgerufen, und die Seher hatten ihre klarsten und beeindruckendsten Visionen. Das war – wenn man so will – ein weiterer Pluspunkt für Snögglinduralthorma: Ab März befand sich das ganze Land in einem allgemeinen Rauschzustand. Anders hätte man diesen Winter wohl auch nicht ausgehalten. Die Menschen wurden friedlicher, und der Zwerg hatte wieder Ruhe. Irgendwann brach die Eisdecke im Hafen auf. Man packte die Toten auf Boote, legte Feuer daran und schob sie aufs Meer hinaus. Die praktischste Lösung, da der Boden immer noch gefroren war. Anfang April ließ der König eine Silbermünze an das Tor seines Schlosses nageln. Die erhielt derjenige, der ihm als erster eine Blume brachte. Manchmal hing die Münze noch bis zum Mai dort, manchmal musste der Zwerg dann mit Gehirnerschütterung ins Bett. Wenn aber erst einmal die Wiesen in Blüte standen, ging alles sehr schnell. Jeden Tag blieb es länger hell, die Äcker überzogen sich mit einem grünen Flaum, und die Bauern trieben ihr Vieh aus den Schuppen auf die leuchtenden Weiden. Rund um das Schloss wurden Balken über die Schlammlöcher gelegt, damit auch die Königin, die Prinzessin und die Hofdamen spazieren gehen konnten. Der Zwerg wurde gehätschelt, gestreichelt und mit wässrigen Erdbeeren gefüttert. Trotzdem versuchte er jeden Sommer wieder zu fliehen, aber man wusste schon, wo man ihn suchen musste. Stets kampierte er auf einem Felsen in der Nähe des Hafens, wo er in eine Wolldecke gewickelt auf ein fremdes Schiff hoffte. Seine Fluchtversuche zogen keine Strafen nach sich. In den Sommermonaten waren die Nordländer unbeschwert und verziehen kleine Missetaten schnell. Sie machten überhaupt alles schnell. Sie aßen, arbeiteten, tollten, küssten und atmeten mit doppelter Geschwindigkeit, dann war es auch schon wieder Oktober, und die kalte, dunkle Zeit brach abermals an.
Der beste aller Sänger
An so einem Oktobertag, kurz vor dem ersten Schnee, geschah es, dass ein fahrender Sänger auf seinem Esel geritten kam und ans Schlosstor klopfte. Er war nicht mehr ganz jung und trug einen grünen Rock aus schmiegsamem Sammetstoff mit schwarzen Punkten aus Maulwurfsfell, die gut zu seinen dunklen Haaren passten. Auch die Strumpfhose war zweifarbig, ein Bein grün und das andere schwarz. Er hieß Pennegrillo, und er war der erste auswärtige Sänger, der es je bis zum Nordland herauf geschafft hatte. Bisher hatte man immer mit Hrimnir Nebelhorn vorliebnehmen müssen, dessen Gesang genauso widerwärtig war wie seine speckige Lumpenkutte. Pennegrillo hingegen galt weit über die Grenzen seiner Heimat Baskarien hinaus als Meister der Reimkunst, und seine Stimme war wie Honigseim. Wenn er loslegte, hielten selbst Nachtigallen den Schnabel und lauschten lieber ihm. Was hatte einen Burschen von solchem Talent bis ins Nordland hinauf verschlagen? Nun, so merkwürdig es klingen mag, aber es war sein großer Erfolg, der ihm vorauseilende Ruf, der ihm seine gewohnte Tournee verleidet hatte. Ob Baskarien, Italien, Rapunzien oder Burgund – wo immer er ankam, wurde er stürmisch empfangen. Und das ödete ihn an. In Basko hatten sie schon gejubelt und geklatscht, bevor er seine Laute überhaupt vom Sattel losgebunden hatte. Ekelhaft! In Rom hatten hellblau gewandete Jungfern seinem Esel rosa Nelken vor die Hufe gestreut. Lästig! Und in Pargo hatten sie nach jedem Lied so lange geklatscht, dass er insgesamt nur vier hatte vortragen können. Diese Banausen! Die feierten doch bloß sich selbst und ihren guten Geschmack! Darum hatte der Große Pennegrillo beschlossen, diesmal weit nach Norden zu reisen, wo man hoffentlich noch nicht von ihm gehört hatte, Kiefern- und Birkenwälder statt Olivenhaine zu durchqueren und nebenbei auch noch den Verbandsrekord zu brechen, indem er in einem Jahr mehr Länder abhaken würde als je ein Sänger vor ihm. Das Nebelreich hatte er bereits geschafft, jetzt wollte er der Vollständigkeit halber auch noch das Nordland machen und dann schleunigst zurückreisen, um vor Einbruch des Winters in eine wirtlichere Region zu gelangen.
König Rothafur hieß den unerwarteten Gast willkommen. Dessen Ankunft versprach nicht nur angenehme Zerstreuung an den kürzer werdenden Tagen, sondern war auch eine Gelegenheit für die Ritter, das lange vernachlässigte Baskarisch wieder aufzufrischen, ohne dessen Gebrauch man sich nicht zu den wirklich vornehmen Höfen rechnen durfte. Er ließ ihn darum mit allem versorgen, was der Sänger sich nur wünschen konnte. Zwei frisch gefüllte Strohsäcke und ein Lager bei den Knappen, ein gelbes Jacki gegen den Frost und ein Leinentüchlein voller Spezereien, um die Hautparasiten zu vertreiben, die man sich auf Reisen unweigerlich einfing.
Pennegrillo lauternierte und sang zu allseitiger Zufriedenheit, er aß und trank, verdiente sich die Gunst der Damen und das Silber der Herren, und nach Ablauf zweier Tage dichtete er auch noch ein Lied auf die Prinzessin.
»Eure Tochter ist eine Schönheit, die in aller Welt gerühmt gehört«, hatte er König Rothafur und dessen Gemahlin zugeraunt. »Dass sie in der jährlichen Liste der heiratsfähigen Königs- und Fürstentöchter bisher nicht besser weggekommen ist, liegt allein an Hrimnir Nebelhorns Unfähigkeit. Ich werde sein Versäumnis wieder gutmachen.«
Am dritten Abend trug er das Huldigungslied vor. Die Feuer im Saal brannten, die Ritter und der König saßen mit aufgestützten Ellbogen am langen Tisch. Es hatte den ganzen Tag geregnet, der Geruch tropfnasser Ponyfelljackis hing in der Luft, und unter dem Tisch liefen Rinnsale und verdampften zischend auf den heißen Steinplatten des kleinen Kamins. Vor dem großen Kamin kuschelten sich die Hofdamen mit ihrem Handarbeitszeug. Der Zwerg hatte sich bäuchlings auf einem Fell ausgestreckt.
Pennegrillo stimmte seine Laute und blickte einmal in die Runde. König Rothafur versenkte die Nase im Bart, die Königin faltete ihre Hände im Schoß, und Prinzessin Lisvana beugte sich tief über den Stickrahmen und tat sehr emsig. Und dann begann Pennegrillo zu singen. Er sang von der unübertrefflichen Schönheit der Nordland-Prinzessin, von ihrer Makellosigkeit, Wohlgestalt und Anmut, ihrer Erlesenheit, Herrlichkeit, Köstlichkeit, sang von ihrem unvergleichlichen Liebreiz, den er dann doch mit allerlei verglich: Die Rubinlippen schmiegten sich aufeinander wie eine Abendwolke auf die Mondsichel. Die zarten Nüstern bebten wie die eines edlen Füllen, die schneeweißen Hände hoben sich wie Schwanenflügel, und die Haare – das hatte ja sogar Hrimnir Nebelhorn bereits bemerkt – strömten wie flüssiges Gold über ihre Schultern und ihren Rücken. Acht Strophen handelten ausschließlich von Prinzessin Lisvanas körperlichen Vorzügen, fünf befassten sich mit ihrer Sittsamkeit und Tugend. Die vierzehnte Strophe handelte davon, dass die Prinzessin ein Paradiesvogel sei, gefangen im Eis, ein Kleinod, das jeder begehren musste, der sie nur einmal gesehen hatte. Pennegrillo behauptete kühn, König Rothafur halte seine Tochter aus Weisheit versteckt, denn wenn ihre Schönheit bekannt würde, so wären alsbald die fürchterlichsten Kämpfe ihretwegen entfesselt. Schließlich sang er, dass die Welt für jeden Mann ein Jammertal sei, nichts als Asche, Bitternis und Qual, ein Fluch, die Pest und Nasenbluten – nur für den nicht, den die Prinzessin erwählen würde. Dabei wurden sein Lautenspiel und sein Gesang immer leiser, klagender und langsamer, bis er schließlich mit gesenktem Kopf verstummte. Einen Moment lang war es im Saal ganz still. Dann brachen alle – außer der erröteten Prinzessin – in Hochrufe aus, und die Ritter sprangen auf, nahmen ihre Schilde von der Wand und klopften mit den Schwertknäufen darauf.
Als Pennegrillo später auf seinem Strohbett lag, malte er sich aus, wie er am nächsten Morgen mit Abschiedsgeschenken und Proviant überhäuft werden würde. Anders war es nach diesem Erfolg gar nicht denkbar. Er wusste, wie er sich in einem solchen Fall zu verhalten hatte. Das waren ja nicht die ersten Geschenke, die er bekam. Auf seinem Weg ins Nordland hatte er fünf Depots anlegen müssen. Er würde sich vor König Rothafur hinknien und sagen: »Aber das ist doch viel zu viel, es ist mir ja gar nicht gelungen, der Schönheit Eurer Tochter auch nur annähernd gerecht zu werden. Außerdem hat mir Eure Gemahlin, die holde, hohe Königin, doch gestern schon einen Silberbecher überreicht.«
Gerührt von so viel Bescheidenheit würde der König seinen schicken Lemmingfellmantel mit der Zobelkante abnehmen und ihn Pennegrillo um die Schultern legen. »Damit du nicht frierst, du unersetzbarer Künstler, du Meistersänger, ein königlicher Mantel für den König der Poesie«, würde der alte Zauselbart sagen, und Pennegrillo würde sich stumm noch tiefer verbeugen. Die Hofdamen würden vor Rührung schluchzen. Dann würde die Prinzessin zu ihm treten, ihn lange ansehen, und in ihren Augen …
Aber bevor Pennegrillo sich ausmalen konnte, was in den Augen der Prinzessin zu lesen sein würde, wurde er von seinem Lager gerissen und bekam einen Sack über den Kopf gestülpt. Grobe Hände stießen und knufften ihn vorwärts. Er taumelte, stolperte, fiel gegen etwas Hartes, es schepperte, er schrie um Hilfe, wurde dafür roh getreten und gestoßen, andere nicht weniger grobe Hände fingen ihn auf und stießen ihn weiter in die Hände eines dritten; falls das nicht wieder der erste war. Man zerrte ihn fort. Kalte Nachtluft umfing ihn, jetzt hatte man ihn aus dem Schloss verschleppt, seine bestrumpften Füße traten auf spitzen Kies.
»Wohin bringt ihr mich?«, rief er, bekam Schläge zur Antwort, und weiter, immer weiter ging es. Wenn er fiel, wurde er wieder hochgerissen. Endlich durfte er einen Augenblick Atem schöpfen. Er hörte das Ächzen einer schweren Tür, die aufschwang, dann erhielt er einen Puff in den Rücken und stürzte mehrere Stufen hinunter. Er schrie vor Schmerz und Schreck und erwartete, dafür sogleich wieder getreten zu werden, aber nichts geschah. Hinter ihm drehte sich knirschend ein Schlüssel im Schloss, und drei Riegel wurden vorgeschoben. Nach einer ganzen Weile wagte er es, sich hinzusetzen, fühlte Stroh unter sich und eine harte Mauer im Rücken. Mit einem rauen Schluchzen ließ er sich dagegensinken. Der Ort, an dem er sich befand, war so duster, dass er zuerst gar nicht begriff, dass man ihm den Sack bereits wieder abgenommen hatte. Erst als der Morgen kam und die Sonne einen Klotz Licht durch ein schmales, vergittertes Fenster drückte und das entsprechende Muster leicht verbogen an einer Mauer erschien, begriff er, dass man ihn in den Turm des Vergessens geworfen hatte, den finstersten Ort dieses an Finsternis ohnehin nicht armen Landes. Immerhin hatte man darauf verzichtet, seine Füße in Eisen zu legen, und immerhin hatte man ihm einen Strohhaufen aufgeschüttet und einen Napf mit Gerstengrütze hingestellt. Pennegrillo begann zu grübeln. Er war ein Gefangener. Zweifellos. Aber womit hatte er das verdient? Was hatte er falsch gemacht? Was bloß?
Ritter Bredur verliebt sich nicht
Die Antwort lautete: Nichts. Gar nichts. König Rothafur hatte bereits bei Ankunft des fremden Sängers beschlossen, ihn bis zum nächsten Frühling dazubehalten, um den Winter über ein bisschen Abwechslung zu haben. Und da es sich bei einem Sänger, auch wenn er der beste von allen war, doch nur um fahrendes Volk handelte, so hatte er sich nicht die Mühe gemacht, ihn um sein Einverständnis zu bitten oder ihm die Sache auch nur zu erklären. Zwei Wochen später, als das Nordland tief verschneit war, zu tief, als dass jemand ohne Ausrüstung und Kenntnisse sich noch hätte fortwagen können, ließ er ihn wieder frei.
Pennegrillos Repertoire war so groß, dass er eine ganze Woche lang singen konnte, ohne sich ein einziges Mal wiederholen zu müssen, aber sobald er die Laute zur Hand nahm, brüllte der ganze Hofstaat: »Huldigungslied! … Huldigungslied!«, und er musste sein Meisterstück zum Besten geben. Abend für Abend besang er Prinzessin Lisvanas Schwanen- bzw. Lilien- bzw. Muschelhände und ihre Veilchen- bzw. Kristall- bzw. Tief-wie-Brunnen-Augen und ihren Leib, der schlank und biegsam wie eine Weidengerte bzw. weiß und zart wie kostbarstes Linnen war, sang in immer neuen Variationen von den Wonnen aussichtslosen Begehrens, wobei seine eigene Begeisterung allerdings von Tag zu Tag abnahm. An manchen Abenden sang er das Huldigungslied vier- oder fünfmal. Selbst das tiefe und reine Gefühl eines Sängers musste bei einer solchen Fron verschleißen. Doch während Pennegrillos Herz zunehmend kühler wurde, geriet sein Publikum in einen allgemeinen Liebestaumel. Dieser Winter ging in die Geschichte des Nordlands ein als der Winter, in dem sich jeder zweite im Schloss verliebte. Aus lauter Langeweile und mit zunehmendem Alkoholkonsum waren die Nordländer in der kalten Jahreszeit sowieso leicht entzündlich, aber so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie gewesen. Fünf Hofdamen verliebten sich in den frisch verwitweten jungen Ritter Luntram, Ritter Luntram wiederum verliebte sich in Rauhilde, die zweite Ehrenjungfer der Prinzessin, der Koch verliebte sich nacheinander in vier Mägde, die Königin verliebte sich noch einmal in ihren Mann und lachte sogar über seine Witze, die Schlosswache verliebte sich ineinander und musste getrennt werden, und mindestens dreißig Ritter – verheiratet oder nicht – verliebten sich in die Prinzessin. Sämtliche Knappen sowieso. Die Prinzessin war aber auch zu schön. Je öfter Pennegrillo seine Lobpreisungen zum Besten gab, desto hübscher wurde sie. Ihre Haare gleißten goldener denn je, ihre Pupillen füllten schwarz und samtig den größten Teil des Auges, und ihre weißen Hände glitten wie Schwanenflügel über ihre Stickarbeit. Trotzdem gab es einen Ritter, der jedes Mal, wenn Pennegrillo seine Laute stimmte, spöttisch den Mund verzog, sich zu seinem Knappen beugte und etwas sagte wie: »Oh Gott, gleich hören wir zum vierundzwanzigsten Mal das Lied über den Schwanenhals und die Schwanenhände unserer Schwanenprinzessin.«
Der hartherzige, unbeeinflussbare junge Mann war Ritter Bredur, sein Schwert hieß Greinderach, sein Leibross Kelpie und sein Knappe Wigald.
Ritter Bredur zählte gerade mal neunzehn Jahre. Er war für einen Nordlandritter eher schmal, nicht viel größer als die Prinzessin, besaß feine Gesichtszüge, eisblaue Augen, eine Nase, die auch ein Hoffräulein nicht hätte verschleiern müssen, und einen fast mädchenhaften Mund. All dies hätte ihm großen Kummer bereiten müssen, wenn er nicht wenigstens den üppigen Bartwuchs von seinem Vater Fredur Wackertun geerbt hätte. Dessen Bart glich einem alten Krähennest, in dem seine Nase wie eine Runkelrübe steckte. Fredur Wackertun war einer der angesehensten Ritter. Er hatte sich in mehr Kämpfen hervorgetan als irgendein anderer, konnte das Wetter auf drei Wochen vorhersagen und hatte erst kürzlich ganz allein und nur mit einem Messer bewaffnet einen See-Elefanten erlegt. Dass er fast immer betrunken war, störte die wenigsten.
Ritter Bredur hatte es schwer, seinem Vater etwas recht zu machen.
»Mein Herr Sohn hat es ja nicht einmal fertiggebracht, auf die Welt zu kommen, ohne seine schöne gute Mutter das Leben zu kosten«, pflegte Fredur Wackertun zu sagen.
Bredur verschloss seine Gefühle in seinem Herzen, versteckte seinen Mund in einem dichten blonden Bart und seine dünnen Arme und schmalen Schultern in Kettenhemd und unförmigem gelbem Jacki, die ein Nordlandritter praktisch nie auszog. Wenn Bredur mit verschränkten Armen an der Saaltür lehnte und seinem Knappen bissige Bemerkungen zuraunte, ruhten die Augen der Hofdamen durchaus mit Wohlgefallen auf ihm.
»Nun schau dir bloß diese verliebten Gockel an«, sagte Bredur beim zweiunddreißigsten Vortrag des Huldigungsliedes zu Wigald, »die alten Krächzer und die flaumigen Küken, verheiratet oder gerade von der Ammenbrust gerissen, richtige Froschaugen machen sie. Aber das ist natürlich alles völlig aussichtslos. König Rothafur will einen König zum Schwiegersohn haben, das ist einmal klar. Oder wenigstens einen Herzogs- oder Grafensohn – niemals wird er sie einem seiner landlosen Ritter geben. Niemals!«
»Aber wenn sich nun kein König und kein Grafensohn einfinden wird?«, fragte Wigald. »Die Prinzessin ist immerhin schon siebzehn.«
Bredur strich Wigald liebevoll über die Knappenfrisur.
»Dann wird Rothafur seine Tochter schließlich doch einem seiner Ritter geben müssen.«
Der Hofzwerg Pedsi schlich sich von hinten an, kletterte auf einen Hocker, klapste Ritter Bredur mit der Pritsche auf den Kopf und schrie: »Jucheirascha!«
Später, als Wigald seinem Herrn beim Ablegen der Kleider half, sagte der junge Ritter:
»Findest du nicht auch, dass der gute Pennegrillo gewaltig übertreibt? Sooo schön ist die Prinzessin ja nun auch wieder nicht.«
Knappe Wigald, der gerade die Lederstrippen an Bredurs Hosenbeinen aufpuhlte, antwortete beflissen: »Oh, nein, so besonders schön ist sie wahrhaftig nicht.«
Bredur versetzte ihm eine Ohrfeige.
»Dummkopf, natürlich ist sie sehr schön. Denk nur an das ganze Goldhaar! Aber dass die Haut ihres Halses so fein wäre, dass man den Rotwein hindurchschimmern sehen könnte, wenn sie trinkt, ist zum Beispiel schlichtweg erfunden. Ich habe darauf geachtet, man sieht überhaupt nichts.«
Der Knappe zupfte schweigend die Schuppenstrümpfe von den Ritterfüßen. Schweigen war das Klügste, was ein Knappe in einem solchen Moment tun konnte.
Pedsi und Rosamonde
Im November durfte Pennegrillo mehr von seinen anderen Liedern ins Programm mischen, aber mindestens einmal am Abend musste er immer noch das Huldigungslied zum Besten geben. Nachts wand er sich in Alpträumen, in denen König Rothafur beschlossen hatte, ihn nie mehr fortzulassen, sah sich als weißhaarigen Greis noch in zwanzig Jahren das Huldigungslied auf eine altjüngferliche Prinzessin Lisvana anstimmen.
Inzwischen hatte sich der unglückliche Hofmarschall in die Königin verliebt, die zweite Ehrenjungfer Rauhilde in den hünenhaften Prinzen Jörgur, die Knappen schmachteten immer heftiger die Prinzessin an, und Ritter Bredurs Kommentare wurden immer bissiger. Da von überall her die Liebeswinde bliesen, erwischte es schließlich sogar Hofzwerg Pedsi. Statt den verliebten Rittern die Pritsche auf den Kopf zu hauen, schwänzelte er bei jeder Gelegenheit um die erste Ehrenjungfer der Prinzessin herum und schenkte ihr kleine Leckereien, die er für sie aus der Küche stahl.
»Liebste, schönste Rosamonde«, flehte Pedsi, »wollt Ihr nicht meine Frau werden?«
Rosamonde schüttelte ihre braunen Locken und verzog den Mund so angewidert, dass ihre weißen Schneidezähne mit dem entzückenden kleinen Spalt dazwischen zu sehen waren.
»Eher esse ich meinen Schuh«, sagte sie und steckte das Gebäck ein, das Pedsi ihr in einer Spanholzschachtel überreicht hatte.
»Warum nicht, liebliche Rosamonde?«
»Du bist so verdammt klein!«
»Ja, aber ich bin jung, und ich habe ein hübsches Gesicht.«
Rosamonde stutzte einen Augenblick und betrachtete den Zwerg. Pedsi hatte tatsächlich ein schönes Gesicht. Traurige dunkle Augen mit langen Wimpern, eine feine, blasse Haut und dichtes schwarzes Haar.
»Das reicht nicht«, entschied Rosamonde. »Du bist einfach zu klein. Und so jung, dass du noch wachsen wirst, bist du ja wohl auch wieder nicht.«
»Einen Ritter werdet Ihr vielleicht niemals bekommen. Aber wenn Ihr mich nehmt, könnt Ihr immer am Hofe bleiben!«
»Wer sagt denn, dass ich mein Leben lang an diesem Dreckshof bleiben will? Wenn die Prinzessin heiratet, zieh ich sowieso mit ihr weg.«
»Heiratet mich trotzdem. Wenn Ihr mich erst richtig kennt, werdet Ihr euch schon in mich verlieben. Wir könnten zusammen wegziehen.«
Rosamonde lachte ihn aus. Jedes Mal. Je öfter sie und die anderen Hofdamen lachten, desto trauriger und mutloser wurde Pedsi.
Doch dann, eines Abends, geschah Folgendes:
König Rothafur saß auf seinem Thron aus Narwalzähnen und hatte schlechte Laune.
»Was ist denn nur mit dem Zwerg los«, murrte er, »der ist ja gar nicht mehr lustig. Zwerg, reiß dich zusammen! Sei lustig!«
Um der Forderung seines Königs Nachdruck zu verleihen, versuchte Ritter Luntram, den Zwerg in den Hintern zu treten. Pedsi wich aus, packte Luntrams Bein, während es sich noch in der Luft befand, und rannte damit einmal um den auf der Stelle hüpfenden Ritter herum. Dann ließ er los und kauerte sich so hin, dass der taumelige Herr Luntram rückwärts über ihn fiel und zu Boden polterte. Der König war begeistert. Er trommelte sich mit den Fäusten auf die Oberschenkel.
»Großartig«, rief er, »ganz große Klasse! Endlich! Ich dachte schon, du hättest es nicht mehr drauf. Komm her! Los, komm schon! Ich erfüll dir einen Wunsch!«
Sofort rannte Pedsi zum Thron.
»Nun?«, sagte Rothafur, »was soll’s denn sein? Ein neues Jacki? Oder ein Biberwams?«
Der Hofzwerg zögerte.
»Ich habe nur einen einzigen Wunsch …«
König Rothafur nickte aufmunternd.
»Die erste Ehrenjungfer der Prinzessin … Fräulein Rosamonde … sie ist doch verwaist und ohne Mitgift, … ich meine … ich wollte sagen … ich hätte sie gern zur Frau.«
Im selben Augenblick schrie Jungfer Rosamonde auch schon wütend auf, packte einen Feuerhaken und wollte sich damit über den Zwerg hermachen. Pedsi flüchtete unter den Tisch, an dem die Ritter saßen. Rosamonde vergaß sich, raffte die Röcke und kroch hinterher. Das fand der König noch lustiger, die Tränen spritzten ihm vor Lachen aus den Augen, und als der Zwerg wie ein Kaninchen vor dem Marder aus dem Bau flüchtete, winkte er ihn zu sich. Da der Zwerg das nicht sofort mitbekam, schnappte ihn einer der Ritter und stellte ihn vor dem Thron ab. Rosamonde kam jetzt auch unter dem Tisch hervor und wollte sich wieder auf ihn stürzen, aber König Rothafur befahl, sie festzuhalten.
»Genug«, japste der König und wischte sich die Lachtränen in den Bart, »hört sofort auf. Alle beide. Oder ich lach mich tot.«
Dann wandte er sich an den Zwerg.
»Deine Bitte soll erfüllt werden«, sagte er. »Wenn der Schnee schmilzt, sollt ihr Hochzeit halten. Dieses Weib scheint mir zur Gattin eines Hofnarren geradezu geboren zu sein.«
Die Königin legte ihrem Gemahl die Hand auf den Arm und wollte etwas sagen, die Prinzessin rief: »Väterchen, nicht …«, aber alle Einwände gingen im dröhnenden Gelächter der Ritter unter. Als das Lachen abebbte, riss sich Rosamonde los, warf sich vor dem König auf den Boden und flehte um Schonung.
»Nein«, sagte der König und musste schon wieder kichern, »ein Versprechen ist ein Versprechen. Geh, und wenn das nächste Mal eine Kuh geschlachtet wird, lass dir das Euter aushändigen. Daraus wirst du eine Schellenkappe für deinen zukünftigen Gemahl fertigen. Kau sie schön weich und näh silberne Glöckchen dran.«
Rosamonde rannte schluchzend aus dem Saal, und die Ritter brüllten vor Lachen. Anschließend erörterten sie ausführlich die Sache mit dem Euter, während die Hofdamen aufgeregt berieten, wie Rosamonde zu helfen sei. Aber bevor sie mit ihrem Bittgesuch beim König vorstellig werden konnten, begannen die Ritter, durch die Euter-Diskussion animiert, zotige Witze zu reißen. Da mussten die Damen den Saal verlassen, die Ritter waren unter sich, und der gemütliche Teil des Abends konnte beginnen. Der Hofzwerg aber saß still vor dem Kaminfeuer, so überwältigt von seinem Glück, dass er es gar nicht mitbekam, wie sein Kostüm ansengte.
Ende Dezember war es soweit: Niemand mochte mehr Pennegrillos Lieder hören. Vor allem nicht das Huldigungslied auf Prinzessin Lisvana. Nicht einmal die Prinzessin selbst wollte es noch hören. Es war ja nicht so, dass Pennegrillo freiwillig sang. Aber es war auch nicht so, dass er es schnell begriff, als er allmählich damit aufhören durfte. Ein Künstler muss wissen, wann es genug ist. Er muss die leisen Zeichen beachten, ob jemand während des Vortrags gähnt oder ob die Zuhörer anfangen, sich ungeniert an den dreckigen Stiefeln herumzupopeln und miteinander zu schwatzen, oder ob einem nachts Pferdeäpfel in den Schlund gestopft werden. Wenn einem nachts Pferdeäpfel in den Schlund gestopft werden, sollte man in Erwägung ziehen, das Singen ganz einzustellen. Und das tat Pennegrillo.
Von nun an unterhielt er die Hofdamen damit, von fremden Ländern und ihren Sitten und Moden zu erzählen. Alle lauschten gebannt. Außer Rosamonde, die Abend für Abend leise schluchzend in einer Ecke saß, auf das gegerbte Kuheuter in ihren Händen starrte und immer noch nicht fassen konnte, welche Zukunft sich vor ihr aufgetan hatte. Prinzessin Lisvana hingegen konnte gar nicht genug hören von den Städten des Mittelmeeres, wo es Tag und Nacht, sommers wie winters, so warm sein sollte, dass die Männer bloß Hosen bis zum Knie trugen und ihre Wamse und Ärmel mit lauter Schlitzen versahen. Die Frauenkleider dort waren so voluminös, dass nie mehr als zwei Damen zur gleichen Zeit in einem normal großen Zimmer sein konnten, und weil man für solch ein Kleid enorm viel Stoff brauchte, mussten diese Stoffe ganz dünn und leicht sein. Flachs oder Wolle rührte ein richtiger Schneider gar nicht erst an, sondern nahm nur, was aus einem Faden gewoben war, den ein winziger Vogel spann. Dieser Faden schillerte wie der Vogel selbst in allen Regenbogenfarben, und so schillerten natürlich auch die Gewänder. Die Ärmel wurden aus Schmetterlingsflügeln gefertigt, denn die Schmetterlinge waren dort so groß wie Kaninchen und ihre Flügel noch bunter als der spinnende Vogel und so fest und dehnbar wie eine Schweinsblase.
»Wenn das alles wahr ist«, rief die Prinzessin, »so will ich nur den König des Mittelmeers zum Mann und sonst niemanden. Und dann werde ich fortan nur noch Kleider aus Vogelgarn und Schmetterlingen tragen.«
Die verliebten Ritter, die anderweitig beschäftigt getan, aber doch immer wieder zur Damenrunde hinübergehorcht hatten, zuckten zusammen. Bisher hatte die Prinzessin noch nie einen Heiratsgedanken formuliert oder ihren Blick länger auf einem der Herren ruhen lassen, sodass jeder sich ungestört seinen Illusionen hatte hingeben können.
»Du nimmst, was kommt«, knurrte Prinz Jörgur hinter seinen Spielkarten hervor. »Oder willst du als alte Jungfer enden?«
Die Ritter entspannten sich wieder, und der schmächtige Herr Bredur tauschte einen verstohlenen Blick mit seinem Knappen.
Der Winter nahm und nahm kein Ende, dem Sänger fielen keine Geschichten und neuen Kostümschnitte mehr ein, er ließ sich ein wenig gehen, kniff die Knappen in die Wangen und wurde auffallend häufig bei der Schlosswache gesehen. Also musste Hofzwerg Pedsi wieder Purzelbäume schlagen. Lisvana bestickte ihre Filzpantoffeln mit blauen Schmetterlingen und ihr Leinenkleid mit bunten Vögeln, während Rosamonde mit dem Euter, das einmal eine Schellenkappe werden sollte, so gar nicht vorankam. Dem Zwerg hatte sie verboten, sie auch nur anzusehen, und wann immer er das Wort ›Liebe‹ in den Mund nahm, schrie sie vor Wut und griff nach dem nächsten schweren Gegenstand. Rosamondes Unglück rührte Ritter Luntram, dessen Gefühle für die Jungfer Rauhilde inzwischen wieder abgekühlt waren. Auch gönnte er dem Zwerg, der ihn vor allen lächerlich gemacht hatte, eine so schöne Belohnung nicht. Herr Luntram begab sich zum König, ersuchte um eine Unterredung unter vier Augen und bat Rothafur, Jungfer Rosamonde die Hochzeit mit dem Hofzwerg zu erlassen, weil nämlich er selber sie gern heiraten würde.
»Wenn’s weiter nichts ist«, sagte König Rothafur launig. »Eigentlich war der Wunsch des Zwergs sowieso ziemlich unverschämt. Ich werde ihm stattdessen ein Biberwams schenken und die Glöckchen an seinen Schuhen neu versilbern lassen. Das ist mehr als reichlich.«
Die erste Ehrenjungfer wurde eingeweiht, ließ sich von Herrn Luntram die Tränen abtupfen, und am nächsten Abend winkte König Rothafur den Hofzwerg zu sich. Neben dem Thron stand Rosamonde. Mit Juchheirascha purzelte Pedsi den beiden vor die Füße.
»Die Jungfer will dir einen Kuss geben!«, sagte der König und musste sich sichtlich das Lachen verbeißen. Der Zwerg sah etwas ängstlich zu seiner zukünftigen Gemahlin auf, dann zu den Rittern und schließlich wieder zu Rosamonde. Doch die Ehrenjungfer beugte sich mit sanftem Lächeln zu ihm herunter und nahm sein Kinn in die Hand. Pedsi zuckte nervös, er erwartete, geschlagen zu werden, hielt aber trotzdem still, weil es das erste Mal war, dass ihn Rosamonde überhaupt berührte. Als er nun sogar ihre Lippen auf den seinen fühlte, da glaubte er, vor Seligkeit vergehen zu müssen, und es war ihm ganz gleich, dass der König, die Königin, der Prinz, die Prinzessin, die Hofdamen und alle Ritter zusahen – eine dicke, runde Glücksträne rollte ihm aus dem Auge. Rosamonde küsste ihn lange, damit der König auf keinen Fall sagen konnte, dass es zu kurz gewesen wäre und sie den Zwerg noch einmal küssen müsste. Die Ritter trommelten mit den Fäusten auf den Tisch, und die Damen sahen einander verwundert an.
»So«, sagte der König und rieb sich zufrieden die Hände, »das war der erste Teil der Belohnung, und jetzt gibt es noch mehr.«
Bei diesen Worten trat Ritter Luntram vor und drückte dem Zwerg ein Biberwams und einen Lederbeutel mit frisch versilberten Schellen in die Hände, während er gleichzeitig Jungfer Rosamonde an sich zog.
Pedsi begriff nicht sofort, wie das gemeint war.
»Was?«, sagte er und sah den König mit schiefem Kopf an.
»Was?«, machte der König ihn nach und legte ebenfalls den Kopf schief. »Nichts was! Hiermit schenke ich dir ein nagelneues Biberwams. Das soll dir genügen. Fräulein Rosamonde wird Herrn Luntram heiraten.«
Da begriff der Zwerg und heulte auf vor Verzweiflung.
»Aber ich habe Euer Ehrenwort.«
»Niemals! Keinem Zwerg würde ich je mein Ehrenwort geben – das steht nur Rittern und Königen zu. Dir habe ich bloß irgendetwas erzählt.«
»Ihr habt mir Euer königliches Versprechen gegeben. Das müsst Ihr halten.«
»Gar nichts muss ich«, brummte König Rothafur verlegen, »sag einem König nicht, was er muss, sonst mach ich dich noch kürzer!«
»Noch kürzer, haha«, rief er, und die Ritter lachten ebenfalls. Rosamonde fiel erleichtert ein und lehnte sich ein wenig gegen Herrn Luntram.
Der Zwerg saß da wie ein Häuflein Unglück. Schließlich konnte der König seinen Anblick nicht länger ertragen und winkte ihm, sich zu entfernen. Mit regloser Miene ging Pedsi aus dem Rittersaal, das Biberwams schleifte er hinter sich her über den Boden. Beim Hinausgehen taumelte er, als hätte er sein Augenlicht eingebüßt, und stieß mit der Schulter heftig gegen die Tür. Er fühlte es nicht. Auch das Gelächter der Ritter schmerzte ihn kaum. Demütigungen waren schließlich sein Beruf. Alte Tradition in seiner Sippe, die sich auf die Aufzucht von Hofzwergen und -narren spezialisiert hatte. Die Mütter legten ihre Kinder in Eisen, um ihr Wachstum zu hemmen, sie hauten bereits den Säuglingen die Rassel auf den Kopf und lachten sie dabei aus, um sie an Gemeinheiten zu gewöhnen. Was Pedsis Seele zu zerschmettern drohte, war ausschließlich der Verlust Rosamondes. Seine Träume – dahin. Seine Liebe – vergebens. Und das in jenem Moment, in dem er sich seinem Ziel am nächsten geglaubt hatte.
Bredur und Lisvana
Natürlich scherte sich niemand groß um die Gefühle eines Zwerges. Allerdings quälte ihn auch niemand zusätzlich, denn es machte kein Vergnügen, jemanden zu drangsalieren, der sowieso nur noch still in einer Ecke saß. Pedsi klagte nicht einmal, wenn man ihn trat. Kurz: Der Januar war noch langweiliger als sonst, und darum setzte König Rothafur diesmal schon Anfang Februar das Widderhorn an die Lippen und rief seine Ritter zum Krieg. Damit hatten die Bewohner des Nebelreiches nicht gerechnet. Ja, eigentlich hatten sie vorgehabt, endlich einmal selbst anzugreifen und dadurch im Vorteil zu sein. Aber da standen bereits die Nordländer vor den Toren, stürmten die Burg, nahmen den König des Nebelreichs gefangen und verlegten die Grenze zum dritten Mal in Folge dreihundert Schritt nach Süden. Das Ganze war beinahe unblutig abgegangen, und so waren alle, selbst der Nebelreichkönig, zufrieden. Die Ritter schlugen sich gegenseitig auf die Schulter, versicherten einander, ungeheuer tapfer und ehrenvoll gekämpft zu haben, und banden ihre vier, fünf Toten auf die Pferde. Dann zog man ab und wünschte einander ein gesegnetes neues Frühjahr. Bis zum nächsten Mal.
All das wäre gar nicht weiter erwähnenswert, hätte das Schlachtgetümmel nicht für Ritter Bredur die Möglichkeit offeriert, sich hervorzutun. Prinz Jörgur war in der Dunkelheit mit Karacho gegen eine Mauer galoppiert, von seinem Pferd gestürzt und hatte sich dabei in der eigenen Rüstung verheddert. Bredur hatte im Schein seiner Fackel den mächtigen Brustpanzer mit dem königlichen Eisbär-Emblem an sich vorbeisegeln gesehen und war sogleich von seinem Hengst Kelpie gesprungen. Mit dem eigenen Schild schützte er den Nordlandprinzen vor herangaloppierenden Hufen, durch die Dunkelheit zischenden Äxten und schwirrenden Schwertern, bis Jörgur seine Scharniere sortiert und sich wieder aufgerappelt hatte.
Deswegen sollte Ritter Bredur bei der anschließenden Siegesfeier die Ehre zuteilwerden, dass Prinzessin Lisvana ihm ein- und nachzuschenken hatte, nur ihm und niemandem sonst. König Rothafur teilte das seiner Tochter kurz vor der Feier mit. Die königliche Familie war noch unter sich.
»Es widerspricht Anstand und Gerechtigkeit, dass ich einem Mann einschenke, der ein Gefolgsmann meines Vaters ist«, rief Lisvana empört.
»Dieser Ritter hat mir, deinem Bruder, das Leben gerettet. Also halt den Mund und tu, was man dir sagt«, fuhr Prinz Jörgur sie an.
»Wieso soll ich einen Ritter bedienen, bloß weil mein Bruder so dumm war, vom Pferd zu fallen?«, wandte Lisvana sich wieder an ihren Vater. »Am Ende kommt noch das Gerücht auf, du willst Ritter Bredur zum Grafen erheben und mit mir vermählen.«
»Dummes Zeug«, schnaufte König Rothafur, »du schenkst diesem tapferen Helden ein und damit basta. Kein Mensch denkt an Heirat.«
»Nach dem, was mein sauberer Bruder neulich beim Kartenspiel gesagt hat, wäre es kein Wunder«, schmollte die Prinzessin.
Prinz Jörgur lachte höhnisch.
»Wo sind sie denn, deine vielen Freier? Du kannst froh sein, wenn Ritter Bredur dich überhaupt will. Wahrscheinlich bist du ihm viel zu alt. Aber vielleicht können wir seinen Vater überreden, dich zu nehmen.«
»Hört ihr das?«, rief Lisvana. »So ist er immer!«
»Aber Kind«, hatte ihre Mutter sich schließlich eingemischt, »ist es dir denn vollkommen egal, was für ein schöner und tapferer Ritter Herr Bredur ist?«
»Vollkommen«, hatte Lisvana geschluchzt und ihren Stickrahmen auf den Boden geschleudert.
Den Helden musste sie trotzdem bedienen und während des ganzen Siegesfestes schräg hinter ihm stehen. Jedes Mal, wenn sie Ritter Bredur einschenkte, versuchte er, ihr in die Augen zu sehen. Lisvana hielt eisern die Lider gesenkt. Nur die Hand, die den Krug zum Becher führte, zitterte vor Wut. Bredur, der das Zittern, aber nicht die Wut bemerkte, hielt es für ein günstiges Zeichen. Nun stand der alte Ritter Högli auf, ging um den Tisch herum, stemmte sich mit fettigen Fingern auf Bredurs Schulter und sagte, was für ein tapferer, tüchtiger Bursche er sei.
»Genau wie dein Vater.«
Und ein Vorbild für alle. Die Ritter brummelten ihre Zustimmung und hoben ihre Becher, nur Fredur Wackertun, der seinem Sohn schräg gegenübersaß, trank einfach weiter, als hätte er nicht gehört, und wischte sich den Schaum in den Bart. Seine mächtigen Schultern beugten sich über den Tisch.
»Fredur«, rief Högli vorwurfsvoll. »Fredur, wir trinken auf deinen Sohn!«
»Oh. Ja. Auf meinen Sohn«, sagte Fredur Wackertun. Seine Stimme dröhnte wie aus einem Fass und als hätte er es selber leer getrunken. »Dann lasst uns vor allem darauf trinken, dass mein Sohn es mal wieder fertiggebracht hat, ohne eine einzige Narbe in seiner hübschen Milchfratze nach Hause zu kommen. Da frag ich mich doch, wie …«
»Also wirklich, Fredur, was soll denn das …«, rief Högli.
Ritter Bredur hob seinen Becher und sagte kalt:
»Auf meine hübsche Milchfratze und meinen trinkfesten Vater!«
»Auf dich, Bredur!«, rief Högli schnell, und die anderen Ritter schlossen sich ihm an.
»Auf Bredur!«
»Ja, auf Bredur!«
»Den Helden!«
Als Prinzessin Lisvana ihm diesmal nachschenkte, sah sie dem Ritter zum ersten Mal ins Gesicht. Er war tatsächlich hübsch.
»Sie hat mich angesehen, ganz gewiss, kein Zweifel möglich«, jubelte Bredur zwei Stunden später, als er wieder mit seinem Knappen allein war.
»Was habe ich getan«, klagte zur gleichen Zeit Prinzessin Lisvana ihrer ersten Ehrenjungfer. »Jetzt denkt er bestimmt, er hat mich bereits im Sack. Wahrscheinlich prahlt er schon vor den anderen Rittern damit. Ich bin entehrt. Dem Gespött des ganzen Hofes preisgegeben. Mein Vater bringt mich um! Was soll ich nur tun?«
»Am besten, Ihr schaut ihn die nächsten Wochen gar nicht mehr an. Tut so, als würdet Ihr einen anderen Ritter beobachten, das macht ihn fertig. Schaut Ritter Brödi an, der ist auch tapfer gewesen und hat den König des Nebelreichs gefangen. Warum nicht Ritter Rutem mit den schönen Augen? Dass die Herren in Euch verliebt sind, ist ja nun keineswegs neu. Und wenn Ihr alle anseht, habt Ihr keinen angesehen«, riet die kluge Rosamonde.
»Nein, sie will nichts von mir wissen. Wie konnte ich je glauben, bei ihr landen zu können«, jaulte Ritter Bredur die folgenden Tage seinem Knappen vor. »Ich bin doch nur ein blöder Ritter, Sohn eines Säufers, und sie ist auch viel zu schön.«
Vergebens versuchte Wigald, seinen Herrn aufzumuntern.
»Die Prinzessin wagt nur nicht, Euch anzusehen. Sie möchte schon, aber sie traut sich nicht.«
»Doch, sie traut sich! Sie will bloß nicht!«
Und Ritter Bredur ließ fortan den Kopf hängen.
»Na also, er leidet«, triumphierte Rosamonde, »wir sind auf dem richtigen Weg. Wer leidet, meint es aufrichtig. Ab morgen könnt Ihr wieder ein bisschen netter sein.«
Die Prinzessin benahm sich also ein bisschen netter, wobei die Angelegenheit dadurch erschwert wurde, dass Ritter und Damen sich nur einmal am Tag im selben Raum aufhielten, abends im Rittersaal, selbst dort an verschiedenen Tischen saßen und alle stets unter der Aufsicht aller standen.
»Sie liebt mich … ich bin unwiderstehlich … ich bin der tapferste aller Ritter …«, sang es in Ritter Bredur, als er das Lächeln der Prinzessin auffing. Und als am selben Abend noch musiziert wurde, tanzte er aus lauter Übermut einen wilden Tanz mit einer Kammerzofe.
»Er liebt mich nicht, er interessiert sich nur für die Zofenschlampen«, jammerte die Prinzessin an diesem Abend. »Da lässt man sich herab – ach, wenn ich nur tot wäre. Es soll mir eine Lehre sein.«
Aber am nächsten Abend sah er wieder nur sie an, ganz deutlich, und diesmal schaute sie zweimal zurück – und beim zweiten Mal sogar einen ganzen Lidschlag lang.
Von nun an bekam die Entwicklung ein schwindelerregendes Tempo. Rosamonde fand durch ihren etwas unbedarften Ritter Luntram heraus, zu welcher Tageszeit Herr Bredur durch den Ostturm hinunter zu den Pferdeställen ging, und lauerte mit Prinzessin Lisvana auf der Wendeltreppe, bis sie seine Schritte poltern hörten, um ihm sodann unverfänglich plaudernd entgegenzuschreiten. Auf der Wendeltreppe wurde es so eng, dass sie einander unweigerlich berühren mussten, auch wenn Ritter Bredur sich gegen die Wand presste, als wollte er hindurchdiffundieren.
»Oh süße Lust, von diesem tapferen Mann berührt zu werden«, seufzte die Prinzessin später in ihrer Kammer.
»Oh ja, das ist wahr«, seufzte Rosamonde, woraufhin Prinzessin Lisvana beschloss, beim nächsten Mal allein zu gehen.
Viermal traf sie den Ritter auf der Treppe und streifte mit ihrem Arm an seinem Jacki entlang. Aber öfter als viermal hintereinander konnte man so etwas nicht machen, fand auch Rosamonde. Deutlich genug war es schließlich gewesen. Wenn Ritter Bredur jetzt nicht handelte, so war es ganz allein seine Schuld, und vergeben wollte sich die Prinzessin schließlich auch nichts. Also ging sie eine Woche lang nicht mehr in den Turm, sehnte und quälte sich, seufzte über ihrer Stickerei und trat nach ihren Zofen, da der bekümmerte Zwerg sich in irgendwelche Ecken verkrochen hatte. Ihre Qualen waren aber nichts gegen die des Ritters, der sich den Kopf zermarterte, was er falsch gemacht haben könnte. War er zu zudringlich gewesen, weil er seine Schulter ein wenig vorgestreckt hatte, als sie an ihm vorbeiglitt? Hatte er sich ihr widerlich gemacht, weil er dabei zu laut geatmet hatte? Hatte er sich am Ende nur eingebildet, dass sie seine Nähe gesucht hatte, war es gar keine Absicht gewesen, bloß Zufall? Vielleicht wollte der König ihr ein neues Pferd schenken, und sie kam deswegen so oft aus den Pferdeställen. Vielleicht passte es ihr zu der Stunde gerade gut. Ach, sie war doch immer noch eine Prinzessin und er nur ein schmächtiger Ritter ohne Land. Was hatte er sich nur eingebildet. Oder hatte Knappe Wigald recht, und alles war ganz anders? Hatte er die Prinzessin verärgert, weil er zu zögerlich gewesen war? War sie seine Halbherzigkeiten leid und verlangte Taten? Oh, wenn sie ihm doch nur noch eine einzige Chance geben würde. Dann könnte er etwas Eindeutiges tun.
Fünf Wochen später, als er den Ostturm bereits völlig resigniert hinunterging, stand die Prinzessin plötzlich wieder auf den Stufen. Ihre Blicke trafen sich. Funken stoben. Gleich sah Prinzessin Lisvana wieder zu Boden und eilte an ihm vorbei, aber diesmal drückte er sich nicht an die Wand, und als sie an ihm vorbeiglitt, griff er nach ihrer Hand. Er wusste selbst nicht, woher er den Mut dazu nahm. Du bist völlig wahnsinnig, dachte er noch bei sich, komplett plemplem. Wenn du dich geirrt hast, bist du verloren. Aber er griff zu und hielt fest. Die Prinzessin blieb stehen, ohne sich umzuwenden. Sie ließ ihm ihre Hand. So standen sie viele lange Sekunden, die Prinzessin den Blick immer noch auf den Boden geheftet, der Ritter, auf ihren Rücken starrend, dann, als ihm klar wurde, dass er ja unbeobachtet schauen konnte, weitere Teile ihrer Anatomie betrachtend. Endlich wurden ihre ineinander verflochtenen Hände so warm und feucht, dass sie von selbst auseinanderglitten, und die Prinzessin hastete davon.
Von Glück durchrauscht sprang Bredur die letzten Stufen hinunter – und lief in seinen Vater hinein.
»Das hört auf!«, donnerte Fredur Wackertun. »Du bringst mir keine Schande über meinen Namen!«
Pennegrillos Heimreise
Und dann, eines Morgens, kam ein Ziegenhirte mit einem Krokus in der Faust angerannt und verdiente sich die festgenagelte Münze vom Schlosstor. Kein Zweifel: Der Frühling war da; die Wege waren wieder frei.
Kaum hatte Pennegrillo davon erfahren, ging er zu seinem Strohlager und begann wortlos zu packen. Als er den Silberbecher der Königin in die Hand nahm, verzog er sein Gesicht zu einer giftigen Grimasse. Er war kurz davor, den Becher aus lauter Wut über die verdorbene Saison aus dem Fenster zu schleudern oder dem weinenden Knappen zu schenken, der ihm beim Packen half. Aber dann siegte seine sparsame Ader, und er steckte ihn ein. Die Nordlandfahrt hatte ihn schon genug gekostet. Er durfte gar nicht darüber nachdenken, was er währenddessen in Pargo und Rom alles hätte verdienen können. Bis er zu Hause ankam, würde es Juni sein, und den Sommer würde er brauchen, um sich von diesem Winter zu erholen. Und wie sein Kostüm aussah! Die Hosen waren fast durchgewetzt und die Punkte aus Maulwurfsfell auf seinem schönen Rock ganz grau und mottig. Einer hing bereits kläglich herunter. Pennegrillo riss ihn ab und schenkte ihn dem aufschluchzenden Knappen als Andenken. Dann schleppte er seine Habseligkeiten in den Schlosshof. Während er den Esel belud, kamen der König, die Königin und die Prinzessin sowie einige Damen, Knappen und Pagen zu ihm.
»Du willst doch nicht etwa ohne deine Abschiedsgeschenke gehen?«, rief der König.
»Nicht nötig, ich hab ja schon den tollen Silberbecher«, muffte Pennegrillo und zerrte am Bauchgurt seines Esels.
»Damit du dich nicht verkühlst und womöglich deine Stimme ruinierst«, sagte der König und legte Pennegrillo einen kratzigen Wollschal um. Der Sänger musste sich mehrmals räuspern, bevor er ein »Danke« herausbrachte. Dann trat die Prinzessin vor und gab ihm einen Kasten aus Holz. Es war ein gewaltig großer Kasten. Da konnte alles Mögliche drin sein. Es wäre sehr unhöflich gewesen, ihn nicht entgegenzunehmen. Und wie hold die Prinzessin ihm lächelte … Pennegrillo war beinahe versöhnt.
»Gute Reise, großer Sänger, du warst viel besser als Hrimnir Nebelhorn und hast uns erfreut und unterhalten. Möge dein Heimweg angenehm und ohne Gefahren sein«, sagte die Königin, und der König nickte. Um nicht gierig zu erscheinen, öffnete Pennegrillo den Kasten nicht sofort, sondern band ihn so, wie er war, an seine Packtaschen.
Zwerg Pedsi, der dem Abschied von Weitem zugesehen hatte, lief so schnell er konnte in die Küche, wo er einen Kanten Käse und ein Brot stahl und in sein Halstuch wickelte. Dann rannte er aus dem Schloss und auf Schleichwegen zum Wald. An dem einzigen Weg, der hindurchführte, setzte er sich auf einen Baumstumpf, zappelte mit den Beinen und zerpflückte vor Nervosität einen Rindenpilz. Aber bevor noch Pennegrillo auf seinem Esel angeritten kam, wurde Pedsi von einem grässlichen Schrei aufgescheucht. Er kam ganz aus der Nähe und klang, als wäre jemand in großer Not. Pedsi sprang von seinem Baumstumpf und lief hin. Auf einer Lichtung mit einem kleinen Waldsee fand er den Sänger. Pennegrillo stand neben seinem Esel, hielt den geöffneten Holzkasten in den Händen und starrte angewidert hinein.
»Herr«, rief der Zwerg, »lieber Herr, was ist Euch?«
Statt einer Antwort brachte Pennegrillo bloß ein Gurgeln hervor.
»Ich hörte Euren Schrei«, sagte Pedsi. »Was für ein Schrei, dachte ich bei mir, da macht jemand einem Kummer Luft, der sich mit meinem messen kann.«
Pennegrillo stemmte den Holzkasten hoch über seinen Kopf und schleuderte ihn in den See. Während der Kasten durch die Luft flog, fielen kleine Metallgegenstände heraus und verstreuten sich über den Waldboden. Pedsi bückte sich und hob einen der Silberlöffel zweiter Wahl auf, für die das Nordland so berüchtigt war.
»Gefällt Euch das Besteck nicht?«
»Löffel dieser Qualität«, schrie Pennegrillo und schnappte nach Luft, »würde ich in meinem eigenen Palais nicht einmal den Lakaien zumuten. Man hält mich gefangen, mehr als ein halbes Jahr, treibt seinen Mutwillen mit mir, man verleidet mir beinahe meine eigene Kunst, man schlägt und schikaniert mich, und dann drückt man mir diesen Ramsch in die Hand und meint, damit wäre alles wettgemacht. Ihr Barbaren!«
Er schüttelte die Fäuste.
»Wie recht Ihr habt«, rief Pedsi. »Auch ich bin ein Gefangener. Viele Jahre schon. Oh, wenn Ihr mich doch nur mitnehmen wolltet.«
»Kommt überhaupt nicht in Frage«, sagte Pennegrillo scharf. »Ich will jetzt so schnell wie möglich nach Hause. Du wärst mir bloß hinderlich.«
»Niemals«, rief Pedsi. »Ich könnte Euch sogar nützlich sein. Wir könnten zusammen auftreten: Ihr singt, und ich mache Späße!«
Pennegrillo bestieg seinen Esel und gab Pedsi, der sich an den Sattel zu klammern versuchte, einen Tritt, dass er zu Boden stürzte.
»Seh ich vielleicht aus wie ein Wanderzirkus?«
Er trieb seinen Esel an und ritt über den Zwerg hinweg.
Pennegrillo schlug die Küstenroute ein. Wochenlang musste er reiten, bis er auf ein Schiff traf, das auf dem Weg nach Süden war. Damit fuhr er eine gute Strecke Wegs, stieg wieder aus, klapperte nacheinander seine fünf Depots ab, nahm dann mit sechs Maultieren gleich das nächste Schiff und landete schließlich am Mittelmeer, in seiner Heimat, dem Land der Baskaren, wo er den heiligen Schwur tat, nie wieder Richtung Norden zu reisen und nie, nie wieder das Huldigungslied auf die Prinzessin Lisvana zu singen. Sein Leben lang nicht mehr.