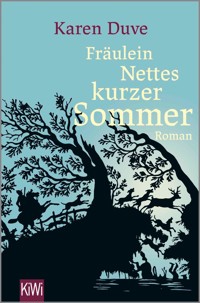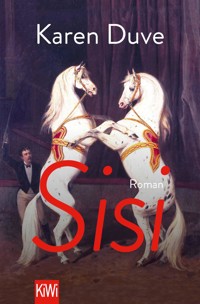9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Noch nie war Liebe so finster und Weltuntergang so unterhaltsam. Frauen haben die Regierung an sich gerissen, Pillen geben ewige Jugend, religiöse Endzeitsekten schießen wie Pilze aus dem Boden und ein genervter Mann kettet seine Frau kurzerhand im Keller an … Wir schreiben das Jahr 2031: Staatsfeminismus, Hitzewellen, Wirbelstürme, Endzeitstimmung und ein 50-jähriges Klassentreffen in der Hamburger Vorortkneipe ›Ehrlich‹. Dank der Verjüngungspille Ephebo, der auch Sebastian Bürger sein gutes Aussehen verdankt, sehen die Schulkameraden im besten Rentenalter alle wieder aus wie Zwanzig- bis Dreißigjährige, und als Sebastian seine heimliche Jugendliebe Elli trifft, ist es um ihn geschehen.Wen interessiert es da noch, dass die Krebsrate vonEphebo bei 60 % innerhalb der nächsten zehn Jahre liegt? Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Sebastians Frau, die ehemalige Ministerin für Umwelt, Naturschutz, Kraftwerkstilllegung und Atommüllentsorgung, die er seit zwei Jahren in seinem Keller gefangen hält. Dort muss sie ihm seine Lieblingskekse backen und auch sonst in jeder Hinsicht zu Diensten sein. Seiner neuen Liebe steht sie jetzt allerdings im Weg. Bei dem Versuch, sich seine Frau vom Hals zu schaffen, löst Sebastian eine Katastrophe nach der anderen aus . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Karen Duve
Macht
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Karen Duve
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Karen Duve
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2005), Die entführte Prinzessin (2005) und Taxi (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, in dem sie die Frage aufwarf »Wie viel gönne ich mir auf Kosten anderer?« und damit eine breite Diskussion über unser Konsumverhalten auslöste. Zuletzt erschien von ihr die Streitschrift Warum die Sache schiefgeht (2014). Die Verfilmung ihres Romans Taxi kam im Sommer 2015 ins Kino.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Wir schreiben das Jahr 2031: Staatsfeminismus, Hitzewellen, Wirbelstürme, Endzeitstimmung und ein 50-jähriges Klassentreffen in der Hamburger Vorortkneipe »Ehrlich«. Dank der Verjüngungspille Ephebo, der auch Sebastian Bürger sein gutes Aussehen verdankt, sehen die Schulkameraden im besten Rentenalter alle wieder aus wie Zwanzig- bis Dreißigjährige, und als Sebastian seine heimliche Jugendliebe Elli trifft, ist es um ihn geschehen. Wen interessiert da noch, dass die Krebsrate von Ephebo bei 60 Prozent innerhalb der nächsten zehn Jahre liegt?
Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Sebastians Frau, die ehemalige Ministerin für Umwelt, Naturschutz, Kraftwerkstilllegung und Atommüllentsorgung, die er seit zwei Jahren in seinem Keller gefangen hält. Dort muss sie ihm seine Lieblingskekse backen und auch sonst in jeder Hinsicht zu Diensten sein. Seiner neuen Liebe steht sie jetzt allerdings im Weg. Bei dem Versuch, sich seine Frau vom Hals zu schaffen, löst Sebastian eine Katastrophe nach der anderen aus …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © plainpicture/Bildhuset
Lektorat: Wolfgang Hörner und Esther Kormann
ISBN978-3-462-31538-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Dank
Schritt 1: Schnapp das Opfer und lass es verschwinden.
Schritt 2: Isoliere das Opfer und mache es vollkommen von dir abhängig.
Schritt 3: Beherrsche das Opfer und lass es sich um deine Anerkennung und Zustimmung bemühen.
Schritt 4: Instruiere das Opfer und erziehe es so weit um, dass es nach deiner Ideologie handelt.
Schritt 5: Verführe das Opfer und vermittle ihm neue sexuelle Wertvorstellungen.
(»Gehirnwäsche, wie man den menschlichen Verstand in fünf einfachen Schritten beugt, verwirrt und zerstört«, ein Artikel aus dem Herrenmagazin OUI, erschienen 1976, zitiert in »Die Leibeigene«, Christine McGuire, Carla Norton, Bergisch Gladbach 1988)
»Mit Frauen und Untertanen umzugehen ist äußerst schwierig.«
(Konfuzius)
1
Ich habe gerade das Telefon installiert, das ich auf dem Dachboden gefunden habe, ein einfacher hellgrauer Fernsprechapparat mit Wählscheibe und ohne technische Fisimatenten – kein Stand-by-Modus, kein Bildschirm, kein integriertes Kopiergerät, dessen Druckerpatrone nur unter Zuhilfenahme einer bebilderten Bedienungsanleitung gewechselt werden kann, und vor allem kein Anrufbeantworter. Nichts als ein altmodisch großer Hörer auf einem robusten Gehäuse, das von jedem Laien mit einem einfachen Schraubenzieher geöffnet und repariert werden kann.
Aber als es jetzt klingelt, ist es nicht dieser Inbegriff der Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit, der meine Eltern in den 60er-Jahren mit der Welt verbunden hat, sondern es ist natürlich das schicke, flache, leicht konkave Ego-Smart in meiner Hosentasche, dieser Fluch der Menschheit, der uns zwingt überall und jederzeit verfügbar zu sein, wenn wir noch irgendwo mitmischen wollen. Und dass es dabei den gleichen altmodischen Klingelton von sich gibt wie das Telefon meiner Eltern, ist der reine Hohn.
Ich fürchte, dass es jemand vom Heimatbund sein könnte. Unvorsichtigerweise habe ich zugesagt, beim gemeinschaftlichen Geländeeinsatz gegen den alles überwuchernden Killer-Raps mitzuhelfen. Aber das Gesicht auf dem Display – eine halb kahle, halb ergraute Raubvogelphysiognomie mit Beuteln unter dem unrasierten Kinn – kenne ich von irgendwo anders her, wenn ich auch nicht sofort weiß, woher.
»Hey Basti«, schreit das Gesicht, »es ist wieder so weit! Bist du dabei?«
Kaum jemand sagt heute noch am Telefon seinen Namen. Je langweiliger ein Mensch, desto mehr ist er auch davon überzeugt, dass seine öde Hackfresse überall einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen hat. Ich shamme das Bild auf den 80-Zoll-Compunikator über dem Sideboard, hoffe, dass sich wenigstens dort der Name des Anrufers einblendet – aber Fehlanzeige.
»Ich bin’s – Norbert! Sag bloß, du erkennst mich nicht? Norbert Lanschick! Weißt du nicht mehr, wer ich bin?«
»Ja, … schon, … du hast doch …«
Ich lasse große Pausen zwischen den Wörtern in der Hoffnung, dass Norbert Lanschick sie füllt.
»Gymnasium Ohlstedt! Abiturjahrgang 1981! Na, fällt der Groschen?«
Er fällt: Norbert – Nobbi – Lanschick, damals ein spindeldürres Elend, dem die Mädchen »Biafra« hinterhergerufen haben, überdurchschnittliche Leistungen in Physik, unterdurchschnittliche bis gar keine in Sport, außerdem etwas kindisch, nie eine Freundin. Heute: Marathonläufer, Rechtsanwalt, BMW-Fahrer, Ehemann, Vater, immer noch langweilig, immer noch dünn, Halbglatze. Alle fünf Jahre organisiert er ein Jahrgangstreffen im »Gasthof Ehrlich«, um die Zeugen seiner erbärmlichen Jugend zu Zeugen seiner wunderbaren Verwandlung werden zu lassen. Was natürlich nicht funktioniert. Seinen ehemaligen Schulkameraden kann man genauso wenig etwas vormachen wie seinen Geschwistern. Auch wenn Biafra Lanschik jedes Mal seine durchaus ansehnliche Ehefrau mitbringt, vergisst deswegen niemand, wie er damals beim Geräteturnen diese unglaublich langen und dünnen Beine, die aus seinen Turnhosen wuchsen, um den Stufenbarren wickelte und Ewigkeiten zwischen dem oberen und unteren Holm hängen blieb, kopfüber wie ein bizarres Insekt, sich mit den Spargelarmen immer wieder hochzustemmen versuchte, dabei aber nur Zentimeter für Zentimeter dem Boden entgegenrutschte.
»Und ich dachte schon, du hättest die Sache aufgesteckt …«, sage ich zu ihm. Das letzte Treffen ist nämlich ausgefallen. Da hat es wohl einen Karriereknick gegeben. Aber nun wieder! Was wird er uns diesmal vor die Füße legen, wie ein gut abgerichteter Labrador? Eine neue Frau, ein neues Auto?
»Das letzte Mal konnte ich nicht«, sagt Lanschick mit bebender Stimme, »mein Teilhaber ist gestorben. Das hat mich unheimlich schwer getroffen. Wir haben die Kanzlei über dreißig Jahre zusammen geführt, verstehst du? Mit dem habe ich mehr Zeit verbracht als mit meiner Frau. Jetzt muss ich das alles allein machen.«
Das auf die vierfache Größe aufgeblasene Geiergesicht auf dem Compunikator-Bildschirm versucht, ein selbstzufriedenes Grinsen zu unterdrücken. Eine Haut wie angetrockneter Grießbrei. Alt sieht er aus – alt, alt, alt. Wie kann man sich nur so gehen lassen.
»Aber diesmal mache ich es wieder. Wenn ich es nicht mache, macht es doch niemand. Ist dir das überhaupt klar, dass das diesmal unser fünfzigjähriges Klassentreffen ist? Also: Kneifen kommt nicht infrage. Soll ich für dich ein Zimmer buchen?«
»Nein, ich brauche kein Zimmer«, sage ich. »Ich wohne wieder in Wellingstedt.«
»In Wellingstedt? Wo denn? Du wohnst doch nicht wieder bei deinen Eltern?« Lanschick lacht meckernd. »Seit wann?«
»Schon seit vier Jahren«, sage ich. »Und meine Eltern sind tot. Ich wohne bloß in dem Haus.«
Als die Dinge um mich herum sich aufzulösen begannen, meine Frau mich verließ und mir die Kinder wegnahm, als klar wurde, dass die Klimaerwärmung sämtliche Tipping-Points bereits überschritten hatte und auch der verordnete Staatsfeminismus nichts mehr daran würde ändern können, als meine Lieblingskneipe abbrannte und meine Augen so schlecht wurden, dass ich die Zeitung nur noch lesen konnte, wenn ich sie am ausgestreckten Arm von mir hielt, was dann aber sowieso egal wurde, weil auch die letzte seriöse Printzeitung ihren Druck einstellte, als kurz nacheinander erst meine Mutter und dann mein Vater aus purem Eigensinn starben und meine Geschwister auf mich einredeten, dass wir das Haus, in dem wir aufgewachsen waren, einem unglaublichen Schmierlappen von Makler übergeben sollten, verkaufte ich alles, was sich irgendwie zu Geld machen ließ, nahm einen Kredit auf, zahlte meinen Bruder aus, ließ meine Augen lasern und die Haare wieder wachsen, packte meine Zahnbürste und ein paar Unterhosen in eine Adidastasche und zog dahin zurück, wo ich die glücklichste Zeit meines Lebens verbracht hatte.
»Ist ja eigentlich auch gar keine schlechte Lage«, räumt Lanschick gönnerhaft ein, »habe selbst schon einmal daran gedacht.«
Wellingstedt gilt inzwischen als erstklassige Wohngegend für gut verdienende junge Familien und Angeber wie Lanschick. Eine geringe Kriminalitätsrate, nur zwei – noch dazu bestens integrierte – Asylbewerberheime, grüne Wälder und ein brauner Fluss, der sich durch die Endmoränenlandschaft windet, und nur zwanzig Kilometer bis zur Hamburger Innenstadt. Ende der 50er-Jahre bauten Handwerker und kleine Angestellte hier ihre Häuser auf Grundstücke, die ihnen ein wenig vorausschauender Bauer zu einer unfassbar niedrigen Leibrente überlassen hatte. Unter ihnen meine Eltern, die nach Feierabend Beton mischten und die Ziegelsteine in einer Schubkarre heranschafften. Nachdem die Zufahrtsstraßen asphaltiert worden waren, kamen auch wohlhabendere Leute und bauten ihre großzügigen Flachdach-Bungalows direkt neben die kleinen Backstein- und Walmdachhäuser mit den bunten Glasbausteinen. Und wir, die Kinder von Elektrikergesellen und Waschmittelvertretern, gingen mit den Kindern der Bank- und Versicherungsdirektoren wie selbstverständlich gemeinsam aufs Gymnasium, paddelten im Sommer mit ihnen auf der Alster und lieferten uns Schlachten, in denen vielfach geflickte Schlauchboote auf Kanus aus kanadischem Zedernholz trafen. Unter der Regierung einer sozialliberalen Koalition machten wir später wie selbstverständlich gemeinsam das Abitur – ein kurzes Zeitfenster sozialer Gerechtigkeit hatte sich aufgetan, eine Anomalie der Geschichte, die es so noch nie gegeben hatte und wohl auch nie wieder geben wird.
Damals lebten hier Erdkröten, Eisvögel und Fischotter und selbst heute kann man mit etwas Glück noch einem Spatzen oder einem Kaninchen begegnen. Natürlich hat sich Wellingstedt ganz schön verändert. Die in den 60er-Jahren in die Gärten gepflanzten Koniferen sind so groß geworden, dass die Grundstücke inzwischen aussehen wie die Toteninseln von Böcklin. Außerdem verwandelt sich der Ort langsam, aber unvermeidlich in ein Habitat der Reichen. Vor den letzten kleinen Häusern, in denen noch indigene Bevölkerung vor sich hin wurschtelt, schnüren Makler auf und ab. Und wenn eines dieser alten Häuser frei wird, reißt man es weg und setzt stattdessen einen Klotz von Toskana-Villa auf das dafür viel zu kleine Grundstück, weil so eine Toskana-Villa aus irgendeinem Grund zweistöckig gebaut werden darf, ohne damit die Bauvorschriften, die eigentlich nur einstöckige Bebauung erlauben, zu verletzen.
»Das Gebäude selber hat gar keinen Wert«, sagte der Makler, den mein Bruder damals beauftragt hatte, den Preis unseres Elternhauses für ihn vorteilhaft zu bestimmen. »Im Gegenteil, Sie müssen vom Grundstückswert minus Abrisskosten ausgehen – aber das sind immer noch schöne 500000 Euro cash – Euro-Nord natürlich.«
Die Grundstückspreise sind explodiert. Weswegen auch das Wollgeschäft und die Scheune, die an meinem Schulweg lagen, längst verschwunden sind. Der etwas schmuddelige Reiterhof ist jetzt ein Sport-Hotel und die Erdbeerfelder, auf denen ich vor Jahrzehnten kleine, sandige und sonnenwarme Früchte in einen Spankorb pflückte, wurden in einen 27-Loch-Golfplatz verwandelt. Im Nachbarort hat sich ein Koi-Züchter niedergelassen. Außerdem gibt es dort jetzt ein Sternerestaurant und zwei Läden für Wohndesign. Meine Vergangenheit löst sich auf wie ein Zuckerstück im Regen.
»Ist deine Frau mitgezogen?«, fragt Lanschicks Riesengesicht. »Ich meine, die muss doch in Berlin anwesend sein, da kann die doch nicht ständig hin- und herpendeln. Wie macht ihr das denn?«
Ich antworte nicht. Lasse ihn einfach schmoren, warte darauf, dass es ihm von selber einfällt.
»Gott«, sagt Lanschick, »Gott, wie dumm von mir! Entschuldige bitte, das hatte ich einfach vergessen. Was bin ich doch für ein Trampeltier! Gibt es denn inzwischen irgendetwas Neues, eine Spur meine ich. Tut mir leid, tut mir echt wahnsinnig leid.«
»Ist schon okay«, sage ich, »ist ja über zwei Jahre her. Außerdem waren wir da schon getrennt. Die Scheidung war da schon lange durch.«
Lanschick murmelt noch mehrmals, was für ein Trottel er sei, und hört gar nicht auf, sich zu entschuldigen.
»Schon gut«, versuche ich die Sache zu verkürzen. »Erzähl mir lieber, wer alles beim Klassentreffen dabei sein wird. Haben schon viele zugesagt? Sind Bernie und Rolf dabei?«
»Ja, beide. Die kommen doch immer.«
»Und von den Frauen? Kommen Kiki Vollert und Elisabeth Westphal?«, frage ich möglichst nebenbei. Elisabeth Westphal ist die Frau, die ich niemals gehabt habe. Elisabeth Westphal ist der Grund, weswegen ich zu den Klassentreffen gehe. Ich habe meine halbe Jugend damit verbracht, mich nach ihr zu sehnen. Selbst heute fehlt sie mir immer noch. Auch wenn mir ihr Fehlen inzwischen so zur Gewohnheit geworden ist, dass ich es meistens gar nicht bemerke. Bis es mir bei einem melancholischen Lied oder dem Anblick einer Frau, die so ähnlich lacht oder sich so ähnlich bewegt wie Elli früher, plötzlich wieder einfällt.
»So weit bin ich noch nicht. Ich bin erst bei ›L‹. Birgit Lammert will aber kommen«, antwortet Lanschick.
»Schön«, sage ich, »prima.«
Ich gebe ihm meine Festnetznummer.
»Ruf mich in Zukunft nur noch mit dieser Nummer an. Ich werde das Handy« – ich sage absichtlich Handy, obwohl das ja heute nicht mal mehr die echten Greise sagen – »ich werde mein Handy in ein paar Wochen abmelden.«
»Ist nicht dein Ernst«, sagt Lanschick, »wie soll man dich denn dann erreichen? Ich habe schon deine E-Mail-Adresse nicht gefunden. Zum Glück hatte Holger Hasselbladt deine Mobilnummer.«
»E-Mail-Adresse habe ich auch löschen lassen«, sage ich. »In drei, vier Monaten schmeiße ich den Computer raus und dann benutze ich keine Technik mehr, die nach 1980 erfunden worden ist. Wenn du mich erreichen willst, gibt es das Festnetz oder du kannst mir einen Brief schreiben. Oder du kommst vorbei. Alte Adresse: Redderstieg 12. Wie gehabt.«
»Das ist verrückt«, sagt Lanschick. »Das kannst du nicht machen!«
Er klingt empört, aber gleichzeitig klingt er auch beeindruckt.
»Aber sicher doch«, sage ich. »Und komm nicht auf die Idee, mir Briefe mit irgend so einer Billigfirma zu schicken, die ihren Angestellten 4 Westos die Stunde zahlt. Wenn du mir was schickst, dann mit der Post. Oder ich nehme es nicht entgegen.«
Lanschick will mir nicht glauben, er denkt, ich will ihn veralbern, und als er merkt, dass es mir ernst ist, meint er, es wäre wahrscheinlich nur so eine Phase von mir, weil mir gerade alles zu viel sei.
»Geht uns ja eigentlich allen so«, sagt er.
Aber es ist keine Phase, es ist Notwehr. Und wenn ich mich nicht sehr irre, ist Notwehr eine in sämtlichen Gesellschaftsformen der Welt allgemein anerkannte Ausnahmesituation, die ansonsten nicht gebilligte Handlungen rechtfertigt. Wenn es um »die oder wir« geht, ist alles erlaubt. Manchmal muss man seinen Mitmenschen ein paar Umständlichkeiten zumuten, um nicht zum ausführenden Sklaven einer tyrannischen Maschinendiktatur zu werden. Und manchmal muss man eine Frau zerstören, wenn man nicht von ihr zerstört werden will.
Und nein, keiner der Nachbarn hat etwas gemerkt.
2
Ich bringe die Kinder zu ihrer Großmutter zurück. Zeit wird’s. Übers Wochenende haben sich die Abdrücke ihrer klebrigen kleinen Finger im ganzen Haus verteilt. Das 50er-Jahre-Schleiflack-Sideboard, in dessen Schubladen ich unvorsichtigerweise die Hologramm-Spiele aufbewahrt habe, ist so stumpf und fettig, dass es aus der Entfernung geradezu pelzig wirkt. Durchs Torfbeet pflügt sich ein Planwagentreck aus seltsamen Gummifiguren. Auf den Kutschböcken sitzen grüne, gelbe und rote Klumpen mit Knollennasen, Cowboyhüten und Pistolenhalfter um die nicht vorhandenen Hüften, die nach Aussage der Kinder irgendwelche Vitamine oder sonstigen Nährstoffe darstellen sollen – Sheriff Fatty, Vitamity-Jane, Mineral-Kid und so weiter.
Wir haben die Fahrräder genommen, weil das Wetter so schön ist. Was heißt schön – das immerwährende Höllenfeuer! Kein Tag unter 35 Grad, gestern waren es 37 Grad, letzte Woche sogar einmal 41 Grad und es soll noch heißer werden. Seit acht Wochen ist der Himmel blau wie auf einer Postkarte – ohne einen Tropfen Regen. Die Blätter an den Bäumen haben sich eingerollt, die Ginsterbüsche biegen sich unter einer Last aus Staub und das Gras auf den Wiesen sieht aus wie im Spätsommer, braun und vertrocknet raschelt es vor sich hin. Dabei haben wir erst April. Wie soll das im Sommer werden? Nur der Killer-Raps gedeiht auch ohne Wasser prächtig und verbreitet seinen schweren, süßen Geruch. Er blüht in allen Gärten und selbst auf den Fußwegen, blüht auf den Wiesen, in den Wäldern, in der Sonne, im Schatten, hinter den Mülltonnen, einfach überall – außer auf dem Golfplatz, wo sie extra zwei Hilfsgärtner nur für das Rausreißen der Rapspflanzen eingestellt haben. Die ganze Gegend leuchtet gelb. Vergisst man mal für einen Augenblick, was für eine widerliche genmanipulierte Pest das eigentlich ist – vier Mal im Jahr blühend und schneller nachwachsend, als man sie herausreißen kann, resistent gegen jedes bekannte Unkrautvernichtungsmittel und mit jedem Boden und fast jedem Klima zurechtkommend –, ist es geradezu ergreifend schön. Sofern man nicht allzu viel Wert auf Artenvielfalt legt.
Mein Sohn Racke fährt in wilden Schlangenlinien auf seinem Bingo-Rad vor mir her. Er trägt ein rot kariertes Hemd und eine speckige kurze Lederhose mit einem weißen Herzen aus Hirschhorn auf dem Verbindungsstück der Hosenträger – so eine, wie auch ich sie in seinem Alter getragen habe – und seine gebräunten und etwas pummeligen Beinchen strampeln wie Maschinenkolben. Als er den Kopf zu mir umdreht, trifft ihn der Fahrtwind am Hinterkopf und lässt seine feinen weizenblonden Haare senkrecht nach oben stehen. Die Sonnenbrille mit den tropfenförmigen Pilotengläsern rutscht ihm auf die Nasenspitze.
»Kuck mal«, kreischt er, wobei sein kreideweißes, wenn auch rudimentäres, weil mitten im Zahnwechsel befindliches Gebiss aufblitzt, und macht einen so scharfen Schlenker, dass sich der gefederte Fahrradrahmen bis zum Anschlag zusammenschiebt und der rote Wimpel, der an der Spitze einer biegsamen Stange am Gepäckträger des Fahrrads angebracht ist, fast die Straße berührt.
»Sehr schön«, schreie ich zurück, »und jetzt schau gefälligst nach vorn!«
Warmer Fahrtwind streicht über meine Schläfen, die Wellensittiche zwitschern in den Bäumen und die Rapskäfer prasseln uns gegen die Sonnenbrillen. Ich komme mir vor wie einer dieser aussterbenden Groß-Wale, der mit seinem Jungtier durch ein gelbes Meer pflügt.
Meine Tochter fährt mit einigen Metern Abstand hinter uns. Binja-Bathseba schmollt. Eigentlich schmollt sie ständig. Sie ist sowieso nicht besonders hübsch, ihr Gesicht ist ziemlich rund und dann noch diese ständig beleidigte Flappe – an diesem Tag schmollt sie schon zum zweiten Mal. Das erste Mal hat sie aufgehört mit mir zu sprechen, als ich ihr und Racke die pROJEktas abgenommen und weggeschlossen habe, was bedeutete, dass die beiden einen ganzen Nachmittag ohne ihre 3-D-Freunde verbringen mussten. Rackes »Destroyer« hätte ich vielleicht noch ertragen, es ist die gedrosselte Version für das Alter von 7 bis 10 Jahren. Deswegen ist die Projektion nur 1,50 m hoch, ein Roboter mit Krokodilschädel, altägyptisch anmutendem Lendenschurz und einem gigantischen Hammer, der ständig schnarrt: »Ich will dein Freund sein«, oder vorschlägt: »Lass uns Rabatz machen!« Das Wort »Rabatz« betont er auf der ersten Silbe. Wenn mein Sohn Racke ihm durch den langsam und deutlich ausgesprochenen Satz: »Ja, lass uns Rabatz machen«, die Starterlaubnis erteilt, stapft die Blechechse zum nächsten Haushaltsgegenstand und schlägt mit dem Hammer darauf, wobei der pROJEkta-Lautsprecher täuschend ähnlich die Geräusche simuliert, die entstehen würden, wenn es sich nicht um eine Projektion, sondern um einen echten Vorschlaghammer handeln würde, der entsprechenden Schaden anrichtet – ein scharfes Klirren bei Glas, gedämpftes Klirren bei Porzellan, ein Bersten und Splittern beim Couchtisch. Schon für den Destroyer braucht man Nerven wie kleine Waldwege, aber wenigstens hat Racke sich durch ihn das Nuscheln abgewöhnt. Die Befehle müssen geradezu übertrieben deutlich ausgesprochen werden. Was mich wirklich fertigmachte, war das lispelnde, regenbogenfarbene Einhorn meiner Tochter Binja-Bathseba. Das Einhorn hat ungefähr Pony-Größe und zwanzig Zentimeter lange Wimpern und es lümmelte sich auf meiner Couch, klapperte mit den Augenlidern und gab zu allem seinen Senf, weil das Sprachprogramm in seinem pROJEkta auf bestimmte Schlüsselwörter reagiert. »Ich bin Shangri-La, das letzte lebende Einhorn«, nölte es mit seiner Telefonsex-Stimme: »Komm mit mir in den Wald, wo die Schmetterlinge singen, und werde Teil des Großen Ganzen.« Oder: »Das Leben ist ein Fluss, baue ein Boot, damit du nicht nass wirst.«
Das mit dem Boot sagte es, während im Fernsehen eine Sondersendung über die Flutwelle lief, die in Tirol den Reisebus von der Staumauer gespült und zwei talwärts gelegene Dörfer plattgemacht hat, nachdem mehrere Millionen Kubikmeter Geröll und Eis von einem angetauten Gletscher abgebrochen und in den Stausee gerutscht sind. Als ich ihnen die pROJEktas wegnahm, warf Racke sich auf den Boden und brüllte, bis sein Gesicht blau anlief. Binja saß mit verschränkten Armen und untergeschlagenen Beinen auf einem Sessel, aber verkehrt herum, mit dem tränenverschmierten Gesicht zur Lehne, zischte »Faschist« und kniff dann die Lippen zusammen. Das hat mich an Kindern schon immer gestört – diese geringe Frustrationsschwelle und diese Unfähigkeit, Schmerz und Wut dem Anlass gemäß zu dosieren. Bei jeder Kleinigkeit fahren sie gleich das volle Programm ab. Wie laut wollen sie denn bitte heulen, wenn sie mal wirklich einen Grund dazu haben? Wie wollen sie sich noch steigern, wenn die tauenden Permafrostböden der arktischen Tundren und Meere demnächst ihre Milliarden Tonnen Methan an die Atmosphäre abgegeben haben und es auf diesem verdammten Planeten keinen Platz mehr geben wird, wo es nicht entweder brennt oder alles überflutet ist oder gerade eine Dürre herrscht oder so sehr stürmt, dass man sich an den nächsten Laternenmast klammern muss? Eine halbe Stunde später waren sie wieder ausgeglichen wie die Zen-Mönche und spielten mit Legosteinen.
Jetzt schmollt Binja, weil Racke und ich keine Fahrradhelme aufgesetzt haben, obwohl sie uns selbstzufrieden und rechthaberisch einen viertelstündigen Vortrag über die Gefahren im Straßenverkehr heruntergebetet hat, der wahrscheinlich eine Woche zuvor an ihrer Schule gehalten wurde. »Es ist gesetzlich vorgeschrieben«, holte sie ihren vorletzten Trumpf aus dem Ärmel, und als Racke und ich bloß Faxen machten, packte sie die ganz große Keule aus: »Mama will auch, dass wir die Helme aufsetzen!«
Das ist richtig. Meine Frau hatte mir sogar einmal angedroht, dass ich die Kinder nicht mehr zu sehen bekäme, wenn ich ihre Erziehung weiterhin systematisch unterwandern würde.
»Mach doch«, habe ich zu meiner Tochter gesagt, »niemand hindert dich daran, die Scheiß-Plastikschale aufzusetzen. Aber geh deinem Bruder und mir damit nicht auf die Nerven. Und übrigens, falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Deine Mutter ist nicht mehr da. Und solange sie weg ist, gilt, was ich sage!«
Das war vielleicht etwas hart, schließlich ist sie erst zehn, aber der Fahrradhelmzwang ist nun mal das verachtenswerteste Gesetz, das in den letzten Jahren verabschiedet worden ist, darin manifestiert sich für mich alles Lächerliche und Gluckenhafte unserer heutigen Regierung, dieses kleinkarierte Sicherheitsdenken, als wäre auf einem derart kaputten Planeten so etwas wie Sicherheit überhaupt noch möglich. He, tut uns leid, wir wissen zwar immer noch nicht, wie wir den Temperaturanstieg und die Verlangsamung der ozeanischen Strömungen aufhalten sollen, was bedeutet, dass die menschliche Spezies in fünf bis allerhöchstens zehn Jahren elend krepieren wird, lasst alle Hoffnung fahren, aber bis zum endgültigen Untergang setzt bitte unbedingt eure Fahrradhelme auf, sonst zahlt ihr saftige Bußgelder.
Ich weiß, ich weiß, Fahrradhelme hat es auch schon gegeben, bevor die Frauen – mit der Unterstützung nützlicher Idioten wie mir – alle Macht an sich gerissen haben, aber Pflicht waren sie damals noch nicht. Oder jedenfalls nicht für Erwachsene. Ich meine: Schaut sie euch doch an, alle diese feschen jungen und echt-jungen Ministerinnen, mindestens fünf Piercings in jedem Ohr und drei in der Nase, und die Unterarme bis über die Ellbogen tätowiert, als müssten sie vor lauter Unangepasstheit zwischen Dienstschluss und Feierabend immer noch schnell ein paar Handelsschiffe kapern. Und was tun sie in Wirklichkeit? – verderben uns das letzte bisschen Spaß, missgönnen uns das Gefühl von Wind und Sonne im Haar, verlangen von erwachsenen Menschen per Straßenverkehrsordnung, sich zu entwürdigen und ein grellbuntes Stück Plastik aufzusetzen.
Ich will ja gar nicht behaupten, dass unsere Eltern alles richtig gemacht haben, aber wenigstens waren sie nicht tätowiert wie die Piraten und besaßen trotzdem hundertmal mehr Lässigkeit im Umgang mit ihren Kindern und dem Straßenverkehr. Mein Vater zum Beispiel hat meine Geschwister und mich zum Spaß oft einfach in den Kofferraum gesperrt – meist im Sommer, wenn wir vom Kupferteich kamen und er nicht wollte, dass wir mit unseren sandigen Füßen und nassen Badehosen seinen Opel Rekord eindreckten. Auf der Heimfahrt hielt er zwischendurch immer mal wieder an, stieg aus dem Auto, klopfte auf den Kofferraumdeckel und ließ uns raten, wo wir uns gerade befanden. Außerdem war es für meine Eltern ganz selbstverständlich, dass auf Urlaubsreisen das jeweils kleinste Kind auf der Hutablage transportiert wurde, und kein Zollbeamter oder Polizist hat jemals daran Anstoß genommen. Heutzutage würde man meinen Eltern deswegen die Erziehungsberechtigung entziehen und der Fall würde in den Abendnachrichten auftauchen.
Plötzlich höre ich hinter mir einen erstickten Schrei. Als ich mich umdrehe, liegt Binjas Fahrrad im Gras und sie selber wälzt sich in einer summenden schwarzen Wolke auf dem Boden. Rapskäfer! Unglücklicherweise trägt meine Tochter außer ihrem gelben Helm auch noch eine weiße Bluse, was ihr die ungeteilte Aufmerksamkeit der kleinen schwarzen Biester gesichert hat. Ich springe vom Rad, reiße mir mein Oberhemd herunter, schaufele damit den größten Teil der Käfer aus Binjas Gesicht und drücke ihr den Stoff straff vor die Lippen, damit sie atmen kann, ohne den Mund voller Käfer zu haben. Aber Binja begreift nicht, was ich beabsichtige, sie reißt das Hemd weg, schlägt um sich und schreit und heult inmitten des Insekteninfernos. Ich muss ihr mit einer Hand die Arme festhalten, damit ich ihr mit der anderen den Helm abnehmen und die Bluse aufknöpfen kann, und dabei muss ich die ganze Zeit die Luft anhalten, weil ich ja auch in der Käferwolke stecke. Das widerliche Viehzeug hat bereits meinen Oberkörper gestürmt und wimmelt meine Arme herauf und herunter. Nur gut, dass meine Haare bis zu den Schultern herabhängen, das schützt mich etwas. Racke steht mit seinem kleinen Kinderrad in gebührendem Abstand neben uns und heult vor Angst oder auch bloß aus lauter Mitgefühl. Endlich halte ich Binjas Bluse und ihren Helm in der Hand und stopfe beides zusammen mit einer Million Rapskäfer in die Fahrradtasche und ziehe den Reißverschluss zu. Auch die anderen Käfer lassen allmählich von uns ab und summen in den nächsten Garten. Binjas Gesicht ist wie gesagt sowieso nicht das Hübscheste, und nun ist es auch noch verschwollen und zerbissen von tausend Miniaturmäulern mit mikrometergroßen Kiefern.
»Wie sieht das Kind denn aus«, ruft Oma Gerda auch gleich hysterisch, als wir ankommen, obwohl Binjas Gesicht inzwischen wieder abgeschwollen und nicht halb so rot ist wie mein nackter Rücken, auf dem ein Sonnenbrand zweiten Grades Blasen schlägt. Mein blaues Hemd hat Binja an. Sie trägt es als Kleid über ihren Jeans, mit einem Spanngurt von meinem Gepäckträger als Gürtel. Und offensichtlich geht es ihr nicht so schlecht, dass sie nicht sofort ins Wohnzimmer zum Compunikator gehen und ihre Mails abfragen könnte. Racke wühlt in seinem Rucksack nach dem pROJEkta und lässt den »Destroyer« im Hausflur auferstehen. Ich überreiche Gerda den Fahrradhelm mit der zusammengeknüllten weißen Bluse darin.
»Weiß!«, sage ich. »Denkst du eigentlich überhaupt nicht nach? Genauso gut hättest du meine Tochter mit Honig einschmieren und in einen Ameisenhaufen schubsen können. Die Rapskäfer haben sie beinahe aufgefressen.«
»Du hast nicht gesagt, dass ihr mit den Fahrrädern kommen wollt«, setzt Gerda zänkisch an, aber dann verkneift sie sich den Rest. Wir haben lange und heftig um die Kinder gestritten, nachdem sich abzeichnete, dass Christine wohl nicht so schnell wieder auftauchen würde, und natürlich wurden sie mir zugesprochen. Es gab überhaupt keinen Grund, warum sie nicht bei mir hätten leben sollen. Wenn sie jetzt die meiste Zeit bei ihrer Großmutter wohnen, dann hängt das ausschließlich von meinem Wohlwollen ab. Ich kann sie jederzeit zu mir zurückholen. Und seitdem das geklärt ist, ist mit Gerda sehr viel besser auszukommen.
Das alte Mädchen ist kaum älter als ich, sieht aber wesentlicher älter aus. Ich frage mich, warum sie inzwischen auf Großmutter macht und sich mit dem Erscheinungsbild und der Fitness einer gut konservierten Fünfzigjährigen zufriedengibt. Wie fünfzig sehen heute doch höchstens noch die Neunzigjährigen aus. Dabei war Gerda mal eine der Ersten, die das damals wirklich noch scheißgefährliche Verjüngungsprogramm durchlaufen haben – als die Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten fünf Jahre an Krebs zu erkranken, noch bei über 80 Prozent lag. Davon hat sie auch die wässrigen, ständig vor sich hin triefenden und tropfenden Augen und die wulstig hervorstehenden Lymphknoten an ihrem Hals behalten. Immerhin hat sie bis jetzt noch keinen Krebs. Jedenfalls so viel ich weiß. Ich habe sie ein wenig in Verdacht, dass sie mich mit ihrem Großmutter-Look demonstrativ an mein eigenes, hinter der jugendlichen Fassade lauerndes Greisentum erinnern will. Es hat sie immer gestört, dass ihre Tochter einen zwanzig Jahre älteren Mann geheiratet hat. Damit hat sie sich nie abgefunden.
»Ich will dein Freund sein«, schnarrt der Destroyer, klappt sein Krokodilmaul auf und zu, watschelt den Flur entlang und bleibt neben Gerda stehen.
»Oma, du musst antworten!«, ruft Racke.
»Schön. Vielen Dank. Ich will auch dein Freund sein. Wir werden bestimmt gute Freunde«, sagt Oma Gerda. Der Destroyer grunzt zufrieden.
»Lass uns Rabatz machen«, ruft Racke und der Destroyer mustert einen Moment lang unentschieden Oma Gerda und mich, aber dann fällt ihm erfreulicherweise doch noch ein, dass er das entschärfte Programm für Sieben- bis Zehnjährige geladen hat, und er wendet sich ab und schmettert seinen Hammer klirrend in den Flurspiegel.
»Ich muss mal mit dir reden«, sagt Gerda zu mir. Ich sehe, wie viel Mühe es sie kostet, freundlich zu bleiben.
»Oh bitte«, sage ich, »fang nicht schon wieder mit den Punkten an.«
»Aber ich komme einfach nicht aus«, ruft Gerda, »rechne doch mal nach. Binja muss ich zweimal die Woche zum Reitunterricht fahren und Racke zweimal zum Fußball und einmal zum Klavierunterricht. Und wenn jetzt wieder die Orkane anfangen, muss ich sie auch zur Schule bringen. Ich brauche noch mindestens drei Tankfüllungen. Und Racke hat gesagt, er würde so gern mal wieder Königsberger Klopse essen. Die Kinder sind im Wachstum, aber die paar Marken, die ich habe, die reichen ja nicht mal dafür, dass sie jeden Tag ihre Milch bekommen.«
»Ich habe dir oft genug erklärt, dass Kinder überhaupt keine Milchprodukte brauchen!«
Das habe ich allerdings, und wenn sie ihre CO2-Punkte für auf tierquälerische Weise hergestellte Joghurts verschleudern will, dann ist das ihr Privatvergnügen. Geht mich nichts an.
Jetzt kann sie sich nicht mehr beherrschen.
»Aber es sind doch die Punkte der Kinder. Und die Kinder wohnen ja nun mal bei mir. Es ist nicht gerecht, dass du das Kontingent der Kinder für dich behältst. Wie soll ich denn mit einem einzigen Kontingent drei Personen satt kriegen?«
»Was willst du damit sagen? Dass ich den Kindern ihr Fleisch wegfresse und ihr Benzin verfahre? Die kriegen schon ihren Anteil, wenn sie bei mir sind. Frag sie, was heute auf dem Tisch stand. Frag sie ruhig. Ich kann es dir sagen: Rindergulasch, das Kilo für 70 Euro und fünf Punkte – dafür hätte ich auch eine Tankfüllung bekommen können.«
»Aber die Kinder waren in diesem Monat nur zweimal bei dir. Und ich hatte sie die ganze übrige Zeit. Es ist einfach nicht gerecht …«
»Also, wenn es dir zu viel wird … Die Kinder können auch gerne wieder bei mir wohnen.«
Gerda sackt in sich zusammen. »Bitte«, sagt sie, »bitte, wir sind so furchtbar knapp … Racke muss immer bei den Eltern seiner Mitspieler fragen, ob er bei ihnen mitfahren darf, die fangen auch schon an zu murren, dass ich nie …«
Ich habe von Anfang an vorgehabt, ihr ein Kontingent zu geben. Ich bin ja kein Unmensch. Aber ich warte damit immer so lange, bis sie von ihrem hohen Ross heruntergestiegen ist. Ich bin lange genug von Frauen und ihren blöden Argumenten manipuliert worden. Ich habe ein Recht darauf, die letzten paar Jahre vor dem Weltuntergang in Frieden zu verbringen. Gerda bekommt Binjas CO2-Kontingent, von dem ich noch kaum etwas abgezweigt habe. Ich buche es ihr mit dem Ego-Smart auf ihr Konto rüber. Sie darf dabei zuschauen.
»Danke«, sagt Gerda und ist wieder völlig handzahm. »Danke, das hilft uns sehr weiter. Vielen, vielen Dank.«
Na also. Geht doch.
3
Wieder zu Hause gehe ich als Erstes in den Keller, um Christine Gesellschaft zu leisten, mich ein wenig mit ihr zu unterhalten und ihr die Zeit zu vertreiben. Mir ist bewusst, dass es nicht besonders angenehm sein kann, 48 Stunden lang allein in einem geschlossenen Raum ohne Fenster zu verbringen, und sie lässt ja auch keine Gelegenheit aus, es mir unter die Nase zu reiben. Also räume ich die Konservendosen aus dem Kellerregal, die Erbsen und Wurzeln und die Tortenpfirsiche, schiebe das Regal zur Seite, drehe mit meinem 70er-Jahre Black-&-Decker die Schrauben aus der Sperrholzplatte, löse sie von der Wand und drücke die Zahlenkombination, um die Stahltür zu öffnen. Voilà, schon bin ich in meinem kleinen, geheimen Reich des Trostes, meiner Schutzzone. Acht mal vier Meter plus eine durch einen Vorhang abgetrennte Nasszelle – die klassische Prepper-Raum-Größe. Genug Platz für ein altmodisches französisches Messingbett, eine kleine gelbe Ikea-Sitzecke inklusive Beistelltischchen und eine Ikea-Kücheninsel mittendrin. Es riecht nach Plätzchen, frisch gebackenen Plätzchen, ein Geruch, den ich sehr liebe. Christine steht in einer rosa-weiß karierten Schürze am Herd und hält mit rosa-weiß karierten Topflappen-Handschuhen das Backblech. Vor vier Monaten hatte sie eine Phase, in der sie sich fürchterlich gehen ließ, aber ich habe einiges klargestellt und jetzt sind ihre Lippen in einem zarten, zu ihrem Nagellack passenden Pastellton geschminkt und die Augenbrauen sind zu einem runden Bogen getrimmt, der ihren Augen einen fragenden und intelligenten Ausdruck verleiht. Unter der Schürze trägt sie ein hellblaues Blümchenkleid und ihre blonden Haare fallen bis zu den Schultern herab, wo sie in schönster Natürlichkeit einen Bogen nach außen beschreiben. Sie lächelt mich an. Aber ich weiß, dass ich ihr nicht trauen kann, und deswegen ziehe ich zuerst die Stahltür zu, und während Christine das Blech auf den Herd stellt – sie hat »Spitzbuben« gebacken, kleine dunkle Teigklumpen mit halbierten Walnusskernen obendrauf, meine Lieblingskekse –, beuge ich mich über die Tastatur, damit sie nicht erkennen kann, welche Zahlenkombination ich eingebe. Dann lasse ich sie dicht an die Wand treten, dorthin, wo ich drei Metallringe mit Karabinerhaken ins Mauerwerk gedübelt habe, einen in Kniehöhe, einen in Schulterhöhe und einen über Kopfhöhe, und hake die Kette, die an Christines Halsband befestigt ist, so straff wie möglich in den mittleren. Ich weiß, das klingt jetzt alles ganz furchtbar, Kette und Halsband, da denkt man gleich an Inquisition oder SM-Studio, aber ich bin kein Perverser, bloß ein Mann mit seinen ganz normalen Bedürfnissen. Ich würde mit Freuden auf das mittelalterliche Kettengerassel verzichten, aber bei einer Frau wie Christine ist das nun mal nicht möglich. In den beiden Jahren, seit sie hier unten lebt, hat sie elfmal versucht, mich ernsthaft zu verletzen. Sie hat ein Stuhlbein abgeschraubt und mir über den Scheitel gezogen, hat versucht, mir heißes Wasser ins Gesicht zu schütten, mir einen Holzlöffel in den Rücken zu rammen, dessen Stiel sie mit ihren Schneidezähnen spitz geschabt hatte, und einmal hat sie sogar das Starkstromkabel aus dem Herd gerissen und mich unter dem Vorwand, der Herd funktioniere nicht mehr, ob ich mir das nicht einmal ansehen könne, in die Nähe gelockt. Und zwischendurch hat sie mir immer wieder überzeugend vorgespielt, sie würde jetzt einlenken, hätte endlich aufgegeben, sich mit der Situation abgefunden und sei bereit zu kooperieren. Über Wochen, ja Monate hat sie das jedes Mal durchgezogen, bis ich mich in Sicherheit wiegte, ihr beinahe schon vertraute, und bei der ersten kleinen Nachlässigkeit von mir – zack – schon hat sie wieder zugeschlagen. Es lässt sich also vielleicht nachvollziehen, weswegen ich sie bei jedem Besuch zuerst an der Wand fixiere, nach Waffen abtaste und danach gründlich den Raum inspiziere, ob irgendwo ein Stuhlbein locker ist, ein Kabel aus der Wand schaut oder sonst eine Veränderung mein Misstrauen verdient. Nachdem sie mich ein halbes Jahr lang terrorisiert hatte, habe ich dann noch einmal richtig investiert und das Sicherheitsschloss mit der Geheimzahl eingebaut. Obwohl ich handwerklich ja eher ungeschickt bin. Aber wenn man etwas wirklich will, entdeckt man plötzlich ungeahnte Fähigkeiten an sich. Bei der Kontrolle des Raumes gehe ich systematisch, konzentriert und schweigend vor. Auch Christine darf mich währenddessen nicht ansprechen. Erst danach lasse ich ihr wieder die volle Kettenlänge, mit der sie sich in zwei Dritteln des Raumes frei bewegen kann, und erst dann begrüße ich sie.
»Hallo Christine.«
Und sie senkt den Kopf und sagt, ohne mich anzusehen, »mein Gebieter«, wie ich es ihr beigebracht habe, und es ist keine unterdrückte Wut dabei in ihrer Stimme und allerhöchstens ein Hauch von Ironie.
Ich habe diese Anrede etwa vier Wochen, nachdem ich sie hier heruntergebracht hatte, eingeführt. Ich weiß noch, dass ich mir dabei damals selber etwas albern vorkam. Aber jedes Mal, wenn sie mich mit meinem Namen ansprach, wenn sie Sebastian zu mir sagte, war das mit zig Erinnerungen an Situationen verknüpft, in denen sie früher Sebastian zu mir gesagt hatte. »Sebastian, das ist doch wohl nicht dein Ernst?« Oder als sie sich von mir trennte – sie hat mich verlassen! – und wie selbstverständlich die Wohnung für sich beanspruchte: »Sebastian, du willst doch nicht wirklich den Kindern die Wohnung wegnehmen? Willst du, dass Binja die Schule wechseln muss? Weißt du nicht mehr, wie lange Racke gebraucht hat, um sich an den Kindergarten zu gewöhnen? Was auch immer wir einander angetan haben, die Kinder sollten dafür nicht büßen müssen. Können wir uns darauf einigen, Sebastian?«
Letztlich war es nur konsequent, dass sie sich die Wohnung unter den Nagel riss. Schließlich hatte sie ja auch all die vorangegangenen Jahre ganz allein bestimmt, wie unsere Wohnung eingerichtet und gestrichen wurde – mit ihrem fliederfarbenen Weibergeschmack hatte sie das bestimmt, der keine freie Fläche ertragen konnte, ohne eine dämliche Holzschale daraufzustellen und sie mit polierten Halbedelsteinen oder den vertrockneten Schlauben irgendwelcher afrikanischen Pflanzen zu füllen. Und als ich einwilligte, was sagte sie da? Dankte sie mir? Ach woher denn. Sie meinte, dass ich bei meinem Gehalt sowieso Schwierigkeiten gehabt hätte, die Miete allein zu stemmen. Erst im Nachhinein ist mir klar geworden, wie sehr diese Frau mich demoralisiert hat. Schon die Art, wie sie Sebastian sagt, und ich falle sofort in tiefe Resignation und drohe wieder zu dem Mann zu werden, den sie von früher kennt und den zu manipulieren eine ihrer leichtesten Übungen war.
Als ich ihr damals vorschlug, sie solle mich von nun an »mein Gebieter« nennen, biss Christine sich auf die Unterlippe und sah an mir vorbei.
»Was hast du denn?«, sagte ich. »Es ist doch nicht mehr als eine Formalie. Du hast ja auch ›Herr Meier‹ zu Herrn Meier gesagt, ohne dass du ihn als deinen Herrn angesehen hast. Dann kann es doch wohl nicht so schwer für dich sein, zu deinem richtigen Gebieter ›Mein Gebieter‹ zu sagen. Im Grunde benennst da damit bloß die bestehenden Machtverhältnisse in diesem Raum.«
»Klingt ein bisschen nach 1001 Nacht, findest du nicht?«, sagte Christine.
Oh, dafür liebe ich sie, dass sie solche Dinge sagt, selbst wenn sie eine Kette um den Hals hat. Sie ist ein tapferer kleiner Terrier. Die Kette lässt sich ja nun mal nicht vermeiden, aber ansonsten versuche ich, ihr den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich zu machen.
Christine bindet ihre Schürze ab, und wir setzen uns nebeneinander auf das gelbe Sofa, ich lege meinen Arm hinter sie auf die Lehne. Vor uns auf dem Beistelltisch steht die Keksschale mit den warmen Spitzbuben und die Walnusshälften darauf sehen aus wie Mäusegehirne. Daneben steht ein gelb gestreifter Krug mit Limonade – Limburger Dom-Keramik. Meine Mutter benutzte früher den gleichen Krug, bloß mit rosa Streifen, aber ich habe nur noch einen gelben gefunden. Erst hatte ich ihn oben in meiner Küche, aber irgendwann hat mich die falsche Farbe so gestört, dass ich ihn zu Christine ausgelagert habe. Und hier passt er ja auch ganz hervorragend zur Sitzecke.
Wir plaudern, und ich erzähle Christine, was für ein Wetter draußen ist – dasselbe wie seit Wochen, sie soll bloß froh sein, hier schön kühl unter der Erde zu hocken – und dass Racke eine »Sonne mit Wolke« in »Tanzen und Turnen« bekommen hat und Binja ein »Beachtlich« in »Chinesisch« und von dem Gletscher erzähle ich, der in den Stausee gerutscht ist. Wir fragen uns beide, warum das keiner vorhergesehen und die nötigen Evakuierungsmaßnahmen in den beiden Dörfern eingeleitet hat, und dabei kommen wir auf die neuesten politischen, geologischen und klimatischen Entwicklungen, und es ist richtig nett, so nett wie ewig nicht mehr.
Es ist fast wie damals, als wir gerade erst im Demokratiekomitee aufeinandergestoßen waren und begannen, uns ineinander zu verlieben, während wir mit den anderen ganze Nächte durch Pläne schmiedeten, wie dieser Staat umstrukturiert werden könnte, ohne die Grundsätze der Demokratie dabei aufzugeben. Ich nehme mir einen Spitzbuben aus der Keksschale, knabbere die Walnuss herunter und lege den Keks wieder zurück. Und während Christine sich ereifert, dass die Möglichkeit, das Klima durch die Produktion künstlicher Wolken herunterzukühlen, immer noch eher halbherzig umgesetzt wird – »… dem müsste allererste Priorität eingeräumt werden, haben die das denn noch nicht begriffen?« –, lasse ich meinen Arm auf ihre Schulter gleiten, greife mir eine Strähne ihres Haares und drehe sie zwischen den Fingern.
»Ich finde dich immer noch schön«, sage ich und das ist die reine Wahrheit. Ich gebe ihr ein Drittel meiner täglichen Ephebo-Dosis. Ich kann sie hier unten ja schließlich nicht verschimmeln lassen. Sie ist 48, sieht mithilfe der Ephs aber wie Mitte dreißig aus, während ich mit der doppelten Dosis als Ende dreißig durchgehe. Kein Mensch würde jetzt noch vermuten, dass ich eigentlich zwanzig Jahre älter bin.
Es ist schon eine merkwürdige Vorstellung, dass Christine ohne die Medikamente so alt wie ihre Mutter aussehen würde. Sie lächelt mich an und wir stehen gemeinsam auf und gehen zum Bett hinüber. Wegen der Kette trägt sie nur noch Kleider, die durchgehend geknöpft sind, dieses hier auf der Vorderseite. Ich knöpfe sie bis zur Hüfte auf und greife unter den Stoff, lasse meine Hände über ihre warme Haut und den raffinierten schwarz-roten Slip wandern, den ich ihr bei einem Versand bestellt habe. Sie fühlt sich gut an, diese glatte, junge Haut, und ich versuche mir vorzustellen, wie sie sich wohl anfühlen würde, wenn ich Christine mal für ein oder zwei Monate die volle Ephebo-Dosis geben würde. Ich schiebe ihr das Kleid über die Hüften herunter und ziehe mich ebenfalls aus.
»Wann lässt du endlich deine Brusthaare wieder wachsen«, sagt Christine. »Kein Mensch trägt heute noch rasiert.«
»Na, du musst es ja wissen«, sage ich.
Wir legen uns ins Bett und ich ziehe ihren Körper eng an mich. Sie küsst meinen Hals und streicht über meine Brust.
»Schon seit zehn Jahren trägt niemand mehr rasiert. Ich würde gern wissen, wie das bei dir aussieht.«
»Blöd«, sage ich, »das würde völlig blöd aussehen. Da und dort eine Insel und um jede Brustwarze einen Kranz von Borsten. Das willst du gar nicht sehen.«
Wir schlafen miteinander, haben den liebevollen, routinierten und geschmeidigen Sex eines alten Ehepaars mit jungen Körpern. Hinterher liegt Christine in meinem Arm und zupft und krault in meiner nicht vorhandenen Brustbehaarung herum. Ich werde ganz sentimental dabei.
»Genau wie früher«, sage ich.
Aber Christine kann es nicht gut sein lassen, sie muss mal wieder die Stimmung versauen. Ruckartig setzt sie sich auf und schiebt meinen Arm von ihrer Hüfte, als wäre er ein zudringliches Haustier.
»Sieh mich an«, sagt sie. »Es ist nicht wie früher! Nichts ist wie früher! Ich bin mit einer Kette angebunden. Das ist nicht normal. Dir muss doch klar sein, dass es krank ist, was du hier tust?«
Geht das also wieder los. Christine schafft es nie länger als ein paar Tage, sich zusammenzureißen. Wir haben dieses Gespräch schon hundertmal geführt und wir werden immer besser dabei. Das heißt: Ich werde besser, von Mal zu Mal geschliffener in der Argumentation. Christine sagt eigentlich immer bloß das Gleiche: dass es krank sei, dass ich krank sei.
»In sehr vielen Ländern sperren Männer ihre Frauen ein«, erwidere ich geduldig, »und es ist gesellschaftlich vollkommen akzeptiert, ja, es wird geradezu erwartet. Warum soll ich meine ureigenen männlichen Bedürfnisse verleugnen, bloß weil ich das Pech habe, ausgerechnet in diesem winzigen Zeitfenster geboren zu sein, in dem man den Frauen hier allen Ernstes die Regierung überlasst? Nur ein paar Jahre früher und die Sache hätte völlig anders ausgesehen. In den meisten Ländern sieht es ja auch heute noch anders aus. Oder wieder. Männer herrschen seit Jahrtausenden über Frauen. Und sie würden es auch die nächsten tausend Jahre tun, wenn die Menschheit noch so lange Bestand hätte. Das, was gerade in Europa und Nordamerika passiert, diese Verweiblichung der Kulturen und dass ihr jetzt überall mitmischen dürft, ist eine kurzzeitige historische Abnormität. Ein Ausrutscher in der Geschichte der Menschheit. Der Islam wird diese jämmerlich toleranten und entscheidungsschwachen Schwuchtel-Demokratien hinwegfegen. Und wenn es die Muslime nicht machen, dann tun es die Chinesen. Jedenfalls würden sie es tun, wenn sie noch die Zeit dazu hätten und nicht gerade der ganze Planet den Bach hinunterginge. Gesellschaften, die von Frauen regiert werden, sind zum Untergang verurteilt.«
Sie lässt mich ausreden, wie ich ihr das beigebracht habe, eine Sache, die früher undenkbar war. Ständig hat sie dazwischengeplappert, nichts blieb unwidersprochen. Aber nun kann ich mich ausbreiten, wie ich will, und sie lässt mir alle Zeit der Welt, wartet notfalls minutenlang, bis ich fertig bin, bevor sie antwortet.
»In keinem Land der Welt werden Frauen an die Kette gelegt«, sagt Christine. »Selbst in Saudi-Arabien laufen sie frei auf der Straße herum.«
»Ja, aber bloß, weil es keinen Ort gibt, wohin sie fliehen könnten. Sie haben gar keine andere Möglichkeit, als wieder nach Hause zu kommen. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass du wieder zu mir zurückkommst, würde ich dich auch einkaufen gehen lassen. Aber solange das noch nicht geht, freu dich doch, dass ich dir diese Arbeit abnehme.«
Darauf sie: »Niemand darf seine Frau an einer Kette halten, das gibt es in keiner Kultur, das ist überall ein Verbrechen. Das ist krank!«
»Das bezweifle ich«, sage ich sehr ruhig, »aber selbst, wenn es in einigen Kulturen als Verbrechen angesehen werden mag – deswegen ist es noch lange nicht krank.«
»Doch. Es ist krank, krank, krank!«
Sie quetscht sich zwei erpresserische Tränen aus den Augen.
»Unsinn«, sage ich, und obwohl sie sich so aufführt, bin ich immer noch geduldig, antworte höflich und gefasst. »Denk doch bloß an den Mädchenhändlerring, der aufgeflogen ist, als ihr schon geglaubt habt, die böse, böse Prostitution endgültig abgeschafft zu haben. Die hatten ihre Mädchen doch auch den ganzen Tag in Ketten gelegt. Aber soweit ich mich erinnere, ist keiner von den Jungs deswegen als psychisch gestört in eine Irrenanstalt eingewiesen worden. Die wurden alle zu Gefängnis verurteilt. Und erzähl mir nicht, dass diese Männer die Mädchen bloß des Geldes wegen angekettet hatten – die haben da auch jede Menge Spaß dabei gehabt. Warum sind die Richter also nicht auf die Idee gekommen, diese Männer als psychisch krank einzustufen? Wo es deiner Meinung nach doch nur einem kranken Hirn entspringen kann, eine Frau in Ketten zu halten? Ich sag es dir: Weil jeder Richter den Spaß daran nachvollziehen kann. Weil er auch heimlich davon träumt, so viel Macht zu besitzen. Für einen Mann ist es nämlich etwas sehr Schönes, eine Frau ganz und gar zu beherrschen. Und vor allem ist es etwas völlig Normales – ein gesundes männliches Bedürfnis.«
»Ist es nicht, und das weißt du auch, Sebastian. Und außerdem war es eine Richterin, die das Urteil gesprochen hat. Und du willst ja wohl nicht ernsthaft behaupten …«
»Halt den Mund«, sage ich. »Du solltest dir abgewöhnen, immer das letzte Wort haben zu wollen. Und nenn mich nicht Sebastian!«
Ich verlange keinen Kadavergehorsam – wie man gerade sehen konnte, lasse ich ihr sogar ziemlich viele Frechheiten durchgehen –, aber mein Name ist absolut tabu.
»Oh, Verzeihung, Gebieter«, antwortet sie, wobei sie die Hände hebt, auf eine alberne Weise mit den Fingern wedelt und das Wort »Gebieter« affektiert betont. »Ich habe ganz vergessen: Wenn ich den verbotenen Namen ausspreche, dann verwandelst du dich womöglich in das arme Würstchen, das du in Wirklichkeit bist, und kannst hier nicht mehr als der tolle Hecht und Frauenbändiger auftreten.«
Ich betrachte sie kalt. Da sitzt sie neben mir, nackt, eingesperrt, angekettet, ausgeliefert. Die Scheiße steht ihr wahrlich bis zum Hals, aber sie denkt immer noch, sie könnte Wellen machen. Ich könnte jetzt wütend werden. Ich könnte sonst was mit ihr anstellen. Aber ich bin ganz ruhig. Ohne ein Wort steige ich aus dem Bett und greife sie mir. Sie zuckt zurück, hebt reflexhaft die Hände vors Gesicht. Dabei habe ich gar nicht die Absicht, sie zu schlagen. Ich packe einfach bloß die Kette dicht neben ihrem Hals und schleife sie daran zur Wand, zu den Karabinerhaken. Sie versucht, sich zu wehren, nach mir zu treten und mit den Fäusten nach mir zu boxen. Ich bin genauso nackt wie sie und dadurch verletzlicher als sonst. Aber ihre Versuche sind rührend schwach. Ich brauche bloß einmal kräftig an der Kette zu ziehen und sie gerät sofort aus dem Gleichgewicht und stolpert brav neben mir her. Ich ziehe die Kette wieder in den mittleren Karabiner, bis sie nur noch einen Meter lang ist, sodass Christine sich weder setzen noch irgendwohin gehen kann, sondern einfach an der Wand stehen bleiben muss. Es tut gut, sie so zu sehen, ihre penetrante Ich-erklär-dir-mal-was-mit-dir-los-ist-Arroganz hat einen tüchtigen Sprung bekommen. Sie schluchzt, schluchzt die ganze Zeit, während ich zum Bett zurückgehe, mich wieder anziehe, meine Schuhe zuschnüre, zur Kücheninsel gehe, die Schublade aufziehe und nach einem Kabelbinder wühle.
»Tu das nicht«, schluchzt sie, während ich ihr die Hände mit dem Kabelbinder auf den Rücken fessele. Ohne Schuhe hängen da nur noch kümmerliche 1,69 an der Kette. Wie klein sie ist! Zusammengesunken steht sie da mit hängenden Schultern und bebenden Lippen. Aber das hätte sie sich vorher überlegen müssen. Ich drehe die Heizung herunter und gehe wortlos hinaus.
4
Als ich aufwache, liege ich im Wohnzimmer auf dem Cordsofa in vollen Klamotten und der Fernseher läuft. Ein schwarzes Zeichentrickdings wird von einer Wippe senkrecht in die Luft geschleudert. Eine helle Kinderstimme – vielleicht sind es auch mehrere Stimmen oder doch nur eine, das ist schwer zu sagen – singt ein Lied, irgendetwas mit Sombrero.
»… mit Sombrero … mit Sombrero«, singt die Stimme und jetzt erkenne ich auch die Zeichentrickfigur. Es ist Calimero, das Fernsehküken. Kennt das noch einer? – Die Zeichentrickserie aus den 70ern mit einem schwarzen Küken namens Calimero, das als Symbol seiner unvollständigen Entwicklung und eines übergroßen Schutzbedürfnisses auch nach dem Schlüpfen immer noch ein verdammtes Stück Eierschale auf dem Kopf spazieren trägt. So, wie sich das unsere fürsorgliche Regierung auch für ihre schutzbedürftigen Untertanen wünscht: allen Radfahrern eine Calimeroschale auf den zerbrechlichen Schädel, dann kann niemandem mehr etwas geschehen. Nur, dass Calimero jetzt irgendwie anders aussieht … die Augen! Die Zeichner haben ihm widerliche Manga-Augen verpasst, mit denen Calimero in die Gegend glotzt, als würde er Drogen nehmen. Die rote Digitalanzeige am unteren Rand des Bildschirms zeigt 7:12 Uhr. Ich schaue auf meine Armbanduhr – jawohl, ich besitze noch eine – tatsächlich, es ist bereits nach sieben. Gestern Nacht muss ich vor dem Fernseher eingeschlafen sein. Sieben Uhr morgens, das ist noch zu früh, um sich fürs Büro fertig zu machen, vor neun erscheint dort niemand. Die meisten kommen erst nach zehn. Dann fällt es mir siedend heiß ein: sieben Uhr morgens, das bedeutet, dass Christine seit sieben Stunden im Keller steht und auf mich wartet, die Hände auf den Rücken gefesselt. Das war nicht meine Absicht. Ich hatte vor, nach zwei Stunden zurückzukommen und die Kette wieder länger zu machen, vielleicht nicht gleich die volle Länge, aber wenigstens so lang, dass sie hätte sitzen können. Ich will sie ja nicht quälen. Ich will ihr bloß zeigen, was in meinen Möglichkeiten liegt, und ihr ein wenig das Mütchen kühlen. Respekt – darum geht es. Aber ehrlich gesagt, habe ich sie wohl einfach vergessen. Jedes Mal, wenn ich die Kellertür hinter mir geschlossen und das Regal wieder angebracht und die Konservendosen eingeräumt habe, wird der geheime Raum dort unten, wird auch Christines Existenz für mich schlagartig so unwirklich, als wäre alles bloß eine Phantasie von mir. Selbst in der allerersten Zeit, in den beiden Wochen, nachdem ich sie eingesperrt hatte, war es irgendwie unwirklich. Obwohl ich Tag und Nacht an Christine dachte und die Tatsache, dass sie dort unten saß, in einer Welt, in der ich die Regeln vorgab und sie nicht Nein sagen konnte, mich geradezu euphorisierte. Und dennoch war diese zweite, geheime Welt schon damals für mich so unwirklich, dass ich mehrmals täglich hinuntergehen, das Regal ausräumen, die Sperrholzplatte lösen und die schalldichte Tür aufschließen musste, um mich immer wieder davon zu überzeugen, dass der Ort tatsächlich existierte. Jedes Mal, wenn ich eintrat und Christine an der Kette vorfand, traf mich wieder ein Glücksflash. Das war real! Das war so was von real!
Leider gewöhnt man sich ja an alles. Es gibt Untersuchungen darüber, dass selbst das Glück, das ein Lottogewinn einem bereitet, nur drei Monate anhält. Danach ist man wieder genauso depressiv wie vorher.
Gestern Nacht habe ich mir auf DFS ein Formel-1-Rennen angesehen. Pullman führte vor Lambert, der ihm die ganze Zeit an der nicht vorhandenen Stoßstange klebte und einfach nicht vorbeikam. Er versuchte es rechts, links, wieder rechts, in der Kurve, auf der Geraden, während die Fliehkräfte an seinem Helm ruckten, und dann muss ich irgendwann eingeschlafen sein.