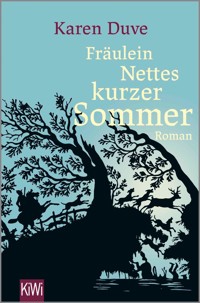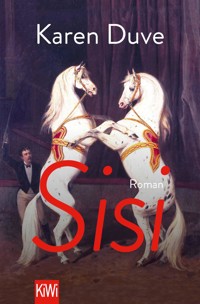
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karen Duves großer Roman über Sisi – zwischen Zwang und Freiheit Als Elisabeth (Sisi) durch Heirat zur Kaiserin von Österreich wird, betritt sie eine streng geordnete Welt voll steifer Konventionen und langweiliger Empfänge. Ausbrechen kann sie nur auf ausgedehnten Reisen und bei Aufenthalten auf ihrem ungarischen Schloss Gödöllö. Dort kann sie ungezwungen leben und ihrer größten Leidenschaft nachgehen: wilden Reitjagden. Kein Wassergraben ist der Kaiserin zu breit, kein Hindernis zu gefährlich – Sisi gehört zu den besten und tollkühnsten Reiterinnen ihrer Zeit. Der legendäre Jagd- und Rennreiter Bay Middleton bewundert die Kaiserin nicht nur für ihr reiterliches Können. Bei einem Aufenthalt auf Gödöllö lädt Sisi ihre reit- und fechtkundige Nichte Marie Wallersee zu sich ein. Als Tochter einer Schauspielerin ist Marie eigentlich nicht standesgemäß, aber Sisi sieht in ihr ein freieres zweites Selbst und macht sie zur engen Vertrauten. Die 18-jährige Marie erliegt schnell dem Charme der kaiserlichen Tante und assistiert ihr nur allzu gerne, wenn diese die leidenschaftliche Reiterin und Femme fatale gibt. Doch bald wirkt auch Marie anziehend auf andere, besonders auf die männlichen Adligen. Sisi, daran gewöhnt im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sieht sich nach einem Ehemann für die lästige Konkurrenz um und beginnt ein intrigantes Spiel aus Verführung und Verrat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Karen Duve
Sisi
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Karen Duve
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Karen Duve
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2002), Die entführte Prinzessin (2005) und Taxi (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, 2014 ihre Streitschrift Warum die Sache schiefgeht. Die Verfilmung ihres Romans Taxi kam 2015 in die Kinos. 2016 sorgte sie mit ihrem Roman Macht für Aufruhr und wurde mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2017) ausgezeichnet. Für ihren Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer (2018) wurde Karen Duve mit dem Carl-Amery-Preis, dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Elisabeth (Sisi) durch Heirat zur Kaiserin von Österreich wird, betritt sie eine streng geordnete Welt voll steifer Konventionen und langweiliger Empfänge. Ausbrechen kann sie nur auf ausgedehnten Reisen und bei Aufenthalten auf ihrem ungarischen Schloss Gödöllő. Dort kann sie ungezwungen leben und ihrer größten Leidenschaft nachgehen: wilden Reitjagden. Kein Wassergraben ist der Kaiserin zu breit, kein Hindernis zu gefährlich – Sisi gehört zu den besten und tollkühnsten Reiterinnen ihrer Zeit. Der legendäre Jagd- und Rennreiter Bay Middleton bewundert die Kaiserin nicht nur für ihr reiterliches Können.
Bei einem Aufenthalt auf Gödöllő lädt Sisi ihre reit- und fechtkundige Nichte Marie Wallersee zu sich ein. Als Tochter einer Schauspielerin ist Marie eigentlich nicht standesgemäß, aber Sisi sieht in ihr ein freieres zweites Selbst und macht sie zur engen Vertrauten. Die 18-jährige Marie erliegt schnell dem Charme der kaiserlichen Tante und assistiert ihr nur allzu gerne, wenn diese die leidenschaftliche Reiterin und Femme fatale gibt. Doch bald wirkt auch Marie anziehend auf andere, besonders auf die männlichen Adligen. Sisi, daran gewöhnt im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sieht sich nach einem Ehemann für die lästige Konkurrenz um und beginnt ein intrigantes Spiel aus Verführung und Verrat.
Ein spannender, kluger Roman über Sisi – Karen Duve zeichnet in ihrem bis ins Detail recherchierten Buch eine andere, interessantere Sisi, als wir sie von ihrem Glanzbild kennen. Sie stellt eine widerspenstige Kaiserin vor, die seit mehr als 20 Jahren überaus versiert darin ist, sich den Forderungen des Hofes zu entziehen und sich Freiräume zu schaffen. Und die das Spiel der Macht subtil beherrscht.
Ein widersprüchlicher Mensch - faszinierend, manipulativ, sehnsüchtig, tapfer und bisweilen zerstörerisch.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2022, 2024 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Lisa Neuhalfen
Covermotiv: © Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Fotograf: Studio Johannes Wagner / Sammlung Bundesmobilienverwaltung
ISBN978-3-462-32102-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1 Althorp
2 Hinter den Hunden
3 Der Kaiser am Morgen
4 Die Sklavin der Haare
5 Ein Eisenbahnabenteuer
6 Die neue Frisur
7 Der Hohenembs Cup
8 Die Fußwaschung
9 Pauline Metternich
10 Anna
11 Hotel Strauch
12 Die Sache mit dem Herrn Pacher
13 Die Nichte
14 Treibjagd am Traunstein
15 Gödöllő
16 Parforce
17 Rudolf
18 Der Tag des Franz von Assisi
19 Die Pennants
20 Es ist nicht immer leicht
21 Der Platz an ihrer Seite
22 Das kleine Souper
23 Eifersucht
24 Der Captain geht auf Expedition
25 Die Sache mit Dr. Fischer
26 Abschied von Middleton
27 Die alte Kaiserin
28 Waldesgespräch
29 Parforce mit dem Kaiser
30 Nächtlicher Botenritt
31 Elemér
32 Emmerich
33 Grüne Schuhe
34 Geschenke
35 Trübsinn allerorts
36 Rustimo
37 Die Geburtstagsfeier
38 Die Sache mit Gisela
37 Die Geburtstagsfeier (Fortsetzung)
39 Die Sache mit Giselas erstem Kind
37 Die Geburtstagsfeier (Fortsetzung 2)
40 Ein Obersthofmeister für den Thronfolger
41 Ein harmloser Gatte
42 Kleine Freiheit
43 Solza
44 Herbst
45 Die Hochzeit
46 Weihnachten
Förderhinweis
Anmerkung und Dank
Literaturverzeichnis
»Wenn die Menschen etwas recht Beißendes äußern wollen, sagen sie, Napoleon war groß, aber gar so rücksichtslos; ich denke immer dabei, das sind gar viele Menschen, ohne dabei groß zu sein. Ich zum Beispiel auch.«
Elisabeth von Österreich-Ungarn
1Althorp
Es sind die großen Tage der englischen Fuchsjagd. Der Meet ist für ein Uhr angesetzt. Jetzt ist es zwölf, und die Schaulustigen strömen nur so nach Althorp, dem felsgrauen Anwesen des fünften Earl of Spencer.
Das Schloss hat seine Reize. Die Fassade gehört nicht dazu. Ein eigensinniger Vorfahre der Spencers hat das einst heiter rote Tudorhaus mit grauen Ziegeln verblenden lassen und korinthische Säulenattrappen rechts und links neben den Eingang geklebt. Doch die Märzsonne scheint, wenn es auch immer noch winterlich kalt ist, und in diesem Licht mit den glänzenden Pferden davor und den Reitern in ihren bunten Röcken und schwarzen Zylindern macht das Anwesen einen noblen Eindruck. Die graue Fassade verlangt nach den überschwenglichen Farben einer Jagd. Die trübselige Landschaft verlangt danach. Der englische Winter verlangt danach. Die kalten Monate ziehen sich hin in Britannien. Regen, Nebel, Ereignislosigkeit. Eine Parforcejagd bringt Pracht und Sensation.
Plaudernd reiten die Jäger, unter denen sich auch einige Damen befinden, vor dem Gebäude auf und ab. Die Pferde erfüllen alle Erwartungen. Sie kauen auf dem Gebiss, stampfen und schäumen und zertrampeln die gepflegten Rasenflächen. Es sind große, edle Hunter mit rasierten Mähnen und akkurat gestutzten Schweifen. Diener in Livreen laufen zwischen ihnen hindurch. Sie balancieren Gläser auf Silbertabletts, Port für die Herren, Sherry für die Damen. Brandy für alle. Die Jagdteilnehmer haben sich mit einer Sorgfalt gekleidet, die nicht größer sein könnte, wären sie zu einer exklusiven Abendgesellschaft eingeladen – nur dass es hier die Damen sind, die Schwarz tragen. Allenfalls sind ihre Reitkleider dunkelblau oder grün. Die Herren tragen ausnahmslos Pink. Natürlich sind ihre Röcke nicht rosa. Sie sind leuchtend rot, wie es sich für einen Jagdrock gehört. Aber das darf man nicht sagen. Man darf in England nicht sagen »Er reitet in Rot«. Niemals, nie, auf gar keinen Fall. Nicht einmal denken darf man »rot«, wenn man nicht als ungehobelt gelten will.
Üblicherweise trägt man zu einem inoffiziellen Jagdtag, wie Lord Spencer ihn als Master der Pytchley-Meute kurzfristig angesetzt hat, eigentlich gar nicht Pink, aber da die Kaiserin von Österreich mitreiten wird, kann man sich ja schlecht in einer alten Tweedjacke präsentieren.
Der Earl hat sein Möglichstes getan, nichts von der Teilnahme Ihrer Majestät an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Sie reist inkognito unter einem ihrer vielen weiteren, aber gänzlich ungebräuchlichen Titel, dem einer ›Gräfin Hohenembs‹. Sie wünscht in Ruhe gelassen zu werden. Was Elisabeth von Österreich jedoch nicht davon abgehalten hat, ihren Obersthofmeister, ihre Hofdame, ihre Kammerfriseurin, ihren Leibarzt, ihren Gestütmeister und ihren englischen Reitlehrer nach Althorp mitzubringen. Außerdem wird sie von sieben Kavalieren aus der Heimat begleitet – allesamt hervorragende Reiter und allesamt auffallend gut aussehend.
Es ist also nicht ganz einfach, die Anwesenheit der hohen Frau zu verbergen. Zumal Lord Spencers Talent, etwas Interessantes für sich zu behalten, eher gering ist. Und nun haben sich dreihundert Jagdreiter versammelt, und rundherum wimmelt es nur so von neugierigen Lehrern, Weibern, Pferdehändlern, Geistlichen, Krämern und Schlimmerem, und ihre Dogcarts und Breaks samt den drittklassigen Pferden stehen überall im Weg. Einige Gaffer sind bereits am Vortag mit dem Zug aus London angereist, um mit etwas Glück dabei zu sein, wenn die angeblich schönste Frau Europas in einem schlammigen Pytchley-Graben landet.
Das ist vor dem Haus.
Innerhalb der althorpschen Mauern, in der großen Eingangshalle und dem angrenzenden Salon mit der Treppe aus Walnussholz, strömt die beste Gesellschaft ein und aus, um sich mit einem Happen für das bevorstehende Gemetzel zu stärken. Dort riecht es nach Punsch, nach Rauch und frisch gefettetem Leder und auch ein wenig nach Pferd, denn einige der Anwesenden haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Pferde persönlich herzureiten. Die Herrschaften schieben sich zwischen den Tischen hindurch, überall stehen Tische, bedeckt mit weißem Leinen, auf denen sich brodelnde Kessel, Sandwichplatten und glänzende Silberschüsseln voller Roastbeef, Hammelfleisch und jeder erdenklichen Köstlichkeit drängen. Dazwischen Pyramiden aus blank polierten Äpfeln und Orangen. Blumen, überall stehen Blumen. Die Getränketische sind mit Blüten geradezu überwuchert. Die großen Mengen Alkohol, die die Jagdteilnehmer hier in sich hineinschütten, zeugen von dem Respekt, den sie der vor ihnen liegenden Strecke entgegenbringen. Aus dem ganzen Gewühl ragen zwei nahezu lebensgroße Sklavenstatuen heraus, deren Marmorrümpfe einst aus dem Tiber geborgen wurden und die nun – um lackschwarze Gliedmaßen und Köpfe ergänzt – neben dem Eingang auf ihren Podesten Wache halten.
Plötzlich legt sich das Stimmengewirr.
»Her Majesty … the Empress«, hört man flüstern, und alles drängt in den Salon, die Blicke fliegen die Treppe hoch, auf deren oberster Stufe die Kaiserin von Österreich erschienen ist. Sie trägt ein dunkelblaues Reitkleid und ist sehr groß. Trotzdem wirkt sie zart, weil sie ungewöhnlich schlank ist. Das Haar hat den berühmten Tizianschimmer. Langsam kommt sie die Stufen herunter. Sie muss etwas seitlich gehen, weil sich der Rock so eng an ihre Hüften schmiegt. Eigentlich ist es eher ein Gleiten als ein Gehen. Sehr elegant wirkt das – die verkörperte Majestät. Alles verstummt und verneigt sich. Nur weiter hinten recken sich die Hälse. Die Schönheit der Kaiserin ist legendär. Dabei ist sie schon achtunddreißig Jahre alt. Ihr Gemahl, der österreichische Kaiser, hat über die Jahre ein Bild nach dem anderen von ihr anfertigen lassen, von denen keines ihren Zauber je einfangen konnte. Ein Betrachter dieser Bilder könnte sagen: Jaja, sie ist schon sehr hübsch, aber eigentlich mag ich es etwas voller, die Haare heller, und sehe ich da etwa den Ansatz eines Doppelkinns? Wenn derjenige ihr dann aber in der Wirklichkeit gegenübersteht, so spielen seine Vorlieben plötzlich keine Rolle mehr. Es ist mehr als das hübsche Gesicht und die phantastische Figur – ihre Schönheit ist nicht greifbar, sie scheint einen Meter vor ihr her zu schweben. Ist es die Haltung? Ihre Anmut? Die Art, wie sie den Kopf neigt und mit geschlossenen Lippen lächelt? Man weiß nur, dass man sie immerzu anstarren will.
Hinter Elisabeth von Österreich-Ungarn geht ihre Schwester, die ehemalige Königin von Neapel. Aber niemand sieht auf die Ex-Königin oder ihren Gemahl, den etwas trotteligen Ex-König Francesco, oder auf die Hofdame oder Prinz Ruffano und wer auch immer da noch mit der Kaiserin die Stufen herunterkommt. Sie verschwinden einfach neben ihr.
Am Fuß der Treppe warten ihre Kavaliere und der Hausherr. Der Earl of Spencer stellt ihr Captain Middleton vor, den er zu ihrem Piloten ausersehen hat, ihrem Begleiter während der Jagd, der sie sicher über alle Hindernisse führen und im Notfall mit einem kleinen Beil eine Bresche für sie schlagen soll. Middleton ist kein schöner Mann. Er ist rothaarig und von eher gedrungener Statur. Gerade so eben noch als mittelgroß zu bezeichnen. Dennoch wirkt er elegant. Sein Jagdrock ist mit wenigen Knöpfen hochgeschlossen und wie ein Cutaway geschnitten. Er trägt dazu die üblichen weißen Lederhosen und Stiefel mit hellbraunen Stulpen und Stiefelriemen – zum Binden, nicht zum Schnallen. Die Kavaliere der Kaiserin mustern ihn finster. Baron Orczy hat zur Jagd seine Uniform angezogen, wie das in Österreich-Ungarn nicht unüblich ist, und zu seiner Verärgerung festgestellt, dass der hellblaue Stoff mit all seinen goldenen Tressen und Verschnürungen in dieser Umgebung wie ein Papageienbalg wirkt. Die übrigen Kavaliere haben sich bereits englische Jagdröcke zugelegt, verübeln Middleton aber die lässige Eleganz.
»Eure Majestät«, sagt Middleton, küsst die weiß behandschuhte Hand, die ihm entgegengehalten wird, und nimmt wieder die aufrechte Haltung des ehemaligen Kavallerie-Hauptmanns ein.
Auch er hat natürlich schon vorher gehört, dass die Kaiserin ungewöhnlich schön sein soll. Trotzdem erwischt es ihn unvorbereitet. Noch bevor sein Blick ins Detail gehen, ihre makellose Haut und die braungoldenen Augen richtig wahrnehmen oder etwa bemerken kann, auf welch atemberaubender Haarfülle ihr Reitzylinder in seinem neckischem Winkel thront, noch bevor sein Blick den Linien ihres blauen Reitkleids folgen und an den schmalen Schultern oder der winzigen Taille hängen bleiben kann, ist er vollkommen hingerissen.
Die Kaiserin sagt etwas, das Middleton nicht versteht. Er schiebt es darauf, dass er seit einem Reitunfall schwerhörig ist. In Wirklichkeit hat niemand das genuschelte Flüstern der Kaiserin verstanden. Sie spricht, ohne die Lippen zu bewegen, damit man ihre Zähne nicht sieht. Die verfärbten, leicht durchsichtigen Zähne sind ihr einziger Makel.
Middleton nickt höflich und lächelt mit diesem unbestimmbaren Charme, wie ihn nur die englische Oberschicht hervorbringen kann. Doch Middleton gehört keiner der großen Familien an. Auch wenn er mit seinen roten Haaren, den roten Augenbrauen und dem roten gestutzten Schnauz aussieht wie ein Bruder des Lords. Middleton ist noch nicht einmal besonders reich. Und Spencers Vollbart, der sich wie die Wamme eines preisgekrönten Shropshire-Hammels unter dessen Kinn bauscht, leuchtet in einem viel kräftigeren und feurigeren Rot. Bei Middleton sind selbst die Augen bleich, bläulich bleich; die Märzsonne hat Nase und Wangenknochen verbrannt.
»Mit dem Captain haben sie den besten Mann, den ich Eurer Majestät zur Seite stellen kann«, sagt Spencer, während sie in die Eingangshalle gehen, wo er der Kaiserin die maßangefertigten und in die Wand eingefügten riesigen Jagdgemälde aus dem frühen achtzehnten Jahrhundert zeigen und nebenbei auf ein winzig kleines Jagdhorn auf einem der Bilder hinweisen will, weil es originellerweise dasselbe ist, das auch heute zum Einsatz kommen wird.
»Middleton war mein Adjutant zu meiner Zeit als Vizekönig in Dublin«, sagt Spencer. »Man wollte mich dort keine Jagden mehr reiten lassen. Wegen der Attentate. Ich bin im Feld nun mal leicht auszumachen.«
Er hebt mit dem Handrücken seinen roten Bart an.
»Die Schutzgarde fühlte sich meinem Tempo und den Hindernissen nicht gewachsen. Zum Glück fand ich dann Captain Middleton bei den zwölften Lancers. Der sprang mit der Waffe in der Hand neben mir her.«
Lady Spencer, die ein feenhaftes grünes Reitkostüm trägt, lächelt.
»Ich bezweifle, dass Captain Middletons Begleitung die Sicherheit meines Ehemanns erhöht hat. Beide setzen bei einer Jagd alles daran, sich den Hals zu brechen. Ein Attentäter müsste sich schon sehr ranhalten, wenn er ihnen dabei zuvorzukommen will.«
»Der beste Reiter«, wiederholt Spencer, ohne dass Middleton deswegen eine Miene verzieht, »der beste Reiter weit und breit. Wenn er eine Schwäche hat, dann höchstens die, dass er sich dessen etwas zu sehr bewusst ist.«
Jemand hüstelt. Spencer wird plötzlich verlegen und sucht mit der rechten Hand nach dem Kinn in seinem Bart. Lady Spencer betrachtet die braunen und blauen Fliesen ihres Hallenbodens mit so großer Aufmerksamkeit, als sähe sie sie zum ersten Mal, und Ex-König Francesco geht völlig unmotiviert zu einer der großen Sklavenstatuen am Eingang und popelt vor lauter Nervosität mit dem Zeigefinger an den Marmorzehen. Nur Middleton und die Kaiserin bleiben ruhig.
Was eigentlich niemand erfahren sollte, aber sämtliche Anwesenden einschließlich der servierenden Diener wissen, ist, dass Middleton sich über den ehrenvollen Auftrag, die Kaiserin zu pilotieren, nicht so begeistert gezeigt hat, wie sich das gehört hätte. Zunächst hat er es sogar rundheraus abgelehnt.
»Was bedeutet mir schon eine Kaiserin?«, soll er zu seiner Lordschaft gesagt haben, »sie wird mich nur behindern.«
Spencer hat ihm versichert, dass Elisabeth von Österreich eine exzellente Reiterin sei. Sie sei sogar so gut, dass niemand außer Middleton diesen ehrenvollen Auftrag erfüllen könne.
Und Middleton so: »Sie wissen doch, dass ich meinen eigenen Weg reiten muss. Was ist, wenn sie nicht über die Fences kommt? Oder ich jedesmal auf sie warten muss? Am Ende muss ich mit ihr noch auf der Straße traben.«
Und Spencer so: »Nein, nein, das wird nicht geschehen. Ich hab die Kaiserin im letzten Jahr selbst reiten gesehen. Frank Beers war auch begeistert. Tu mir den Gefallen, Bay.«
Spencer hat beinahe gefleht, und schließlich hat Middleton sich daran erinnert, dass er ja unter anderem auch so etwas wie sein Stallmeister ist, und eingelenkt: »Aber nur dieses eine Mal.«
Es ist unerlässlich, ein paar Worte über das Verhältnis zu verlieren, in dem der 5. Earl of Spencer und Captain Middleton zueinander stehen. Ansonsten wäre es schwer zu begreifen, wieso ein Mann, der so vom Bewußtsein seiner hohen Abkunft durchdrungen ist wie der Earl, sich von einem kleinen Adjutanten auf der Nase herumtanzen lässt. Denn das war Middleton, als Lord Spencer ihn das erste Mal traf: ein für die Fuchsjagd abkommandierter Adjutant mit minimalen Pflichten. Doch neben der Anbetung von Status und Klasse herrscht in der englischen Oberschicht noch ein weiterer Kult: die Anbetung von Muskeln, Schnurrbärten, Härte, Mut und Todesverachtung. Die Offiziere überschütten das Kriegsministerium mit Gesuchen um Versetzung in den aktiven Dienst, und sie meinen das vollkommen ernst. Aber es gibt nicht genug blutige Feldzüge für alle im Empire. Also setzt man seine körperliche Unversehrtheit in den Vorräumen der Offiziersmessen aufs Spiel oder in den Rauchsalons der Familiensitze, wo man nach dem Dinner miteinander rangelt. Bärenkämpfe nennt sich das, wenn man seinen besten Freunden die Nasen blutig schlägt und ihnen die Rippen bricht. Hier tut sich Middleton ganz besonders hervor, er kennt überhaupt keine Grenzen. Auf dem Schlachtfeld der Parforcejagd ist er sowieso der Beste. Als Krieger ohne Krieg sind Spencer und Middleton von gegenseitiger Hochachtung erfüllt und unzertrennlich. Bay ist der Freund, den der Lord zuvor nicht besaß.
Natürlich wollte Spencer vermeiden, dass Middletons Bockigkeit der Kaiserin zu Ohren käme. Was für ein Affront! Darum hat er es nur der Königin von Neapel anvertraut, die er für absolut integer hielt. Schließlich ist sie die Schwester der Kaiserin. Genauso gut hätte er es öffentlich anschlagen können. Als Erstes hat es die Königin von Neapel ihrer kaiserlichen Schwester persönlich erzählt, und dann den sieben gut aussehenden Kavalieren. Und dann Lady Dudley. Lady Dudley hat es an diesem Morgen sofort Lord Langford erzählt, und damit erfuhren es dann alle, die es nicht bereits von Middleton persönlich gehört hatten.
Die Kaiserin lässt sich nichts anmerken, allenfalls drückt sich ihre Verstimmung in der besonderen Perfektion ihres Reitkleids aus. Das dunkelblaue Samtkostüm mit kleinem Zobelbesatz und goldenen Knöpfen sitzt wie aufgemalt. Es hat diesmal mehr als zwei Stunden gedauert, bis sie mit dem Ergebnis des Einnähens zufrieden gewesen ist – ohnehin eine mühsame Arbeit für die arme Schneiderin, da die Etikette ihr verbietet, beim Nähen den Körper der Kaiserin zu berühren.
»Wie freundlich von Ihnen, mir zur Seite stehen zu wollen«, sagt Elisabeth. Diesmal ist sie besser zu verstehen. Ihr Englisch ist hervorragend und ihr Akzent entzückend. Sie schenkt ihm ein Lächeln, diesem arroganten kleinen Captain Middleton, ihr berühmtes Lächeln mit geschlossenen Lippen und registriert zufrieden, wie sich seine blassblauen Augen weit öffnen und etwas Schwammiges bekommen.
»Na, dann sollten wir wohl mal los«, sagt Spencer.
Wie aus dem Nichts steht ein livrierter Diener neben ihm und überreicht Handschuhe, Samtkappe und Peitsche. Die Hofdame, die die ganze Zeit schweigend neben der Kaiserin gestanden hat, fängt beinahe an zu weinen, als sie ihrer Herrin die Reithandschuhe entgegenhält.
»Ach Festi«, sagt die Kaiserin, streift die weißen Handschuhe ab und die Hirschledernen über, »nun machen Sie sich doch nicht solche Sorgen.«
»Keine Angst«, mischt sich Prinz Ruffano, ein Mann mit dunklen Locken, ein und sucht den Blick der hübschen kleinen Hofdame, »ich habe schon oft auf diesem Gelände gejagt und bisher sind noch immer alle heil zurückgekommen.«
Eine freundliche, wenn auch etwas plumpe Lüge. Die englische Fuchsjagd ist die waghalsigste aller überflüssigen Aktivitäten. Man reitet in einem ähnlichen Tempo wie bei einem Pferderennen, nur dass es querfeldein und über Hecken und Gräben geht. Ein Kaninchenloch genügt, ein unsichtbarer Draht, der nasse Boden oder ein ungeschickter Mitreiter, der direkt vor einem stürzt, und schon stürzt man ebenfalls und bricht sich den Rücken oder gleich das Genick. Jeder weiß das. Das House of Lords ist voller Rollstühle – alles Jagdunfälle. In den vornehmen Sanatorien vegetieren die Jagdreiter mit den irreparablen Hirnschäden vor sich hin.
2Hinter den Hunden
Die Pferde für die Kaiserin und ihre Begleiter warten an den korinthischen Säulenattrappen. Middleton sieht zu, wie Elisabeth ihren geschnürten Stiefel in die verschränkten Hände ihres Stallmeisters setzt und sich in den Damensattel heben lässt. Sie reitet einen herrlichen Fuchs. Mit einer geschmeidigen Bewegung wickelt sie ihre Beine um die Sattelhörner, zupft zwei Schlaufen um die Füße und zieht ihren Rock glatt. Etwas Blut tropft von der Hand des Stallmeisters, wo sie ihn mit ihrem winzigen Sporn geritzt hat. Middleton wendet sich ab.
Seine Stute steht noch in den Stallungen. Er muss sich den Weg durch die Pferde und die inzwischen vollzählig erschienenen Jagdteilnehmer bahnen. Unter ihnen erkennt er Lord Otho Fitzgerald und grüßt. Fitzgerald tippt mit angewidertem Gesicht an seine Zylinderkrempe. Seine Augen sind wie Dolche. Er ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Im letzten Jahr hat er einen Ball ausgerichtet und den Fehler gemacht, Middleton dazu einzuladen, was der ihm mit einem seiner widerwärtigen und alle Grenzen überschreitenden Scherze vergolten hat. Man muss dazu wissen, dass Otho Fitzgerald enorm stolz auf seine Mitgliedschaft im exklusivsten aller Segel-Clubs, dem Königlichen Jachtgeschwader, ist. Anlässlich des Balls hatte er die Flagge des Königlichen Jachtgeschwaders auf dem Turm von Oakley Court, seinem kürzlich erworbenen Anwesen, gehisst. Im Laufe des Abends schlich sich Middleton zusammen mit dem Ehrengast – es handelte sich um den französischen Kronprinzen und beide waren viehisch betrunken – auf den zinnenbewehrten Turm, holte das erhabene Emblem ein und hisste an seiner Stelle ein Badehandtuch. Am nächsten Morgen hatten dann alle diesen abscheulichen Fetzen im Wind flattern sehen, und bis zum Abend hatte ganz London davon erfahren.
Fitzgerald gibt sich bunten Rachephantasien hin. Er wünscht Middleton die Krätze an den Hals und dass er vom Pferd stürzen möge – am besten gleich mehrmals. Und falls er dabei einen komplizierten Bruch oder einen ausgerenkten Kiefer davontragen sollte, geschähe ihm das nur recht. Noch besser wäre es allerdings, wenn Middleton den Anschluss an die Meute verlöre. Darunter würde er mehr leiden als unter jedem körperlichen Schmerz.
Middleton ahnt, was in Fitzgeralds Kopf vorgeht. Es wimmelt hier von Gentlemanreitern, die ihm sein Können und sein Glück nicht gönnen und ihn nur zu gern weit abgeschlagen am Ende des Feldes sehen wollen. Jetzt haben sie Oberwasser, denn es ist nicht zu erwarten, dass die schöne Kaiserin bei einer solchen Jagd auf Anhieb mithalten kann – wie sehr Spencer auch von ihren Fähigkeiten geschwärmt hat. Nicht bei dem Tempo, das Middleton vorzulegen pflegt. Und dann sind da noch die berüchtigten Pytchley-Oxer, massive Zäune, die einen Meter vor den Hecken stehen und die Pferde zu enorm hohen und weiten Sprüngen zwingen. Er sieht sich schon mit dem kleinen Beil durch eine Hecke krauchen und einen Durchgang für die Kaiserin schlagen, während Fitzgerald lachend an ihm vorbeifliegt. Besonders schwierig wird es, wenn hinter den Hecken ein zweiter Zaun lauert – oder ein Graben. Einige dieser Hindernisse lassen sich einfach nicht überspringen. Nicht, wenn man nicht Middleton heißt – und manchmal selbst dann nicht.
Ein Bursche bringt ihm sein Pferd. Middleton schwingt sich in den Sattel und trabt dorthin, wo er Ihre Majestät vermutet.
Die Hunde treffen ein. Alle Reiter machen für die heranzottelnde Meute Platz, große gefleckte Tiere, die von Goodall, dem Huntsman mit kurzen Rufen dirigiert werden – »Rose, warte!« »Trooper, nicht trödeln!« – sodass die beiden Whippers nahezu tatenlos hinterdreinreiten können. Goodall und die Whippers tragen als Jagdbedienstete keine Zylinder, sondern einfache schwarze Samtkappen – genau wie Spencer. Der Lord hat ihnen die allerbesten Pferde zugeteilt, wahre Cracks, die auch für Rennen gemeldet werden. Diese Pferde springen ohne zu zögern über einen vier Meter breiten und furchterregend tiefen Graben, setzen spielend über höchste Hecken oder brechen notfalls hindurch. Der beste von ihnen ist »Bay Colonel«, den Goodall reitet. Nicht einmal der große Braune, den Spencer für sich selber ausgesucht hat, ist besser. Schließlich dürfen er und die Gäste es sich jedesmal aussuchen, ob sie ein Hindernis nehmen oder lieber darum herumreiten, während die Meutenführer so gut wie alles springen müssen, um die Verbindung zu den Hunden nicht zu verlieren.
Middleton sieht die Kaiserin auf sich zureiten. Ihr Sitz ist vollkommen, ihre Handhaltung perfekt. Ihre Taille ist nicht von dieser Welt. So verschnürt eine Jagd zu reiten, erfordert eine übermenschliche Selbstbeherrschung. Er zieht seinen Zylinder. Die Kaiserin pariert ihr Pferd neben ihm.
»Captain Middleton, darf ich Sie um etwas bitten?«
»Was immer Eure Majestät wünschen.«
Die Kaiserin legt ihre Hand, in der sie auch die Peitsche hält, auf den Mähnenkamm seines Pferdes.
»Versprechen Sie mir, so wie immer zu reiten! Versprechen Sie mir, mich nicht zu schonen!«
»Das hatte ich gar nicht vor, Eure Majestät.«
Er setzt seinen Zylinder wieder auf und befestigt das Band daran mit einer Nadel unter seinem Rockkragen.
Fürchtet Elisabeth sich denn überhaupt nicht? Nicht im Geringsten.
Mit ihrer Furchtlosigkeit beim Reiten hat sie schon als Kind alle beeindruckt, sogar ihren Vater, Herzog Max, der an seiner Familie ansonsten wenig Interesse zeigte. Seinetwegen ist sie noch draufgängerischer geritten als ihre Brüder und Schwestern, ist schneller galoppiert und höher gesprungen und zögerte nicht, zögerte nie, ihrem Vater über ein Hindernis nachzusetzen – auch wenn sie nicht wusste, was sich dahinter befand.
»Ach Sisi, du bist ganz wie ich«, sagte er einmal, »wenn wir keine Herzöge wären, wären wir Zirkusreiter geworden.«
Das änderte allerdings nichts daran, dass sie ihren Vater kaum sah. Herzog Max war ständig auf Reisen. Reisen mit schönen Damen. Oder er führte sein Junggesellenleben auf Schloss Unterwittelsbach, das er genau zu diesem Zweck für sich erworben hatte und zu dem Frau und Kinder keinen Zutritt hatten. Nach Possenhofen kam er praktisch nie und zu Hause im Münchener Palais war er allenfalls im Winter und auch das höchst selten. Sein Appartement im Palais hatte einen eigenen Eingang zur Straße, sodass es ihm möglich war, tagelang mit seiner Familie unter einem Dach zu leben, ohne Frau oder Kindern begegnen zu müssen. Wollten die ihn sehen, mussten sie sich bei seinen Dienern anmelden. Nicht einmal zu Mittag aß er mit seiner Familie, sondern lieber mit seinen außerehelichen Töchtern. Die sich bei ihm übrigens nicht anmelden mussten. Den legitimen Kindern war es dann strengstens verboten zu stören.
Ein ganzes Jahr hat Elisabeth damit verbracht, sich auf die englischen Parforcejagden vorzubereiten. Und dieser kleine Captain Middleton fühlt sich belästigt, weil er an ihrer Seite reiten muss! Nach der Jagd soll er darum betteln, sie wieder pilotieren zu dürfen!
Lord Spencer hält eine kurze Ansprache, heißt alle willkommen, dann schlängeln sich die Hunde und die Pferde mit ihren Reitern im Schritt durch die Zuschauer und an den Kutschen vorbei. Der Lord hat die Kaiserin und Middleton an seine Seite geholt. Dicht hinter ihnen folgen die Kavaliere aus der Heimat, mit denen die Königin von Neapel reitet. Die Königin ist eine Kopie ihrer kaiserlichen Schwester. Sie trägt nicht nur das gleiche blaue Reitkleid mit Zobelbesatz, sie reitet auch ebenfalls einen Fuchs. Auch Marie von Neapel ist groß und schlank und hat die gleichen wunderbaren Haare. Die Augen der Königin sind sogar noch schöner als die ihrer Schwester, weil sie so überaus melancholisch blicken. Aber ihre Nase ist spitz, und um den Mund gibt es einen bitteren Zug – mit der majestätischen Anmut der Kaiserin kann sie nicht mithalten. Trotzdem: eine sehr schöne Frau. Sie plaudert mit Rudolf Liechtenstein, der sich über die Aufmerksamkeit freut. Prinz von und zu Liechtenstein ist ein entschlossener, sehr stattlicher Mann, der schon einige Falten in den Augenwinkeln hat. Böswillige Tratschen in Wien wollen Anzeichen für eine Liebschaft zwischen dem schönen Rudi und der Kaiserin ausgemacht haben.
Neckisch schlägt die Königin von Neapel mit ihren losen Handschuhen auf Liechtensteins Unterarm und beschwört abwechselnd ihn und Obersthofmarschall Graf Larisch von Moennich, der auf ihrer anderen Seite reitet, einen angemessenen Jagdrock in Pink für den blau uniformierten Baron Orczy aufzutreiben.
»Nicht dass die Hunde am Ende noch ihn jagen«, sagt sie, was aber niemand versteht, weil auch die Königin von Neapel mit geschlossenem Mund nuschelt.
Man reitet zu einem ausgedehnten Gehölz. Hier haben sich bereits Hunderte Zuschauer eingefunden, die sich in respektvoller Entfernung auf den kleinen Hügeln rundum verteilt haben. Zu Beginn sieht es nicht so aus, als ob es eine erfolgreiche Jagd wird. Die Hunde flitzen durch die Büsche von einer Seite zur anderen, ständig die Fährten wechselnd, ohne sich auf eine Witterung zu einigen, während die Reiter in Gruppen am Rand des Dickichts entlangstreifen. So geht es eine halbe Stunde, die Hunde lassen im Eifer bereits nach.
Immer mehr Reiter gesellen sich zu Spencer, Middleton und der Kaiserin, vorgeblich um den Lord nach seiner Einschätzung der Lage zu befragen oder vorzuschlagen, in ein anderes Covert zu wechseln. Aber dann starren sie die ganze Zeit bloß die Kaiserin an. Ein Vertreter der regionalen Presse mit flacher Mütze und braunem Freizeitanzug hat sich nur wenige Meter vor Elisabeth aufgebaut und notiert eifrig in ein kleines Buch. Elisabeth wird immer bleicher. Sie nimmt den Fächer, der stets in ihrem Sattel steckt und hält ihn sich vor das Gesicht, als wollte sie die Sonne abwehren.
Captain Middleton wendet sein Pferd, vergewissert sich, dass die Kaiserin es ihm nachmacht, und galoppiert mit ihr auf die talabwärts gelegene Seite. Hier brechen die Füchse zwar nur selten aus, aber dafür gibt es kaum andere Reiter. Fast im selben Moment, in dem er mit der Kaiserin dort anlangt, bellt ein Hund hysterisch auf, und ein Fuchs rennt aus dem Gehölz. Das typische middletonsche Glück. Sofort spritzt die ganze aufheulende Meute aus den Büschen. Middleton und die Kaiserin sind mittendrin. Hinter ihnen bricht die Hölle los. Alles will zu den Hunden aufschließen und galoppiert aus verschiedenen Richtungen kommend durcheinander. Die vielen Pferde sind sich gegenseitig im Weg. Es wird gerempelt, geflucht, am Zügel gerissen und gleichzeitig werden die Sporen in die Pferde gebohrt. Nasse Erdklumpen fliegen durch die Luft. Innerhalb weniger Sekunden ist das noble Gemälde zerstört, sind die hellen Hosen schlammbespritzt, die glänzenden Pferde voller Morast, die Jagdröcke gefleckt wie bei den Marienkäfern.
Währenddessen haben die Hunde über einige Gräben gesetzt und erreichen den ersten Oxer. Elisabeth beißt die leicht verfärbten Schneidezähne in die Unterlippe. Auf der Wiener Rennbahn hat sie das weite Springen aus schnellem Galopp geübt. Mr. Allen, ihr englischer Reitlehrer, hat behauptet, die Hindernisse dort würden den Natursprüngen in England ähneln. Aber so eine Hecke hat es auf der Freudenau nicht gegeben, und dann steht auch noch dieser Zaun davor. Hat sie jetzt endlich Angst?
Und wie!
Die Angst ist das Beste an einer Jagd.
Middleton hat versprochen, die Kaiserin nicht zu schonen, und er schont sie nicht. Ohne das Tempo zurückzunehmen, sucht er eine geeignete Stelle und überwindet Zaun und Hecke glatt. Er sieht sich um, ob sie das Hindernis heil übersteht. Das tut sie. Ihr Gesicht strahlt vor wilder Freude. Sie drängt wieder an seine Seite. Von den nachfolgenden Pferden brechen einige vor dem Zaun seitlich aus, zwei stürzen hinter der Hecke. Das dichte Feld beginnt, sich in die Länge zu ziehen. Middleton und die Kaiserin rasen über grünes Weideland. Immer geradeaus. Unter ihnen verwischt das Gras in der Geschwindigkeit. Zäune und Hecken tauchen auf und sind im selben Moment schon wieder vorbei. Weiter vorn rennen die gefleckten Hunde über eine kahle Wiese. Es gibt keine Straßen, die das Gelände zerteilen, keine Äcker, deren tiefe Erde die Pferde ermüden würde. Als die Industrialisierung zum Zusammenbruch der Landwirtschaft führte, ist hier mehr als die Hälfte des Bodens, auf dem einst Getreide stand, in Weideland umgewandelt worden und der Lohn der Landarbeiter auf drei Schilling gesunken. Ideale Bedingungen. Jetzt gibt es nur noch federnden Grasboden, die Pferde, den Fuchs, die kläffende Meute und die schönsten Hecken und Gräben.
Die Hunde stauen sich in einiger Entfernung vor einem Gatter, klettern hinüber oder zwängen sich hindurch. Middleton zügelt sein Pferd so grob, dass es das Maul aufreißt und den Kopf hin und her wirft. Die Kaiserin zupft am Zügel, öffnet und schließt ihre Finger, doch der Hals ihres Hunters scheint inzwischen aus Stahl zu bestehen. Nun schenkt er ihr endlich ein Ohr und ist vielleicht sogar bereit, Geschwindigkeit herauszunehmen. Aber das soll er gar nicht mehr. Die Hunde sind rechtzeitig durch das Gatter gekommen. Elisabeth zieht einfach an Middleton vorbei. Sie will schnell sein, uneinholbar, ihren finsteren Gedanken entkommen und den Gaffern, die der Meinung zu sein scheinen, durch die Heirat mit dem österreichischen Kaiser habe sie jedes Recht auf Privatsphäre verwirkt. Wenn sie galoppiert, lodert eine Glut in ihr. Ihr Gehirn arbeitet losgelöst von diesem glutgefüllten Körper, sucht den idealen Absprungspunkt. Sowie das Hindernis überwunden ist, sind Körper und Geist wieder eins und von tiefer Befriedigung erfüllt. Da kommt das Gatter. Middleton hat aufgeholt und springt gemeinsam mit ihr hinüber.
Fünfzehn Minuten lang galoppieren der Captain und die Kaiserin so dahin, nehmen die Hindernisse, wie sie kommen. Der Wind rauscht in ihren Ohren und treibt ihnen Tränen in die Augen. Drei Gatter, die eng hintereinanderstehen und schwer zu taxieren sind. Middleton fliegt hinüber, und die Kaiserin folgt ihm dicht, hält gerade soviel Abstand, dass sie ihn nicht bedrängt. Ihm ist jetzt klar, dass sie eine erstklassige Reiterin ist. Mehr als das. Noch nie ist Middleton einer Frau begegnet, die ihr Pferd so vollkommen beherrscht. Außer ihnen haben nur noch vier Reiter der Meute bis hierhin folgen können. Spencer ist natürlich dabei. Sein roter Bart weht ihm links über die Schulter. Er holt auf und galoppiert an Middletons Seite. Ein tiefer und weiter Graben klafft im Boden. Jetzt zieht auch Elisabeth vor und gleichzeitig springen alle drei hinüber. Allerdings hat die Kaiserin die Peitsche einsetzen müssen. Ihr Pferd scheint erschöpft zu sein.
Schon kommt der nächste Graben. Wieder saust die Peitsche durch die Luft. Das Pferd der Kaiserin springt trotzdem zu kurz. Mit ungeheurer Wucht schlägt es hinter dem Graben auf und rutscht noch einige Meter weiter. Seine Vorderbeine ziehen Furchen durch die Grasnarbe.
In der nächsten Sekunde ist Middleton neben der Kaiserin und hebt sie aus dem Sattel. Niemand hat gesehen, wie er sein Pferd anhielt. Niemand hat gesehen, wie er aus dem Sattel sprang. Er ist einfach da. Sachte stellt er die Kaiserin vor sich auf den Boden. Ihr Pferd rappelt sich auf. Zitternd und mit weit auseinandergestemmten Beinen bleibt es stehen. Der Sattel ist verrutscht und das obere Horn gebrochen. Der Fächer liegt zerfetzt im Gras. Das Pferd senkt den Kopf. Sein Atem faucht durch die weit aufgerissenen Nüstern.
»Bay«, schreit Spencer, kreidebleich unter seinem glutroten Bart und springt ebenfalls vom Pferd. »Bay, ist alles in Ordnung?«
»Ja«, ruft Middleton. Dann erst sieht er der Kaiserin ins Gesicht. Sein Arm liegt immer noch um ihre Taille. Winzig ist sie, diese Taille. Elisabeth hat ihren Zylinder verloren, scheint aber nicht verletzt. Sie keucht damenhaft, strahlt vor Begeisterung und denkt nicht daran, ob man ihre Zähne sehen kann.
»Bay? Ist das Ihr Name – Bay?«
Er entfernt seine Hand von ihrer Taille.
»Meine Freunde nennen mich so, Eure Majestät.«
»Ich danke Ihnen, Bay.«
Mit einer dunklen, sehnsüchtigen Weichheit sieht sie ihn an und legt ihre Hand auf seinen Arm.
»Schnell, heben Sie mich in den Sattel! Wir können die Hunde noch einholen.«
3Der Kaiser am Morgen
Der Kaiser beginnt seinen Tag in Finsternis. Er liegt in einem eisernen Bett, schaut in das undurchdringliche Dunkel und hört, wie es nebenan plätschert, hört, wie der Leibkammerdiener sich ankleidet, hustet, schneuzt. Ein Fenster klappt. Dann öffnet sich die Tür zum Dienstzimmer und der Leibkammerdiener steckt ein Licht in die Finsternis und tritt herein. Es ist exakt 3:30 Uhr.
»Leg’ mich zu Füßen Eurer Majestät, guten Morgen.«
»Guten Morgen. Na, Pachmaier, was haben wir denn heute für ein Wetter?«
»Kühl, Eure Majestät, recht kühl, und die Luft ist feucht.«
Der Kaiser schiebt die Decke zur Seite, schwingt die schlanken bloßen Beine über die Bettkante und steht ohne Zögern und Bedauern auf.
Um zu seinem Leibstuhl zu gelangen, muss Franz Joseph durch drei Zimmer gehen. Im zweiten kniet ein Diener auf dem Fußboden, schichtet Holzscheite und tut, als sähe er nicht, wie der Kaiser im Nachthemd an ihm vorbeischlappt. Das ist seine Order: den Kaiser auf seinem Weg zum Leibstuhl nicht bemerken! Ein Badezimmer gibt es nicht. Die Sisi will unbedingt eins haben. Ein eigenes Badezimmer! Wozu? Ist man ein Amphib? Die Sisi hat immer die seltsamsten Ideen.
Zurück in seinem Schlafzimmer, kniet sich Franz Joseph zur Morgenandacht. Er spricht mit dem Herrn, der ihn zum Herrscher über dieses große Reich eingesetzt hat, das nun ständig kleiner wird. Er bittet ihn um die Kraft und die Weisheit, das Reich nach dem himmlischen Willen regieren zu können. Er wirft einen Blick auf das Bild von Piloty, das seine Gattin als fünfzehnjährige Verlobte auf einem Pferd vor Schloss Possenhofen zeigt. Dann wird der Badewaschl hereingelassen. Es handelt sich um Seiner Majestät Ersten Bademeister, aber so nennt ihn niemand.
»Leg’ mich zu Füßen Eurer Majestät und wünsch’ einen guten Morgen.«
Schon am Abend zuvor ist der Badeteppich im Schlafzimmer ausgebreitet worden und nun kommt die Gummiwanne darauf. Dem Badewaschl fehlt die Disziplin des Kaisers. Für den Kaiser ist das Frühaufstehen militärische Selbstzucht und Ausdruck seiner Überlegenheit. Niemand – abgesehen von seinen nächsten Dienern – steht zu so früher Stunde auf wie er. Und das Tag um Tag, seit Jahren und Jahrzehnten. Die Regelmäßigkeit der Lebensweise ist – da er sich aus freiem Willen dafür entschieden hat – ebenso ein Zeichen seiner Überlegenheit. Der Badewaschl kann das nicht – dieses frühe Aufstehen. Deswegen bleibt er die ganze Nacht wach. Die Stunden nach Mitternacht sind am schlimmsten. Man ist ganz allein auf der Welt und darf nicht schlafen. Also geht er in eine Branntweinstube, da sind noch andere allein und mit ihnen kann man trinken. Wenn er das Schlafzimmer Seiner Majestät betritt, sind seine Haare derangiert, die Augen rot unterlaufen, und er riecht nach Schnaps.
Der Kammerdiener zieht dem Kaiser das Nachthemd über den Kopf. Der nackte Kaiser stellt sich in die Gummiwanne. Der Badewaschl strafft sich, taucht sein Schwämmchen in die Waschschüssel, die auf einem hölzernen, aufklappbaren Möbel steht und reibt den Kaiser mit lauwarmem Wasser ab. Dann massiert er den Körper Seiner Majestät von Kopf bis Fuß. Er schwankt ein wenig vor Müdigkeit, fast hätte er sich an dem nackten Kaiser festhalten müssen. Das wäre was gewesen. Der Kaiser hat es wohl gemerkt, aber er sagt nichts dazu. Stets ist er nachsichtig mit seinen Bediensteten, wie schlecht sie auch arbeiten. Außerdem erfüllt es ihn mit Befriedigung, wenn jemand das frühe Aufstehen nicht so gut wegstecken kann wie er.
Der Badewaschl duscht ihn noch einmal mit kaltem Wasser und rubbelt ihn dann mit einem Handtuch ab. Dann schleift er rückwärtsgehend die Wanne hinaus. Nun kleidet der Leibkammerdiener den Kaiser in ein Hemd aus einfachem Kattun und die schlichte Uniformhose eines Infanterieleutnants. Unterhosen tragen Männer seiner Generation nicht.
Anschließend erscheint der Friseur, der mehr mit dem prächtigen Backenbart als mit der rosigen Kahlheit auf dem Schädel des Kaiser zu tun haben wird. Zu dieser Zeit beginnt die Hofburg zu erwachen. Klappernde Hufe und rasselnde Räder, hurtige Schritte und scheppernde Eimer.
Der Kaiser wirft sich seinen Bonjour-Rock über, ein hechtgraues Kleidungsstück mit roten Paspeln, das das zackige Aussehen eines Generalmantels mit der windelweichen Bequemlichkeit eines Morgenrocks verbindet, und geht in sein tiefrot tapeziertes Arbeitszimmer mit den dicken, dunklen Teppichen. Auf dem Schreibtisch wartet bereits ein Berg von unerledigten Akten, Briefen und von ausgeschnittenen und auf Karton geklebten Auszügen in- und ausländischer Zeitungen. Zuoberst der Polizeibericht. Dem Polizeiminister ist es endlich gelungen, die unverschämte Brut, die zur Demonstration gegen die Kaiserin aufgerufen hat, vollständig in Gewahrsam zu bekommen. Auch die letzten beiden Unruhestifter sind gefasst. Es ist nicht mehr nur der Hofstaat, der sich über Elisabeths Desinteresse an jeder Art von gesellschaftlicher Teilhabe empört. Auch die einfachen Leute nehmen es ihr inzwischen übel, dass sie sich lieber mit Pferden amüsiert, als sich bei Grundsteinlegungen und Denkmalenthüllungen beklatschen zu lassen. Dabei würden sie sie so gern lieben, ihre schöne Kaiserin. Wie sie gejubelt haben, als sie das erste Mal in Wien einzog. Eine Kaiserin gehört dem Volk. Und wenn man das Volk zurückstößt, benimmt es sich wie ein beleidigter Liebhaber. Die Reise nach England hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Am Bahnhof wollte man sich zusammenrotten, die Kaiserin abpassen und beschimpfen, während sie den Hofzug bestieg. Die Flugblätter waren bereits gedruckt. Zum Glück hat der Geheimdienst rechtzeitig einen Hinweis bekommen und schon im Vorfeld großzügig Verhaftungen vornehmen lassen. Sonst ehrbare Kleinbürger sind darin verwickelt, ein Bäcker sogar und der Besitzer eines Tabakgeschäfts.
Franz Joseph seufzt und blickt auf das Bild, das gegenüber seinem Schreibtisch an der Wand hängt. Es ist sein Lieblingsbild von Sisi. Sie trägt darauf nur ein weißes Hemd und ihre langen Haare sind aufgelöst und vor der Brust verschlungen. Ein sehr privates, fast frivoles Bild.
Elisabeth ist die einzige Unvernunft, der einzige Rausch in seinem strengen und nüchternen Leben. Selbst seine Geliebten sind zahmer und langweiliger als sein angetrautes Weib. Er hat Elisabeth nichts von der Verschwörung berichtet. Es hätte sie nur aufgeregt. Staatspolitisch steht ihrem Englandaufenthalt schließlich nichts entgegen. Es ist immer noch besser, als wenn sie wieder nach Frankreich gereist wäre, diesem Anarchistennest, wo sie den schrecklichen Reitunfall gehabt hat, und er dann nicht einmal an ihr Krankenbett fahren durfte. Man ließ ihn nicht. Der Aufenthalt eines Kaisers hat immer auch eine diplomatische Bedeutung. In Berlin wären sie außer sich gewesen, wenn sie davon erfahren hätten. Gegen die Englandreise ist ja hingegen nichts einzuwenden. Franz Joseph hat nur zwei Bedingungen gestellt. Erstens: Langyi, ihr Arzt, soll sich immer in ihrer Nähe aufhalten. Ihm muss ein Wagen zur Verfügung stehen, in dem er jedesmal, wenn die Kaiserin auf die Jagd geht, die ganze Zeit herumzufahren hat, um im Falle eines Sturzes so schnell wie möglich an ihrer Seite zu sein. Zweitens begleitet Gestütsmeister Bayzand die Kaiserin bei jeder Jagd, damit er ihr sofort beistehen kann.
Der Kaiser überlegt, ob nicht eine Sonderzuwendung angebracht wäre für jene Agenten, die die Unruhestifter aus dem Verkehr gezogen haben. Aber das würde auch die Erinnerung an die heikle Angelegenheit in ihnen auffrischen. Es ist besser, nicht daran zu rühren.
Er schiebt den Polizeibericht auf die rechte Schreibtischseite, neben sein einfaches, fast primitives Tintenfass und wendet sich dem ersten schriftlichen Gesuch zu. Vier Wiener Wagenbauer beschweren sich, dass die Hofburg zwei neue Kutschen in Paris bestellt hat, statt auf Wiener Qualität zu vertrauen. Nach rechts damit. Das nächste Gesuch ist von Anna Heuduck. Ihr Name, der in krakeliger Schrift auf dem Kopf des Briefbogens steht, löst in ihm eine Mischung aus Rührung und Unwillen aus. Das kleine Annerl. Er muss sofort daran denken, wie sie sich das letzte Mal im Park geziert hat, als er ihr das Kleid aufhakte. Wie rot sie geworden ist. Und um die Bank herum der Nebel so dicht, dass es von den Zweigen tropfte. Anna erfüllt sein handfesteres Begehren, die überschaubaren Sehnsüchte eines vielbeschäftigten, phantasielosen Mannes. Aber es ist nicht gut, dass sie ihm schreibt. Was will sie? Immer wollen alle etwas von ihm. Meistens Geld. Der Brief ist wirr und stellte keine klaren Forderungen. Sie schreibt, sie will sich scheiden lassen. Großer Gott, ist sie denn nicht katholisch? Er weiß es nicht. Vielleicht ist sie gar nicht katholisch, dann wäre eine Scheidung sogar zu befürworten. Ihr Mann ist ein Trinker, der sein Geld verspielt. Wenn sie geschieden ist, kann man ihr eine Wohnung besorgen und sie müssen sich nicht mehr im Park treffen. Andererseits: Mit fünfzehn Jahren bereits an Scheidung denken – Geduld scheint nicht gerade ihre Stärke zu sein. Sie schreibt, dass ihr Affe gestorben ist. Das Annerl hat ein Haus voller Tiere – Hunde, einen Papagei, Fische und eben diesen Affen. Fast wie bei Sisi. Vielleicht sollte er ihr einfach den Makaken schicken, den Elisabeth für Valerie angeschafft hat. Das Biest ist sowieso nicht mehr tragbar. Es hat sich auf unschicklichste Weise vor den Hofdamen produziert. Wenn man noch länger wartet, wird der Affe womöglich die kleine Valerie schockieren. Erleichtert über diese gute Idee, schreibt Franz Joseph eine Notiz auf ein Blatt Papier, steckt Annas Brief mit der Adresse dazu und schiebt beides mit den Fingerspitzen an den Tischrand.
Um fünf serviert der Kammerdiener das Frühstück, das aus Kaffee, Butter und Milchwecken besteht. Der Schinken fehlt, da man sich in der Fastenzeit befindet. Danach klingelt der Kaiser nach seinem diensthabenden Flügeladjutanten. Adjutant Gemmingen sitzt zusammengesackt in einem Dienstzimmer vor den Kaiserlichen Appartements, die Hände vor sich auf dem Schreibtisch, die Stirn auf die Hände gelegt und die Augen geschlossen. Er sitzt hier bereits seit halb drei und befindet sich in einem watteartigen Dämmerzustand, der sich von echtem Schlaf nur wenig unterscheidet. Vor ihm auf dem Schreibtisch liegt eine Aktentasche. Jetzt schreckt der Flügeladjutant hoch, streicht mit beiden Händen seine Haare nach hinten, reißt die Aktentasche an sich und bringt seinem Kaiser die gestern Abend noch eingetroffenen Schreiben des Kriegsministeriums. Im Gegenzug nimmt er die bereits erledigten Papiere fürs Ministerium mit.
Kurz darauf erscheint Doktor Widerhofer beim Kaiser, behauptet, dass er sich Seiner Majestät zu Füßen lege, und wünscht einen guten Morgen. Er trägt bloß einen Gehrock, obwohl man den Kaiser in seinen Privatgemächern eigentlich nur im Frack besuchen darf, aber morgens sieht das der Kaiser nicht so eng. Der Kaiser ist überhaupt die Liebenswürdigkeit selber. Seine Anweisungen sind höfliche Bitten. Doch hinter jeder dieser Bitten steht die unerbittliche Macht höchster Befehlsgewalt. Man raucht gemeinsam Zigarre, billige Virginier, wie sie die Fiaker rauchen, spricht über das Wetter, die Verdauung des Kaisers – tadellos – und den neuesten Klatsch in Wien. Dann geht der Leibarzt, und Franz Joseph zieht den Staubwedel hinter dem großen Stehkalender auf seinem Schreibtisch hervor, wedelt die verlorene Zigarrenasche von seiner Arbeitsplatte und wendet sich wieder seinem Aktenstapel zu.
Dann kommt ein Telegramm. Es ist aus London, vom Botschafter. Beust ist desperat: Königin Victoria will Elisabeth nach Windsor Castle einladen, aber Botschafter Beust hat beträchtliche Schwierigkeiten, mit dem Obersthofmeister der Kaiserin einen Termin auszumachen. Nopcsa weigert sich, seine Kaiserin auch nur darüber zu informieren. Er hat offenbar den Befehl, jede Einladung – auch wenn sie von der englischen Königin kommt – ja, gerade, wenn sie von der englischen Königin kommt – abzulehnen und sie nicht damit zu behelligen. In den Augen von Queen Victoria gibt es nur eine Entschuldigung, nicht zu einem ihrer Dinner zu erscheinen: plötzlicher Tod. Franz Joseph sieht das ganz genauso. Gerade jetzt, da die Orientalische Frage beunruhigende Ausmaße angenommen hat, darf die Einigkeit mit England nicht strapaziert werden. Elisabeths Verhalten ist nicht tragbar. Er muss ein Machtwort sprechen und ihr den Besuch befehlen – auch wenn er sie damit gegen sich aufbringen wird.
4Die Sklavin der Haare
Middleton brennt natürlich darauf, die Kaiserin wieder pilotieren zu dürfen. Doch leider, leider sind die kommenden Tage schon verplant. Am nächsten Morgen reitet Elisabeth mit den Graftons aus, und Oberst Pennant ist bereits als ihr Pilot eingesetzt. Am Tag darauf übernimmt ein Oberst Hunt diese Aufgabe.
Um die Trennung nicht zu lang werden zu lassen, veranstaltet Elisabeth eine intime Dinnerparty auf Easton Neston, dem alten englischen Herrensitz, den sie für die Saison gemietet hat, nur die Kavaliere, ihre Schwester und ihr Schwager samt Hofstaat und natürlich Lord und Lady Spencer. Und Middleton.
Die Herren erscheinen in einfachen, aber eleganten Gesellschaftsanzügen. Sogar Baron Orczy. Er hat sich von der Königin von Neapel beraten und einkleiden lassen. Kein Mensch würde in England zu einem solchen Anlass in Uniform erscheinen. Elisabeth selber trägt ein eng anliegendes Kleid aus elfenbeinfarbenem Samt. Ihr einziger Schmuck sind eine Perlenkette und Kamelien im Haar. Natürlich ist sie auch hier der Mittelpunkt der Gesellschaft, sie ist schließlich die Gastgeberin. Und eine Schönheit. Und eine überragende Reiterin. Die Gespräche drehen sich überwiegend um Pferde und die letzten Jagden. Und um Pferde. Vielleicht spielt es auch eine ganz kleine Rolle, dass sie die Kaiserin von Österreich ist, aber niemand käme hier auf die Idee, zu warten, bis sie ihn anspricht. Stattdessen erzählt Oberst Hunt sogleich in die Runde, wie die Kaiserin am Morgen vom Pferd gestürzt ist.
»Ich wollte Ihrer Majestät meinen Goldfuchs empfehlen, ihr kennt ihn alle, ihr wisst, wie zuverlässig er ist. Ich habe ihn Ihrer Majestät für die Jagd zum Ausprobieren überlassen. Und was sage ich – der Goldene stürzt gleich beim ersten Sprung. Fällt über seine eigenen Beine wie der dümmste Ackergaul. Ihre Majestät wollte sofort wieder aufsitzen, aber das habe ich natürlich nicht zugelassen. Und was sagt da Ihre Majestät?«
Er sieht die Kaiserin auffordernd an, als wäre sie einer von seinen Kumpanen. Elisabeth lacht.
»Ich wollte den Goldfuchs trotzdem kaufen. Das Angebot gilt übrigens immer noch.«
»Oh nein, Ma’am«, ruft Oberst Hunt, »für ganz Österreich verkaufe ich Ihnen dieses dämliche Vieh nicht!«
So geht es den ganzen Abend. Captain Middleton soll erzählen, woher sein Spitzname »Bay« kommt, und behauptet, der Name käme von seinem Haar, das abends schimmern würde wie eine Bucht, eine Bay, bei Sonnenuntergang. »Uuuuuuuh«, machen die Kavaliere und Middleton lächelt versonnen in sich hinein. Spencer behauptet, Middletons Spitzname käme von einem besonders hässlichen Rennpferd, und erzählt, wie Bay einmal dem Cricket-As Sir Chandos Leigh die Frackschöße an den Boden genagelt hat.
»Der arme Kerl«, Spencer wischt sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln, »er hatte sich hingekniet, um sich einen Orden um den Hals hängen zu lassen, die Sache war ihm wirklich wichtig, und da schleicht sich Bay von hinten an und nagelt ihm die Frackschöße an den Boden.«
Sie wetteifern darin, ihre Streiche und Schandtaten vor der Kaiserin auszubreiten, wilde und manchmal fast geniale Streiche, ein wenig grausam auch und hin und wieder gewalttätig. Elisabeth ist entzückt. Selbst die österreich-ungarischen Kavaliere lachen, zuerst ein wenig besorgt, aber es dauert nicht lange, dann benehmen auch sie sich wie die Engländer. Brandy- und Rotweinflaschen werden so schnell geleert, wie sie aufgetragen werden.
»Können Sie sich vorstellen, dass am Wiener Hof das Protokoll sogar vorschreibt, welche Menge Wein von jedem Gast auf den Banketten getrunken werden darf«, sagt Elisabeth zu Middleton.
Spencer will sich ausschütten vor Lachen.
»Es muss furchtbar sein, so zu leben«, erwidert Middleton leise, »der vorgeschriebene Wein ist sicher nicht das Schlimmste.«
Elisabeth zuckt mit den Schultern.
»Als Kaiserin bin ich in eine Ebene aufgestiegen, wo mir das normale Menschsein nicht mehr möglich ist. Jedenfalls in Österreich. Darum ist mir die Zeit hier in England auch so kostbar.«
Prinz Ruffano, der zum Gefolge des Königs von Neapel gehört, entfernt sich unauffällig vom Tisch und geht zu dem Sofa, auf dem Marie Festetics, die Hofdame der Kaiserin, ein wenig abseits sitzt.
»Darf ich?«
Sie nickt. Er setzt sich neben sie.
»Sagen Sie mir bitte, wenn ich ihnen zu nahe trete, aber ich konnte nicht umhin zu bemerken, wie traurig Sie aussehen. Möchten Sie nicht mit zu uns an den Tisch kommen?«
»Oh, es ist nichts.« Sie wendet den Kopf zur Seite.
»Ja, ja, das englische Klima ist schon so, dass man traurig werden kann«, sagt der Prinz und seufzt.
»Das denke ich mir – Sie als Neapolitaner müssen unter dieser nassen Kälte ja noch mehr leiden als unsereiner.«
Am Tisch der Kaiserin wird in diesem Moment brüllend gelacht.
Don Gerardo 5. Principe Ruffano ist recht hübsch. Er hat ganz dunkle Locken und eine sanfte, unaufdringliche Art. Beinahe beiläufig erzählt er, dass er vor zwei Jahren seine junge Frau verloren hat. Er ist selbst noch jung, jedenfalls jung genug. Bestimmt keine vierzig Jahre alt. Die Hofdame Festetics ist voller Mitgefühl. Beide schweigen. Am Tisch der Kaiserin wird abermals gelacht.
»Vielleicht haben Sie nun ein wenig Vertrauen zu mir und mögen mir sagen, was Sie so bedrückt«, bittet der Prinz.
»Ach, es ist wirklich nichts. Im Vergleich mit Ihrem Leid ist es so ganz und gar lächerlich, und ich schäme mich, dass Sie mir deswegen einen Kummer ansehen konnten.«
Ruffano fragt nicht weiter, und da erzählt sie es ihm doch: dass in Wien ein gräuliches Buch herausgekommen ist, ein Schlüsselroman über Baron Leopold Edelsheim-Gyulai. Über seine Laster und seine Frauengeschichten. Geschrieben hat es eine, die von ihm verführt und verlassen wurde. ›Fata Morgana‹ heißt dieses ganz unqualifizierbare Buch, und es ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Dann aber sind in den Wiener Zeitungen lauter Schmähungen über die Verfasserin des Schandbuchs erschienen und dabei die Behauptung, dass es keine andere sein könnte, als die ungarische Hofdame Ihrer Majestät, die bekannte blonde kleine Gräfin M.F.
»Wie empörend«, sagt Prinz Ruffano.
Hofdame Festetics tupft sich mit einem Taschentuch am rechten Augenwinkel.
»Wirklich, man muss nach Wien kommen, damit einem so etwas zugemutet wird.«
»Ja, hat denn der Hof nichts dagegen unternommen?«
»Baron Braun – unser Kabinettchef – ließ in den Zeitungen energische Dementis erscheinen. Mit Nennung der wahren Verfasserin. Es ist Eleonora Bais, eine Hofdame der Herzogin Clementine. Die Bais ist ziemlich verrückt, das muss zu ihrer Entschuldigung gesagt werden. Doch so einen Schimpf wäscht ja nichts fort.«
»Oh, Sie Arme«, tröstet Prinz Ruffano. »Das ist wahrhaftig ein Grund, so geknickt zu sein. Ich kann aber gar nicht glauben, dass irgendjemand Ihnen so etwas zutraut.«
»Das ist nur, weil Sie den Wiener Hof nicht kennen. Es steckt eine Absicht dahinter. Jemand hat mit Absicht dieses Gerücht gestreut. Die Kaiserin hat viele Feinde. Und wer zu ihr hält, ist ebenfalls ein Ziel. Immer, wenn ich längere Zeit nicht am Hof gewesen bin, muss ich feststellen, dass wieder gegen mich gearbeitet worden ist.«
»Kommen Sie«, sagt Prinz Ruffano, reicht ihr die Hand und führt sie an den Tisch der Kaiserin, »hier sind Sie unter Freunden.«
Lord Spencer erzählt immer noch von Middletons Heldentaten:
»Sein Oberst hat nicht gerade geweint, als Bay seinen Dienst quittierte und mit mir ging. Bay hatte die anstrengende Gewohnheit, nach dem Lunch sein Jagdhorn zu blasen. Sie haben ihn sogar befördert, damit er endlich ginge und alle wieder ihren Mittagsschlaf halten konnten.«
Von nun an an folgt eine Jagd auf die andere. Und immer ist Middleton der Pilot der Kaiserin.
»Wird es nicht ein wenig viel, jeden Tag zu reiten, Eure Majestät?« bittet die Hofdame Festetics, »selbst die englischen Herren reiten höchstens viermal die Woche.«
»Ich bin nicht müde, Festi. Überhaupt nicht«, sagt die Kaiserin und trinkt im Stehen eine Kraftbrühe, während die Schneiderin ihr den Rock an das Oberteil ihres Reitkleides näht. Die Brühe wird täglich aus Rindfleisch, Huhn, Reh und Rebhuhn gekocht und so abgeseit, dass sie keinen einzigen Fetzen Fleisch enthält. Nur die klare Brühe.
»Ich war noch nie so frisch und wach, und ich habe nicht vor, auch nur einen einzigen Tag zu verpassen.«
Festetics muss zugeben, dass ihre Herrin schon lange nicht mehr so blühend aussah. Die Aufregung der Jagd und die Rücksichtslosigkeit, mit der Middleton der Kaiserin das Äußerste abverlangt und sie immer wieder in gefährliche Situationen bringt, scheinen ihr bestens zu bekommen. Kopf- und Rückenschmerzen, über die sie sich in Wien ständig beklagt hat, sind wie weggeblasen. Kein Hang zur Schwermut mehr, kein stundenlanges lautloses Weinen, keine Wutanfälle, keine Ohrfeigen für die Friseurin Feifalik. Auch die Menschenscheu hat nachgelassen.
»Sie können das nicht nachvollziehen, Gräfin«, sagt die Kaiserin, »weil Sie ja nicht mitreiten. In voller Pace über englisches Gras zu galoppieren, diese phantastischen Hindernisse zu springen – das Gelände in Gödöllő können Sie damit überhaupt nicht vergleichen.«
Sie lässt sich den Becher mit der Brühe abnehmen und winkt mit dem Finger nach einem Glas Wein. Die Kammerfrau Meissl reicht es ihr und sie stürzt es hinunter wie Medizin. Das Glas wird ein zweites Mal gefüllt.
»Finden Sie nicht auch, dass die Engländer den Ungarn in vielem ähnlich sind? So gute Reiter! Die Eleganz und die Ungezwungenheit. Ehrlich gesagt, graut mir schon vor dem Sonntag, wenn keine Jagden stattfinden dürfen.«
Das Telegramm aus Wien fällt wie ein Ziegelstein in Elisabeths gute Laune. Franz Joseph verlangt, dass sie die Einladung der englischen Königin sofort annimmt und der Besuch innerhalb von fünf Tagen zustande kommt. Elisabeth schickt nach ihrer Schwester Marie. Es ist morgens um sechs, aber die Ex-Königin von Neapel, deren Jagdsitz ganz in der Nähe liegt, schwingt sich sogleich auf ihr schnellstes Pferd und galoppiert los. Eine graue Dogge begleitet sie. In Towcester erregt sie ziemliches Aufsehen, da man sie für die Kaiserin hält, die eine ganz ähnliche Dogge mit nach England gebracht hat. Kurz darauf biegen Pferd, Hund und Ex-Königin in den Park von Easton Neston ein und noch etwas später rauscht Marie von Neapel mit gerafftem Reitkleid eines der bemerkenswertesten Treppenhäuser Englands hinauf. Sie selber hat Easton Neston als Jagdresidenz für Elisabeth empfohlen. Etwas so Exquisites hätte Sekretär Linger niemals ohne sie gefunden. Ein Miniaturpalast mit zurückhaltend eleganter Fassade, innen aber vollgestopft mit wertvollen Gemälden, Möbeln und Wandteppichen aus den letzten beiden Jahrhunderten. Der Park ist riesig und die Stallungen besonders schön – Pferde sind Sisi ja immer das Wichtigste. Und dann befindet man sich hier im Einzugsbereich von vier namhaften Meuten: Pytchley, Bicester, Grafton und Cottesmere.
Marie findet ihre Schwester wie erwartet im Ankleidezimmer. Zusammen mit der Königin trampelt auch die Dogge herein. Die Kaiserin sitzt an einem Tisch, der in die Mitte des Raumes gerückt und mit einem weißen Tuch bedeckt ist, und trägt einen ebenfalls weißen Frisiermantel. Darüber wallen an beiden Seiten ihre unglaublich langen und dichten Haare herab. Wenn man sie offen sieht, schimmern sie rotblond. Eigentlich schade, dass Elisabeth sich ihre Haare dunkel pomadieren lässt. Sie reichen bis auf den Boden und bilden rund um den Stuhl eine Art Pfütze. Neben der Haarpfütze liegt Elisabeths graue Dogge Morphy, ein Abziehbild von Maries Hund, sogar die beiden Halsbänder sind mit dem gleichen Muster bestickt. Erfreut fallen die Doggen übereinander her und verschwinden im bemerkenswerten Treppenhaus.
Hinter dem Sessel der Kaiserin steht die Coiffeuse in hellblauem Hofkleid, ein weißes Spitzenschürzchen umgebunden, und zelebriert das Ritual des täglichen Frisierens. Die Feifalik ist eine hübsche, aber etwas gewöhnlich aussehende Person. Mit wichtigtuerischem Gesicht und theatralischen Bewegungen tastet sie über die Haare, hebt dicke Strähnen wie eine Hexenmeisterin in die Höhe und wickelt sie sich um die Arme. Sie trägt dabei weiße Glacéhandschuhe, weil Elisabeth von der französischen Kaiserin Eugenie erfahren hat, dass deren Hoffriseur Leroi auch immer solche Handschuhe zu tragen pflegt.
»Du bist die Sklavin deiner Haare«, sagt Marie und küsst Elisabeth auf die Wange, »warum schneidest du nicht einfach mal einen Meter ab? Du kannst sie doch sowieso nur hochgesteckt tragen. Es würde niemandem auffallen.«
Elisabeth sieht ihre Schwester befremdet an. Ihre Haare sind die dritte große Leidenschaft im Leben der Kaiserin: Pferde, ihre jüngste Tochter Valerie und die enorm langen Haare. Mit Märtyrermiene zeigt Elisabeth auf den Tisch, auf dem das Telegramm liegt. Marie lässt es sich von einer Kammerzofe reichen, fällt in einen Rokokosessel und liest. Als sie wieder hochschaut, lächelt sie breit. Das Schicksal arbeitet ihr zu.
»Ich weiß nicht, was Victoria will«, bricht es aus Elisabeth heraus, »in London wollte ich ihr ja bereits meinen Besuch machen. Damit ich es hinter mir habe und sie mich nicht mehr bei der Jagd stören kann. Und da hieß es, sie kann mich nicht empfangen, sie ist zu beschäftigt. Das hat sie doch absichtlich gemacht. Um mich zu quälen. Um mir alles zu verderben. Wenn ich so ungezogen wäre! Und jetzt will Franz mich zwingen.«
Die Feifalik setzt einen Ausdruck äußerster Konzentration auf, nimmt einen Kamm aus goldgelbem Bernstein und teilt einen Haarstrang in mehrere Strähnen. Jede dieser Strähnen trennt sie in unzählige Fäden, zieht sie mit Kamm und Fingern behutsam auseinander und legt sie über die kaiserlichen Schultern, wo sie im Morgenlicht golden glänzen.
»Ach Sisi«, sagt ihre Schwester, »die Ablehnung in London ist doch bloß die Rache für letztes Jahr gewesen, für deine beiden Refüs auf ihre Dinnereinladungen. Aber jetzt will Victoria sich mit dir versöhnen. Sie hat nicht die entfernteste Ahnung, was eine Reitjagd für dich bedeutet. Du musst hinfahren, sonst gibt es riesigen Ärger, und die Botschafter beschäftigen sich mit gar nichts anderem mehr.«
»Ich weiß«, schreit Elisabeth mit Tränen in den Augen, reißt der Feifalik den Kamm aus der Hand und schleudert ihn auf den Boden. Die Feifalik erstarrt. Es sind Haare im Kamm hängen geblieben.
»Besuche Victoria doch einfach am Sonntag«, sagt Marie, »da darf man hier doch sowieso nicht jagen.«