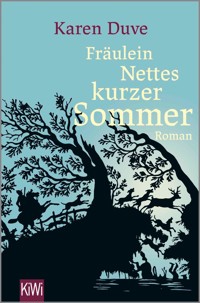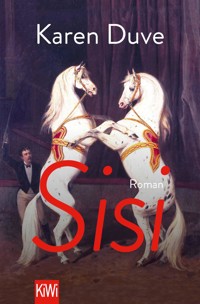9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karen Duves erfolgreicher Debütroman. Als der Hamburger Schriftsteller Leon sein Traumhaus am Rande eines ostdeutschen Moores findet, scheint alles bereit für eine glückliche Idylle. Aber das Moor und der Morast menschlicher Beziehungen sind tückisch. So, wie die Schneckenplage und der unablässige Regen die Grundmauern des Hauses angreifen, so durchdringen Gleichgültigkeit und Kälte Leon und seine Ehe. Ein zugelaufener Hund und die erotischen Verwirrungen um die herbe Kay und ihre nimmersatte, fette Schwester Isadora beschleunigen den Zerfall …Karen Duves erster Roman ist wie das Moor, in dem er spielt: erbarmungslos und wunderschön, doppelbödig, unberechenbar und voller schillernder Details.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Karen Duve
Regenroman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Karen Duve
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Karen Duve
Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Sie wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane Regenroman (1999), Dies ist kein Liebeslied (2005), Die entführte Prinzessin (2005), Taxi (2008) und Macht (2016) wurden in 14 Sprachen übersetzt. 2011 erschien ihr Selbstversuch Anständig essen, 2014 die Streitschrift Warum die Sache schiefgeht, 2018 der Roman Fräulein Nettes kurzer Sommer.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als der Hamburger Schriftsteller Leon sein Traumhaus am Rande eines ostdeutschen Moores findet, scheint alles bereit für eine glückliche Idylle. Aber das Moor und der Morast menschlicher Beziehungen sind tückisch. So wie die Schneckenplage und der unablässige Regen die Grundmauern des Hauses angreifen, so durchdringen Gleichgültigkeit und Kälte Leon und seine Ehe. Ein zugelaufener Hund und die erotischen Verwirrungen um die herbe Kay und ihre nimmersatte, fette Schwester Isadora beschleunigen den Zerfall …
»Mit unzähligen literaturhistorischen Anspielungen und einer ironisch immer wieder herbeizitierten romantischen Todessehnsucht hat Duve ein brillantes, mitleidloses Untergangsepos des 20. Jahrhunderts geschrieben.«
FAZ
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2015, 2018 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Christina Hucke
ISBN978-3-462-31554-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
»Denn wisse wohl: Ich will die Sintflut über die Erde kommen lassen, um alle Geschöpfe, die Lebensgeist in sich haben, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen; alles, was auf der Erde lebt, soll umkommen.«
1. Mose 6,17
»Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt bloß falsche Kleidung.«
Englisches Sprichwort
»Das Böse gedeiht an feuchten Stellen.«
Schwester Mary Olivia
1
Starke Bewölkung und vereinzelte, zum Teil heftige Schauer, Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Wind aus Nord-West, abnehmend 2 bis 3.
»Was sagst du? Was …?«
Die dünne junge Frau sah angestrengt die Böschung hinunter und lauschte. Sie stand allein auf dem öden Parkplatz einer Landstraße, allein mit einem schwarzen 300er-Mercedes, einer überquellenden Mülltonne und einem zugenagelten Wohnwagen ohne Räder, auf dessen Dach ein Holzschild mit der Aufschrift IMBISS befestigt war. Die dünne junge Frau hieß Martina Ulbricht. Sie hatte vor wenigen Wochen geheiratet, und ihr Mann, Leon Ulbricht, mit dem sie unterwegs war, um ein Haus zu besichtigen und eventuell zu kaufen, war vor einer Viertelstunde im Gebüsch verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Sie hatte im Auto gewartet, weil es stark regnete. Aber dann hatte sie sich Sorgen gemacht, und als der Regen etwas nachließ, war sie ausgestiegen. Es war kalt. Für Ende Mai war es sogar entschieden zu kalt. Martina trug bloß einen kurzen gelben Wildlederrock (einen von der Sorte, die mit einer Druckknopfleiste zusammengehalten wird), dünne Nylonstrumpfhosen und ein viel zu großes lappiges grünes Sweatshirt.
FIT FOR LIFE
stand auf der Rückseite des Sweatshirts. Schon nach einer Minute klebten Martina die kinnlangen roten Haare im Gesicht. Aus dem kalligrafischen Schnörkel, den eine Strähne auf ihrer Stirn beschrieb, leckte Wasser auf ihren Mund herunter. Sie hatte einen großen Mund – Zähne wie Würfelzucker, die Lippen in den Winkeln wund und ein bisschen ausgefranst. Er gab ihrem Gesicht einen beängstigenden Zug ins Raubtierhafte. Aber über diesem Mund saß eine ganz gerade und durchschnittlich große Nase. Und die Augen lagen so nackt und verschreckt in ihren Höhlen, als wären diese nicht ihr angestammter Platz, sondern nur ein vorläufiger Zufluchtsort, und es könnte jederzeit der rechtmäßige Besitzer kommen, Ansprüche geltend machen und sie wie zwei Murmeln in die Tasche stecken. Alle Details ihrer Physiognomie zusammengenommen erweckten einen derart vorteilhaften Eindruck, dass, wo immer Martina erschien, die Männer sich strafften wie Vorstehhunde, die Witterung aufnehmen, während die Frauen bei ihrem Anblick zusammensackten wie missratene Kuchen.
Der Regen fiel jetzt leise und gleichmäßig und verteilte sich auf dem glatten Belag, ohne Pfützen zu bilden. Der Parkplatz war erst vor Kurzem geteert worden. Als Martina zu der Stelle ging, wo Leon mit einer Packung Tempotaschentüchern in der Faust verschwunden war, knirschte Rollsplitt unter ihren Schuhen. Hinter einer kniehohen Abzäunung aus einfachen Holzbalken führte ein Trampelpfad abwärts. Er war so schmal und überwuchert, dass man nicht erkennen konnte, ob er schon nach wenigen Metern endete oder ob er die steile Böschung hinunter bis zu dem Fluss reichte, der die Landstraße seit einigen Kilometern begleitete. Martina rief nach Leon. Aus unerwartet großer Entfernung kam eine Antwort, die so ähnlich wie »Komm runter« klang.
»Was sagst du? Was …?«
Er rief noch einmal etwas, aber im selben Moment ratterte auf der anderen Seite des Flusses ein Zug vorbei, und Martina verstand wieder nichts. Unschlüssig schabte sie mit einer nylonbestrumpften Wade über die andere und stellte ein bisschen Reibungswärme her. War es ein Fehler, den Mercedes unbewacht zurückzulassen? Er stand offen; den Schlüssel hatte Leon eingesteckt. Martina lief ein paar knirschende Schritte auf die Kurve zu, in der die Landstraße auf den Parkplatz abzweigte, und reckte den Hals, ob nicht gerade ein Auto mit einem möglichen Dieb darin einbog. Ein weißer Kleinbus näherte sich – hektische Scheibenwischer, Gardinen vor den Seitenfenstern – und rauschte Fontänen spritzend vorbei. Dann war es wieder still bis auf den Regen und das Klopfen des Eisenbahnzugs in der Ferne. Martina ging zur Böschung zurück und machte sich an den Abstieg. Der Weg war so zugewachsen, dass sie unter einem Dach aus triefendem Laub und zwischen Wänden aus Brennnesseln, Holunder und riesigen rhabarberähnlichen Blättern ging. Ein Tunnel, eine grüne Röhre. Tropfen raschelten in den Blättern. Fette, kalte Pflanzenstängel streiften ihre Hände. Es roch nach Schlamm, verfaultem Holz und Pilzen. In dem breiweichen Lehmboden hatte sich das Profil von Leons Stiefeln erhalten wie das geriffelte Fossil eines Gliederfüßlers aus dem Paläozoikum. Martina fasste rechts und links in die Büsche, hielt sich an den Zweigen der kleinen Birken fest, damit ihre flachen gelben Wildlederschuhe beim Auftreten möglichst wenig einsanken. Aber ihre Sohlen waren glatt, und sie hatte kaum zehn Schritte auf dem steilen Abhang zurückgelegt, da rutschte sie auch schon aus. Sie fiel in weiches, altes Laub und glitschigen Lehm, landete auf dem Rücken, die Beine idiotisch verdreht, den Rock bis über die Hüften hochgeschoben, zwischen Fanta-Dosen, grauen Papierklumpen, leeren Haribo-Tüten und halb verwesten Kothaufen. Einen Moment blieb sie betäubt liegen, biss sich auf die Unterlippe und betrachtete den Zweig, den sie mit der rechten Hand umklammert hielt. Als sie ihn losließ, schnellte er zurück, und ein Trommelfeuer schwerer Wassertropfen prasselte auf sie herunter. Martina rappelte sich hoch, zog den Rock zurecht und begutachtete den Schaden. Das Sweatshirt klebte ihr wie eine Fangopackung auf dem Rücken, ihre linke Seite war von oben bis unten verschmiert: ihr Arm, der Rock, die Strumpfhose – alles! Der linke Schuh war vermutlich ruiniert. Er hatte sich regelrecht in den Boden hineingebohrt und sah jetzt aus, als hätte sie ihn als Förmchen benutzt, um Schlammkuchen zu backen.
»Verdammte Scheiße«, murmelte Martina und wischte die linke Hand an einem weißen Baumstamm ab, dessen unteres Ende mit Pilzen in Farbe und Form von Kinderohren bewachsen war.
Weniger vorsichtig, und ohne sich noch an irgendwelche Pflanzen zu klammern, ging sie weiter. Als der Weg nicht mehr steil bergab führte, sondern eben wurde, endete auch das Dickicht. Danach waren es nur noch ein paar Meter über Sand und Steine bis zu dem Fluss. Breit und glanzlos schleppte er sich unter dem Regenhimmel dahin, und seine Oberfläche krausten unzählige, sich zitternd von ihren Mitten entfernende Ringe. Am Ufer, fast im Wasser, stand Leon. Er trug klobige schwarze Stiefel mit Metallringen an den Seiten, eine schwarze Jeans und einen schwarzen Anorak, dessen Kapuze er unter dem Kinn fest zugeschnürt hatte. Er wirkte vor der Landschaft wie ein Tintenfleck auf einem Foto. Leon hielt einen abgebrochenen Ast in der Hand und betrachtete etwas, das vor ihm im Fluss lag. Überrascht wandte er sich zu Martina um. Über sein rundes Gesicht und die runden Brillengläser, die darin steckten, rannen Tropfen. Er war achtunddreißig Jahre alt. Martina war vierundzwanzig.
»Ich habe doch gerufen, dass du nicht herunterkommen sollst. Wieso bist du jetzt trotzdem hier?«, sagte er.
»Ich habe ewig auf dich gewartet. Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht?«
Martina wischte sich mit dem Handrücken eine Haarsträhne aus dem Gesicht und hinterließ einen braunen Streifen auf ihrer Stirn. Sie sah an Leon vorbei, sah in das Wasser hinter ihm, ins Schilf, dorthin, wo monströs und ekelhaft ein großes, weißes, weiches Etwas lag.
»Was ist das?«
Leon wendete den Kopf, als müsste er sich vergewissern, was sie meinte, und antwortete nicht. Das war auch nicht nötig. Martina sah selber sehr gut, was da ins Schilf geschwemmt war: eine nackte Frau.
»Ist sie tot? Sie ist tot, nicht? O mein Gott, da liegt eine Leiche. Was machen wir denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen?«
»Sieh dir das nicht an«, sagte Leon, »besser, du gehst jetzt wieder zurück: Ich komme auch gleich nach.« Dann fragte er plötzlich: »Bist du hingefallen? Du bist ja ganz dreckig. Hast du dir wehgetan?«
Martina trat einen Schritt zurück, sah ihn an, sah auf die Wasserleiche runter, sah wieder ihn an.
»Was willst du mit dem Stock in der Hand?«, fragte sie leicht hysterisch. »Wozu brauchst du einen Stock? Sie ist tot, nicht?«
Leon ließ den langen Ast, mit dem er sich nervös gegen seine Stiefel geklopft hatte, fallen, schnürte seine Kapuze auf und schob sie sich vom Kopf. Er hatte kurze braune Haare – vorn weniger als hinten –, die an den Seiten bereits grau durchsetzt waren. Er legte einen Arm um Martinas Schultern und küsste sie auf die Schläfe, wofür er sich etwas recken musste.
»Komm schon. Du bist ja völlig durchnässt. Ich möchte nicht, dass du das siehst. Ich bringe dich jetzt zum Wagen, und wir fahren weg.«
Seine Stimme sollte fürsorglich klingen, aber sie klang bloß heiser. Seine Lippen fühlten sich so nasskalt an, als hätte er selbst einige Zeit im Fluss zugebracht. Martina starrte weiter auf die Leiche. Die tote Haut war bleich und aufgequollen, besonders dort, wo sie zuvor am härtesten gewesen war: an den Fußsohlen, den Händen, an den Knien und Ellbogen. Das Fleisch sah mürbe aus – als ob man es mit bloßen Händen reißen könnte. Martina fragte sich, ob die Frau jung gewesen war, als sie starb. Wahrscheinlich war sie jung. Wahrscheinlich war sie gut aussehend gewesen, bevor sie sich in einen Haufen Glibber verwandelt hatte. Sie besaß unerhört lange Haare. Schwarze Haare. Pechschwarze Haare, die ihr einmal bis auf die Hüften gefallen sein mussten. Jetzt wiegten sie sich in der trägen Strömung. Die Leiche lag auf dem Rücken. Sie sah zu Martina hoch – falls man von Sehen überhaupt sprechen konnte. Die Augäpfel fehlten. Zuerst dachte Martina, dass bloß die Lider geschlossen wären, denn die Augenhöhlen waren nicht rot und blutig, sondern genauso weiß wie der ganze übrige Leib. Er sah so weich aus, dieser Leib, so verletzlich. Im Schamhaar wuchsen feine grüne Algenfäden.
Von den Hüften abwärts lag die Frau im Schilf. Die Füße im Schilf. Die Zehen waren rundum benagt. Zwischen den Hautfetzen ragten einzelne Knöchel hervor. Martina wurde übel. Und gleichzeitig musste sie plötzlich an ihre alte Handarbeitslehrerin denken und an die Spitzendeckchen, die sie in der dritten Klasse der Grundschule mit einer Nagelschere aus weißem Papier geschnitten hatte. Erst faltete man das Papier ein paarmal, dann schnitt man Zacken und Halbkreise aus dem Rand. Und wenn man das Papier auseinanderfaltete, hatte man eine Spitzendecke mit durchbrochenem Rand. Jedenfalls war das bei allen anderen Schülern so gewesen. Wenn Martina ihre Spitzendecken auseinanderfaltete, dann hatten diese in der Mitte ein großes Loch, oder sie fielen in zwei Teile.
»Nun, Martina, was werden wir als Nächstes falsch machen?«, hatte Frau Weber gefragt.
»Sag mal, hast du den Wagen da oben einfach so offen stehen gelassen?«, riss Leons Stimme sie wieder in die Gegenwart. »Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Bist du völlig bescheuert?«
Er wirbelte herum, rannte über den Uferstreifen, dass der Sand nur so aufspritzte, und stürzte die Böschung hinauf. Martina lief hinterher. Als sie oben auf dem Parkplatz ankam, umkreiste Leon bereits den Mercedes, der genauso dastand, wie sie ihn verlassen hatte. Der Regen klopfte in erhöhter Frequenz auf das schwarze Dach. Martina öffnete die Beifahrertür, aber Leon drängte sich zwischen sie und den Wagen und schlug die Tür wieder zu.
»Willst du mir die ganzen Polster eindrecken?«
Er machte die hintere Tür auf und begann, auf dem Rücksitz zu wühlen. Äpfel, sein Fotoapparat, eine Tüte mit drei Pfund Spargel, die sie am Straßenrand gekauft hatten und aus der Erde rieselte, als er sie anhob; ein Netz mickriger Apfelsinen, der Atlas, ein seidenes Halstuch mit Schmetterlingsaufdruck, die Abfalltüte, aus der es weihnachtlich nach Apfelsinenschalen roch, sein Notizbuch und ein Buch mit dem Titel DU KANNST MICH EINFACH NICHT VERSTEHEN. Es gehörte Martina. Seit Leon mit ihr zusammen war, stieß er ständig auf solche Bücher, mit denen sie das Rätsel Mann auszuloten versuchte. Er hatte schon mehrere Anläufe gestartet, ihr richtige Bücher schmackhaft zu machen, hatte ihr abends im Bett vorgelesen, ihr welche geschenkt und darauf geachtet, sie nicht gleich zu Anfang zu überfordern, hatte versprochen, ihr den Rücken zu massieren, wenn sie wenigstens DAS PARFÜM zu Ende lesen würde. Umsonst. Wann immer er sie mit einem Buch in der Hand antraf, war es ein Ratgeber für Frauen.
Unter DU KANNST MICH EINFACH NICHT VERSTEHEN lag eine Wochenzeitung, die Leon noch nicht gelesen hatte. Er entschied sich für den Reiseteil und breitete ihn auf dem Beifahrersitz aus.
»Wie für einen Hund«, sagte Martina, während sie auf dem Reiseteil Platz nahm, und fügte hinzu:
»Wir müssen die Polizei anrufen.«
Leon wollte nicht, denn sie waren einen weiten Weg gefahren, um dieses Haus zu besichtigen, und jetzt hatten sie es beinahe erreicht. Er hatte keine Lust, sich von der Polizei aufhalten zu lassen.
»Sie ist schon tot, verstehst du? Die hat es nicht mehr eilig. Morgen findet sie jemand, der scharf darauf ist, sich wichtigzumachen, und der mit Begeisterung stundenlang Fragebögen ausfüllt. Warum willst du ihm die Freude verderben?«
Er startete das Auto. Der Scheibenwischer schwappte Wasser zur Seite.
»Aber wir müssen die Polizei anrufen«, wiederholte Martina und knisterte auf dem Zeitungspapier. »Wir müssen einfach. Wenigstens anonym.«
Zehn Minuten später hielt der schwarze Mercedes in einem Ort, der Freyenow hieß und so still und leer wie nach einer Atomkatastrophe dalag. Leon ging in eine Telefonzelle und stieß seinen Zeigefinger dreimal knapp oberhalb der Eins auf das Blech der Tastatur.
»Ja, eine Leiche«, sagte er mit deutlichen Lippenbewegungen zu dem knisternden Telefonhörer und sah durch das Glas seiner Brille, die Glasscheibe der Telefonzelle und durch die Seitenscheibe des Mercedes, die alle zunehmend beschlugen, Martina an. Martina klappte die Sonnenblende herunter und wischte ihr Gesicht vor dem Schminkspiegel mit einem Taschentuch sauber, beobachtete ihn aber gleichzeitig aus den Augenwinkeln. Als Leon wieder in den Wagen stieg, kniff er sie freundlich in die Wange.
»Na? Zufrieden?«
Sie nickte.
»Wenn wir nicht angerufen hätten, hätte ich wahrscheinlich jede Nacht von der Frau geträumt.«
Leon nahm ein Ledertuch aus dem Handschuhfach und wischte erst seine Brille trocken und dann die Fahrerseite der Windschutzscheibe frei. Er drückte das Leder Martina in die Hand, drehte den Zündschlüssel um und stellte das Gebläse auf volle Leistung. Das Auto sprang wie immer an, die Gebläsedüsen röhrten, aber das Wischerblatt rührte sich nicht. Leon probierte die verschiedenen Geschwindigkeitsstufen durch, schaltete den Scheibenwischer aus und wieder ein.
»Geht er nicht?«, fragte Martina.
»Das siehst du doch!«
Auf den Fenstern zogen die Regentropfen Schlieren hinter sich her, flossen zitternd ineinander und rollten schwer geworden abwärts. Leon kannte sich mit Autos nicht aus. Er hielt sich für einen mehr als guten Fahrer, aber er verstand überhaupt nichts von Reparaturen. In seinem ganzen Leben hatte er noch nie einen Ölwechsel gemacht oder auch nur einen Reifen montiert. Für jede Kleinigkeit brachte er sein Auto in eine Werkstatt. Er erinnerte sich, kurz hinter dem Ortsschild von Freyenow eine grau-violette Tankstelle gesehen zu haben. Also wendete er und fuhr zurück.
An der Kasse der Tankstelle saß ein dünner, siebzehnjähriger Junge mit Ohrring und kurzen blonden Stoppelhaaren, die nur im Nacken lang herunterhingen. Er blätterte in einer Motorradzeitschrift und sah nicht auf, als Leon hereinkam. Leon räusperte sich und nahm die Brille ab, die schon wieder beschlug. Er entschied sich, den Jungen zu duzen.
»Kannst du mal nach meinem Wagen sehen? Der Scheibenwischer tut’s nicht mehr.«
Der jugendliche Tankwart hob den Kopf. Sein schwarzes Heavy-Metal-T-Shirt war mit einem Totenkopf und äxteschwingenden Barbarenweibern bedruckt. Er betrachtete den vor Nässe dampfenden Mann, der vor dem Tresen wartete und seine Brille mit den Daumen putzte, und er brauchte nur eine Sekunde, um zu wissen, dass er diesen Typen verachtete. Schon wie der da stand.
»Haben Sie die Sicherungen nachgesehen?«
»Die Sicherungen?«
Der Junge legte eine Folie auf den Tisch, in die längliche blaue, rote und gelbe Plastikstücke eingeschweißt waren.
»Wechseln Sie erst mal die Sicherung. Meistens liegt es daran.«
Er beugte sich wieder über sein Heft.
Leon holte tief Luft und setzte ein gequältes Grinsen auf.
»Kannst du das für mich tun? Ich kenne mich damit nicht aus.«
Der Junge lehnte sich zurück.
»Nein, ich kann hier nicht weg«, sagte er mit ruhiger Schadenfreude. »Ich bin ganz allein im Laden. Sie werden doch wohl noch eine Sicherung wechseln können?«
In diesem Moment kam Martina herein und stellte sich verlegen hinter Leon.
»Wo kann ich mir denn hier die Hände waschen?«, murmelte sie.
Der Junge sprang auf und schlug seine Zeitschrift zu. Er nahm einen Schlüssel vom Haken, der mit einer Schnur an einem großen, ausgehöhlten Markknochen befestigt war.
»Hier. Bitte schön«, sagte er. »Die Toilette ist links bei der Waschanlage. Oder warten Sie – ich zeige Ihnen, wo es ist.«
Er hielt ihr die Tür auf.
»Sieht ja echt übel aus«, sagte er. »Sind Sie hingefallen? Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen mein T-Shirt.«
Der Junge lachte, er schwitzte, er suchte verzweifelt in seinem Kopf nach irgendetwas Witzigem, das er noch sagen konnte. Er streifte Leon nicht einmal mit einem Blick.
Für einen schwachen, jämmerlichen Augenblick wünschte Leon sich, er wäre eine Frau, er wäre eine langbeinige Blondine mit rot lackierten Vampirkrallen, von der niemand erwartete, dass sie Sicherungen wechseln konnte oder allein den Weg zur Toilette fand. Dann zog er seine Brieftasche aus der Jacke, und als der halbwüchsige Tankwart zurückkam und sich wieder vor seine Zeitschrift setzen wollte, legte Leon einen Fünfzigmarkschein auf den Tresen.
»Okay, fahren Sie Ihr Auto zur Garage! Ich schließe nur eben zu.«
Der Junge brauchte vier Minuten, um die Sicherung auszutauschen. Er arbeitete demonstrativ lässig und starrte Martina, die auf dem Beifahrersitz saß, auf die langen, inzwischen wieder sauberen Beine, ohne sich um Leons Anwesenheit zu kümmern. Dann wischte er seine Hände an einem Lappen ab, der viel schmutziger als seine Hände war. Er legte in diesen Vorgang die ganze Bitterkeit, die er darüber empfand, dass jemand, der nicht in der Lage war, eine Sicherung zu wechseln, einen 300er-Mercedes fahren konnte, während er, der alles über Autos wusste, noch nicht einmal den Führerschein machen durfte.
»Das war’s«, sagte er und baute sich mit dem Lappen über der Schulter vor Leon auf. »Ich hoffe, Sie haben mitgekriegt, wie man’s macht, und können es das nächste Mal selbst.«
Leon bückte sich in den Wagen, schaltete den Scheibenwischer an, der – flapp … flapp – zwei Schläge tat, und schaltete ihn wieder aus. Dann richtete er sich langsam auf und packte den schlaksigen und nur wenig größeren Jungen ruhig am Kragen.
»Hör zu«, sagte er so leise, dass es fast ein Flüstern war, und zog ihn zu sich heran. »Ich muss solche Dinge nicht können. Ich nicht. Ich werde meinen Kopf nicht mit Proletenwissen vollstopfen, nur weil du das sagst. Ich glaube nämlich an die arbeitsteilige Gesellschaft; und für Autoreparaturen gibt es Leute wie dich, Tausende von Leuten wie dich – alle mit einem Ohrring und Stoppelhaarschnitt mit Nackenspoiler. Und es gibt Leute wie mich, die Leute wie dich bezahlen, damit sie ihnen die Autos reparieren und dabei die Schnauze halten – ist das klar?«
»Ist ja gut, Mann! Ist ja gut.«
Leon ließ den Tankwart wieder los, stieg in seinen Mercedes und setzte rückwärts aus der Garage, ohne ihn noch einmal anzusehen. Martina kicherte anerkennend und küsste Leon auf die Wange. Er legte ihr seinen Arm um die Schultern. Geld zu haben machte vieles wieder wett.
Leon Ulbricht konnte sich noch sehr genau daran erinnern, wie es war, kein Geld zu haben, denn er war diesem Zustand gerade erst entkommen. Er war Schriftsteller. Er schrieb Kurzgeschichten über enttäuschte Männer, die ihm ähnelten, und Gedichte, die sich nicht reimten und nicht gut verkauften.
»Ich hasse Gedichte, die sich reimen«, sagte Leon, »ich frag mich, was das soll.«
Er wohnte in Hamburg, bis vor Kurzem in einer muffigen Wohnung im dritten Stock eines vernachlässigten Altbaus ohne Stuck und Schnörkel. Er hatte sie mit einem Schlachtergesellen geteilt, mit dem er weiter nichts gemein hatte, als dass sie die einzigen Westeuropäer unter den Mietern dieses Hauses waren. Der Schlachter war zuerst da gewesen und bewohnte das größere und bessere Zimmer, das nach hinten auf den Hof hinaus lag. Leons Zimmer lag auf der Straßenseite, gegenüber war der Schlachthof. Von seinem Fenster aus konnte Leon einen Teil des Geländes überblicken. Wenn er die Nacht durchgearbeitet hatte, sah er dort die Lastwagen ankommen, an deren Lüftungsschlitzen sich Tiernasen drängten, manchmal meterlange Doppeldecker voller Schweine. Sie kamen frühmorgens, wenn es in der Stadt am ruhigsten war, seifenrosa Schweine mit absurd langen Körpern und obszönen Hinterteilen, deren Schwänze abgebissen waren. Einmal hatte er gesehen, wie eines entwischt und stolpernd über das Gelände geirrt war, bis blutbespritzte Männer es wieder eingefangen und an den Ohren zurückgezerrt hatten. Wenn er das Fenster zum Lüften öffnete und der Wind ungünstig stand, roch er Blut und Tod – besonders im Sommer.
An so einem Sommerabend im letzten Jahr war plötzlich Harry bei ihm aufgetaucht. Harry Klammt war Leons einziger und bester Freund. Dass sie sich fast nie sahen, tat nichts zur Sache. Leon wusste, dass er Harry jederzeit – auch wenn es morgens um drei war – anrufen konnte und sagen: »Du musst kommen und mich abschleppen; ich bin mit meinem Wagen auf der Autobahn liegen geblieben«, und dass Harry dann sofort losfahren würde – und zwar gern –, auch wenn er fünfhundert Kilometer entfernt war.
Als es an der Tür klingelte, lag Leon auf seinem Bett, dem einzigen bequemen Möbelstück in seinem Zimmer, und sah sich im Fernsehen einen Film über Komodowarane an. Die Wohnung hatte sich während des Tages stark aufgeheizt, und er ließ das Fenster geöffnet, obwohl die Luft, die hereinsickerte, so mit Blut gesättigt war, dass er die ganze Zeit einen Geschmack im Mund hatte, als hätte er soeben zwei rohe Steaks verdrückt. Leon ließ den Schlachter öffnen, weil Besuch sowieso fast immer zum Schlachter wollte. Leon kannte zwar eine Menge Frauen, aber wenn er mit ihnen ins Bett ging, dann lieber in ihren Wohnungen als bei sich zu Hause. Er fand es leichter, einfach abzuhauen, als eine Frau hinauszuwerfen.
Als die Zimmertür aufging und Harry hereinkam, waren die Komodowarane gerade dabei, einen Hirsch gegen eine Felswand zu treiben. Harry trug einen zementgrauen Anzug mit einer weiten Hose, der gleichzeitig teuer und unseriös aussah. Der Bart, der bisher den rücksichtslosen Zug um seinen Mund gemildert hatte, war abrasiert. Seine Haare hatte er jetzt zu einem Pferdeschwanz gebunden und mit grünen Pfeifenreinigern umwickelt. Harry war dünner geworden. Seine Wangenknochen standen eckig vor, und das Weiße in seinen Augen hatte sich gelblich verfärbt.
»Hey, Alter«, sagte er, und Leon sprang auf und rief: »Mensch!«
Sie pufften sich gegen die Oberarme und fassten einander an die Schultern. Harry war einen Kopf größer als Leon. Auch sonst sahen sie sich nicht gerade ähnlich. Der untersetzte Leon hatte weichliche Gesichtszüge, wirkte mitunter fast weinerlich, weil er an Allergien litt und seine Augen dann gerötet und geschwollen aussahen. Die einzigen klaren Konturen in seinem Gesicht stammten von seiner Brille. Er trug auch an diesem Tag, was er fast immer trug: eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Leon wollte den Fernseher ausstellen, aber als er nach der Fernbedienung griff, kam Harry ihm zuvor und nahm sie ihm weg.
»Nee, lass mal! Lass mal an! Das sind doch diese komischen Biester. Das sind doch diese Viecher, wo sie immer eine ganze Ziege vom Felsen schmeißen, und die Viecher reißen die dann in Stücke. Ohne Ende. Ich hab das schon mal gesehen. Die können einem mit einem Schwanzschlag die Beine brechen.«
Sie setzten sich beide auf das Bett und lehnten sich gegen die Wand, und Leon, der den Anfang des Films bereits kannte, konnte noch ergänzen, dass Komodowarane auch Leichen auf Friedhöfen ausbuddelten.
»Lecker«, sagte Harry, »aber bei dir stinkt es auch nicht schlecht. Ich hoffe, das kommt von draußen.«
»Das bin ich«, sagte Leon, »ich wasch mich jetzt nicht mehr.«
Noch so etwas, was Leon an der Freundschaft mit Harry schätzte: Auch wenn sie sich jahrelang nicht gesehen hatten, gaben sie keine langen Erklärungen ab, sondern benahmen sich, als hätten sie sich erst am Abend zuvor getrennt.
Die Komodowarane hatten den Hirsch gestellt und machten sich zu sechst über ihn her. Aber sie brachen ihm nicht gleich das Genick, sondern wälzten sich bloß über ihn und bissen kleine Fetzen aus ihm heraus, während der Hirsch schrill schrie. Einer der großen Drachen lag schluckend auf einem Bein des Hirsches, einer fraß Stücke aus seiner Brust, und einer riss ihm den Bauch auf, wühlte seinen Schlangenkopf hinein und kam mit blutig glänzenden Schuppen wieder heraus. Und die ganze Zeit schrie der Hirsch und schrie und schrie, bis ihn die Warane vollständig unter sich begraben hatten und seine Schreie erstickten.
»Drecksviecher«, sagte Harry, »tolle Drecksviecher.«
Auf dem Bildschirm tauchte eine blonde Forscherin auf. Sie inspizierte die Erdlöcher, in denen die Echsen wohnten, lotete die Höhlentiefe aus, indem sie sich mit den Beinen voran hineinschob. Sie hatte Glück; alle Komodowarane waren unterwegs, um Hirsche zu killen. Ein paar Kameraeinstellungen später schlich die Forscherin sich mit einer Plastiktüte an eine dösende Warangruppe heran, warf Eier und Fleisch auf den Boden und blieb neben den Tieren stehen, während sie fraßen. Ein Waran verschluckte ein ganzes Huhn mit Federn, Füßen und Schnabel, und als die Frau wieder ein Ei aus der Tüte nahm und ihn noch mit dem Huhn beschäftigt glaubte, stürzte er sich auf sie. Sie konnte gerade noch zur Seite springen, aber der Waran entriss ihr die Plastiktüte und verschluckte sie samt Inhalt so schnell wie vorher das Huhn.
»Hähä«, machte Leon.
Die Frau gab nicht auf. Immer wieder fütterte sie die unheimlichen Drachen und rückte ihnen dabei jedes Mal näher. Sie goss ihnen Wasser aus einer Plastikflasche über den Kopf, um ihnen Kühlung zu verschaffen, und schließlich saß sie auf einem und streichelte seinen faltigen Hals.
»Scheiße, was macht die da?«, sagte Harry. »Was soll das? Warum macht die blöde Kuh das?«
Der Waran ließ eine lange, gespaltene Zunge aus seinem Maul zischeln, und die Frau streichelte auch die Zunge, ließ ihre Hand davon umwinden und lobte den Drachen für sein schönes Organ.
»Die ist doch pervers«, sagte Harry.
»Komodowarane wollen das gar nicht«, sagte Leon. »Reptilien legen überhaupt keinen Wert darauf, dass man mit ihnen rumknutscht. Das nervt die bloß.«
Die Frau nahm eine Pinzette und entfernte abgestorbene Hautschuppen und Dreck aus der Drachenhaut. Dann küsste sie den Komodowaran auf den Mund.
»Schalt aus«, sagte Harry. »Ich kann die aufdringliche Fotze nicht mehr sehen. Außerdem will ich dir etwas zeigen.«
Leon stand auf und stellte den Fernseher aus. Er nahm einen zerknitterten Hundertmarkschein aus einer Schreibtischschublade und steckte ihn in die Hosentasche. Harry wartete schon an der Tür.
»Wir gehen ins MAI TAI«, sagte er.
Das beunruhigte Leon etwas. Das MAI TAI war eine Kneipe in einer der Seitenstraßen der Reeperbahn. Es war Harrys Welt, nicht Leons. Ins MAI TAI gingen – abgesehen von der Bedienung – ausschließlich Männer – Männer, die auch größere Summen stets in bar beglichen und deren Berufe alle in irgendeiner Weise mit Prostitution, Drogen oder Sonnenstudios zusammenhingen. Es war ein Ort, an dem das deutsche Rechtssystem sich gegen das viel ältere und erbarmungslose Recht des körperlich Stärkeren, des Schnelleren und Brutaleren nicht richtig durchzusetzen vermochte und an dem es gut war, Harry neben sich zu wissen. Er arbeitete dort als eine Art Geschäftsführer. Leon ahnte, dass Harry wieder mit einer bestimmten Absicht aufgetaucht war. Das letzte Mal, als Harry mit ihm ins MAI TAI gegangen war, hatte Leon für ihn eine Falschaussage vor Gericht machen sollen. Er hatte wenig Lust, so etwas noch einmal zu tun. Aber falls Harry ihn darum bat, würde er, ohne zu zögern, wieder Ja sagen.
Doch diesmal schien es um etwas anderes zu gehen, denn sie stiegen zu dem Boxring hinunter, der sich im Keller der Kneipe befand.
»Das ist Pfitzner«, flüsterte Harry und wies mit dem Kinn auf den älteren der zwei Männer, die in kurzen, weiten Hosen und mit solariengebräunten Oberkörpern einander umtänzelten. Leon nickte, obwohl ihm der Name nichts sagte. Pfitzner hatte silbergraues schulterlanges Haar, eindrucksvoll und Furcht einflößend wie das Altersprachtkleid eines Pavians. Er war bestimmt über sechzig Jahre alt und wog mindestens zehn Kilo zu viel. Ein dicker Speckreifen hing über seine goldene Hose. Er bewegte sich deutlich langsamer als der junge Türke, gegen den er kämpfte. Aber sogar Leon konnte erkennen, dass Pfitzner einmal ein richtig guter Boxer gewesen sein musste. Er machte dem Türken ganz schön zu schaffen. Leon sog den Geruch von frischem Männerschweiß ein, lauschte andächtig dem leisen Trampeln weicher Turnschuhe und dem Klatschen von Leder auf Fleisch, das hin und wieder von einem Keuchen begleitet wurde. Jedes Mal wenn Pfitzners massiger, haariger Schädel seitlich wegtauchte, duckte sich auch Leon. Ein einziges Mal in seinem Leben hatte er selbst zu boxen versucht – gegen Harry – und war sofort zu Boden gegangen. (Merkwürdigerweise war es ein angenehmes Gefühl gewesen, k.o. zu gehen. Es hatte überhaupt nicht wehgetan.)
»Gut jetzt«, sagte Pfitzner schließlich, und der junge Türke hörte sofort zu kämpfen auf. Beide hielten die Handschuhe in Kopfhöhe und knufften sie leicht aneinander. Der Türke stieg zwischen den Seilen durch, nahm seine violett und schwarz gestreifte Tasche auf und verschwand hinter einer Tür, die Leon zuvor gar nicht aufgefallen war, weil sie wie die Wände mit Boxplakaten tapeziert war. Pfitzner kam mit geblähten Nasenflügeln in die Ecke, an der Harry und Leon standen, und ließ sich von Harry die Handschuhe aufbinden und abstreifen. Auf seinen Fingerknöcheln waren Narben. Harry reichte ihm das Handtuch, und Pfitzner rieb sich damit den Nacken und wischte seinen Bauch ab.
»Ist er das?«, fragte er, nachdem er einen beiläufigen Blick auf Leon geworfen hatte. Pfitzners Augenlider hingen so tief, dass sie einen Teil der Iris verdeckten, was seinem Gesicht den Ausdruck einer melancholischen Natter verlieh.
Harry nickte und lachte nervös.
»Und du sagst, er ist in Ordnung?«
»Is’ mein bester Freund«, sagte Harry.
Leon schluckte. Was auch immer Harry da angeleiert haben mochte, er würde ihn auf keinen Fall blamieren.
»Trägt gern Schwarz, dein Freund, was?«, sagte Pfitzner. Er rotzte ins Handtuch, betrachtete den Schleim im Frottee, und dann sagte er zu Leon:
»Okay, Blacky, bring mir mal meine Tasche!«
Etwas in Leon empörte sich. Sein Stolz verlangte, dass er ruhig an seinem Platz stehen blieb und den alten Sack seine Tasche selber holen ließ. Aber gleichzeitig spürte er, dass Harry nicht gezögert hätte, den Befehl auszuführen. Und jetzt erwartete Harry von ihm, dass er ihn nicht blamierte. Leon ging zurück zur Treppe, wo eine hellblaue Adidas-Tasche stand, und brachte sie dem alten dicken Boxer in den goldenen Hosen. Er tat es für Harry. Pfitzner griff nach der Tasche. Er öffnete den Reißverschluss, nahm ein Bündel Banknoten heraus und drückte sie Leon in die Hand.
»Hier sind 50000,–«, sagte er. »Das ist der Vorschuss. Die zweiten 50000,– kriegst du, wenn das Buch fertig ist.«
Leon sah Harry an. Harry grinste, als wäre ihm ein entscheidender Teil des Gehirns herausoperiert worden. Dann starrte Leon auf das Geld, das Pfitzner ihm in die Hand gedrückt hatte. Er wunderte sich, was für ein dünnes Bündel 50000 Mark in bar waren, und er wunderte sich, dass dieses dünne Bündel in seiner Hand lag.
Von da an war alles anders gewesen.
Leon nahm die Hand von Martinas Schultern und legte sie wieder auf das Lenkrad, denn vor ihnen tauchte die Brücke auf, die der Makler in seiner Wegbeschreibung erwähnt hatte. Es war eine gerade Holzbrücke, aus dicken dunkelbraunen Balken roh zusammengefügt. Sie zweigte wenige Kilometer hinter Freyenow nach links ab und führte über einen Kanal. Hinter der Brücke begann eine Straße, die niemand für wichtig genug gehalten hatte, um einen Wegweiser aufzustellen. Sie wurde von zwei Gräben flankiert, aus denen rostig trübes Wasser in den Kanal quoll. Die Fahrbahn war mit runden Steinen bepflastert. In die Straßenmitte hatte man zwei Spuren aus flachen Steinen eingefügt, auf denen es sich ein wenig komfortabler fuhr. Bedrückt betrachteten Leon und Martina, was hinter nassen Scheiben an ihnen vorbeirumpelte. Rübenfelder wechselten mit fetten Wiesen, auf die wieder Rübenfelder folgten. Dann blieben die Rübenfelder aus, und die Wiesen waren von langen Stechgräben durchzogen, in die der Boden sein rotbraunes Wasser blutete. Leon schaltete das Radio ein. Er musste zweimal den Sender wechseln, bis er die Musik ertragen konnte. Er wartete, dass Martina sich über das alte Reggae-Stück, das jetzt lief, beklagen würde, aber stattdessen fing sie wieder von der Wasserleiche an.
»Wozu hast du den Stock in der Hand gehabt? Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du mit dem Stock gemacht hast.«
»Na, hätte ich sie mit der Hand anfassen sollen?«
»Wozu musstest du sie denn überhaupt anfassen?«
Er zuckte mit den Schultern. Er wollte ihr lieber nicht erklären, dass er den Ast gebraucht hatte, um den Arm der toten Frau unter Wasser zu drücken und zu beobachten, wie er wieder auftrieb; dass er ihn gebraucht hatte, um herauszukriegen, ob die Haut reißen würde, wenn er mit dem Ast hineinstach. (Sie war nicht gerissen.)
»Herrgott, ich musste doch prüfen, ob sie tot ist. Sie ist tot. Tot, verstehst du? Sie hat doch gar nichts mehr gemerkt.«
»Das hättest du auch sehen können. Jeder konnte sehen, dass sie tot ist. Und du bist so lange geblieben.«
Leon antwortete nicht. Martina drehte sich von ihm weg und sah wieder aus dem Fenster. Es regnete aus immer dunkleren Wolken. Die Dämmerung setzte am ganzen Himmel zur gleichen Zeit ein. Auch der Anblick der Tierwelt erheiterte nicht. Einmal drängten schwarzbunte Bullenkälber ihre dreckverkrusteten Leiber gegen ein Metallgatter. Auf einer anderen Wiese stand regungslos ein einsames braunes Pferd, das rechte Hinterbein zur Schonung angewinkelt. Es machte einen schlaffen Eindruck. Die Ohren zeigten zur Seite, und obwohl das Pferd seine Zähne zusammenbiss, hing die graue Unterlippe schwer herunter und bildete einen kleinen, weichen Napf, in den es zweifellos hineinregnete. Martina seufzte schwer.
»Bei Sonnenschein sieht das hier ganz anders aus«, versuchte Leon sie und auch sich selber zu trösten. Aber Martina blickte ihn so mürrisch an, als wäre er und nur er allein schuld – am Regen und daran, dass die Gegend so trostlos war, und überhaupt an allem.
Martina war hübscher als sämtliche Frauen, mit denen Leon vor ihr zusammen gewesen war. Trotzdem hatte er sich nie darüber gewundert, dass die langbeinige Schönheit mit der Rennpferd-Eleganz sich ausgerechnet in ihn, den kleinen und kurzsichtigen Dichter, verliebt hatte. In einem Interview hatte er einmal auf die Frage »Was halten Sie für Ihr größtes Talent?« geantwortet:
»Ich kriege jede Frau, die ich haben will.« Woraufhin die Zeitschrift einen Haufen empörter Leserbriefe erhielt – überwiegend von Frauen, die Leon Ulbricht als arrogantes Schwein, bebrillten Zwerg und widerlichen Chauvinisten beschimpften. Ihm gefiel es, wenn er so angegriffen wurde. Dieser hilflose Hass. Auf sein größtes Talent war er allerdings weniger stolz, als es den Anschein hatte. Natürlich freute es Leon, wenn andere Männer ihn beneideten; wenn Männer sich den Kopf darüber zerbrachen, wie dieser kleine, hässliche Kerl, der noch nicht einmal reich war, es anstellte, ihnen die Frauen auszuspannen. Vielleicht war das sogar das Beste an der ganzen Geschichte. Trotzdem gab ihm das kein Gefühl von Überlegenheit. Im Gegenteil. Leon selbst kamen seine erotischen Begabungen – sein Charme, sein Einfühlungsvermögen und selbst die technische Geschicklichkeit, mit der er Frauen befriedigte – ja, besonders diese Geschicklichkeit – ein bisschen unwürdig vor. So erstrebenswert wie die Fähigkeit, mit Tellern jonglieren zu können oder, freihändig auf einem Einrad fahrend, ein Tablett mit zwanzig gefüllten Gläsern auf dem Kopf zu balancieren. Ein Mann – und er dachte dabei noch nicht einmal an Harry oder Pfitzner – musste andere Qualitäten haben. Ein Mann war jemand, der einen Haufen Geld verdiente, ein Haus besaß, Kinder zeugte, Autos reparieren konnte und jedes Gurkenglas aufbekam. Ein Mann war jemand, der einen stehen hatte, wenn es darauf ankam – und damit fertig.
Martina hatte er bei der Talkshow eines Lokalsenders kennengelernt, zu der Leon eingeladen worden war, um seinen neuesten Gedichtband SCHREIB ODER SCHREI vorzustellen. Die Fragen des Moderators betrafen dann allerdings weniger den Gedichtband, sondern mehr das Gerücht, Leon Ulbricht würde von einem Zuhälter dafür bezahlt, dass er ihm seine Biografie schrieb. Martina saß im Zuschauerraum. Eigentlich war sie die Redaktionsassistentin, aber der Aufnahmeleiter setzte sie während der Talkshows immer mit zu den Zuschauern, weit nach vorn, wo sie oft im Bild war. Deswegen hatte Leon sie zuerst für eines der Fotomodelle gehalten, die über ihre Agenturen Freikarten bekamen, damit sie ihre langen Beine in die Kameras hielten und sich hin und wieder die Haare aus den außerordentlichen Gesichtern strichen. Neben den branchenüblichen Vorzügen ihres Körpers hatten ihm vor allem Martinas Augen gefallen.
»Du hast Augen wie ein angefahrenes Reh«, hatte Leon zu ihr gesagt, als er nach dem Ende der Sendung neben ihr am Büfett stand. Er sagte grundsätzlich allen Frauen, dass er sie für unglücklich hielt. Einem Doktor, der die richtige Diagnose stellt, vertraut man auch die weitere Behandlung an. Und Leons Erfahrung nach waren schöne Frauen keineswegs glücklicher als andere. Tatsächlich unterschied sich ihr Unglück nur insofern vom Unglück hässlicher Frauen, als hässliche Frauen die Ursache ihres Kummers zu kennen glaubten.
Vier Wochen später hatte Leon seine Bücher, seinen Computer, seinen Schreibtisch, sein Zebrafell und einen Koffer in einen gemieteten VW-Transporter gepackt und war in Martinas helle, große Wohnung gezogen. Dem überraschten Schlachtergesellen vermachte er die übrigen Möbel und seine alte Musikanlage samt Schallplatten (die CDs nahm er mit) und erklärte ihm, dass alle wirklich großen Schriftsteller in geordneten Verhältnissen gelebt hätten. Bei Leistungssportlern sei das ja auch nicht anders.
Vier Monate später heiratete er Martina. Leon sah sich in einem kleinen Haus weitab von den Oberflächlichkeiten der Großstadt ein stilles und ernstes Leben führen. Er würde keine Lesungen mehr geben. Und er würde keine Zeitschriftenartikel mehr schreiben, sondern nur noch Bücher. Dicke, schwere Bücher eines abgeklärten, gereiften Mannes. Erst das über Benno Pfitzner und dann andere. Und nebenbei würde er seine Kinder aufwachsen sehen. Er und Martina fingen an, die Immobilienanzeigen der Zeitungen nach einem billigen Haus auf dem Land zu durchsuchen. Zwei Häuser hatten sie schon besichtigt. Eines war eine Bruchbude gewesen, und das andere hatte keine zweihundert Meter von einer Autobahn entfernt gelegen. Aber die letzte Anzeige, die Martina ihm vorgelesen hatte, hörte sich gut an, obwohl sie von einem Makler aufgegeben worden war. Das Haus sollte das letzte in einem kleinen ostdeutschen Dorf sein; dahinter lag nur noch Moor, unbebaubar, Naturschutzgebiet. Und es sollte nur 40000 Mark kosten. Also hatten sie sich wieder auf den Weg gemacht, der sie diesmal ein ganzes Stück in die ehemalige DDR hineinführte. Es hatte geregnet, als sie aufgebrochen waren.
Und es regnete immer noch, als sie Priesnitz erreichten. Priesnitz war so klein, dass es weder Schule noch Kirche besaß. Sechsundzwanzig Wohn- und Bauernhäuser und ein Lebensmittelgeschäft reihten sich an die einzige Straße. Hinter Drahtzäunen wuchsen Johannisbeerbüsche und krumme Obstbäume. Kurz vor dem Gestell, an dem einmal das Ortsschild gehangen hatte, stieg das Gelände leicht an, ohne es jedoch zu einem richtigen Hügel zu bringen. Die Straßengräben endeten hier. Rechts des Wegs plätscherte Leon und Martina stattdessen ein lebhafter Bach entgegen, der bei jeder Auffahrt in einem unterirdischen Betonrohr verschwand. Wie eine flinke Nadel wechselte der Bach mehrmals den oberirdischen mit dem unterirdischen Aufenthalt. Abgesehen von dem frisch verputzten Lebensmittelladen, unter dessen tropfendem Vordach ein Jugendlicher auf seinem Mofa saß und rauchte und dem vorüberfahrenden Mercedes lange nachblickte, und abgesehen von einem Schuppen, den ein unausgelasteter Landwirt mit zerschnittenen und weiß gespritzten Autoreifen verziert hatte, zeigten alle Gebäude eine entschiedene Tendenz zum Melanismus. Einige Dächer waren mit schwarzen Planen geflickt. Ein breiter roter Plastikstreifen, der an einem Haus diagonal über ein Fenster geklebt war und der in weißen Buchstaben versprach, dass hier Videokassetten ausgeliehen werden konnten, wirkte in dieser Umgebung erschreckend grell. Wo die Straße nicht mehr von Häusern gesäumt wurde, standen hohe Birken Spalier, und dahinter lag ein hundert Jahre altes, schlossähnliches Gebäude, dessen rechte Hälfte verfallen, mit Efeu und Druckwurz überwachsen und dessen linke Hälfte mit sieben Satellitenschüsseln bestückt war. Bei den Birken schlug sich der Bach in die Felder, das heißt – da er ihnen ja entgegenfloss – kam er dort aus den Feldern heraus. Die gepflasterte Straße setzte sich als Schotterpiste fort und führte auf den Gutshof zu, als wollte sie mitten hindurch. Vor der Flügeltreppe machte sie im letzten Moment eine scharfe Kurve nach rechts, verlief noch ein paar Hundert Meter geradeaus und endete dann in einem Feld kniehoher Maispflanzen. Am Feldrand gurgelte wieder der Bach. Vor dem Maisfeld führte links ein Weg in die Wiesen hinein zu einem grauen Haus, das ein Stück entfernt lag. Der Weg war nicht befestigt. Er war noch nicht einmal ein richtiger Weg. Nach einigen Metern bestand er bloß noch aus zwei tiefen Reifenspuren, die ein Trecker in die nasse rote Erde gewühlt hatte. Dazwischen wuchs hohes Gras. Das schlurfte und schabte unter dem Mercedes. Leon hatte Angst, aufzusetzen und den Unterboden an einem Stein aufzureißen, etwas Wichtiges, etwas Teures zu zerstören. Den Tank. Das Getriebe!