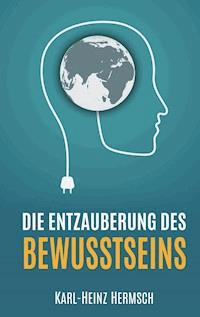
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch versucht, die Welt vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das Gehirn hat die Fähigkeiten, die Welt in merkwürdigen Vorstellungen zu zeigen: Etwa, dass es einen Allmächtigen gibt, dass Bewusstsein letztlich etwas Mystisches ist, man Hilfe aus dem Himmel erwarten kann. Das Gehirn hat aber auch die Fähigkeit, uns die Realität erkennen zu lassen. Lässt man dies zu, stellt sich die Welt vom Kopf auf die Füße. Gelingt dies, wird die Toleranz gefördert - gegenüber anderen und uns selbst. Das Gehirn arbeitet exakt nach der Mittelpunkt-Mechanik: Ein Mittelpunkt besteht aus weit über das Gehirn verteilten Neuronen, die ein Netz bilden, das dazu dient, Einstellungen, Handlungen, Vorstellungen, Gefühle usw. zu erzeugen. Es ist ein Ziel, das alles zulässt was passt, um es zu erreichen, und allem anderen nur wenig oder gar keine Aufmerksamkeit widmet. Es gibt unzählige Mittelpunkte im Gehirn; alle laufen nach den gleichen Gesetzen ab. Die Mittelpunkt-Mechanik ist der Schlüssel zum Verstehen menschlichen Verhaltens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
VORWORT
EINLEITUNG
DIE ENTZAUBERUNG DES BEWUSSTSEINS
MITTELPUNKT-MECHANIK
DER HIMMEL IST NEUTRAL
DIE-1-MILLIARDE-EURO-FRAGE
QUANTEN-GESETZE
WEISE IST, DER WEISS, DASS ALLES SO GESCHEHEN MUSSTE, WIE ES GESCHAH
DER RAHMEN – MEIN FREUND
GEDANKEN – UND WENN SIE LÄSTIG WERDEN
GEGENWART
VERGANGENHEIT
SCHULD UND WIEDERGUTMACHUNG
SINN DES LEBENS
FREITOD
VORWORT
Menschen lieben Märchen.
Nüchterne Realität bedient in der Regel nicht ihre Bilder.
Warum tun sich einige Menschen so schwer, meine Bücher zu verstehen?«, fragte ich Phil Osof.
»Sie beschreiben Ebenen, die etlichen Menschen verschlossen bleiben, Herr Hermsch«, antwortete er. »Sie folgen keinen Traditionen, sondern es herrscht freies, nüchternes Denken ohne Fesseln vor: eine ungebundene Sicht auf die Grundprinzipien der Welt und das Leben. Angetrieben von dem Ziel, die Welt zu ergründen.
Dies könnte auch für ›Die Entzauberung des Bewusstseins‹ gelten. Etwa bezüglich der Wissenschaften: Diese wollen zwar ebenfalls die Welt ergründen, sind aber oft gefangen in den übernommenen Werten der Vergangenheit, die ihre Sicht beschränken.
Darüber hinaus interessiert der Inhalt der Bücher die Menschen leider wenig, weil sie in aller Regel trunken sind vom Leben. Das macht es ihnen schwer, einen nüchternen Blick darauf zu werfen.«
»Aber gibt es nicht Experten, die bezüglich der behandelten Themen zu ähnlichen Schlüssen kommen könnten, wenn sie sich intensiv damit beschäftigen und dies dann öffentlich diskutieren würden?«
»Diese Experten sind in aller Regel im Mittelpunkt ihrer Zeit. Das heißt: in einem begrenzten Rahmen. Gehen sie zu sehr darüber hinaus, dann drohen sie aus ihm herauszufallen. Zum Beispiel laufen sie Gefahr, von ihren Kollegen ausgegrenzt zu werden.
Dies ist verständlich: Alle Menschen vermeiden die Ausgrenzung.
Sie sind gewohnt, in ihrer Welt zu leben und deren Werte zu erhalten, falls diese von abweichenden Meinungen betroffen werden. Sie wollen ihre Ziele, ihre Sicht beibehalten. Das wird umso häufiger der Fall sein, je stärker sich innere Strukturen gefestigt haben, starrer geworden sind. Dadurch kann es ihnen unmöglich werden, loszulassen und Neues anzunehmen.
Es läuft ähnlich ab wie mit den vier Phasen des Sterbens: Ablehnung (Ignorieren), Kampf (Beseitigen-Wollen), Traurigkeit/Depression (Nicht-loslassen-Können oder -Wollen) und Zustimmung (Annehmen).
Dieser Ablauf geschieht ja nicht nur im Angesicht des Todes. Es ist allgemein so, dass der Mensch, wenn etwas Neues auftritt, was ihm nicht passt, dies nicht zur Kenntnis nehmen will. Wenn das nicht möglich ist, wird der nächste Schritt sein, es mit mehr oder weniger stichhaltigen Argumenten oder Gewalt zu eliminieren.
Ist das auch nicht möglich, kann Depression auftreten, Traurigkeit durch das Sich-lösen-Müssen. Schließlich, wenn alles gut geht, findet man sich damit ab und stimmt dem Neuen zu.«
EINLEITUNG
Alles im Universum – auch der Mensch – wird ausschließlich von Zielen strukturiert und gesteuert, alles unterliegt unumstößlichen Gesetzen.
Die Menschen sprechen vom Geist des Menschen, weil das, was im Gehirn passiert, scheinbar nicht zu fassen ist. Mit bildgebenden Verfahren ist es aber möglich, die Netze aus weit über das Gehirn verteilten Neuronen sichtbar zu machen. Da das Gehirn ausschließlich mit Zielen (Mittelpunkten) arbeitet, die diese Netze generieren, nenne ich das, was andere als »Geist« bezeichnen, »Mittelpunktnetz« oder kurz »MPN«.
Der Satz »Alles im Universum – auch der Mensch – wird ausschließlich von Zielen strukturiert und gesteuert, alles unterliegt unumstößlichen Gesetzen« wird wohl bestritten werden. Besonders, weil er den Menschen einschließt – denn wir haben das Gefühl, »frei« zu entscheiden.
Mein Ziel ist es, diesen Satz zu belegen – und die Konsequenzen aufzuzeigen:
Was geschah, musste geschehen, wie es geschah.
Einen Gott, der willkürlich – ohne sich um die Gesetze kümmern zu müssen – in jedes beliebige Geschehen eingreifen kann, kann es nicht geben.
Nimmt man den Satz an und lebt danach, ergeben sich mindestens zwei Konsequenzen:
Man wird tolerant.
Der religiöse Glaube wird zu dem, was er eigentlich ist: zu etwas, das man gerne glauben möchte – was aber letztlich nicht der Realität entspricht.
Anmerkung:
Die Freiheit hat für den Menschen einen besonderen Wert. Wenn jetzt jemand sagt: »Was geschieht, muss geschehen, wie es geschieht«, dann kommt schnell das Gefühl auf, die eigene Freiheit zu verlieren. Eine beliebte Reaktion auf etwas, das man nicht möchte, besteht darin, es einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorteil: Man muss sich nicht damit auseinandersetzen. Der Nachteil: dass man einen großen Teil der Selbsterkenntnis einfach beiseiteschiebt.
Diese Reaktion kommt aus dem Selbst. Das Selbst besteht aus Zielen – nur aus Zielen.
Sich mit etwas auseinandersetzen kann man nur, wenn sich ein entsprechendes neues Ziel bildet. Das ergibt sich jeweils durch eine Frage. In diesem Fall die des Lesers: »Was ist an dem Satz ›Was geschieht, muss geschehen, wie es geschieht‹ dran?« Diese Frage wird aus den oben dargelegten Gründen aber nicht gestellt.
Wer alles weiß (wer glaubt, alles zu wissen), stellt keine Fragen. Wer keine Fragen stellt, entwickelt sich nicht weiter, erstarrt.
In meinen Ausführungen wird man immer wieder den Begriff »Mittelpunkt« finden. Dazu vorab eine kurze Erklärung:
Während alles im Universum von Zielen gestaltet wird, denen die Folgen ihrer angestrebten Struktur »egal sind«, kommt bei Lebewesen das Ziel der Erhaltung hinzu.
Dieses erfolgt im Gehirn durch Netze aus Neuronen, die ich »Mittelpunkte« nenne. Je nach Art und Individuum werden die Lebewesen von ihnen gestaltet.
Mittelpunkte agieren in der Form, dass sie alles zulassen, was dazu beitragen könnte, ihre Struktur zu verwirklichen bzw. zu erhalten, und alles andere möglichst unberücksichtigt lassen. Sie bewerten also. Werte bewegen die Lebewesen.
Im Allgemeinen spielen die Mittelpunkte miteinander das Konzert des Lebens. Im Extremfall kann aber ein Mittelpunkt alle anderen stark herabsetzen, sodass nur dieser den Menschen gestaltet, etwa in Phasen der Panik, der Ekstase oder wenn man dabei ist, Höchstleistungen zu vollbringen.
Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Darwins Theorie von der Entwicklung des Lebens für die Erklärung der Kompliziertheit der Lebewesen nicht ausreichend ist, weil dafür viel mehr Zeit notwendig gewesen wäre.
Die Mittelpunkt-Mechanik könnte diese Lücke schließen: Mittelpunkte passen sich an, verändern sich oder es bilden sich neue.
Ist diese Veränderung lebenswichtig und nachhaltig, dann könnte sie in der Erbmasse verankert werden. Die Lebewesen würden sich also um ein Vielfaches schneller anpassen, als dies bei der Darwin’schen Theorie der Fall ist.
DIE ENTZAUBERUNG DES BEWUSSTSEINS
Beweisen Sie, dass der ›unfassbare Geist‹ ohne die Neuronen des Gehirns existieren kann. Wenn das nicht möglich ist, folgt daraus, dass der ›Geist‹ über die Neuronen fassbar ist.
Diesen Zettel hatte ich auf einer Party der Familie Lempertz verteilt. Sie hatte einen weiten Bekanntenkreis und so waren quasi alle Gruppen der Gesellschaft eingeladen.
Ich schlenderte zu einem Zirkel von Geistlichen und fragte nach ihrer Meinung.
»Ich denke, auch ohne die Neuronen des Gehirns ist der Geist da«, antwortete ein hochgewachsener Mann mit einem Lächeln.
»Sie sagten: ›Ich denke.‹ Wo kommt das Denken her, woraus entsteht es?«
»Ich weiß, worauf Sie hinauswollen«, lächelte er wieder, »dann werde ich es so formulieren: Ich glaube es.«
Und wo kommt dieser Glaube her?«, fragte ich weiter und ergänzte: »Sicherlich aus dem Gehirn.«
Er antwortete nicht und wandte sich wieder den anderen zu.
Ich ging weiter und gesellte mich zu einem Kreis von Geschäftsleuten.
»Wissen Sie, Fragen dieser Art stellen wir uns nicht«, entgegnete ein älterer Herr in jovialem Ton, »wir sind an unseren Geschäften interessiert, wollen die Wirtschaft in Schwung halten und Arbeitsplätze schaffen.«
Auch die nächste Gruppe – Töchter und Söhne wohlhabender Eltern – waren nicht an dieser Frage interessiert. »Wir wollen leben, Spaß haben«, erklärte eine gut aussehende Brünette. »Bezüglich des Geistes«, fügte ein nach der Mode gekleideter junger Mann hinzu, »suchen wir ihn in unseren Getränken.«
Etwas abseits stehend sah ich meinen Freund Philipp, der mich beobachtete. Er war an solchen Fragen sehr interessiert. Wir kannten uns schon länger und diskutierten von Zeit zu Zeit.
»Und«, schaute er mich an, »was ist bei deinen Fragen herausgekommen?«
»Eigentlich das, was ich erwartet hatte«, erwiderte ich.
»Ich finde die Frage interessant, aber ich glaube, dies ist nicht die richtige Zeit, sie zu diskutieren.«
Ich nickte. Wir verabredeten uns für das nächste Wochenende im Stadtpark.
Dann setzte ich meinen Weg fort. Leider ohne auf viel Interesse zu stoßen.
Ein Satz blieb mir besonders im Gedächtnis, der in diesem Zusammenhang geäußert wurde, von einer älteren Frau, die bekannt war für ihre esoterische Neigung: »Ich weiß auch ohne mein Gehirn, dass es Geister gibt.«
Auf meine Frage, wie man ohne Gehirn etwas wissen kann, bekam ich keine Antwort.
Zwischendurch kam mir wieder Philipp in den Sinn und unser Gespräch, das wir vor ein paar Monaten geführt hatten:
»Wer bin ich?«, fragte er.
»Du bist Philipp«, lachte ich.
»Okay – aber wer ist dieser Philipp? Warum bin ich so, wie ich bin?«
»Nun – du bist die Struktur deiner Ziele, deiner Mittelpunkte.«
»Welcher Ziele?«
»Das Ziel des Überlebens, das Ziel der Orientierung, das Ziel, anerkannt zu werden. Diese und viele andere Ziele gestalten dich – sie bringen dich in eine Struktur.«
»Meinst du, ich werde ausschließlich von Zielen gestaltet? Was ist denn mit meinem Bewusstsein? Meinem Willen? Meiner freien Entscheidung?«
»Nun, überleg mal: Wozu ist das Bewusstsein da? Doch wohl, um wahrzunehmen, sich auf etwas zu konzentrieren. Woraus resultiert der Wille? Doch wohl aus dem Wunsch, ein Ziel zu erreichen. Und liegen nicht allen deinen Entscheidungen Ziele – und nur Ziele – zugrunde, die in deinem Selbst – oder anders ausgedrückt, in deiner Seele – liegen und sich in deinem Willen bündeln?«
»Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, wie du den ›Mittelpunkt‹ mal beschrieben hast«, meinte Philipp:
»Der Mittelpunkt ist die Gestalt, die ein Ziel aus einem Menschen macht.
Um ein Ziel zu erreichen, muss man einen Weg gehen. Wenn man ›Weg‹ etwas umfassender ausdrücken will, dann kann man sagen: ›Um ein Ziel zu erreichen, braucht man eine Struktur.‹ Der Weg muss in der Umwelt strukturiert werden – und natürlich auch der Mensch, der dieses Ziel erreichen will.
Alles, was zu diesen Strukturen beitragen könnte und im Moment fassbar ist, wird von dem Ziel berücksichtigt, alles andere bleibt unberücksichtigt. Stört dieses andere, wird es durch Nichtbeachtung im Wert gemindert.
Dieses Herabsetzen aller anderen Werte – Mittelpunkte – geschieht nicht willentlich, sondern mechanisch.«
»Das hast du ziemlich genau wiedergegeben«, nickte ich.
Am Wochenende trafen wir uns im Landhaus Walter im Stadtpark. Philipp hatte seine Freundin Sabrina dabei, die diese Themen ebenfalls mochte.
Wir gingen, nachdem wir eine Kleinigkeit gegessen und der Jazzkapelle zugehört hatten, spazieren.
Philipp fragte mich:
»Was ist Bewusstsein?«
»Es hat die Funktion, wahrzunehmen, Informationen an das Selbst zu liefern.«
»Aber ist es nicht für die meisten Menschen mehr als das?«
»Es gibt Leute, die meinen, Bewusstsein sei eine besondere Eigenschaft, die man mit der unfassbaren Seele des Menschen gleichsetzen kann. Es sei so eine Art Geist. Aber das Bewusstsein ist kein unfassbarer Geist, sondern lediglich eine Verstärkung der Sinne. Es dient dem Wahrnehmen und Empfinden.«
»Aber warum hat man ein Bewusstsein von der Welt und sich selbst?«, fragte Sabrina.
»Weil es für das Selbst wichtig ist, gezielt und verstärkt mit den Sinnen Informationen aufzunehmen, um den Mittelpunkten – den Zielen in einem selbst – genaue Fakten zu liefern, die dann in Gefühle oder Handlungen umgesetzt werden.«
»Ich habe mal von dem Qualia-Problem gehört«, bemerkte Philipp. »Darunter wird der subjektive Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes verstanden.«
»Also quasi das, was ein Mittelpunkt im Gehirn auslöst und was man dann erlebt?«, fragte Sabrina.
»So kann man es ausdrücken«, nickte ich, »es wird hier aber von einem phänomenalen Bewusstsein gesprochen, das heißt, wir wissen nicht, warum wir etwas bewusst wahrnehmen.
Wem aber klar ist, dass das Bewusstsein nur die Funktion hat, Informationen zu ermitteln und weiterzugeben (Erlebnisgehalte mentaler Zustände sind Informationen), der hat kein Qualia-Problem.
Dies ist den meisten Menschen aber nicht klar. Sie sehen das Bewusstsein als etwas, das Entscheidungen trifft. Es wird angesehen als ein selbstagierendes Etwas und nicht als eine Funktion für die Ziele im Gehirn.
Als Beispiel dafür wird etwa Folgendes angeführt: Wenn man sich die Finger verbrennt, werden Reize zum Gehirn geleitet, dort verarbeitet und schließlich ein Verhalten produziert. Nichts aber mache es zwingend, dass dabei ein Schmerzerlebnis entstehe.
Es wird also quasi gesagt, dass man dies nicht wissen müsste, um eine Reaktion entstehen zu lassen.
Dazu kann man sagen: Jeder aktuelle starke Mittelpunkt, der vorherrscht, aktiviert automatisch das Bewusstsein, um genauere Informationen zu bekommen, damit die Ziele in einem angemessener reagieren können.
Wir fühlen nicht nur Außenreize mit der Haut, sondern auch Innenreize, wenn wir etwa Musik hören. Das Bewusstsein verstärkt diese Reize, die wir in der Regel als angenehm empfinden, weil wir im Mittelpunkt der Musik sind.«
»Das Bewusstsein hat also nur die Aufgabe, Informationen zu liefern. Seien es Informationen von außen oder aus dem Inneren des Menschen«, schloss Philipp.
»Das Bewusstsein wird also überbewertet?«, fragte Sabrina.
»Ja, weil alles in unserem Leben mit mehr oder weniger Bewusstsein begleitet wird«, nickte ich. »Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass es ein eigenständiges Phänomen ist, das frei agiert.
Es sind besonders zwei Fakten, die eine reale Sicht auf das Bewusstsein verhindern: einmal, dass unsere Vorfahren nichts von der heutigen Hirnforschung wussten, aber weiterhin die Definition des Geistes liefern. Und zweitens die Sucht, dass die Menschen das Gefühl haben wollen, mit ihrem Bewusstsein zu entscheiden und sich zu kontrollieren.
Das Problem ist hier also die Definition des Bewusstseins.
Sieht man es aber als einen Verstärker der Sinne, dann wird aus dem Qualia-Problem ein Pseudo-Problem.«
»Und wenn man sagt: Jemand entscheidet sich bewusst oder macht etwas bewusst?«, war Sabrina neugierig.
»Dann heißt das, er begleitet seine Entscheidung mit seinem Bewusstsein. Die Ausführung erfolgt durch die Mittelpunkte des Selbst – das Bewusstsein liefert die Fakten. Es ist Beobachter und Informationslieferant. Die Ziele, was es beobachten und welche Fakten es für relevant halten soll, kommen aus dem Selbst. Das Bewusstsein hat tatsächlich lediglich eine Funktion: Informationen, die außerhalb und innerhalb des Menschen liegen, weiterzuleiten.«
»Bewusstsein ist also ein Wissen ›von‹. Zum Beispiel sehe ich etwas und weiß ganz genau, was ich sehe. Der Vorteil ist, dass das Selbst das, was ich sehe, besser bewerten kann?«, hakte Philipp nach.
»Das ist offensichtlich«, nickte ich.
»Was machst du, wenn du einen Fehler gemacht hast?«, fragte ich ihn jetzt.
»Dann versuche ich, mir die Auslöser dafür anzusehen.«
»Das heißt, du holst dir genauere Informationen mit deinem Bewusstsein ein?«
»Ja.«
»Dies zeigt ebenfalls, dass die Ziele das Bewusstsein lenken.«
»Du sagst, es tritt das ins Bewusstsein, was wichtig ist. Und du sagst, es ist die Konzentration auf etwas. Aber wenn ich durch die Gegend gehe, dann habe ich ständig Bewusstsein. Warum ist das so? Warum kommt mir dann etwas in den Kopf, wird mir bewusst?«, wollte Sabrina wissen.
»Weil die jeweiligen Themen eine gewisse Stärke haben, um das Bewusstsein zu aktivieren. Weil es für das Selbst immer wichtig ist, sich zu orientieren, besonders dann, wenn etwas auftritt, das zum Beispiel gefährlich werden könnte.«
»Dann entscheidet das Bewusstsein nie alleine?«
»Noch mal: Es trifft keine Entscheidung, diese fällen die Mittelpunkte im Selbst – und zwar Millisekunden, bevor man meint, mit seinem Bewusstsein zu entscheiden.«
»Und wie ist es, wenn ich denke?«, fragte Phillip.
»Es ist ein Ziel«, antwortete ich. »Das Denken bildet einen Mittelpunkt. Auf diesen Mittelpunkt (weil es der aktuelle Wert ist) richtet sich das Bewusstsein und gibt die Informationen, die bei dem Denken entstehen, an das Selbst weiter.«
»Das Bewusstsein hat also wirklich nur die Funktion, Informationen für das Selbst zu liefern?«
»Absolut. Das Bewusstsein holt sie mittels der Sinne ein. Es kann nur das aufnehmen, was im Aufnahmespektrum unserer Sinne möglich ist und was die Mittelpunkte zulassen. So kann man auch sagen: Wir machen die Welt, weil vieles gar nicht aufgenommen werden kann oder soll. Das Selbst – oder anders ausgedrückt, die Seele – zieht daraus Schlüsse, verändert sich oder bildet neue Ziele.«
»Warum sehen das die Menschen nicht und heben das Bewusstsein des Menschen dermaßen in die Höhe?«, fragte Phillip jetzt.
»Es gibt viele, für die es die höchste Form der Erkenntnis ist und die glauben, es ist ein Zauber, den man nicht erklären kann. Sie sehen es als etwas an, das aus dem Nichts kommt. Aber es kommt nicht aus dem Nichts, sondern aus dem Gehirn. Genauer gesagt: Die Ziele des Gehirns steuern das Bewusstsein. Es ist ähnlich wie mit dem freien Willen‹, der auch nicht aus dem Nichts kommt.
Der Grund ist die Hybris, etwas Besonderes unter den Lebewesen sein zu wollen, und das Nachplappern dessen, was Autoritäten sagen. Und die Menschen wollen nicht sehen, dass nicht sie, als bewusste Personen, die Entscheidungen treffen, sondern das Selbst, das zum allergrößten Teil unbewusst ist.
Nebenbei: Unabhängig von der Arbeit des Bewusstseins nimmt das Gehirn, für den Menschen unbewusst, in jeder Sekunde Millionen von Bits – Informationseinheiten – auf. Mit der Verarbeitung dieser Informationsmenge wäre das Bewusstsein oder das Ich völlig überfordert.«
»Unter ›Ich‹ verstehst du was?«
»Ein begrenzter Raum von wichtigen Zielen, die man von sich erfahren hat und die die Persönlichkeit darstellen.«
Jedenfalls: Die Ähnlichkeiten der Situationen und die Vergleiche für das Ausschlussverfahren, die das Selbst anstellt, können unmöglich von den Zielen des Ich oder des Bewusstseins in dieser Menge ausgeführt werden.«
»Das Selbst gehört also zum Gehirn; man kann es mit der Seele gleichsetzen?«
»Ich habe mal mit Phil Osof darüber geredet«, sagte ich:
»Wo würden Sie Bewusstsein ansiedeln?«
»Im Gehirn. Es beruht auf neuronalen Aktivitäten.«
»Ausschließlich?«
»Es ist vollständig an bestimmte physikalische und chemische – also physiologische – Prozesse in unserem Gehirn gebunden.«
»Wie würden Sie Bewusstsein definieren?«
»Es dient dem Wahrnehmen, um Informationen zu liefern. Es wird besonders dann aktiviert, wenn etwas im Selbst einen stärkeren Wert bekommt.«
»Und woher wissen wir, dass wir selbst Bewusstsein haben?«
»Weil es nicht nur ein Netz, einen Mittelpunkt, sondern viele gibt, die sich gegenseitig betrachten können. Dies ist, sozusagen, der ›Geist‹ des Menschen. Sie betrachten das Betrachten.
Die Außen- und die Innenwelt werden im Gehirn durch neuronale Netze abgebildet. Wenn diese von einem anderen Netz beobachtet werden, dann kann es bewusst werden – je nachdem, welchen Wert das Beobachtete hat.«
»Bewusstsein wird auch gleichgesetzt mit Geist«, sagte ich, »im Sinne einer immateriellen Kraft.«





























