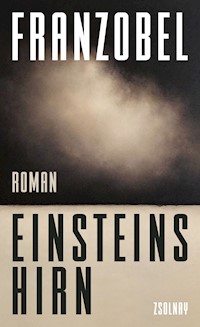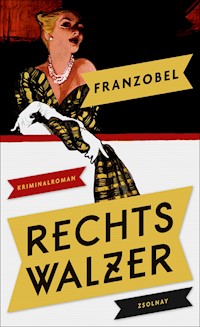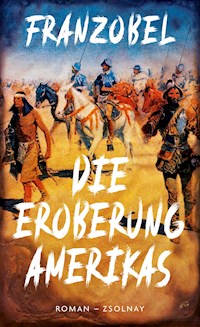
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Feuerwerk des Einfallsreichtums: Nach dem Bestseller „Das Floß der Medusa“ begibt sich Franzobel in seinem neuen Roman auf die Spuren eines wilden Eroberers der USA im Jahr 1538. Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp fünfhundert Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner. Franzobels neuer Roman ist ein Feuerwerk des Einfallsreichtums und ein Gleichnis für die von Gier und Egoismus gesteuerte Gesellschaft, die von eitlen und unfähigen Führern in den Untergang gelenkt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Ferdinand Desoto hatte Pizarro nach Peru begleitet, dem Inkakönig Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Sklavenhandel ein Vermögen gemacht. Er war bereits berühmt, als er 1538 eine große Expedition nach Florida startete, die eine einzige Spur der Verwüstung durch den Süden Amerikas zog. Knapp fünfhundert Jahre später klagt ein New Yorker Anwalt im Namen aller indigenen Stämme auf Rückgabe der gesamten USA an die Ureinwohner.Franzobels neuer Roman ist ein Feuerwerk des Einfallsreichtums und ein Gleichnis für die von Gier und Egoismus gesteuerte Gesellschaft, die von eitlen und unfähigen Führern in den Untergang gelenkt wird.
Franzobel
Die Eroberung Amerikas
Roman nach wahren Begebenheiten
Paul Zsolnay Verlag
Für Ramona — und die Völker, deren Lieder nicht mehr gesungen werden
»Eroberer haben sich noch nie mit Ruhm bekleckert.«
Joseph Conrad, Herz der Finsternis
Independence Day
Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein. Manchmal ist etwas Wahrheit, auch wenn es nicht erkannt wird. Geschichte wird geschrieben, ist parteiisch, voller Skurrilitäten. Sonnenkönig Ludwig der Vierzehnte etwa war ein gefräßiger, zahnloser Fettwanst, dem beim Essen Suppe aus der Nase spritzte. Albert Einsteins Hirn wurde von einem Pathologen gestohlen und vierzig Jahre durch die Provinz gekarrt. Papst Innozenz der Achte war so fett, dass kleine Monde um ihn gekreist sind. Nein, aber er musste im Bett von Dienern gewendet und von jungen Frauen gestillt werden. Abraham Lincoln wurde von einem Schauspieler erschossen, und George Washington starb, weil ihm Ärzte beim Aderlass zu viel Blut abgezapft hatten. Der Leiche Karls des Fünften wurde der kleine Finger gestohlen, und … nicht zu fassen, was da alles ans Licht kommt … Christoph Kolumbus hat Amerika nur aufgrund eines Rechenfehlers entdeckt.
Und solch historische Persönlichkeiten werden bei Festumzügen herumgeschleppt? Die Parade in Gettysburg erreichte ihren Höhepunkt. Musikkapellen spielten »The Star-Spangled Banner«, und Männer in historischen Uniformen stelzten im Stechschritt hinterdrein. Planwagen, ein Weißkopfadler aus Polyesterharz und aufgeblasene Präsident-Lincoln-Puppen.
Amanda Burmaster hätte nicht im Büro sein müssen, aber ihr Schreibtisch quoll über von Briefen von Kriegsveteranen, die ihre posttraumatischen Belastungsstörungen nicht länger mit Antidepressiva bekämpfen wollten, sondern Marihuana forderten.
Auf der Straße zogen Indianer vorbei. Motorradfahrer mit der Flagge der Konföderierten und Kinder mit »Moms with Guns«-Schriftzügen auf T-Shirts. Im Bezirksgericht las die Sekretärin Veteranengeschichten, in denen von Kabul und Mossul die Rede war. Ein Schreiben wie das andere. Einer litt unter Panikattacken, der Nächste hatte mit Schlaflosigkeit zu kämpfen, ein anderer bekam Schreikrämpfe, wenn er Kinder sah, und dann war da ein Brief, der aus der Reihe tanzte. Dass sich ein Veteran einen Anwalt leistete, war ungewöhnlich. Einen aus Manhattan: »Trutz Finkelstein und Partner« stand in eleganten Lettern auf dem Kuvert. Sie öffnete den Umschlag, nahm den Brief heraus, las die Zeilen und verschluckte sich. Ihre Augen wurden Tischtennisbälle und hüpften fast aus den Höhlen. Dann las sie den Text noch einmal und merkte, wie ihre Hände anfingen zu zittern.
— Heilige Dreifaltigkeit! Wenn das durchgeht, können wir einpacken. Aber nein, das wird nicht durchgehen. Das darf nicht sein. Sie schüttelte den Kopf.
Draußen marschierte eine Delegation der Waffenlobby vorbei. Die meisten hatten den zweiten Zusatz der Verfassung auf ihren T-Shirts stehen, andere hielten halbautomatische Bushmaster, AR-15-Gewehre oder Deringer-Pistolen in die Höhe. Waffen, die ihnen nichts nützen würden gegen diesen Brief, den die verdatterte Sekretärin nun ein drittes Mal las. Trutz Finkelstein und Partner wollten dem Land das Fell über die Ohren ziehen, diese Verrückten verlangten nichts Geringeres als die Rückgabe der Vereinigten Staaten von Amerika an die Indianer, einschließlich Hawaii und Alaska. Das war … ungeheuerlich! Wahnsinn! Gestern war heute noch morgen, und übermorgen wird morgen gestern sein. Manchmal ist die Wahrheit wahr, auch wenn sie nicht erkannt wird. Geschichte ist parteiisch, voller Skurrilitäten.
Doch bevor wir auf diesen Brief zurückkommen, machen wir einen Sprung durch Raum und Zeit und begeben uns zur Ursache dieses abstrusen Ansinnens, in eine Zeit, in der sich die medizinische Versorgung auf Zahnzieher und Steinschneider beschränkt hatte und Schusswunden mit Aderlässen und siedendem Öl behandelt wurden, in die Epoche der Eroberung Amerikas, zum Urverbrechen des Kolonialismus, der Conquista, und zwar zu einer Episode, mit der sich Trutz Finkelstein und Partner intensiv beschäftigt hatten, um ihre Klage zu begründen — zu Hernando de Soto, oder, wie wir ihn nennen: Ferdinand Desoto.
Geruch von Schnee
Put, put, put, das Näschen. Obwohl kein Engelsfurz den Abendhimmel zierte und die vom Meer kommende Brise wohltuend warm war, roch es nach Schnee. Davon ließen sich die mexikanischen Fischersfrauen, die weder wussten, dass sie Mexikaner waren, noch sich je als Fischersfrauen bezeichnet hätten, nicht irritieren.
— Put, put, put, das Näschen, und ich bin ein Häschen, hielt sich ein Mädchen einen Bommel an den Steiß und wackelte obszön mit dem Hintern. Nun packte sie zwei Fische und hielt sie sich wie Hasenohren neben das Gesicht. Sie schob die Vorderzähne vor, zog Nasenfalten, kniff die Augen zusammen und sagte etwas von Rammeln, Karnickel, Hasenstall und küsste einen Fisch. Alle lachten — die Dorfälteste so sehr, dass man fürchtete, sie würde sich das Unterkiefer ausrenken. Die Häsin ging in die Knie, wackelte mit dem Bommel und ignorierte den Geruch von Schnee.
Niemand beachtete das Kindergeschrei. Die Kleinen waren immer laut. Mal, weil eine Schildkröte aus dem Wasser kam, mal, weil sie ein Kapuzineräffchen entdeckten oder eine Qualle. Die Netze flickenden Frauen sahen lieber der närrischen Häsin zu. Sie genossen die Abendsonne und stimmten in den Refrain eines zweideutigen Liedes ein, das von Liebe, Eifersucht und Put, put, put, dem Hühnerverb, handelte, als die Schreie der Kinder hysterisch wurden. Endlich wandten die Weiber ihre Köpfe, doch da war es zu spät, sie kamen sich vor wie Feldhasen, die ein Bataillon mähender Sensenmänner zu spät bemerkt hatten. Ihnen wurde heiß vor Aufregung und kalt vor Schrecken.
Erst sahen sie die goldglänzenden Spiegelungen im glatten Meer, dann die bedrohlich aufgetürmten Wolken, schließlich Schiffe. Schiffe? Notdürftig zusammengezimmerte Hasenställe, die Schatten ausspuckten. Schatten? Bärtige, in Lumpen gekleidete Außerirdische, die durch die Brandung wateten und, kaum hatten sie trockenen Boden unter den Füßen, auf sie zuliefen. Es waren dutzende. Eine Horde Zombies. Helme, Brustharnische und Büchsenläufe funkelten, andere waren fast nackt. Und ehe die Frauen den Mund aufbrachten, um nach ihren Männern zu rufen, die besoffen in strohgedeckten Hütten dösten, waren die Gestalten auch schon da. Mokkabraune Kerle mit verwundeten Blicken. Die Typen umarmten die Frauen, die nun nicht mehr lachten, mit ausgemergelten, aber kräftigen Armen und drückten ihnen angefaulte Zahnstummel in die Wangen. Nein, Küsse.
Put, put, put, das Hühnerverb, sie rannten ihnen hinterher, warfen sie zu Boden, griffen ihnen in den Schritt. Die Frauen kreischten. Manche flohen oder versuchten, sich zu verstecken, wurden geschnappt, gedrückt und abgeschmatzt. Alle schrien. Als ihnen ihre Männer zu Hilfe kamen, ließen die Außerirdischen von den Frauen ab, liefen auf die verblüfften Fischer zu, umarmten auch sie und riefen:
— Hunger. Durst! Wir waren vier Jahre lang im Land der Wilden und freuen uns, wieder in der Zivilisation zu sein.
Zivilisation? Das Fischerdorf im Norden Mexikos hatte nicht einmal einen Namen. Seine Bewohner nannten es Tante Zwiebel, weiß der Teufel, woher diese Bezeichnung stammte.
Ohne sich lange aufzuhalten, fielen die Eindringlinge über die Vorräte her. Schamlos verschlangen sie rohen Fisch und Mais, sämigen, aber kalten Erbsenbrei, Wurzeln und Zwiebeln. Nur einer war tiefbewegt, weinte und versuchte das Geschehen den verwirrten Dorfbewohnern zu erklären. Cord Fenk, Sohn eines niederländischen Wurstmachers, Arzt, dessen Äußeres genauso wenig vertrauenerweckend wirkte wie das der anderen — zerschlissenes Leinenhemd, zerfetzte Hose, verfilzte Haare, Bart. Er sprach von der Ferdinand-Desoto-Expedition, Florida, Indianern, Kämpfen, Perlen, und dass man, stimmte die Rechnung, das Jahr 1543 schrieb, den 12. Oktober?
— Über den Tag streiten wir seit Monaten. Was ist in den vergangenen vier Jahren passiert? Gab es Krieg? Haben wir den Weltuntergang verpasst?
Er erwähnte Kaiser Karl den Fünften, in dessen Namen man Florida erobert hatte, und verkündete den Dorfbewohnern, dass sie sich glücklich schätzen könnten, weil ihnen als Bürger Spaniens ein goldenes Zeitalter bevorstünde. Spanien? Karl der Fünfte? Die Fischer hatten nichts von ihm gehört, sie verstanden ja nicht einmal die Sprache!
— Du glaubst doch nicht, die kapieren, was du sagst? Ein Soldat klopfte ihm auf die Schulter.
Und tatsächlich, Cord Fenk sah in verständnislose Gesichter. Zivilisation! Die Zivilisation würde nicht verstehen, was sie erlebt hatten. Vielleicht wäre es besser, diese Geschichte niemandem zu erzählen? Er sank in die Knie und dachte an die Eintöpfe Kastiliens mit Kichererbsen, Blutwurst, Speckstreifen und Meeraal, nach denen er sich seit Jahren sehnte. Was gäbe er jetzt für eine Flasche Rioja, Ibérico-Schinken und holländischen Käse. Auch Paula, seine Verlobte, kam ihm in den Sinn. Was aus ihr geworden war? Nimm mir etwas mit, hatte sie gesagt, das Erste, was dir vor die Füße fällt. So wie in dem Märchen »Drei Nüsse für Aschenbrödel«. Und hatte er ihr etwas mitgebracht? Etwas anderes als Indianerwörter?
Er sah Soldaten, die den Fischern von ihren Heldentaten vorschwärmten, von schier aussichtslosen Kämpfen gegen Menschenfresser und wilde Tiere, von goldenen Palästen und Kisten voller Perlen in fernen Königreichen. Die Leute von Tante Zwiebel hingen an ihren Lippen, obwohl sie nichts verstanden, und Cord Fenk wusste, dass es so nicht gewesen war … Er staunte über die Unbekümmertheit, mit der sich die anderen mühelos wieder in der Welt zurechtfanden, und ahnte, dass man das auch von ihm verlangen würde. Die Kommissionen in Spanien brauchten solche Geschichten, um weitere Expeditionen nach Westindien zu finanzieren. Sie würden ihn bitten, pragmatisch zu sein und die Wahrheit ein bisschen zu verbiegen. Davon, dass man ihren Führer Ferdinand Desoto vergiftet hatte, würde man nichts wissen wollen. Es würde keine Untersuchung geben, und kein irdisches Gericht würde den Mörder je belangen.
Fenk sah den am morastigen Boden liegenden Bommel, mit dem das Mädchen gerade noch gespielt hatte, und fühlte sich schuldig, schuldig, ein Zurückgekommener zu sein, dieses vierundfünfzigmonatige Abenteuer überstanden zu haben. Mehr als die Hälfte der Expeditionsteilnehmer war nicht mehr am Leben, er aber, Cord Fenk, hatte es geschafft. Zumindest seine Haut hatte er gerettet. Er dankte Gott, blickte zum Himmel, sah die Wolkentürme und fühlte erste Tropfen im Gesicht. Schnee? Nein, in Mittelamerika schneite es nicht, das war Hagel!
Während die kleinen weißen Körner alles bedeckten, landete ein weiteres Schiff am Ufer, wateten vier Indianer mit einem Baldachin an Land, unter dem ein würdevoller Mann einherschritt. Der Mensch trug eine für dieses Klima unpassende Robe, einen flachen Hut und eine goldene Kette, die ihn als Vertreter Spaniens auswies. Aber was war mit seinem Gesicht? Er hatte keins!
— Sind Sie Richter?, schrie ihm Cord von weitem zu. Wenn Sie gekommen sind, den Anteil des Königs zu fordern, waren Ihre Mühen vergeblich. Wir haben nichts erbeutet.
— Sind das die Männer der Desoto-Expedition? Der Ankömmling sprach mit ruhiger, sonorer Stimme. Er hielt einen Hund in Händen, einen bellenden Rauhaardackel. Mein Name ist Turtle Julius, ich bin Notar und suche einen Ambrosio Bastardo.
— Was hat der angestellt? Bastardo? Cord dachte an das rattenähnliche Gesicht dieses kleinen Gauners, der gemeinsam mit seinem Kumpan Cinquecento während der gesamten Expedition nur Unheil angerichtet hatte.
— Er ist zum Alleinerben des Grafen von Orgaz bestimmt. Ich bin seit fünf Jahren unterwegs, um es ihm mitzuteilen — er ist ein gemachter Mann. Abzüglich meiner Spesen beläuft sich sein Vermögen auf hundertachtundsiebzigtausend Golddukaten, Ländereien, Weinberge, zwei Schlösser samt Falknerei, ausgedehnte Wälder, vierzehn Mühlen, davon eine für Papier, eine für Draht, und acht Jagdhunde. Dieser nicht, der ist mir zugelaufen, er streichelte den Dackel. Im selben Moment begann das Tier zu kläffen, sprang aus Turtle Julius’ Händen, lief zu einem auffällig bunt gekleideten Menschen und hüpfte an ihm hoch.
— Ramses! Der Mann quietschte vor Freude. Der Hund bellte wie verrückt. Immer noch roch es nach Schnee.
Heiliger Bimbam
Holen wir kurz Luft und blicken in die Heimat jener Rückkehrer, die gerade über die Fischersfrauen hergefallen sind, die Extremadura, das Burgenland Spaniens … also die am wenigsten entwickelte Region — sonst wäre Kastilien das Burgenland. Extremadura? Bereits der Namen verrät, die Landschaft und die Menschen sind extrem — mutig, hart und verschlossen. Nicht von ungefähr kommen so gut wie alle Konquistadoren aus dieser Gegend. Wenn man aber nach Desoto fragt? Risotto? Wer? Ferdinand?
Menschen machen alles lächerlich, sehen nur das Böse. Also ist auch die Eroberung Amerikas für viele ein Gemetzel verrohter Abenteurer, die in lächerlich aussehenden Ballonhosen und mit federgeschmückten Helmen ganze Völker ausgerottet, Landstriche verwüstet und Kunstschätze vernichtet haben sollen. Gräuel, bei denen einem die Luft wegbleibt. Aber ist der moderne Mensch in der Lage, das zu beurteilen?
Wir sind noch am Luftholen und fragen: Darf man den Geschichtsbüchern glauben? Geschichte wird von Siegern geschrieben, von denen, die Geld und Einfluss haben. Andere Sichtweisen werden abgewürgt oder lächerlich gemacht. Warum sollte es der indigenen Bevölkerung Amerikas besser gehen? Was waren das für Leute? Marihuana rauchende, Peyote fressende und Powwows veranstaltende Wilde, die mit Federschmuck um Lagerfeuer tanzten? Leute, deren Nachfahren Casinos betreiben und auf Minderheitenrechte pochen?
Die Chance ist gering, heutzutage einen Menschen des 16. Jahrhunderts zu treffen. Es wird niemanden geben, der bei der ersten Begegnung zwischen Weißen und Indianern dabei gewesen ist. Es wird sich keiner finden, der von einem eine butterweiche Menschenleber verspeisenden Kariben berichtet, von indianischen Kochtöpfen, aus denen Kinderbeine ragen. Niemand hat die Zeremonien, Drogenexzesse und Massenhinrichtungen erlebt oder den von Frauenbrüsten träumenden Mönch gekannt, der im Delirium Amazonenstämme erfand und dem größten Strom Südamerikas den Namen gab.
Eroberer prangen an Hausfassaden, auf Münzen, Bierdosen oder Briefmarken: Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Lope de Aguirre und noch ein paar Namen, durch die ein R rollt wie eine Erntemaschine über einen Hasenbau. Spanien nennt sie Entdecker oder »freundschaftliche Völkerverständiger«, dabei waren sie Brutalos, die unter dem Vorwand der Christianisierung unfassbare Grausamkeiten begingen.
Europa hält sich für das Zentrum der Welt, dabei stammen die wichtigsten Erfindungen aus Asien: die Schrift, das Zahlensystem, der moderne Pflug, das Schießpulver, bewegliche Lettern für den Buchdruck, Steigbügel. Was haben die Europäer erfunden? Die Zeit — und in ihrer Folge Mittel, sie zu überwinden. Die Europäer sind Eroberer. Alles haben sie in Beschlag genommen, ausgebeutet, und immer wurde ihnen die Zeit knapp. Das Christentum ist eine Religion der Endzeit, ein Glaube an die Zählung. Vierzig Jahre in der Wüste, drei Tage bis zur Auferstehung, und am Sonntag, dem 23. Oktober 4004 vor Christus, wurde, wie der Bischof von Armagh anhand der biblischen Genealogie errechnet hat, die Welt erschaffen … Aber darf man, heiliger Bimbam, das Christentum für alles verantwortlich machen? Nein, sämtliche Völker werden von einem Willen zur Übernahme angetrieben. Schon der Homo sapiens hat den Neandertaler verdrängt, die Mongolen kamen bis Finnland und die Mauren bis zu den Pyrenäen.
Menschen waren meist vulgär, scheußlich und unmoralisch, haben einander bekämpft, gefoltert und getötet. Warum sollten die spanischen Konquistadoren anders gewesen sein? Ist die Geschichte des aus der Extremadura stammenden Ferdinand Desoto, der 1539 Florida erobern wollte, eine von Barbarei und Entmenschlichung? Oder war seine Expedition mitfühlend, vernünftig, human? In jedem Fall ist dieses erfolgloseste aller spanischen Unternehmen eine gute Geschichte, die Geschichte von einem Eroberer, seiner Frau und ihrem Geliebten, kein Greenaway-Film, von einem Schiffbrüchigen, einem Arzt und zwei Gaunern.
Doch bevor wir uns in die dicke Luft der Eroberer begeben, zu dem niederländischen Arzt und Wurstmachersohn Cord Fenk zurückkehren und flacher atmen müssen, wechseln wir den Schauplatz und werden im Wortsinn ins kalte Wasser dieser Geschichte geworfen, wo wir einem Luftikus begegnen.
Elias Plim
»Mann im Wasser!«, schallte es vom Krähennest. Der Kapitän, von einem breitkrempigen Filzhut beschattet, kaute an einer verkohlten Hühnerkeule, warf den abgenagten Knochen über Bord und griff zum Fernrohr. Es dauerte, bis er in der azurblauen Fläche das kleine Objekt gefunden hatte, an das sich ein Körper klammerte. Mann im Wasser? Ein Schiffbrüchiger? Mitten im Weltmeer? Hundert Seemeilen nordwestlich von Madeira?
Der frischgewählte Korsarenkapitän, eine Narbe zerteilte sein Gesicht wie der Vertrag von Tordesillas die Welt in eine spanische und eine portugiesische Reichshälfte, ließ die Schaluppe fieren und gab Befehl hinzurudern, um den Mann zu retten. Als die Freibeuter das seltsame Objekt, diese Vorstufe eines Surfbretts, erreicht hatten und den durchweichten, leblosen Körper sahen, das mehlsuppengraue Gesicht, bekreuzigten sie sich an Brust und Stirn. Der Kerl war hinüber, hatte sich im Todeskampf an eine Tür geklammert und trieb nun wahrscheinlich Ewigkeiten durch die See, um irgendwann im Verdauungsstrakt von Haien zu landen. Aber war sein Bauch schon aufgetrieben? Hatte er die für Wasserleichen typische grünstichige Gesichtsfarbe? Wuchsen ihm Algen aus den Ohren? Nein.
Ein Pirat betastete die durchnässte Kattunhose, hoffte auf einen Geldbeutel oder Wertsachen. Als er ihm das Lederband vom Hals riss und mit Mühe die abgewetzte Inschrift »Elias Plim« auf dem Metallplättchen entzifferte, öffnete der bleiche Hautlappen die Augen, blickte seinem Retter und Räuber, den dabei fast der Schlag getroffen hätte, ins Gesicht, bekam einen katatonischen Anfall und fiel gleich darauf zurück ins Koma. Als man ihn in das Rettungsboot hievte, stieß sein Kopf gegen das Dollbord, und selbst da zuckte der Bewusstlose nur leicht.
— Elias Plim, sagte der Kapitän der Seestern, während er in eine Hühnerbrust biss. Elias Plim? Sprichst du Französisch, Spanisch, Italienisch? Bist du Engländer, Holländer oder ein Maure? Rede, Elias Plim! Woher kommst du? Oder bist du eine Meergeburt? Der französische Korsarenkapitän mit unaussprechlichem Namen — einer Mischung aus Giscard d’Estaing, Gérard Depardieu und Chateaubriand — gab dem Schiffbrüchigen eine Ohrfeige und brüllte: Antworte, Elias Plim! Wer bist du? Was machst du hier? Wieso willst du auf einer Tür über den Ozean? Hast du den Verstand verloren? Als ihm die Absurdität seiner Fragen bewusst wurde, trat er dem von zwei Seeleuten gestützten Schiffbrüchigen gegen das Schienbein und schrie aufs Neue:
— Wenn ich etwas nicht leiden kann, du Landfisch, dann Verstocktheit.
Ausgestattet mit einem von König Franz dem Ersten unterfertigten Freibeuterbrief, war der Kapitän mit der nussschalenförmigen Galeone unterwegs, um spanische Karavellen aufzubringen, die Gold von Westindien, wie man Amerika damals nannte, nach Sevilla brachten. Genau genommen waren sie also keine Piraten, auch wenn wir das Wort weiter verwenden, sondern Freibeuter oder Kaperer … Auf alle Fälle waren sie die erfolglosesten Seeräuber aller Zeiten — Vorbilder für Enternix, Dreifuß und Baba im »Asterix«.
Seit mehr als einem Jahr waren sie nun unterwegs, ohne nur eine einzige Prise gemacht zu haben. Abgesehen von Fischern vor Madeira, von denen sie ausgelacht wurden, war ihnen niemand vor den Bug gekommen. Sämtliche Schiffe, die sie gekreuzt hatten, waren dickbauchige Kähne, die Sklaven von Westafrika nach Übersee brachten. Die Bedingungen auf diesen Kuttern waren derart grauenvoll, dass sich ein Gutteil der Sklaven aus dem Leben stahl, womit sie ihren Besitzer um sein Eigentum brachten, gegen das siebte Gebot verstießen und somit ewig in der Hölle schmoren mussten. Der Gestank der halbverfaulten Leichen im Unterdeck war derart erbärmlich, dass man diese Kähne hundert Meilen gegen den Wind roch. Manchmal breiteten sich Cholera und Typhus aus, rissen Löcher in die Mannschaften. Es soll vorgekommen sein, dass alle abkratzten und die Schiffe führerlos über den Ozean trieben, von Vögeln gekapert wurden und mit zugeschissenen Skeletten und fetten Kackvögeln ein derart skurriles Bild abgaben, dass jeder, der so ein Geisterschiff zu Gesicht bekam, um seinen Verstand fürchten musste. Trotzdem würde man im 16. Jahrhundert keine Seele finden, die sich ernsthaft über den Sklavenhandel, das sogenannte »kreolische Geschäft«, entrüstete.
Die einzigen Spanier, die der Seestern begegnet waren, segelten in Formation und waren zu viele, um sie anzugreifen. Die französischen Freibeuter hatten La Gomera umsegelt, waren vor Teneriffa und Madeira gelegen, bis zu den Azoren geschippert, aber egal, wo sie kreuzten, die Spanier schienen an ihnen vorbeizukommen wie an einem von Ameisen bewachten Burgtor. Und ausgerechnet jetzt, da sie beschlossen hatten, ihr Glück in der Karibik zu suchen, stießen sie auf diesen Schiffbrüchigen.
Elias Plim, der Luftikus, hatte minutenlang gehustet, bestimmt sechs Liter Seewasser ausgespien. Nun blickte er auf die holländische Flagge am Besanmast, sah die eingerollte Blutfahne und hörte französische Flüche, die wie »Erde« und »Gülle« klangen. Froschfresser! War er gerettet? Ein Blick auf die Besatzung sagte alles. Plims Vorstellung von Piraten war nicht von Hollywoodfilmen geprägt, und auch wenn hier niemand ein Tuch am Kopf trug, weder Holzbein noch Eisenhaken oder Augenklappe vorzuweisen hatte, wusste er, diese bärtigen Gentlemen mit den wenigen Zähnen in den zerrissenen Mündern, den zerschlissenen Kleidern, abgewetzten Stulpenstiefeln waren kein Alumni-Verein auf Sommerfrische, sondern Seeräuber. Selbst der mit den Resten des Huhnes beschäftigte Kapitän machte keinen seriösen Eindruck.
Elias Plim war vor dem Ertrinkungstod gerettet, dafür aber auf einem Korsarenschiff gelandet. Er sah Männer mit gegerbten Gesichtern Segel flicken und Taue spleißen, andere hockten auf Fässern und würfelten mit der Langeweile um die Wette. Ein paar waren so betrunken, dass sie nicht mehr stehen konnten, andere putzten ihre Säbel oder machten sich an den Kanonen zu schaffen. Nur der Kapitän versuchte mit einer Karte, ihre Position auszumachen. Er warf einen Blick zu seinen Männern und schüttelte den Kopf.
— Ästhetik, ihr verlauster Haufen! Wir sind Franzosen, bekannt für Stil und Eleganz. Und ihr? Wie seht ihr aus?
War Plim also gerettet? Schaurige Geschichten hatte er gehört. Piraten ließen ihre Gefangenen Kakerlaken schlucken, nagelten sie an den Ohren an die erste Rah, brandmarkten sie mit rotglühenden Eisen oder ließen sie kielholen. Aber war er ihr Gefangener? Er sah Männer mit Kübeln voller Pech und Schwefel, und als ihn jemand an den Ohren zog, fürchtete er bereits das Schlimmste.
Wir schreiben also das Jahr 1537. Die Welt war größer geworden. Zuerst hatte die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gensfleisch die Kommunikation revolutioniert, dann erlebte ein Mönch mit starkem Bartwuchs und Beichtzwang bei der Notdurft sein »Turmerlebnis«, das der katholischen Welt gewaltig auf den Kopf fallen sollte. Anfangs verweigerte der erleichtert Erleuchtete jeglichen Kotau, dann soll er das Kirchenportal zu Wittenberg geschändet haben … Tatsächlich hat Luther seine Thesen gar nicht an das Kirchentor geschlagen, was bei der damaligen Alphabetisierungsrate auch völlig unsinnig gewesen wäre, sondern hat sie dem Erzbischof von Mainz geschickt. Der englische König forderte vom Papst die Annullierung seiner Ehe, was dieser ablehnte, weil ihm der Bart des Angelsachsen nicht gefiel. Damit war dem christlichen Abendland ein Rasiermesser angesetzt, das ihm ein Jahrhundert später mit dem Dreißigjährigen Krieg in die Gurgel fahren sollte. Und alles nur, weil der wohlbeleibte Tudor mit seiner verhärmten Spanierin keine Söhne zuwege brachte. Im Reich des Habsburgers Karl des Fünften, eines gichtkranken, humorlosen Fanatikers mit einem so veritablen Unterkieferproblem, dass es nicht einmal Tizian beschönigen konnte, machte den Menschen die Inflation zu schaffen, von der niemand verstand, dass sie mit den steigenden Silber- und Goldlieferungen aus der Neuen Welt zusammenhing. Die Portugiesen ärgerten sich über ihre Rechenkunst, die unzweifelhaft bewiesen hatte, dass Kolumbus’ Route unrentabel war, weil der Weg nach Indien in westlicher Richtung viel zu weit war. Wer hatte ahnen können, dass die Königin von Kastilien mathematischen Dilettanten vertraute, dem Genueser auf den Leim ging, und dieser das Glück hatte, auf einen unbekannten Kontinent zu stoßen?
Der Preuße Kopernikus hatte die Erde zu einem kleinen, lächerlichen Trabanten der Sonne degradiert. Der Straßburger Satiriker Sebastian Brant sah die Gesellschaft als Schiff voller Narren, und Rabelais arbeitete an seinem »Pantagruel«. In der Medizin kritisierte ein verfetteter Schweizer die vorherrschende Viersäftelehre, Machiavelli schrieb an einer Komödie, und die meisten großen Geister rückten den Menschen und die Antike in das Zentrum ihres Denkens, zumindest beriefen sie sich auf griechische Philosophen, die keiner kannte. Die katholische Kirche entwickelte Methoden, um ihre Macht gegen die Reformierten zu behaupten, und an der Lambertikirche zu Münster hingen noch die Eisenkäfige mit den verrotteten Leichen der ein Jahr zuvor zu Tode gefolterten Wiedertäufer.
Aus heutiger Sicht war das 16. Jahrhundert vor allem eines: brutal. So als hätte die Mafia sämtliche KZ-Aufseher zu einem Wettbewerb in Sachen Grausamkeit herausgefordert. Da wurden Menschen gevierteilt, bei lebendigem Leib zersägt oder mit zerstoßenen Gliedern auf ein Rad geflochten. Dass man zur Steigerung des Spektakels den Unglücklichen zuvor noch mit glühenden Zangen die Brustwarzen ausgerissen und flüssiges Blei, Teer und Schwefel in die Wunden gegossen hat, sei nur nebenbei erwähnt. Brutal? Nein, ungeheuerlich, menschenverachtend, maßlos grausam.
Verglichen mit den willkürlichen Herrschern war die Inquisition ein altruistischer Anglerverein, dabei folterte, verbannte und verbrannte auch das Heilige Offizium. Schlimm, dass damit das Denunziantentum fröhliche Urständ feierte, Unschuldige der Wahrsagerei, Bigamie, Sodomie, Dämonenanrufung, Beleidigung von Kirchenglocken, Hostienschändung, Nichteinhaltung der Fastenregeln oder anderer Abstrusitäten beschuldigte, sich niemand mehr seiner Haut sicher sein konnte — und zwar wortwörtlich. In der Neuen Welt machte die indigene Bevölkerung Bekanntschaft mit den Lehren Christi und wurde abgeschlachtet. Als ob das nicht genug wäre, wüteten auf dem Balkan noch die Türken. Ganz Europa zog sich zusammen wie Schnecken im Salz, und das Salz waren die Osmanen.
Daneben fand ein ganz normales Leben statt, mit Liebeskummer, Geldsorgen, Heiratsplänen, Kochrezepten. Menschen erfreuten sich an der Lektüre des »Amadis de Gaula« … bewunderten die Bilder Arcimboldos und Hieronymus Boschs … staunten über apotropäische Figuren an Häuserfassaden, machten Bekanntschaft mit Kartoffeln, Kakao und Tabak, stachen sich an der Ananas, ärgerten sich über die unverschämten Teuerungswellen und sahen im unbeständigen Klima ein Vorzeichen des Jüngsten Gerichts.
Von all diesen Entwicklungen wusste Elias Plim wenig. Er hatte sich noch nie für Politik interessiert und immer in Phantastereien gelebt. Zudem verstand er die französische Sprache schlecht, wusste nicht, was ihn hier auf dem Korsarenschiff erwartete. Mit seinen zwanzig Jahren hatte er schon so viel erdulden müssen, dass er sich jetzt lieber stumm stellte.
— Wie der Einfaltspinsel bisher überlebt hat, ist mir ein Rätsel. Ein Pirat tätschelte seine Wange, versetzte ihm einen Klaps, aber Plim atmete auf, als er sah, dass die Pech- und Schwefelkübel zum Ausräuchern des Ungeziefers im Unterdeck verwendet wurden.
— Trink! Der Kapitän mit dem unaussprechlichen Namen reichte ihm eine bauchige, schilfumflochtene Weinflasche. Dein Glück, dass wir Flaute haben, sonst wärst du jetzt Fischfutter. Wir unterhalten uns später. Seine Narbe glänzte in der Sonne, und zwei Zähne blitzten im Gesicht.
— Sollen wir ihn zum Reden bringen? Ein Pirat packte Plims Haar, riss ihm den Kopf nach hinten.
— Noch nicht. Der Kapitän war von der Mannschaft gewählt worden, weil er schussfest und tapfer war, geschickt verborgen hatte, dass er Grausamkeiten verabscheute. Den Männern reichte sein Herumnörgeln an ihrer Kleidung, sein Beharren auf Schönheit und Ästhetik.
Der Finger des Kaisers
Spanien, 19. Jahrhundert. Kurz vor der Ausrufung der ersten Republik werden die Särge der Könige geöffnet. Revolutionäre wollen dem Volk zeigen, dass ihre früheren Herrscher gewöhnliche Sterbliche gewesen sind. Und was kommt zum Vorschein? Philipp der Zweite ist ein Häufchen Elend, Philipp der Dritte ziemlich ramponiert, und auch Philipp der Vierte hat schon einmal besser ausgesehen, nur Karl der Fünfte, Stammvater aller Philipps, ist erstaunlich gut beisammen, wenn man bedenkt, dass er über dreihundert Jahre Zeit gehabt hat zu verwesen. Einem Leonardo di Caprio hätte er keine Konkurrenz gemacht, in den Augenhöhlen wohnen Spinnen, das Nasenbein ist von brüchiger Haut bedeckt, und die Zähne gleichen den Zehen eines Greises, doch die herben Gesichtszüge sind zu erkennen, selbst der Vollbart lässt sich erahnen.
Am 14. September 1870 steckt der Student Raimundo Fernández Villaverde, Markgraf von Pozo Rubio, einem Wächter zwanzig Reales zu, bittet ihn, kurz wegzusehen, und bricht dann dem toten Kaiser den kleinen Finger seiner linken Hand ab — wie einen Milchzahn reißt er ihn aus. Das Geräusch erinnert an das Zerteilen eines Brathuhns. Was den nachmaligen Ministerpräsidenten zu dieser Tranchieraktion bewogen hat? Weder ist es eine Wette, noch hat er Verwendung für den imperialen Knochen. Damit rührt man schließlich nicht den Tee um oder pult sich Speisereste aus den Zähnen. Fingerfood gibt es nicht. Raimundo Fernández Villaverde, Markgraf von Pozo Rubio! Wir erwähnen diesen Namen, lang wie eine Eisenbahngarnitur, damit Sie die Geschichte überprüfen können.
War der Finger des einst mächtigsten Herrschers, mit dem der Kaiser in der Nase gebohrt und sich an geheimen Körperstellen gekratzt hat, ein Glücksbringer? Eine habsburgische Hasenpfote? Die Geschichte dieses kleinen Fingers endet hier nicht, doch springen wir vorerst zurück in jene Zeit, als die kaiserlichen Hände noch vollzählig waren, zum 20. April 1537: An diesem Freitag nämlich hat Karl der Fünfte mit seinem Digitus minimus — dem kleinen Finger — Muster in den Tisch gezeichnet und sich am Kinn gekratzt. Es war der Tag, an dem Ferdinand Desoto den kleinen Finger der heutigen USA bekam — Florida.
Wir befinden uns in Valladolid, wo damals das reinste royale Spanisch gesprochen wurde. Dicke Schneeflocken taumeln vom Himmel, die Menschen lächeln über dieses Naturschauspiel. In den Nasen stecken Kälte und abgestandener Rauch von Glutnestern. Wie hypnotisiert ist Ferdinand Desotos Blick auf diese Scheiterhaufenreste gerichtet. Hier hatte Feuer Fleisch gefressen, Menschen zu Staub gemacht — dagegen war ein abgetrennter Finger ein Klacks. Nein, keine Verbrennungen von Stellvertretern, keine Puppen in der Kleidung von Verurteilten, sondern richtige Menschen, Fleisch und Blut waren hier abgefackelt worden.
Scheiterhaufen waren im 16. Jahrhundert populär. Es gab weder Fernsehen noch Internet. Die Theater waren so schlecht, dass dem Publikum die Füße einschliefen, Fußball war noch nicht erfunden, und Stierkämpfe fanden nur zu Festtagen statt. Was blieb, waren Hinrichtungen — Köpfen, Rädern, Vierteilen. Schleifen, Hand abhacken, flüssiges Blei in Wunden gießen. Die Unterhaltungsindustrie hatte sich einiges einfallen lassen, um die Leute bei der Stange zu halten. Am beliebtesten waren Verbrennungen. In Andalusien, Aragón, Katalonien, ja, selbst im Baskenland, es brannte überall. Damals war es noch unüblich, die Verurteilten vorher gnadenhalber zu erdrosseln, also blieb das Spektakel der Inflammation, wenn Haut platzte, sich vom Fleisch rollte, Augäpfel wie erschreckte Schnecken aus den Höhlen sprangen, der Mensch so allein war, wie er es nur sein konnte.
Die Feuerteufel hatten sich zu einem Dachverband namens Inquisition zusammengeschlossen. Seit man 1492 Granada erobert und die Reconquista abgeschlossen hatte, war der Krieg ins Innere verlagert worden. Nun ging es für die Rückeroberer Spaniens, sofern sie nicht gerade Amerika plünderten oder sich auf Kreuzzügen austobten, gegen Juden, Konvertiten, Moslems, Ketzer, Hexen, Ehebrecher, Zinswucherer, Bettler, Vagabunden. Zumindest behauptet das die Legende, die die spanische Inquisition als besonders fanatisch verteufelt. Wer den Mächtigen nicht zu Gesicht stand, wurde gefoltert, dann nach allen Regeln der Rechtswissenschaft verurteilt, mit der Schandmütze versehen und verbrannt.
Anschließend bekamen die Angehörigen die Rechnung zugestellt — zwölf Reales für den Folterknecht samt Gehilfen, dreißig für den Richter, acht für die Unterbringung und Verpflegung im Folterkeller. Gerichtskosten, Scharfrichter, Errichtung des Scheiterhaufens …
Ferdinand Desoto gehörte zu den berüchtigsten Gestalten seiner Epoche. Wenn sein Name heute in Vergessenheit geraten ist, so nur deshalb, weil ihn sein Ehrgeiz in die Irre führte. In der Zeit, von der wir reden, war es schwer, sich einen Namen zu machen. Er hat es geschafft. Aber ein Menschenleben war damals nicht viel wert, es herrschte die Willkür einer privilegierten Obrigkeit, dazu die Feuerteufel der Inquisition. Desoto waren die Verbrannten egal. Für ihn waren das Leute, die die Ordnung störten, und trotzdem konnte er den Blick nicht von den Glutnestern wenden, in denen jetzt Schneeflocken zergingen wie gestern Ketzer, die so abscheuliche Sachen wie Gleichheit aller Menschen oder Besitzlosigkeit gefordert hatten.
Desoto, mittelgroß, feine Gesichtszüge, schwarzer Knebelbart, traurige Augen und eine etwas zu lange Nase, war ein ernster Mensch. Heute war ein entscheidender Tag, der wichtigste in seinem Leben, heute traf er den mächtigsten Menschen auf Erden, den Kaiser, der damals noch alle Finger an der Hand hatte. Heute entschied sich Ferdinand Desotos Schicksal.
Er hatte die Hälfte seiner zweiundvierzig Jahre in Westindien verbracht, Panama und Nicaragua erobert, Francisco Pizarro bei der Eroberung Perus begleitet, dem Inkakönig Atahualpa die Grundbegriffe von Schach und Spanisch beigebracht, dessen Schwester geschwängert und mit dem Verkauf von Sklaven genug verdient, um sich in seinem Palast in Jerez de los Caballeros die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen.
Ein bewunderter Held, der sich in den Ruhestand begeben konnte, um mit seiner Frau am Nachwuchs zu basteln und sich der Jagd und dem Tennis zu widmen, aber die Vorstellung daran bereitete ihm Magenschmerzen. Jerez de los Caballeros war keine Herausforderung.
Ferdinand Desoto war unzufrieden. Es gab reichere Grafen, größere Schlösser und Männer, die mehr besaßen, obwohl sie ihr Leben nicht in den Kolonien riskiert hatten. Wozu sich mit Schweinebauern, Korkfabrikanten, Winzern und Hirten streiten, wenn es wichtigere Aufgaben gab?
Also hatte er seine Kumpane versammelt: Luis de Moscoso, Nuño de Tobar, Francisco de Maldonado, Juan de Añasco und Rodrigo Ranjel — Männer, mit denen er in Peru gewesen war, deren Namen so schwer waren, dass sich beim Aussprechen die Zunge verknotete. Mit ihnen wollte er sich einer neuen Unternehmung widmen, seiner, wie seine Frau es nannte, fixen Idee.
— Das wird die Geschichte von sechs Männern, die ein neues Reich gründen, verkündete er. Eine Geschichte, die uns reich machen wird. Kinder werden unsere Namen lernen, ganz Europa wird uns kennen als Könige von Amerika. Das war es, was ihm vorschwebte, ein Königreich in Mittelamerika.
Moscoso, Moskito genannt, ein kleiner Mann mit Vogelnestfrisur, der keinen Alkohol vertrug, gefiel die Idee, sich dort ein Palais mit einem noch größeren Weinkeller zu bauen, als ihn die Pizarros in Trujillo planten. Auch Nuño, ein frühneuzeitlicher Brad Pitt mit einem Pierre-Brice-Kinngrübchen, war begeistert. Der an Sancho Panza gemahnende, aber eitle Maldonado, genannt Nero, der ständig Frauen … »den Süßen« … Küsschen zuwarf, phantasierte von einer indianischen Prinzessin. Añasco vulgo Plattnase, der immerzu von seiner Heimatstadt Granada schwärmte, war auf Abenteuer aus. Und dann war da noch der kleinwüchsige Rodrigo, Stummel, mit der vorgewölbten Stirn, die ihn wie einen Bruder der Zwergin in Velázquez’ berühmtem Bild aussehen ließ. Ein Zyniker, der für einen Gott gehalten werden wollte. Für einen Zwerg zu groß und für einen ausgewachsenen Menschen zu klein, weshalb er sich für eine eigene Rasse hielt, älter und würdiger als alle anderen: »Niemand ist größer als ich!«
Moskito, Nuño, Nero, Plattnase und Stummel, das war Desotos’ Buberlpartie. Seine Brüder? Nein, Männer, denen er sich verpflichtet fühlte. Wirklich nahe waren sie ihm nicht, weil er niemanden an sich heranließ.
— Die Inka beweihräucherten uns nicht, weil wir so stanken, polterte Stummel, sondern weil sie uns für Söhne der Sonne hielten. Nur bei Nero war es anders, klatschte er dem Dicken auf die Wange, der stank wirklich.
Sie alle hielten Desoto für egoistisch und eingebildet. Der ist so von sich selbst überzeugt, dass er glaubt, seine Scheiße stinkt nicht. Er lacht nur einmal im Jahr, und dann geht er in den Keller. Trotzdem vertrauten sie ihm, glaubten seinen Schwärmereien.
Desoto sehnte sich nach der Freiheit in den Kolonien, nach einem Ort, an dem er herrschen konnte, außerdem hoffte er, dort Isabella, seine Frau, zu bändigen, sofern sie mitkam. Er war ein Draufgänger, ernst und ungesellig, aber der herrischen Art seiner Gattin nicht gewachsen. Sie wollte ihm vorschreiben, was er zu essen hatte, wann es Zeit für das letzte Glas Wein und wann für die Nachtruhe war. »Setz dich gerade hin, schmatz nicht beim Essen, reinige deine Fingernägel … Wenn wir ein Kind haben, musst du ihm Vorbild sein!« Diese gemütskranke Frau konnte einem die Seele herausreißen, sie auswringen und auf eine Wäscheleine hängen. Er wusste nie, was in ihr vorging. Ein störrisches Wesen, das ihm, dem großen Eroberer, das Leben zur Qual machte. Immer hatte sie das letzte Wort, jede seiner Erklärungen drehte sie um, so dass sie postwendend zurückkam und in ihn hineingestopft wurde. Ständig gelang es ihr, dass er sich schuldig fühlte. Mal, weil er statt in die Kirche auf die Jagd ging, dann wieder, weil er vergessen hatte, einen Bierkrug wegzuräumen, sein Atem nach Alkohol roch, immer gab es was zu meckern. Diese Isabella war lustfeindlicher als die ärgste Puritanerin, verspannt wie eine Leinwand auf dem Keilrahmen ihrer Ideale und, vielleicht das Schlimmste, unfähig, Ruhe zu ertragen. Wenn ein Engel durchs Zimmer ging, blaffte sie ständig ihr »Ist was?« in die Stille.
Desotos Manieren ließen fraglos zu wünschen übrig. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, einem Nest namens Barcarrota, und hatte jahrelang keinen anderen Umgang als die Kaserne gehabt. Selbst wenn er sich bemühte, war es seiner Frau nicht recht.
Desoto war kultivierter als die vulgären Pizarro-Brüder, ehrlicher als der gerissene Cortés und mutiger als viele andere Konquistadoren zusammen. Einer, der alles, was er anpackte, zu einem guten Ende brachte. Abgesehen von seiner Frau hatte er vor wenig Angst, nur vor Lebensstumpfsinn und Bedeutungslosigkeit.
Mit sieben war er allein nach Jerez de Caballeros auf die Schule gegangen und verprügelt worden, weil er anders war — verschlossen, unnahbar. Es war nicht so, dass ihn die anderen Kinder gehasst hätten, aber er war ihnen unheimlich. Doch er hatte überlebt. Mit sechzehn zog es ihn in das zweihundert Kilometer entferne Salamanca und wurde er gedemütigt. Als ihn die Diener der reichen Schnöselstudenten wegen seines Dialekts verhöhnten, geriet er in Rage. Das Fass zum Überlaufen aber brachte etwas anderes. Man erwischte ihn, wie er nach einem Zechgelage in die Ecke des Universitätsgebäudes pinkelte, in die man Bilder von Heiligen gemalt hatte. Er wurde zum Rektorat zitiert. Seine Rechtfertigung, dass er sich für den heiligen Laurentius entschieden hätte, weil diesen auf seinem glühenden Rost nach Kühlung dürstete, kam nicht gut an, gar nicht gut. Er beschimpfte die Professoren als »impotente, alte Trockenpisser«. Noch ehe das Urteil gesprochen wurde, floh er nach Badajoz.
Ob der damals unsichere, jähzornige Mann ahnte, dass man vierhundert Jahre später ein Auto nach ihm benennen würde, während seine alkoholabstinente Frau das Etikett einer kubanischen Rumflasche zieren sollte — Havana Club Rum?
Isabella de Bobadilla war groß, bestimmt eins vierundsechzig, schlank und für ihre dreißig Jahre recht jugendlich — rotblondes Haar, milchweiße Haut. Weder hatte sie das sorgenvolle Froschgesicht ihrer Mutter geerbt noch das schroffe Kinn des Vaters. War sie wütend, und das war sie oft, bildete sich eine Zornesfalte zwischen ihren Augenbrauen. Obwohl man nicht zu sagen vermochte, wo das Geheimnis ihrer Schönheit lag — der Hals zu lang, die Partie darunter von einem leichten Doppelkinn gestützt und die Nase höckerig —, ging etwas Bezauberndes von ihr aus, das alle Männer entzückte. Lag es an den erdnussgroßen Zähnen? Am schwarzen Muttermal an der Wange oder an den elendslangen Beinen? Sie trieb Gymnastik, ernährte sich von Vogelhäppchen und mied die Sonne. Die meiste Zeit verbrachte sie mit ihren Hofdamen, um modische Neuerungen wie Kothurne, Chopinen und geschlitzte Ärmel zu diskutieren. Außerdem zerkleinerten sie den Gesellschaftstratsch, der in Jerez mit erheblicher Verspätung eintraf. Dem Grafen Soundso wird ein Verhältnis mit der Baronesse von Daunddort nachgesagt. Die Mätresse des Kaisers soll sich unmöglich benommen haben, sie soll seine anderen Kebsweiber … Selbst Julius Cäsar, Isabellas indigener Diener, erhielt mehr Zuneigung als ihr Ehemann.
Bevor wir aber nun Desoto zum Kaiser vorlassen, gehen wir zwei Jahrzehnte zurück, in das Jahr 1514. Europa glich einer überreifen, gerade erst aus Übersee importierten Tomate. Niemand ahnte, welche Kerne daraus hervorquellen würden. Luthers Thesen formierten sich, der Rechenmeister Adam Ries arbeitete an seinem Lehrbuch, Machiavelli verfasste eine Komödie, und Leonardo da Vinci konnte mit seiner verkrüppelten Hand Kriegsmaschinen konstruieren, aber keine neue »Mona Lisa« malen. Venedig verbot das Vergolden von Marzipan, Rabelais schrieb erste Satiren, und Magellan, eben unrühmlich aus der portugiesischen Armee entfernt, ging nach Spanien. Alle waren fasziniert von der roten Frucht, erfüllt vom Geist der Renaissance, der Wiedergeburt des Menschen. An den Höfen der Bourbonen und Medici fanden prunkvolle Feste statt, zu denen nicht nur diese Paradiesäpfel serviert wurden, sondern auch Ochsen — und darin steckte ein mit Hühnern gefülltes Lamm in einem Kalb. Im Geflügel waren mit Wachteln gestopfte Tauben, gefüllt mit Fischen, in denen Froschschenkel waren, darin mit Spinnenaugen gefüllte Schneckeneier in Lerchenzungen. Der Ton allerdings wurde von den Feuerteufeln angegeben, die Inquisitoren waren die Fruchtfliegen an den Paradiesäpfeln, die mit flammenden Reden allen Zweiflern, konvertierten Juden und Moslems einheizten.
1514 also. Der achtzehnjährige Ferdinand war von stattlichem Wuchs und selbstsicherem Schritt — als wollte er die ganze Welt befruchten. Trotzdem ängstlich. Sein Gesicht hatte ein paar Aknenarben, dazu gelocktes Haar, wohlgeformte Lippen. Ein Mann von edler Herkunft, der aber nicht reden konnte. Die richtigen Worte fielen ihm immer erst zu spät ein, er verwechselte die Präpositionen, vergaß Artikel, verschluckte Wortenden. Die Aussprache war bellend, seine Wörter hatten die Patina des Südens, und bei Aufregung begann er noch zu stottern. Dabei stand seine Abstammung auf vier kräftigen Beinen, wurde von blaublütigen Großeltern getragen, die ihm jedoch außer ihrer Herkunft wenig hinterlassen hatten. Bereits der Erhalt des Guts in Barcarrota fiel der Familie schwer, weshalb sich Ferdinand nach dem Intermezzo in Salamanca als besserer Stallknecht in Badajoz verdingte, mit Fliegenschwärmen kämpfte und sich um Rösser, Rüstungen, Lanzen und Pferdeäpfel kümmerte. Er brachte die Fohlen zum Schmied, wo sie beschlagen wurden, und die alten Mähren zum Metzger. Ihm gefiel die Arbeit, sie hatte etwas Ehrliches.
Das Gesinde erkannte, dieser Desoto, der ständig irgendetwas zählte und manchmal mit Zahlen antwortete, war vornehmer als sie. Das provozierte Missgunst. Besonders der gockelhafte Stallmeister Armando Gallo, ein hünenhafter Rüpel, hatte es auf ihn abgesehen und ließ ihn die schwersten Arbeiten tun, was Ferdinand schweigend ertrug.
— Mach dir nichts draus, tröstete ihn ein alter Rossknecht. Stallmeister sind die Schlimmsten. Glaub nicht, du kannst ihnen entkommen. Die Welt ist voller Stallmeister.
— Zweiundfünfzig, antwortete Desoto.
— Wie?
— In der Extremadura gibt es zweiundfünfzig Stallmeister. Ich habe sie gezählt.
Als sich dieser Gallo während einer Kirchweih als ausgemachter Widerling erwies, Mädchen anpöbelte, das Vieh schlechtredete und die Arbeit der Schafscherer verhöhnte, zischte Ferdinand, er solle zeigen, ob er es besser könne.
— Was fällt dir ein? Gallo schwoll der Kamm. Schon packte er den Vorlauten und wollte ihn zerlegen. Andere gingen dazwischen, schlugen einen Wettkampf vor.
— Jawohl. Wer schneller ein Schaf schert. Der Verlierer muss nackt die Stadt verlassen.
— Abgemacht. Ferdinand bekam ein flaues Gefühl im Magen. Worauf hatte er sich da bloß eingelassen? Ihm war, als hätte man literweise Adrenalin in seinen Blutkreislauf gepumpt.
Jeder holte sich ein Schaf, die professionellen Scherer lachten und riefen Wetten aus. Rationale setzten auf den Stallmeister, Emotionale auf Ferdinand. Schon der Anfang zeigte, die Vernünftigen hatten recht. So wie der Stallmeister mit der Schere und dem Schaf umging, wirkte es, als hätte er nie etwas anderes getan.
Desoto hatte keine Ahnung, wie er es anstellen sollte, dem Tier aus seinem Pelz zu helfen. Vorsichtig packte er das Lamm, warf es auf den Rücken, band seine Läufe zusammen und begann zitternd mit der Schere an den Unterschenkeln herumzuschnipseln. Als er bei den Flanken war, pikste er das Tier, das mit einem entsetzten Laut reagierte, worauf hunderte andere Hammel in einen Chor aus Mäh und Bäh und Wäh einfielen. Ferdinand ließ sich nicht irritieren, arbeitete bedächtig weiter, legte die Schenkel frei und kam ins Schneiden. Bald vergaß er die johlende Menge um sich her. Nach seiner Rechnung waren zweihundertachtzig Scherenschnitte notwendig. Zweihundertneunundsiebzig, zweihundertachtundsiebzig … Als er einen Blick zu seinem Konkurrenten wagte, erstarrte er. Gallo war fast fertig. Der Stallmeister entknotete sein Schaf, packte es so, dass der Kopf zwischen den Oberschenkeln eingeklemmt war, und schnitt dem willenlosen Tier das Fell vom Bauch. Zweihundertzwölf, zweihundertelf … Ferdinand plagte sich noch, da war Gallos Schaf schon kahl wie ein Stück Seife. Der Stallmeister ließ sich feiern und verspottete den Verlierer.
Niederlage! Vor diesem Eingeständnis scheut man zurück. Ferdinands Gesichtszüge waren ängstlich, entsetzt. Einhundertzweiunddreißig, einhunderteinunddreißig …
Da kam der Graf von Badajoz, fragte, was hier los sei, ließ sich den Sieger präsentieren und die Felle. Gallo schien zu schweben wie in einem Traum, verbeugte sich und grinste über das ganze Gesicht. Doch was war das? Es stellte sich heraus, das Vlies des Stallmeisters war löchrig wie ein Schwamm, während jenes des jungen Ferdinand, als er endlich fertig war, einem dichten Teppich glich.
— Kann nicht sein. Gallo war sprachlos und suchte nach Ausreden. Jemand habe die Felle ausgetauscht, Parasiten, unbekannte Käfer haben Löcher reingefressen … bestimmt … so etwas kommt vor. Ihr habt doch zugesehen. Du! Und du! Die Decke war perfekt … Der Stallmeister packte einen Knecht und eine Händlerin:
— Ihr habt es gesehen, ihr … Seine Stimme ächzte, als krähte ein Hahn aus ihm. Da niemand reagierte, schlich er geknickt davon, zog sich fluchend aus und verließ unter dem höhnischen Gebrüll der Straßenjungen die Stadt.
— Mir scheint, ich habe einen neuen Stallmeister, gab der Graf Ferdinand eine Ohrfeige. Mal sehen, ob mich das glücklich macht.
Verlegen blickte Desoto um sich, sah Knechte, Viehhändler und Schafscherer, mittendrin ein keckes Näschen, das er kannte. Ein Mädchen, das sich öfter bei den Stallungen herumtrieb, den Pferden Geheimnisse ins Ohr flüsterte und sie stundenlang striegelte. Die Kleine ist abenteuerlich hübsch. Ihm war, als wäre plötzlich Salmiakgeist in seinen Adern, der ihn durchputzte wie ein Abflussreiniger, alles, woran er je gedacht hatte, herauswusch. Dieses Mädchen! Dieses Näschen! … Bevor er ihr schräges Glitzern in den Augen zu deuten wusste, wurde sie von der tobenden Menge mitgerissen.
Desoto war Brachland, das sich selbst bestellen musste. Einen Namen wollte er sich machen. Aber die Aussichten für einen verarmten Adeligen, der, sobald er den Mund auftat, an einen Hinterwäldler erinnerte, waren auch im Spanien des frühen 16. Jahrhunderts trist. Ohne gute Heirat, ohne Karriere in der Armee oder Kirche blieb einem nur das Leben auf einem heruntergekommenen Landsitz, welches unweigerlich zur Trunksucht führte. Pferdeknecht oder Gutsverwalter? Allenfalls, wenn man wie er mit Zahlen umgehen konnte, Buchhalter, Gerichtssekretär oder Reichsverweser, was auch zum Saufen führte, aber der königliche Hof blieb einem verschlossen. Es war also nicht abzusehen, dass aus diesem versonnenen Burschen mit der ungelenken Sprache und der Manie, alles zu zählen, einmal einer der bedeutendsten Konquistadoren Spaniens werden würde, einer, dessen Denkmal am Hauptplatz von Barcarrota stünde — verantwortlich für die größten Erfolge, aber auch für eine der größten Pleiten in der Geschichte Spaniens.
Nach seiner Ernennung zum Stallmeister sah er das Mädchen häufiger. Hübsche Kleider, ein fein geschnittenes Gesicht … dieses Näschen! … mit einem verschmitzten Lächeln, und Karotten, die es an Pferde verfütterte. Keine Magd, Köchin oder Wäscherin, das sah man gleich, sondern ein Wildfang. Ständig trieb sie sich bei den Koppeln herum, besonders ein Hengst mit Blesse hatte es ihr angetan. Obwohl sie noch kein Wort gewechselt hatten, schien es Ferdinand, als käme sie mehr seinetwegen als wegen der Tiere. Wie alt sie war? Vierzehn? Fünfzehn? Mädchen waren ihm so fremd wie der Geruch des Meeresgrundes. Was wollte man mit so einer sprechen?
— Frag sie was, sagte der Rossknecht, doch Ferdinand war zu schüchtern. Was denn? Wie viele Wolken am Himmel stehen? Oder etwas Leichtes? Die Anzahl der Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten?
Wenn er ihr dabei zusah, wie sie mit den Tieren sprach, riss er Moos von Steinen und zerkrümelte es zwischen seinen Fingern. Manchmal hoffte er, ein Pferd würde ausschlagen und sie verletzen, ganz leicht nur, damit er ins Gespräch kommen könnte. So vergingen Tage, Wochen, Jahrtausende, in denen sie sich sahen und schwiegen, bis er sich eines Tages, er hatte schon Tonnen an Moos pulverisiert, ein Herz fasste und sie zitternd fragte, ob vierundvierzig …
— Was?
— Reiten? Ich meinte, ob du … ob Sie reiten wollen, Fräulein? Aber ich muss hinten sitzen.
— Angreifen dürfen Sie mich aber nicht. Das Mädchen kicherte. Weil ich aus Zuckerwatte gemacht bin. Das sind Engel immer.
Sie stiegen auf. Das Mädchen vorne, Ferdinand dahinter. Sie spürte seinen Atem im Genick, er umfasste zaghaft ihre Hüfte. Räuspern. Lassen wir diese schüchternen Menschen kurz allein, sind sie doch auch ohne uns verlegen ohne Ende. Wenden wir uns Badajoz zu.
Wie die meisten Städte der Extremadura saß auch die von portugiesischen Einflüssen geprägte Grenzstadt auf einem Gebirgssattel. Im Weichbild fiel der Kirchturm auf, mehr Stumpen als elegante Stele. Die dicke Stadtmauer, die Alcazaba, stammte von den Mauren. In der Dämmerung trafen sich hier Liebespaare und genossen den Blick über das Tal. Auch die Brücke über den Guadiana sah man, ebenfalls ein maurisches Konstrukt wie die halbe Stadt. Doch davon wollte man nun nichts mehr wissen. Auf die Moscheen hatte man Kreuze gepappt, die arabischen Schriften waren mit Blattgold überpinselt worden, die Gipsstuckaturen mit Mörtel bedeckt. Alles Islamische hatte man unsichtbar gemacht, aber es gab noch türkischen Honig, ein Dampfbad, Zisternen und hunderte Wörter, deren Ursprung arabisch war: Alkohol, Alchemie, Algebra, Almanach, Algorithmus, Alraune, Allianz Versicherung, Alka Seltzer, Alleluja …
Als Ferdinand und das Mädchen vom Ausritt zurückkamen, waren sie ein Paar.
— Ich weiß, ohne zu wissen, sagte sie. Ich bin mir sicher, ohne es erklären zu können.
— Wie heißt du?, fragte Ferdinand, als sie den Gaul in die Koppel brachten.
— Maria de Peñalosa Arias Dávila.
— Nein! Dem jungen Burschen fiel die Kinnlade herunter. Eben noch hatte er geglaubt, über den Mond springen zu können, und jetzt zog ihn ein Universum in die Tiefe. Du bist die Tochter des Grafen?
— Exakt!
— Dann gehst du mit ihm nach Westindien?
— Ich nicht, aber du vielleicht. Sie zwinkerte und lief davon. Ferdinand wusste nicht, was er davon halten sollte. Der damals über sechzigjährige Graf von Badajoz, der Choleriker Pedro Arias Dávila, allgemein nur Pedrarias genannt, war der grauenvollste Mensch, den die Natur jemals hervorgebracht hatte. Und ausgerechnet der sollte der Vater seiner Liebsten sein?
Hundstage
Pedrarias, gerade zum Gouverneur von Goldkastilien ernannt, dem heutigen Panama, war jähzornig, brutal und übellaunig. Ein hageres Männlein mit greisenhaftem Kohlgesicht, kahlrasiertem Schädel, schroffem Kinn und grauem Bart, das abgesehen von seiner an Schinkenrollen gemahnenden Halskrause stets ganz in Schwarz gekleidet war. Ein Rumpelstilzchen mit einer von Alkoholexzessen angeschwollenen Knollennase. Er hatte gekämpft, Granada von den Mauren zu befreien, war gegen die Türken Nordafrikas ins Feld gezogen und hatte acht legitime Kinder — fünf Söhne, drei Töchter —, wer weiß, wie viele Bastarde.
Seine Wutanfälle waren so berüchtigt, dass die Badajozer alle beneideten, die außerhalb der Stadt lebten. Sie hängten silberne Zungen und Ohren zu den Devotionalien-Altären oder ließen Messen für den Verlust seiner Stimme lesen. Nützte alles nichts. Abgestumpft von einem langen Soldatenleben, geschlagen mit einem keifenden Weib, und von der Natur benachteiligt, besaß dieser spanische Richard der Dritte keine andere Triebfeder, als Rache zu üben an der Welt, die ihm so übel mitgespielt hatte.
Als der Despot nun erfuhr, dass ein Stallmeister seiner Tochter nachstellte, ja dass es heimliche Treffen und vielleicht mehr gab, kratzte er sich am Bart und starrte an die Decke. Dann warf er Flaschen gegen Wände, zerschlug Stühle und verprügelte einen Bediensteten mit einem Silbertablett, bis man das Tablett für eine Skulptur, den Lakaien aber für eine Suppeneinlage hielt.
— Himmelherrgottsakrament! Pedrarias brüllte so laut, dass sich selbst die Maulwürfe im Burggarten verzogen. Erst als man diesen Knaben herbeischaffte, kam der Graf zur Besinnung. Die Dienerschaft, die Burg, ja ganz Badajoz zitterte. Nur Desoto war so dreist, hier im Angesicht des Wahnsinns um die Hand von Maria anzuhalten.
— Eins plus eins, einfache Rechnung … Was wir empfinden … Bestimmung … Liebe, stammelte Ferdinand. Ein echtes, ein wahrhaftiges Gefühl.
Pedrarias schäumte.
— So? Liebe also? Ich zeige ihm, was Liebe ist, Drecksau. Beug er sich vor.
Desoto tat, wie ihm geheißen, und schon spürte er eine Glut an seiner Wange. Der Alte hatte ihm eine derartige Ohrfeige verpasst, dass Ferdinand glaubte, er wäre auf eine heiße Ofenplatte gefallen.
— Maria ist für einen Prinzen oder Grafen bestimmt, nicht für einen Pferdeäpfelsammler, du Suppenkasper. Mit gezücktem Schwert ging Pedrarias auf den Jüngling zu.
— Aber … Liebe … eins plus eins … Wir haben uns versprochen. Das ist wichtiger als eine gute Partie. Ferdinand zitterte. Sein Sinn war bei Maria, ihrem makellosen Lächeln. Ohne sie hätte sein Leben keinen Sinn, würde er vergehen wie ein an Land gespülter Fisch. Er liebte sie. Maria war das Erste, woran er nach dem Aufwachen dachte, und das Letzte vor dem Einschlafen. Maria, immer wieder Maria, rein wie eine Primzahl. Wenn er Pferde zuritt, den Stall ausmistete oder dem Sattler zusah, träumte er von ihrem Näschen, ihrer Nähe, ihrem Atem auf seinem Gesicht, kurz, er war vernarrt in sie.
— Liebe ist Verbrechen und meiner Tochter unwürdig. Liebe? Dabei weiß jeder halbwegs vernünftige Mensch: Die Liebe ist ein Blumenstrauß, das Pflücken macht mehr Spaß als das Besitzen. Irgendwann verwelkt das schönste Bukett. Der Tyrann gab ihm noch eine Ohrfeige und setzte ihm die Schwertspitze unters Kinn. Viel hätte nicht gefehlt, und Ferdinand Desotos Zeit wäre hier abgelaufen, die amerikanischen Autohersteller hätten sich einen anderen Patron suchen müssen, den Marktplatz von Barcarrota würde heute ein anderer zieren, das Havana-Club-Rum-Etikett sähe anders aus, und diese Geschichte würde nie erzählt werden. Aber gerade als der vor Wut rasende Pedrarias zustechen wollte, erschien das Näschen, Maria, blickte in den Raum, der vor Zorn zu beben schien, kreischte und lief entsetzt davon.
— Gut, lassen wir das. Ich verschone dich, brüllte der Wütende, aber du begleitest mich nach Darién. Ich gebe dir das Kommando über — der Alte dachte nach, gab ihm eine dritte Ohrfeige und fuhr fort … eine Reiterstaffel, und wenn du dich bewährst … In Darién wirst du sie vergessen.
— Gallien? Was soll ich denn in Frankreich?
— Darién! Idiot. Isthmus, Neue Welt!
Ferdinand holte tief Luft und hielt den Atem an. Darién? Welch kleines Wort für eine große Sache. Darién, das zunächst keine Auswirkung auf sein persönliches Schicksal hatte, aber bald stand fest, es war dieses kleine Wort, Darién, das die Liebenden auseinanderriss.
Drei Monate später brach man auf. Vor seiner Abreise hatten sich Ferdinand und Maria mit pathetischen Worten ewige Liebe geschworen — mit versiegelten Briefen und heimlichen Treffen. Ewige Liebe? Beide waren im süßen Schwebezustand einer einfachen Melodie, die nur aus zwei Tönen bestand: ich und du. Beide glaubten, ohne einander nicht leben zu können. Man müsse, meinte Maria, an das Positive denken.
— Schwöre mir, dass du immer nur mich lieben wirst.
Ferdinand schwor. Sie dachten an die Zukunft und an ihre Haut, wenn sie die des anderen spürten.
Dann war es so weit. Sechs Tage lang saß Ferdinand dem schweigsamen Alten, seiner Giftspinne und ihrem ältesten Sohn in einer engen Kutsche gegenüber und starrte verlegen aus dem Fenster.
— Was gibt es da zu glotzen?
— Storchennester. Zweihundertzwölf.
— Dir ist klar, dass du von dieser Reise nicht zurückkommen wirst?
— Wollen Sie mich umbringen?
— Niemand kommt wieder zurück, grinste Pedrarias, jedenfalls nicht so, wie er losgefahren ist.
Die Fahrt war derart holprig, dass Ferdinand das Gefühl hatte, ein Pfahl würde in ihn getrieben. Als sie nach zwei Deichsel- und drei Federbrüchen Sevilla erreichten, fühlten sich seine Beine hölzern an, und sein Kopf war weichgeklopft.
Die Stadt war ein Labyrinth aus Gässchen. So etwas Gewaltiges hatte er noch nie gesehen. Überall Soldaten, Seeleute, Kaufmänner und ihre Adlaten. Mönche, Sekretäre, Abenteurer, die alle auf eine Passage in die Neue Welt warteten. Sevilla war der Flaschenhals, durch den alle mussten, der einzige autorisierte Hafen für den Transatlantikhandel. Hier war 1503 das Indische Handelshaus gegründet worden, die Casa de la Contratación de las Indias, hier wurde der Handel mit Amerika geregelt, hier kam es zur Erfindung eines neuen Standes, des Passagiers. Sevilla war das unbestrittene Zentrum des Planeten, zumindest für die stolzen Sevillanos.
— Moloch, sagte Pedrarias.
— Überall Gesindel, ergänzte seine Frau.
Ferdinand war beeindruckt. In den verwinkelten Gassen sah er Orangenverkäufer, auf den Balkonen Psalmen-Sänger, deren waberndes Gewinsel sich anhörte, als hätten sie sich ihr bestes Stück im Türstock eingeklemmt.
— Karwoche, erklärte Pedrarias. Und tatsächlich begegneten ihnen Bruderschaften: Kapuzenmänner, die wie wandelnde Stoffkegel aussahen und riesige Kreuze und Marienstatuen schleppten. Daneben Flagellanten und Nonnen in Verzückung. Sind hier alle durchgedreht? Halb Sevilla war im Osterwahn, während die andere Hälfte von nichts anderem als den Gold- und Silberschätzen aus Übersee sprach. In jeder Spelunke war von unermesslichen Reichtümern die Rede. Überall verließen Bedienstete ihre Herren, liefen Söhne von zuhause fort, waren versessen, an Bord eines der Schiffe nach Westindien zu kommen. Lehrburschen, Dienstboten, Schuldner, bankrotte Landbesitzer — alle missachteten die Predigten der Priester, hofften auf das große Glück in Amerika. Amerika! Benannt nach Amerigo Vespucci … oder nach Richard ap Meryk, einem Kaufmann, der die ersten Entdeckungsreisen finanzierte? Amerika! Alle waren wie berauscht, in einer einzigen großen Orgie an Erregung. Nur die Oberschicht wandte indigniert den Blick ab.
Pedrarias inspizierte seine Truppen, und Ferdinand dachte an Maria, zählte die Stunden. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, erreichten sie am Donnerstag nach Ostern Palos de la Frontera, wo die Schiffe lagen. Mächtige Holzkästen. Zum ersten Mal sah Desoto das Meer und war ergriffen von dieser ungeheuren, wie gehämmertes Blei glitzernden Fläche.
Stell dir vor, schrieb er an Maria, in Palos essen die Leute Schnecken, die nicht größer sind als Kichererbsen. Es dauert Stunden, bis man davon satt wird. Die Schwalben fliegen so niedrig, dass sie einem einen Scheitel ziehen, außerdem gibt es einen schweren Wein, den die Leute Sherry nennen. Die Schiffe sind bereits beladen und von den Beamten kontrolliert, das Wetter ist ausgezeichnet, und ich freue mich auf die Reise, vor allem aber auf unser Wiedersehen.
Tatsächlich beschäftige ihn etwas anderes: Er hatte die Soldaten gesehen, mit denen er in Westindien sein würde. Ein Panoptikum an Ausgestoßenen. Es war, als hätte man die Bewohner eines Elendsviertels eingefangen: Knollennasen, vernarbte Gesichter, Einäugige … verrohte, vom Leben gezeichnete Gesellen und ihre stinkenden Gespielinnen. Die meisten so dreckig, dass man hinter ihren Ohren Petersilie hätte anbauen können.
Hatte Pedrarias recht? Würde er wirklich nicht zurückkommen?
Maria und Ferdinand hatten sich damit getröstet, dass die Liebe von Geographie nichts wisse, keine Grenzen kenne, unverwüstlich sei. Beschwere sie mit Gewichten und versenke sie in einem tiefen See — sie taucht wieder auf. Fessle und vergrabe sie, mauere sie ein, schieße sie zum Mond — sie taucht wieder auf. Zerhacke sie, zerschneide sie — sie kommt zurück. Die Liebe ist unverwüstlich. Sie hatten sich auf ein, zwei Jahre Trennung eingestellt. Wenn alles gutging — und sie hatten keinen Grund daran zu zweifeln —, würden sie sich bald wiedersehen. Es kam anders. Einundzwanzig Jahre sollten bis zu Ferdinands Rückkehr vergehen. Einundzwanzig Jahre, in denen aus dem schüchternen Ferdinand ein gefeierter Held werden sollte. Jahre, in denen Maria die Burgmauer von Segovia ablief und auf Nachricht hoffte. Segovia? Maria war mit ihren Geschwistern dort bei der Großmutter untergebracht worden. Um Historiker in den Wahnsinn zu treiben, hieß diese Großmutter genauso wie Marias Mutter, die Giftspinne, und auch Marias Schwester, die spätere Frau Desotos: Isabella de Bobadilla.
Die Isabellas waren Marias geringste Sorge. Bald gab es Freier, die sie abwimmeln musste, um sich aufzusparen für den einen Mann, von dem sie nicht einmal wusste, ob er noch lebte. Diesen einen, den sie in ihrem Herzen trug. Und als sie alle Hoffnung begraben hatte, kam er zurück, zu spät, viel zu spät.
Ferdinands Leben in der Neuen Welt hing oft an einem dünnen Faden. Die im Namen Spaniens und der Kirche agierenden Konquistadoren waren eine staatlich legitimierte Räuberbande, ein skrupelloser Haufen. Selbst die Missionare waren mehr am Fleisch der einheimischen Frauen denn an ihrem Seelenheil interessiert. Und an der Spitze dieser Bande stand der greise Pedrarias, der immer wieder zu Desoto sagte:
— Lange wirst du hier nicht überleben.
Wie alle halbwegs sensiblen jungen Menschen empfand auch Ferdinand die Welt als feindselig, vulgär und grobschlächtig, was er aber in Darién erlebte, übertraf alles. Der Alte führte ein barbarisches Regiment, ließ Hunde auf Einheimische hetzen oder mähte sie vom Pferd aus nieder wie reifes Korn. Seine Mission war es, Indianer zur Arbeit in den Silberminen zu versklaven und sie zum Bau von Häusern und Straßen anzuhalten.
Dabei war Panama wunderbar. Überall flammendrote Mimosenbäume, Orchideen, Magnolien. Weiße Reiher, faustgroße Schnecken, Schildkröten, Krebse. Bis zum Einmarsch der Spanier hatten die Indigenen in einem Paradies gelebt. Freundliche Leute mit einfachem Gemüt, die der Natur in einem fortwährenden Kampf das Notwendigste abrangen. Zwar hieß es, sie würden getötete Feinde verspeisen, Menschenfleisch räuchern und zu Eintöpfen verarbeiten, aber davon hatte Ferdinand nie etwas bemerkt. Er sah, dass selbst Frauen und Kinder in den Silberminen schuften mussten und beim kleinsten Ungehorsam strengstens bestraft wurden.
Ferdinand war schockiert. Wie besessen schrieb er Briefe an Maria, in denen er ihr von den Schönheiten des Landes erzählte. Es war, als ob er sich eine andere Wirklichkeit erfinden wollte. Er berichtete von riesigen Schmetterlingen und kleinen Vögeln, die Nektar aus Blumen saugten, von Wildkatzen und Krokodilen, Schlangen, dick wie Oberschenkel, Zecken, die die Größe von Weintrauben erreichten, und vom Urwald, dem man ein paar Flächen abgerungen hatte. Ein feuchtes, heißes Klima ließ hier üppige Pflanzen sprießen. Palmen, Gummibäume und Mais, aus dessen Blättern die Eingeborenen kleine mit Hühnerfleisch, wildem Reis und Kräutern gefüllte Pakete schnürten, die sie Tamales nannten.
Darién war ein Mekka der Improvisation mit schlechtgelaunten Eingeborenen, deren Haare lang, glatt und schwarz waren, während sie nur weiße Gewänder trugen — Zeichen des Friedens. Eines Friedens, von dem die Spanier nichts wussten.