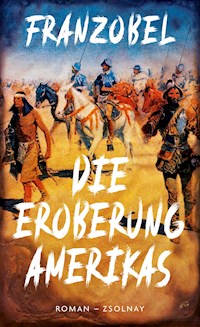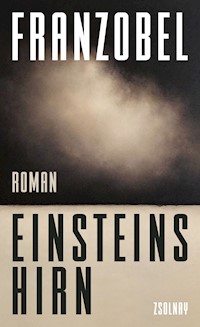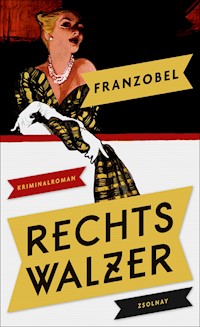Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hildebrand Kilgus' Passion ist das Stöhnen, überall glaubt er es zu hören und zu spüren. Auf der Suche nach dem Geheimnis der tiefsten Gefühle wird er Puffvater, Hebamme, Sargträger und Sterbebegleiter, sogar Ehemann und Vater. Als Angestellter einer Agentur zur Manipulation des Wetters landet er in Rom, wo er in die Fänge der Mafia gerät. Und dann fangen auch noch die Vögel zu reden an! So stolpert "Hildy" durchs Leben, ein neuer Franz von Assisi und tölpelhafter Simplicissimus. Eine herzzerreißend komische, erfrischend obszöne Tour de Force durchs Land der Vögel und des Vögelns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Hildebrand Kilgus' Passion ist das Stöhnen, überall glaubt er es zu hören und zu spüren. Auf der Suche nach dem Geheimnis der tiefsten Gefühle wird er Puffvater, Hebamme, Sargträger und Sterbebegleiter, sogar Ehemann und Vater. Als Angestellter einer Agentur zur Manipulation des Wetters landet er in Rom, wo er in die Fänge der Mafia gerät. Und dann fangen auch noch die Vögel zu reden an! So stolpert "Hildy" durchs Leben, ein neuer Franz von Assisi und tölpelhafter Simplicissimus. Eine herzzerreißend komische, erfrischend obszöne Tour de Force durchs Land der Vögel und des Vögelns.
Franzobel
Was die Männer so treiben, wenn die Frauen im Badezimmer sind
Roman
Paul Zsolnay Verlag
für Maxi, Mucki und H. H.
Fasten your seatbelts, it’s going to be a bumpy night.
Bette Davis in »All about Eve«
Vorwort
Gott existiert nicht, deshalb glaube ich an ihn.
Im April 2011 fand ich im Hotel Orient zwei 120-Minuten-TDK-Tonbandkassetten, deren Aufnahmen mich gleichermaßen schockierten, irritierten wie beeindruckten, sodass ich sie trotz aller Ängste, sie könnten mit einem Fluch behaftet sein, abtippte und dem Zsolnay Verlag zur Veröffentlichung antrug. Glück, Zufall oder höhere Fügung? Ich weiß es nicht.
Es war der Tag, an dem die Zeitungen mit der Schlagzeile Gott heiratet wieder und wird zum siebten Mal Vater aufmachten. Mit Gott war aber keineswegs der allseits angefeindete Schöpfer von allem, sondern bloß der allseits beliebte Schöpfer des Biene-Maja-Liedes, nämlich der gleichnamige tschechische Schlagersänger Karel Gott gemeint. Glück, Zufall oder höhere Fügung? Ich weiß es nicht.
Mein Schriftstellerkollege Antonio Fian hat unlängst darauf hingewiesen, dass man in Wien, wenn man zur staatlichen Hörfunkanstalt gelangen will, an der U-Bahn-Station Taubstummengasse aussteigen muss. Dafür finden sich in der Blindengasse nur Wirtshäuser, in denen man bis zur Sehunfähigkeit saufen kann. In Wien ist die Adresse immer gleichbedeutend mit ihrer Bestimmung. So findet sich die Pathologie in der Sensengasse, das Bestattungsmuseum in der Goldeggasse, und das erste chinesische Restaurant wurde in den späten sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts in der Porzellangasse eröffnet. Am Fleischmarkt steht eine Abtreibungsklinik und in der Museumstraße das Ministerium für Justiz. In der Blutgasse gibt es einen Zahnarzt namens Doktor Stich, während man die Praxis des Gynäkologen Doktor Spreizfuß neben der des Orthopäden Doktor Spalt in der Komödiengasse findet. In der Zirkusgasse ist ein Gymnasium, in der Tendlergasse ein Heim für Studenten und in der Trostgasse eine Ausspeisung für Obdachlose. Weiters gibt es in der Hardeggasse eine Firma für gefärbte Ostereier und in der Wattgasse eine Straßenbahnremise.
Also kein Wunder, dass bei solch sprechenden Adressen auch die Anschrift des bekanntesten Stundenhotels der Stadt, des Hotels Orient, einiges verrät. Sie lautet Tiefer Graben 30—32 und verweist somit auf den tiefen Spalt, der sich zwischen Seitenspringern und Eheleuten, zwischen Stundenhotelbesuchern und Rotlichtmilieugegnern auftut. Oder bezeichnet er die zur Schlucht ausgespülten Risse einer Beziehung, welche über kurz oder lang zum Fremdgehen führt? Oder meint er gar die Kluft zwischen Gut und Böse, Himmel und Hölle?
In diesem Hotel Orient, gleich hinter der alten Börse, fand im April 2011 zur Hebung des miefigen Stundenhotelimages, aber auch, um dem blasierten und verklemmten Wiener Kunstpublikum einen Anlass zu bieten, einen solchen Ort einmal unbefangen zu betreten, eine Soiree statt. Die Künstlerin Ona B. hatte rote Segel an den Fenstern befestigt, die sich wie gigantische Brüste nach außen wölbten. Es spielten Ernst Molden, das Erste Wiener Heimorgelorchester sowie Dobrek Bistro. Josef Krichbaum stellte seine märchenhaften Bilder aus, und ich war geladen, Exotisch-Erotisches aus meinem Roman Scala Santa oder Josefine Wurzenbachers Höhepunkt vorzulesen. Der großgewachsene sozialdemokratische Kulturstadtrat hielt eine kurzweilige Rede, und auf üppig beladenen Tischen warteten Champagner, Austern und Lachsbrötchen.
Nach Beendigung der Lesung, als die vielleicht zwanzig Kunstbeflissenen bereits weiter in die nächste Suite gezogen waren, um einer Puppentheaterversion des Kamasutra beizuwohnen, sprangen mir die beiden TDK-Kassetten ins Auge. Sie steckten in einer bodennahen Strombuchse, deren Deckel sich gelöst hatte, und trugen die Bleistiftaufschriften Purple Rain. Der Siebte Kontinent. Generation Deo. Schwarzer Schnee. Brut. Mittagsteufel. Junibraut. Die Vögel und Ahnungen. Ich weiß nicht, wer sie dort versteckt hatte, aus welchem Grund, und auch nicht, wie lange sie da zwischen den Drähten und Kabelklemmen gelegen sein mochten. Ich weiß nur, dass ich Prince, Hitchcock und Konrad Bayers Der sechste Sinn assoziierte, irgendeinem Instinkt folgend beide Kassetten einsteckte, um sie dann tagelang zu vergessen. Glück, Zufall oder höhere Fügung? Ich weiß es nicht.
Als ich sie endlich abhörte, verstand ich zuerst einmal gar nichts. Eine Art Zwitschersprache war zu hören. Die Kassetten waren, wie sich später herausstellen sollte, in sechsfach verlangsamter Aufnahmegeschwindigkeit besprochen. Als es mir endlich gelang, sie in Normalgeschwindigkeit zu hören (hier ist Klaus Dickbauer für seine technische Hilfeleistung zu danken), war ich von der geschmeidigen dunklen Sprecherstimme wie vom bizarren Inhalt fasziniert, der im Folgenden ungekürzt wiedergegeben wird.
Aus Gründen des Personenschutzes wurden bis auf Hildebrand (Hildy) alle Eigennamen geändert. Gleiches gilt für die Ortsnamen Sumpfing und Schleiming. Die Unterteilung in zwei Bände wurde aus rein inhaltlichen Gründen vorgenommen. Die Benennung der Unterkapitel stammt von mir.
Da in diesem Buch auch mehrmals von Teufeln die Rede ist, bitte ich an dieser Stelle schon den evidentesten von allen zu entschuldigen, den Druckfehlerteufel.
Franzobel, Wien, am 9.10.2011
Satans geschickter Plan besteht darin, die Menschen zu veranlassen, seine Existenz zu leugnen im Namen der Rationalität …
Papst Johannes Paul II.
Band 1
Die Zeit der geringsten Gewissheit
Es gibt Tage, sie müssen nicht einmal besonders kalt sein, Tage, an denen es nicht zwitschert und nicht tiriliert, nicht piepst und zirpt, Tage, an denen niemand in den Bäumen raschelt, niemand auf den Stromkabeln und Fenstersimsen sitzt, der Himmel leergeräumt, ja, leergeträumt ist, Tage, an denen keiner über Felder hüpft und niemand in der Erde nach Würmern oder Larven pickt, Tage, an denen der Himmel vom Himmel gefallen scheint und mit ihm die Vögel. Tage, die uns ganz normal erscheinen. Niemandem nämlich, niemandem außer den Katzen und ein paar verrückten Ornithologen, fällt es an solchen Tagen auf, dass die Vögel verschwunden sind. Vielleicht wundern sich die Käfer, Würmer und Mäuse, dass ihre Population so gut gedeiht. Sonst aber merkt es keiner.
Natürlich können die Vögel nicht einfach so ihre Tage haben und verschwinden, wenigstens nicht alle, nicht die Singvögel und Nachplappervögel aus ihren Käfigen, nicht die Legehennen und Truthähne aus ihren Gefängnissen und auch nicht die Brathühner aus den Grillstationen und Gefrierfächern, aber alle anderen sind an diesen Tagen einfach weg. Doch niemandem fällt es auf, weil alle so mit sich beschäftigt sind, dass sie auf so etwas nicht mehr achten. Ich auch.
Man muss schließlich einmal Hauptsache sein, nicht immer nur die anderen. Man muss auch einmal sagen, das hat man sich verdient. Man muss sich auch einmal was gönnen.
Aber ich gönne mir nichts, ich bin auf der Flucht. Gelandet in einem kleinen, nach Desinfektionsmittel riechenden Zimmer. Rosa geblümte Decke, fadenscheinige Lampenschirme und ein weinrotes Doppelbett mit Spannbezügen. Da sitze ich in diesem Zimmer, das mich an die Schlafkammer der Großmutter erinnert: rosa Vorhänge, blutroter Teppichboden, geblümte Tapete, zerschlissener Fauteuil — genau wie bei Oma, nur die Blumentöpfe und der Nippes fehlen. Keine Schälchen aus Orangenhaut und keine Schächtelchen mit Muscheln oder Schneckengehäusen. Keine Schnupftabakdöschen, keine Stalin-Bilder und auch keine Kanister mit Frittieröl.
Da sitze ich, nachdem ich alles nur denkbare Unheil überstanden habe, im Hotel Orient und überlege, wie viele Menschen hier gestorben sind, wie viele man mit stehengebliebenem Herzen oder Gehirnschlag von hier fortschaffen musste. Das Orient ist eine Bleibe für gewisse Stunden, ein Stundenhotel, wo man sich etwas gönnt, wo einem Zeit gestundet wird, dem geschundenen Alltag zu entfliehen, ein Love-Hotel.
Wie viele Hektoliter Sperma hier vergossen worden sind? Wie viele Kinder hier gezeugt, wie viele Aidsansteckungen, Tripperübertragungen, Pilzvermehrungen, Rollenspiele, Herzinfarkte? Ich denke an den für sein soziales Engagement bekannten Politiker, den man hier nackt und tot mit einer Zitrone im Mund und einem gefrorenen Fisch im Arsch gefunden hat, was damals ein Skandal gewesen ist. Ich sehe helle Verkrustungen im Bettbezug und Kratzspuren im roten Samt, die wahrscheinlich von lackierten Fingernägeln stammen, das Nachtkästchen mit der Blümchenmusterzierdecke, das mausgraue Telefon mit zugeklebter vanilleweißer Wählscheibe, mit dem man nur den Portier anrufen kann.
Dieser Portier, ein Nordfriese, der mit seinen roten Hängebacken aussieht wie ein Truthahn, war keineswegs erstaunt, dass ich allein das dunkle Foyer des Orient betrat und ihn in seiner kleinen Kammer inmitten seiner Zimmerschlüssel, Monitore von Überwachungskameras und Essensreste fand. Eine Glasschale mit Mentholzuckerln für die Gäste.
— Ferde oder Flanzen?, hat er mich gefragt. Wahrscheinlich eine Anspielung auf die Bilder über dem Bett. Jedenfalls hängt hier in meinem Zimmer ein Bild mit fetten Blumen, Pfingstrosen oder etwas in der Art. Ferde oder Flanzen? Ob alle Wörter, die mit F beginnen, früher ein Pf hatten? Hieß es einmal Pfrösche, Pfuß und Pflasche? Pfritz und Pfranz? Und wie ist das mit Pvögeln? Pficken? Pfeiertag?
— Kommen Sie vom Fluchhafen?, wollte der Portier wissen. Ein dicker Mensch mit langem Hals, aus dem ein kleiner Kopf mit einfältigem Gesicht ragte, spitze Nase, das Kinn eine einzige schwabbelige Hautfalte, fettes Haar, derselbe Menschenschlag wie Ödipus Hornbostel, der Hotelportier in Rom, von dem ich später erzählen werde.
Fluchhafen? Norddeutsche gehen ja auch in die Kirsche und sagen Schemie, Schina und Tschournal. Dufte und: Der Könich hat’s lustich, wenn er Honich isst. Ja, vom Fluchhafen komme ich tatsächlich, von einem verfluchten Ort, einem Ausflug zum Siebten Kontinent, aber wie soll der friesische Zerberus-Puter das wissen. Keine Regung hatte er gezeigt, als ich ihm sagte, dass er, wenn eine Frau käme und nach einem Herrn Tosca fragte, sie auf mein Zimmer schicken solle.
— Wünschen die Herrschaften Champagner?, hat er gegurrt und auf eine Witwe Clicquot im Silberkübel gedeutet.
— Später, habe ich abgewunken, das Zimmer bezahlt und an den billigen Prosecco, die zwei Plastiksektflöten in meiner Tasche und die Erwartete gedacht. Sollte ich sie tatsächlich treffen? Wäre es nicht besser gewesen, auf unzurechnungsfähig zu machen? Ich hätte in den nächsten Supermarkt laufen, mich entkleiden, alles aus den Regalen räumen und dabei Alle Vögel sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star singen können.
Nein! Jetzt, nachdem ich alles überstanden habe und mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich mich bei allem Pech, das mir in den letzten Tagen widerfahren ist, doch als Glückspilz fühlen darf, sitze ich in diesem Zimmer, Hotel Orient, Wien, Tiefer Graben 30—32, in berechtigter Erwartung einer attraktiven Frau. Draußen bläst kräftiger Wind, die Luft ist frisch und würzig. Dunkle, angefaulte Wolken liegen in der Himmelsschüssel. Es regnet. Fette Tropfen zerschlagen sich am Fensterbrett, spritzen ins Zimmer. Beim Schließen des Fensters sehe ich Fuck an der gegenüberliegenden Hauswand stehen, als bedürfte es in einem Stundenhotel dieser Aufforderung. Fuck? Ja, eh. Aber mit wem? Mit der Lady, die zu Herrn Tosca kommt? Oder mit der Hauswand? Ich sein eine Abdullah steht daneben, darunter: Du Arschloch wegen das liest! Ich mach dich Messer. Ein gesichtsloses Bürogebäude. Ich fühle Blicke, sehe Menschen an den Fenstern, Bürohengste, Schreibstuten und kaufmännische Fohlen, der reinste Pferdestall. Krähen fliegen vorbei, sehen mit ihren Knopfaugen in meine Richtung. Schnell ziehe ich die Vorhänge vor. Man weiß ja nie. Eine Kirchenglocke schlägt, einmal, zweimal.
Den ganzen Weg von der Straßenbahn-Haltestelle bei der Börse bis hierher hatte ich Angst, jemandem zu begegnen, Angst, erkannt zu werden, beobachtet. Was, wenn ein Bekannter vor dem Eingang stand? Ein Nachbar? Schulfreund? Eine meiner Schwestern? Meine Frau? Oder sonst ein schräger Vogel? Wie reagieren, wenn mir im Treppenhaus jemand entgegenkam? Was für eine verfängliche Komplizenschaft des Verbotenen wäre das? Du? Hier? Oder wie wäre die Anwesenheit in einem Stundenhotel vernünftig zu erklären?
Gut, mir ist niemand begegnet, ich habe keinen getroffen, niemanden gesehen. Einzig den norddeutschen, wahrscheinlich aus Buxtehude oder Hamburg-Furzbüttel stammenden Portier mit seinem durchsichtigen Plastikschlips samt eingeschweißtem Stacheldraht, seiner Ferde-oder-Flanzen-Frage, und eine nur mit einem cremefarbenen Bademantel bekleidete Dame, die von einem hechelnden großen Hund über den Flur gezogen wurde. Sie sah mich an und fragte: Wie lang ist dein Rohr?
Ich war so verdattert, dass ich den Mund nicht aufbekam. Mit Daumen und Zeigefinger formte ich meine Hand zu einer kleinen, halb geöffneten Rohrzange, aber da war die Wasserstoffblondine bereits in ihrem Zimmer. Eine Trostfrau? Eine Käufliche? Und dieses schokoladebraune Vieh mit seinen nässenden Lefzen fungierte als Gehilfe? Oder war sie eine gutbetuchte, sich langweilende Gattin, die sich hier in diesem anrüchigen Ambiente mit ihrem Hund vergnügte? Oder eine Spionin aus der Himmelstrinkerwelt? Hatte sie bereits das Telefon ans Ohr geklemmt, um ihren Auftraggebern meinen Standort mitzuteilen? Waren schon alle unterwegs, um mich zu holen?
Nein, alles ganz normal. Die Blondine war nur eine Nutte aus der Slowakei, wahrscheinlich von einem Geschäftsmann mit zeitweise auftretender erektiler Dysfunktion finanziert, keine Gefahr. Bestimmt bezog sich auch ihr Wie lang ist dein Rohr? auf irgendetwas Harmloses, den Abfluss oder so.
Alles überstanden, flüstere ich mir zu. Du musst keine Angst mehr haben. Hier bist du in Sicherheit, hier kann dir nichts passieren. Niemand weiß, wo du jetzt bist. Nicht einmal die Vögel haben dich gesehen. Und wenn du zitterst, dann wegen der Nerven. Wenn dir kalt ist, dann nur, weil du schon lange nichts mehr gegessen hast. Alles ganz normal. Kein Grund zur Panik.
Draußen fahren hupende Autos vorüber. In Sumpfing hieß das Hochzeit. Blumengeschmückte hupende Autos fuhren durch den Ort, und die Männer murmelten Es hat wieder einen erwischt. Sie haben wieder einen gefangen. Armer Teufel.
Aber ich bin nicht in Sumpfing, und ich sehe auch nicht beim Fenster raus, sondern gehe ins kleine Badezimmer, das nur durch einen Vorhang vom Zimmer getrennt ist, denke, dass es unangenehm sein würde, wenn die Toscanische endlich gekommen wäre, wir gleich zwei hormonellen, aus Staudämmen drängenden Fluten übereinander herfallen wollten, um unsere Körper wie harngefüllte Hautsäcke aneinanderzuklatschen, und die Flüssigkeiten in Resonanz gerieten. Oder wir erleichterten uns vorher und müssten die Pissgeräusche des anderen hören. Auch wenn man vorhatte, sich preiszugeben, man einander intimste Körperöffnungen küssen, Körperflüssigkeiten lecken und in der Saftgrube des anderen verstecken wollte, hieß das nicht, dass einen des anderen Klogeräusche interessierten. Aber will ich das? Bin ich wirklich hier, um mit der Erwarteten das zu tun, was alle machen? Oder dienen diese sexuellen Gedanken bloß zur Ablenkung, um nicht an die Geschehnisse der letzten Tage denken zu müssen? Nicht an die Vögel und den Exorzismus?
Ich stehe vor dem Spiegel. Große, traurige Augen, schwammiges, aufgedunsenes Gesicht, Bartstoppeln. Mit Grausen erkenne ich die Züge meiner Vorfahren, ekle mich, zeige mir die Zunge, sie ist weiß und pelzig, lasse kaltes Wasser ins Waschbecken, lege den Prosecco rein, zünde mir eine Gauloise an, um sie sofort wieder auszudämpfen, und blättere im mitgebrachten Buch, Otto Weininger, Geschlecht und Charakter. Draußen blitzt und donnert es. Krähen schreien auf, die Kirchenglocke schlägt, einmal, zweimal, dreimal. Oma fällt mir ein, die es liebte, bei so einem Wetter nackt Klavier zu spielen. Ich greife zum Telefon, warte auf die Stimme des Portiers und bestelle Leberknödelsuppe, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Preiselbeermarmelade, Kürbiskernöl und eine Flasche Weißwein.
Sicher, Mama, brennst du darauf zu erfahren, wie dein Hildy dazu kommt, als Herr Tosca in einem Stundenhotel zu sitzen. Sicher willst du wissen, wie dein Hildy, gezeugt auf der Ofenbank unserer Gastwirtschaft in Sumpfing, auf die Welt gekommen an einem 29. Februar, angeblich mit dem Steiß voran und einem lauten Furz, in einer Skikammer zwischen schweißstinkenden Skischuhen, nässenden Skihosen, Skistöcken, Skiwachs und braunen Schneepfützen, unter Bildern von Karl Schranz, Toni Sailer, Annemarie Moser-Pröll und anderen Skifahrern, verantwortlich dafür, dass du meinen Erzeuger, den daueralkoholisierten Postbeamten Melchior Kilgus, heiraten musstest, wie dein Hildy, der sich immer bemüht hat, ein folgsames und braves Kind zu sein, aufgewachsen in unserem Wirtshaus Zum Saurüssel, wie also dein Hildy, ein verschlossenes, schüchternes, aber durch und durch normales Kind, dazu kommen konnte, die Sprache der Vögel zu verstehen, und wie er dazu kommen konnte, der Besessenheit verdächtigt und exorziert zu werden, und warum er nun in einem verruchten Ort wie dem Hotel Orient sitzt, um Hauptsache zu sein, auf eine Dame wartet, dabei zittert. Und warum er sich Herr Tosca nennt.
Glaubst du an den freien Willen, Mama? Glaubst du, dass man sich entscheiden kann? Oder ist jede Entscheidung, ganz egal wofür, schon in einem angelegt? Hat man sich also schon entschieden, wenn man meint, sich festzulegen? Ist alles längst von einem als Fahrdienstleiter verkleideten Laplaceschen Dämon vorherbestimmt? Mir kommt es oft vor, als wäre alles angelegt und vorgeschrieben, das Leben eine einzige Bahnfahrt, bei der die Weichen längst gestellt sind. Alle wichtigen Entscheidungen meines kleinen Lebens, so scheint es mir, waren gar nicht von mir entschieden, sondern folgten einem Drang, den der Zug des Lebens eingeschlagen hatte, einem Drang in Richtung Unheil und Verderben, einem Drang in Richtung Türen auf für die Besessenheit. Als würde mein ganzes Leben einem Urknall entspringen, sich ausdehnen und dabei den einmal festgelegten Gesetzen folgen. Da fährt die Eisenbahn darüber.
Machtlos hing ich dran und wurde mitgezogen, wenn es durch Bahnhöfe, Tunnels oder Landschaften ging, vorbei an Signalen, Stellwerken. Und wenn es über Weichen rumpelte, redete ich mir ein, sie selbst gestellt zu haben. Dabei folgte alles einem unbekannten Fahrplan Richtung Hölle, der die Endstation längst festgeschrieben hatte. So auch die Einquartierung im Orient, die Wahl des Kennwortes Tosca, die Entscheidung, meine Erlebnisse auf Kassette aufzunehmen — für dich, Mama, für dich.
Tosca? Weil ich ein Opernliebhaber bin? Puccini-Fan? Weil das der Name eines Fußballspielers ist? Eines Dirigenten? Nein. Tosca war bei der Wiener Anti-Opernball-Demonstration 1989 das Codewort der eingeschleusten Zivilpolizisten. Als nämlich die gepanzerte, mit Plastikschilden, Vollvisierhelmen und Schlagstöcken ausgestattete, von Videos über arbeitsscheue Anarchisten, eingekiffte Vergewaltiger und polizeifeindliche Kommunisten aufgestachelte Phalanx übellauniger Exekutivbeamter alles andere denn halbherzig auf die halbwüchsigen und halbstarken Demonstranten einprügelte, während drinnen in der Oper ganze sozialistische Ministerkabinette ihren unbedarften debütierenden Sprösslingen zujubelten, Champagner schlürften und sich auf die Mitternachtsquadrille freuten, schrien draußen bei der in Tumulten und Prügelszenen zerbröselnden Demo nicht nur dein in diese Veranstaltung zufällig hineingeratener Sohn Hildy und alle anderen Demonstranten, sondern auch die zur Eskalation eingeschleusten und als Anarchisten verkleideten Zivilbeamten.
Aber während die Protestierer Bullenschweine, Arschlöcher und dergleichen Kosenamen von sich gaben, brüllten die Agents Provocateurs alle das Codewort Tosca, was sie vor den Gummiknüppeln ihrer Kollegen bewahren sollte. Nur hatten dummerweise die sich ebenfalls feiernd in irgendwelchen Opernlogen befindlichen Polizeigeneräle vergessen, das Codewort an die einfachen Beamten weiterzugeben, die nun dieses immer verzweifelter gebrüllte Tosca! Tosca! für eine besonders perfide, weil ihnen unverständliche Beleidigung hielten und daher, weil sie glaubten, sie würden als dümmlich schwule Filmpreise beschimpft, besonders unerbittlich auf die Demonstranten einprügelten. Sie droschen auf die weichen Massen, bis das Blut spritzte, bis die jungen staatsfeindlichen Gesichter zu angeschwollenen blauen Klumpen wurden, bis keine Beleidigungen mehr aus ihren blutenden Mündern kamen, nur noch klagendes Wimmern. Was mochte wohl in den Hirnen dieser Prügelpolizisten vorgegangen sein? Überlegten sie, wo dieses Tosca! Tosca! einzuordnen war? Bestimmt bei den Beleidigungen. Das war, als ob sie gefragt würden, wie lang ihr Rohr sei. Und da alle Männer aufgrund des ungünstigen Betrachtungswinkels der festen Meinung sind, ihr Rohr sei zu kurz, mehr Rohrspatz als Rohr, setzten sie sich Gesichter von Männern auf, die keine Gefühle kennen, und prügelten.
So erlebte Tosca, übrigens eine der ältesten Inszenierungen der Wiener Staatsoper, bei der Anti-Opernball-Demonstration 1989 eine überraschende Neuinterpretation, geht es doch auch bei Puccini um die Willkür eines Polizeichefs, um Verrat und Täuschung — aber davon weiß ich nichts, mich hat dieses Gekreische immer nur unter dem Aspekt des Stöhnens interessiert.
Also warum Tosca? Weil ich, dein Hildy, mich hier im Hotel Orient wie ein eingeschleuster falscher Demonstrant fühle? Einer, der vergeblich Tosca! Tosca! schreit? Weil es gar nicht meine Entscheidung war? Der Zug des Lebens dahinrumpelte? Nein. Was geht mich die Anti-Opernball-Demo von 1989 an? Tosca ist der Name eines Dämons (keiner Demo), der Name eines bösen Geistes. Wie? An so was glaubst du nicht? Gerade du, Mama, der dir alle elektrischen Geräte kaputt wurden, wenn du sie nur berührtest, Autotüren aufsprangen, Kreditkarten nicht mehr funktionierten, ständig Glühbirnen ausbrannten, die du Träume von zukünftigen Ereignissen hattest, der dir Tote und Engel erschienen sind, du willst nicht an Dämonen glauben?
Gut, sie sind vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, die Medizin führt sie auf schizophrene Störungen, Epilepsie und dissoziative, häufig durch sexuellen Missbrauch im Kindesalter hervorgerufene Persönlichkeitsstörungen zurück. Aber es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir uns träumen lassen. Täglich finden allein in Deutschland vier bis fünf Dämonenaustreibungen statt, sogar Autos, Computer, Häuser, Stereoanlagen, Küchenmixer, Brotschneidemaschinen, Handys, ja, selbst Hunde, Katzen, Kühe, Hamster werden exorziert. Auch Jesus hat immer wieder Teufelsaustreibungen vorgenommen — allein sieben an Maria Magdalena. Einmal hat er eine ganze Legion von Dämonen in eine Schweineherde einfahren lassen. Und noch immer bildet der Vatikan unter der Führung eines Papstes, der sich täglich, um sie noch dunkler zu bekommen, Maggi-Suppenwürze in die Augenringe träufelt, jährlich fünfzig bis hundert Exorzisten aus. Und da willst du nicht an Dämonen glauben? Der Mensch ist wie eine klare Rindsuppe, und die Dämonen sind wie Maggi-Suppenwürze, die Sojasoße des Westens.
Der eitrige Praktikant
Ist das Böse eine wirkende Macht, ein lebendiges Wesen, verdorben und verderbend, eine schreckliche Realität, mysteriös und beängstigend? Oder ist es nur eine Unregelmäßigkeit? Ein nicht funktionierendes Gesetz? Ein Fehler? Es muss jedenfalls keine furchterregende Fratze sein, kein schmelzendes, feuerspeiendes Gesicht, dem lange Zungen aus einem spitzzahnigen Maul spritzen, kein hässliches Wesen mit Pferdefuß, Schleimdrüsen und Kanalisationsgestank. Das Böse ist wandelbar und vielgestaltig. Aber wie ich, dein durch und durch unschuldiger, haptophobischer Hildy, mit dem Bösen in Kontakt gekommen bin?
Also gut. Ich will beginnen. Nicht mit dem Urknall, der hat früher, nämlich in der Kindheit stattgefunden, aber mit der Ursuppe postpubertärer Adoleszenz. Du weißt, ich bin geräuschempfindlich. Das Geräusch, auf das ich schon immer ganz besonders reagierte, von dem ich mir Erkenntnis über den Sinn des Lebens, über Gott, das Wunder der Schöpfung und alle Vorherbestimmung erhoffte, vor allem aber wahrhaftige Empfindung, das Geräusch, das mich seit jeher zur Verzweiflung trieb, mich anspornte, lockte, jenes Geräusch also, dem ich seit jeher hinterherhechelte wie ein Esel der Karotte, schleicht sich an, klopft einem aber keine Hand auf den Hintern und greift einem auch nicht zwischen die Beine, um dann zuzupacken, sondern übertölpelt einen. Es ist ein leises Quietschen, als würde man einen Kasten rücken. Dieses Geräusch, von dem ich glaubte, dass es als einziges befähigt ist, einen aus den Geleisen des Daseins zu heben, auf eine andere Spur zu katapultieren, dieses Geräusch nimmt einen völlig in Beschlag, lässt einen nicht mehr los, frisst sich ins Hirn, höhlt einen aus wie ein Termitenvolk, bis man zusammenbricht, raubt einem den Schlaf, bis man kapituliert.
Ein tropfender Wasserhahn? Nein, es ist lauter, heftiger, schlägt Wellen und durchflutet alles, reißt dann aber unvermittelt ab, versiegt. Um sofort, sobald man glaubt, der Damm wäre geschlossen, seine Schleusen wieder aufzutun, einen von neuem zu durchfluten. Ein bellender Hund? Krähender Hahn? Ein geprügelter Demonstrant? Nein. Es ist das, was eine Mutter niemals macht, nicht einmal, wenn sie in den Wehen liegt, nicht einmal, wenn sie die Wirtin Zum Saurüssel in Sumpfing ist, es ist ein Geräusch, von dem eine Dame nichts hören will — selbst dann, wenn sie es zum Hausgebrauch selber fabriziert. Es ist eine in die Welt gebrüllte gottlose Intimität. Nein, kein Spukgeräusch und auch kein Geisterschrei, kein Scharren an den Wänden, sondern Stöhnen, Ächzen, wahrhaft dämonisches Gebrüll, getarnt als sich windendes weibliches Kopulationsgeräusch, als Orgasmusschrei! Jawohl, das ist es, ein Ja-jawohl-bitte-gib’s-mir-ja-ich-komme-Brüllen.
Da der moderne Mensch keine natürlichen Feinde mehr hat und geschützt hinter dicken Mauern lebt, kann er es sich leisten, seine Wollust derart in die Welt hinauszuschreien. Diese wahnsinnigen, alles durchdringenden, abgehackten Stöhnschreie, bei denen die Seele wie in einem hohen Turm die Wendeltreppe des Körpers raufrennt, sich oben aus dem Fenster eines Mundes beugt, der Welt die Zunge zeigt, auf der sie liegt, damit sich eine neue Dimension des Daseins auftut, sich alles Leben durch die Kehle presst, herausdrängt und in einem Mark und Bein erschütternden Gebrüll entlädt — diese wahnwitzigen Orgasmusschreie also haben mich ruiniert, weil es die Wehklagen von verlorenen Seelen, ja, von Teufeln sind, weil ich in ihnen die Erklärung für den Urknall sah, den Anfang aller Zeit, die Heilung für meine Gefühlskälte.
Entschuldige, Mama, wenn ich gleich in medias res gehe, aber ohne diese Stöhnerei wäre es niemals so weit gekommen, hätte ich Sumpfing nie verlassen, wäre ich niemals auf die Anti-Opernball-Demo 1989 gegangen, würde ich jetzt nicht im Hotel Orient sitzen und mich Herr Tosca nennen. Der Stöhnerei verdankt dein Hildy, dass er die Vögel versteht, die Entdeckung des Siebten Kontinents und seine Besessenheit, die man später als Strafbesessenheit für einen besonders lasterhaften Lebenswandel bezeichnet haben wird. Aber begonnen hat es mit dem Stöhnen, mit der Ahnung, dass darin die Seele steckt, die Möglichkeit, seiner Vorherbestimmung zu entgehen, vor allem aber viel Empfindung.
Du musst wissen, Mama, ich war seit jeher unfähig für Mitgefühl. Gut, manchmal war ich traurig, doch empfand ich Traurigkeit? Nein. Und wenn ich fröhlich war, empfand ich dann Fröhlichkeit? Nein. Wenn ich im Fernsehen Leichen oder Katastrophen sah, ließ mich das ziemlich kalt, ebenso, wenn einem mir bekannten Menschen etwas Schlimmes widerfuhr. Immer blieb ich seltsam unberührt. Oft hatte ich das Gefühl, mich selbst zu beobachten, wie ich auf etwas reagierte. Immer hielt ich Distanz. Niemals verlor ich die Kontrolle. Die Wissenschaft nennt so etwas Alexithymie, Gefühlskälte, und macht dafür die unzureichende Vernetzung des limbischen Systems mit dem präfrontalen Cortex verantwortlich. Angeblich sind zehn Prozent aller Deutschen davon betroffen und wahrscheinlich neunzig Prozent aller Österreicher. Aber das ist es nicht. Denn ich war ja traurig, und ich war auch fröhlich, nur nicht richtig, weil mich nichts ergriff. Und ich hatte Schmerzen und Empfindungen, aber immer nur an der Oberfläche, nichts drang je wirklich zu mir durch. Ich hatte mir Emotionen zurechtgelegt, mir Verhaltensweisen antrainiert, um nicht aufzufallen. Denn ich konnte nichts wirklich tief empfinden. Alle Gefühle waren wie Kleidung, die ich beliebig aus- oder anziehen konnte. Alle Gefühle waren irgendwie nicht echt.
Vom Stöhnen habe ich mir Besserung erhofft. Ich dachte, ich bräuchte das Gefühl so sehr wie andere die Liebe, von der es im Ersten Brief an die Korinther sinngemäß heißt, hättest du auch alles, hast du die Liebe nicht, so hast du nichts. So hatte auch ich nichts, wollte das Gefühl um jeden Preis. Und die Stöhnschreie waren meine Hoffnung. Oh, hätte ich geahnt, was sich darin verbirgt. Oh, hätte ich das Teuflische bemerkt, hätte mich das Unheimliche abgeschreckt. Oh, hätte ich mich niemals darauf eingelassen. Damals aber zogen mich diese Schreie magisch an. Oho. Damals galt es einen Urknall zu bewältigen, eine Gefühlsblindheit, Berührungsangst. Ohoho.
Ich habe mich also gefragt, was das für Wesen sind, die so durchdringend jaulen, dass seismologische Institute kleine Erdbeben registrieren. Wie sehen sie aus? Was treiben sie? Wer sind diese Frauen, deren Schreie eine andere Welt auftun, alle Vernunft verlassen, vordringen in eine unbekannte Sphäre menschlicher Existenz?
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass Stöhnerinnen äußerlich meist unscheinbar, ja geradezu nichtssagend sind. Gerade die grauen Mäuse, die mit dem ungeschminkten Religionslehrerinnengesicht, den knielangen karierten Röcken, knöchellangen Socken, Rüschenblusen, Perlenketten, absatzlosen Schuhen, gerade diese Bürogräten und biederen Greteln scheinen nachts, wenn sie erkannt werden, erkannt, wie in der Bibel der Mann die Frau erkennt, erkannt, wie der Teufel das ihm zur Wohnung zugedachte Fleisch erkennt, ihre piepsende Maushaftigkeit abzulegen, um sich als wahrer Orgiengesangsverein, als Orchester wilder Grunzer zu entpuppen.
Mich hat dieses Gestöhn stets inspiriert. Ich habe gespürt, hier ließe sich mal etwas fühlen. Aber alle anderen? Wie soll man schlafen, wenn ganz in der Nähe lauthals Exkursionen in die Abgründe des Seins unternommen werden? Wie soll man friedlich schlummern, wenn sich nur wenige Meter entfernt der freie Wille Bahn schafft, alle Prellböcke niederwalzt, ganze Züge mit Ja- und Oh-bitte-ja-Gestöhn aus den Gleisen hebt? Wie soll man weghören, wenn es anderswo zu Kollisionen kommt, sich die Schleusen öffnen, an den Rändern der Existenz gekratzt wird? Es klingt, wie wenn ein Kind zur Welt kommt, jemand abgestochen wird oder ein Zug entgleist. Aber man kann nichts dagegen tun. Die Polizei verständigen? Im Fall der Stöhnerei hätte die Exekutive nichts zu exekutieren gehabt. Oder sollten die Beamten an der Wohnung der Lustschreierin klingeln und fragen: Wie lang ist Ihr Rohr? Oder sollten sie sagen: Verzeihung, Gnädigste, aber derartiges Gekreische ist ein ontologisches Verbrechen, eine ungehörige Anbohrung der Seele, die von schlichteren Gemütern als öffentliches Ärgernis, Hausfriedensbruch und Störung der Nachtruhe ausgelegt und daher angezeigt worden ist. Und was, wenn die Übeltäterin dann, was ihr gutes Recht wäre, eine Demonstration des erlaubten und des nicht mehr erlaubten Lustgeschreis verlangte? Wenn sie darauf bestünde, von den Beamten Beispiele vorgestöhnt zu bekommen? Zum Wettstöhnen würde es kommen. Zu einem Orgasmus-Karaoke. Nein, so etwas war bravbiederen Polizeibeamten (und wenn die hundertmal auf Demonstranten eingeprügelt hatten) nicht zuzumuten.
Und einen Exorzisten? An eine solche Möglichkeit denkt mal wieder keiner.
Gegen Stöhnerinnen wird wenig unternommen, dabei können sie mit ihren heftigen, gepressten Sexschreien, die man anfangs für Hilferufe oder Katzenschreie hält, ihre Umgebung terrorisieren, ja, ganze Hausparteien in den Ruin treiben, Karrieren zerstöhnen, Familien zerrütten. Die Wirkung der Stöhnerinnen ist dermaßen eindringlich, dass unliebsame Mieter schon Hausbesitzer oder Immobilienverwaltungen des Engagements einer solchen verdächtigt haben, um sie rauszustöhnen. Würde die RAF noch existieren, könnte sie Flashmobs mit Stöhnerinnen organisieren. Sogar die al-Qaida, diese lustfeindliche und rückständige Terrororganisation, die nur dazu da ist, um von den Chinesen abzulenken, soll schon an Stöhnattacken gedacht haben.
In Hausordnungen ist jede Wäscheleinenlänge, jeder Fußabstreifer, Fahrradständer, jedes Kellerabteil und jedes Brieffachformat geregelt, aber über das Stöhnen erfährt man nichts. Stöhnen kommt im Strafgesetzbuch nicht vor. Dabei ist es eine ernste, ja teuflische Angelegenheit.
Mit dem Stöhnen hat alles begonnen. Mich hat es von jeher fasziniert, nicht, weil es die Keimzelle von allem ist, sondern weil sich etwas auftut, eine neue Dimension des Seins, ein tiefes, wahrhaftig empfundenes Gefühl. Alles Aufgestaute wird hinausgeschrien in die Welt. Und ich habe gehofft, darin etwas zu finden, eine ehrliche Empfindung, Zugang zu mir selbst. Wie hätte ich wissen können, dass Dämonen und Mitternachtsteufel darin sind?
Also habe ich, Hildebrand Kilgus, versucht, der Stöhnfähigkeit auf den Grund zu kommen. Hat sie mit der Brustgröße, mit der Stimmlage oder der Erziehung zu tun? Stöhnen Klosterschülerinnen mehr als Kassiererinnen, Kindergärtnerinnen mehr als Zahnarztassistentinnen? Stöhnen Dicke mehr als Dünne? Fleischesserinnen kräftiger als Veganerinnen? Schwanenhalsige länger als Halslose? Großschädlige voluminöser als Kleinköpfige? Oder hängt sie mit der Schuhgröße zusammen? Ist so etwas angeboren oder angelernt? Gibt es Volkshochschulkurse im Stöhnen? Wird es vererbt? In den Badezimmern dieser Welt gelernt? Sind es tatsächlich Lustschreie, oder ist alles nur Bluff wie beim Telefonsex? Ich hatte keine Ahnung.
Selbst war ich lange Zeit an keine Frau herangekommen. Immer gab es Schönere, Sportlichere, Lustigere, Größere, Schlankere, die mir vorgezogen wurden. Außerdem habe ich mich wegen meiner Haphephobie (Angst vor Berührung) nur halbherzig bemüht. Also gab es eine Zeit, in der ich mir Freundinnen erfand. Mit dem Staubsauger machte ich mir Knutschflecke am Hals, in Parfümerien stahl ich Düfte, ich brüstete mich, Frauen erobert zu haben wie Hernán Cortés die Azteken. Mit fiktiven Liebhaberinnen vergnügte ich mich, die alle nur den einen Nachteil hatten: Sie existierten nicht — und stöhnten also auch nicht viel.
Um das Unglück an der Wurzel zu packen, stopfte ich mit Taschentüchern meine Unterhose aus, was gar nicht notwendig gewesen wäre, weil meine Wurzel auch so den ganzen Tag herumstand wie ein Maibaum im Mai, ich auch so auf dem besten Weg war, ein Priapist zu werden. Im Saurüssel hatte ich die deftigsten Wörter kennengelernt und auch allerhand gesehen, aber Frauen blieben mir lange Zeit versagt. Ich war schüchtern, verklemmt, haphephob und hatte nicht die geringste Aussicht, jemals an so ein holdes Stöhnwesen heranzukommen.
Jahrhunderte später, als ich schließlich doch meinen Mann stehen durfte, kam mir zugute, dass mich manche Frauen für ein Genie hielten, das man retten musste. Aber leider geriet ich nur an Stumme. Sosehr ich mich auch bemühte, mit meiner Wurzel die Öfchen der Damen anzuheizen, sosehr ich auf Handgreiflichkeiten (mit Handschuhen!) setzte oder sonst wie versuchte, sie bei der Stange zu halten, es kam doch nie ein Gestöhn heraus. Sogar Frauen, denen der Ruf großartigster, hemmungslosester Stöhnerei vorauseilte, waren bei mir stimmloses Fleisch, das höchstens leise piepste, aber niemals selbstvergessen aufstöhnte, niemals das Innerste nach außen kehrte, um durch die Paraurethraldrüse (ich erkläre dir später, was das ist) einen Stausee an gedrängter Lust zu entladen, in einen Ausnahmezustand zu geraten, in eine Besessenheit.
Ja, so war das, Mama. Während meine Schwestern Alma und Irmi in der Schankstube geholfen, im Badezimmer an ihrer Schönheit gewerkelt oder dem besoffenen Poldl Gesellschaft geleistet, seinen Geschichten von den Moslemweibern gelauscht oder ihm bei seinen obszönen Briefen geholfen haben, während du in der Küche gestanden bist oder mit dem Albert, deinem Adlatus, irgendwelche Anbauten am Haus gemacht hast, habe ich, dein Hildy, in direkter Nachfolge Giacomo Casanovas oder Charles Bukowskis Aufklärungsbücher gelesen, pornografische Schriften studiert und mich mit Stellungskatalogen wie dem Kamasutra beschäftigt, immer auf der Suche nach dem Geheimnis des Lebens, immer in der Hoffnung, einmal etwas wahrhaftig zu empfinden. Allein, es war aussichtslos, mein sogenannter freier Wille war schon längst auf Schiene, dem bahnbrechenden Gestöhne hinterher. Ich, dein Hildy, aufgewachsen im Gasthaus Zum Saurüssel im schönen Sumpfing, etwas dicklich, wegen eines leichten Sprachfehlers und des bis zum Nabel gehenden Hosenbundes oft gehänselt, bin Stöhnforscher geworden. Damit begann das Unheil.
Unter Störchen
Wenn man einer Sache an den Kern will, muss man sie umzingeln, einkreisen, den Ring allmählich schließen, um dann zuzustoßen. Meine kernigen Schwestern sind Postbeamtin (Alma) und Sparkassenangestellte (Irmi) geworden, ich, sicher der Verschlossenste von uns dreien, Forschungsreisender in Sachen Stöhngeschrei.
Was Mathematiker in Formeln suchen, Chemiker in Molekularverbindungen oder Astronomen im Weltall, was Vulkanologen in Lava speienden Bergen, Taucher oder Höhlenforscher in unwirklichen, menschenleeren Gegenden und Teilchenphysiker im Urknall sehen, vermutete ich im Stöhnen: das Geheimnis allen Lebens, ein wahrhaftiges Gefühl. Die Weltformel! Im Stöhnen schält sich ein Mensch bis auf seine Quintessenz, das Stöhnen offenbart den Ursprung allen Seins, da spiegelt sich der Big Bang wider, der eruptive Sprung aus der Willenlosigkeit vorherbestimmter Existenz, in dem sich Energie materialisiert.
Ich war natürlich nicht der Einzige, den dieses Gestöhne faszinierte. Millionen Filme, Würstelwestern, wurden zu diesem Thema schon gedreht, eine ganze Industrie befüllt Magazine und das Internet. Die Stöhnerei ist das, worum sich die halbe Menschheit und die Erde drehen. Auch wenn manche glauben, es ginge um Fortpflanzung, Befruchtung oder Machtspielchen, um Aufgeilen, Abspritzen oder Triebabfuhr, um Hormonhaushalt oder Ablenkung, geht es doch immer nur ums Stöhnen, das interessanteste Geräusch der Welt.
Laut dem Georgier Wilhelm Svetopluk Huffingvili (1898 bis 1967), dem neuzeitlichen Ahnherrn aller Stöhnforscher, wie Andrej Dmitrijewitsch Sacharow (nein, das ist nicht der Erfinder des Saccharins) nach Nischni Nowgorod, da gibt man Salz aufs Brot, das macht die Wangen rot, vormals Gorki, verbannt und später wegen systemzersetzender Umtriebe hingerichtet, gibt es drei Hauptgruppen von akzelerierter Respiration: Luststöhnen, Gebärstöhnen und Todesstöhnen, welche in Huffingvilis Hauptwerk Der Urschrei und wir in die Untergruppierungen Schmerzstöhnen, Verluststöhnen, Angststöhnen, hysterisches Stöhnen und so weiter untergliedert werden, aber keines ist so intensiv, so entfesselt wie das weibliche Orgasmusstöhnen. Huffingvili weist übrigens auf allen von ihm bekannt gewordenen Bildern deutliche Anzeichen eines beginnenden Exophthalmus (Glupschaugen) auf. Außerdem hat er bemerkenswerte Fliegerohren und stets geblähte Backen, als wäre er gerade dabei, etwas aufzublasen.
Gibt es also einen freien Willen? Eine Entscheidungsmöglichkeit? Nicht für mich. Ich war wie ferngesteuert, musste mich der Stöhnerei zuwenden. Trotzdem war ich unsicher, in einer nebulösen Ahnung, einer Zeit geringster Gewissheit. Nirgendwo wurde mir bestätigt, dass meine Ahnung richtig war, dass huffing and puffing, wie die Stöhnerei auf Englisch heißt, tatsächlich den Eingang zur Seele bildet, der Orgasmusschrei das Tor in die Unterwelt darstellt — oder ins Paradies? Nirgendwo wurde mir bestätigt, dass ich über das Stöhnen tatsächlich Zugang zu wahrhaftigen Empfindungen bekommen könnte. Da ich schüchtern war, mich mit den seit der Pubertät gewachsenen Maiskörnern im Gesicht, die wie Popcorn aufplatzten, hässlich fühlte, mich mit solchen Pickelplantagen an Frauen nicht heranwagte, sie außerdem auch nicht berühren wollte, weil es mich vor jeder Berührung ekelte, blieb mir das Luststöhnen unzugänglich.
Also habe ich mich nach meiner Flucht aus Sumpfing erst einmal dem Gebärstöhnen zugewandt, eine Schulung zur Hebamme gemacht und in einer geburtshilflich-gynäkologischen Klinik als Aushilfshebamme begonnen. Vivos traho, mortuos frango, caesas plango hing da über dem Portal: Die Lebenden ziehe ich heraus, die Toten zerbreche ich, die zu Fall Gekommenen beklage ich.
Da waren Leben und Tod die alltäglichen Geschäfte, war man eingehüllt in Gekreische und Gejammere — ein Paradies. Gut, es roch nach Ammoniak, Blut und Fruchtwasser, das mich übrigens immer an Kartoffelsuppe erinnerte, überall standen Störche mit Stoffbündeln im Schnabel, überall Fotos von kleinen, zerdrückten Menschlein, die aussahen wie Albino-Dörrpflaumen und Nicole, Kevin, Dennis oder Laura hießen, aber es musste doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich hier nicht dem Stöhnen auf die Schliche kommen sollte.
Du kannst dir aber denken, Mama, dass ich es als männliche Hebamme in dieser Sache nicht gerade leicht hatte. Um nicht sofort hinausgemobbt zu werden, gab ich mich als Schwuler aus, besorgte mir eine Handtasche und verteidigte das Hochamt der Homosexualität, von der ich keine Ahnung hatte. Ich schwärmte von Sokrates, Shakespeare, Schiller, Oscar Wilde, Bert Brecht und Andy Warhol, las Alice Schwarzer, Susan Sontag und all die anderen Lichtgestalten der Emanzipation, interessierte mich für Gender, Fragen der Gleichberechtigung und sprach wie alle Semanzen (semantische Emanzen) die Substantive mit dem Zusatz Innen aus, ersetzte man durch frau.
Binnen weniger Wochen kannte ich mich aus mit den Grundsätzen der Entbindungskunst. Wusste mit der Wiener Schulzange ebenso umzugehen wie mit dem von Tage Malmström entwickelten Vakuumextraktor, einer Saugglocke, die frau zum Einsatz bringt, wenn das Baby schon im Becken ist und plötzlich die Herztöne nachlassen. Ich war ein Experte für Steißgeburten, kannte mich aus mit Schräglagen und Dammschnitten, mit verwickelten Nabelschnüren und Hebammentrünken, das sind abführende Mixturen aus Lebertran, Sauerkrautsaft und Wacholderschnaps. Nabelabbinden konnte ich wie kein Zweiter. Leider alles nur an den Modellpuppen, an die wirklichen Schwangeren ließ man mich nicht ran. Und da ich wegen meiner Angst vor Berührungen ständig medizinische Handschuhe trug, wurde ich ohnehin von allen für etwas seltsam angesehen.
Die Oberhebamme sagte, eine Geburt sei wie ein tiefergelegter Sportwagen, da müsse man auch zuerst einmal das Aussteigen üben. Keine Ahnung, wie sie zu diesem blödsinnigen Vergleich gekommen war. Vielleicht weil sie selbst den ausgebauten Sportwagensitz eines alten Aston Martin in ihrem Keller stehen hatte, an dem sie ständig ein elegantes Aussteigen probierte: Beine zusammen und mit Schwung — zumindest tuschelten die anderen Hebammen davon. Eine Ungeübte muss die Beine spreizen, sich am Armaturenbrett festkrallen oder sich gar von ihrem Begleiter herausziehen lassen wie eine Ertrinkende. Das kam für die Oberhebamme alles nicht in Frage, wäre sie einmal zu einer Ausfahrt in einem Sportwagen eingeladen worden, hätte sie mit Stil und Eleganz beeindrucken können. Beine zusammen und mit Schwung. Aber solange sie an ihrem Sportwagensitz das Aussteigen übte, musste ich, der Schwule, bei den Puppenmodellen bleiben.
Dabei wusste ich, was bei einer Mekoniumaspiration, das ist, wenn Kindspech in die Fötenlunge kommt, zu tun war, beherrschte sogar die Kraniotomie, die ich dir besser nicht erkläre. Gerettet aber hat mich der Kaffee, den frau mir förmlich aus der Hand riss — wobei ich natürlich streng darauf achtete, dass frau mich dabei nicht berührte.
In der Klinik war es wie mit den Wirtshäusern in Sumpfing. Zuerst kam der Kirchenwirt, wo die Besseren, die sogenannten Bürger und Großbauern, hingingen, dann der Hofwirt, der Treffpunkt des Mittelstands, und zum Schluss wir, der Saurüssel, wo sich der Abschaum traf, wo alles erlaubt war, weil keiner hinschaute. In der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik hieß die Hierarchie: Primarärzte, Oberärzte, Krankenschwestern, Oberhebamme, Hebammen, Patientin, Neugeborenes. Und je weiter oben jemand war, desto weniger wusste er. Ich, der ich sehr viel wusste, die Leopoldschen Griffe, den sogenannten Ultraschall der Hebamme, wie kein Zweiter beherrschte, die Wehen systematisiert hatte, am Blick der Schwangeren erkennen konnte, wann es so weit war, kein CTG (Cardiotokogramm) brauchte, um die Niederkunft zu bestimmen, ich also, der ich das Wort pressen in siebenunddreißig Sprachen kannte, durfte meist nur die Blut- und Fruchtwasserlachen, die Erdäpfelsuppe, aufwischen, umgekippte Väter wegtragen oder nicht umgekippten Erzeugern Nabelschnur und Schere reichen, die Neugeborenen wiegen, messen, anhand der Füße ihre künftige Körpergröße bestimmen, sie den Neonatologen zum Ultraschall übergeben, den Intubator bereitstellen und Kaffee kochen, was ich meisterhaft beherrschte. Mein Kaffee war weltberühmt in unserer Klinik, ich war der George Clooney unter den Hebammen. An die wandelnden Überraschungseier, wie ich die Graviditätischen, also die Schwangeren nannte, ließ man mich trotzdem kaum heran.
Dennoch war ich glücklich, träumte von einem Archiv des Stöhnens, einer Schreisammlung — ähnlich den DNA-Sammlungen der Polizei oder den Geruchsarchiven in DDR-Gefängnissen, wo jeder Gefangene ein paar Tage lang einen Stofflappen zwischen den Beinen tragen musste, der dann in ein Rexglas kam, um ihn im Falle eines Ausbruchs den Spürhunden vor die Schnauze halten zu können. So etwas schwebte mir vor, eine Stöhn-Enzyklopädie. Leider hat man mich ertappt, wie ich mich mit meinem Aufnahmegerät hinter einer Gebärenden versteckte.
Während die anderen Geburtshelferinnen die Schwangeren anfeuerten und Fang sie auf, fang die Wehe auf brüllten, dachte ich nicht nur an Holden Caulfield, den Fänger im Roggen, sondern erstellte Diagramme des Stöhnens, die mit dem CTG, dem Herz-Wehen-Schreiber, nur bedingt übereinstimmten. Während die anderen Hebammen den Stuhl, der beim Pressen aus der Gebärenden schoss wie ein Sektkorken aus der Flasche, wegputzten, sich mutig in die Fruchtwasserfontänen stellten und den neugeborenen Früchtchen die weiße Käseschmiere von der roten Haut wischten, war ich mit meinem Aufnahmegerät und meinen Diagrammen beschäftigt — bis man mich erwischt hat.
— Hab ich dich, Bürschchen, brummte die Oberhebamme wie der aufgetunte Motor eines Sportwagens. Sie packte mich am Ohrläppchen und zog mich aus meinem Versteck bis zu ihrem Chef.
Der Oberarzt, Alfred Kaguru, war ein blonder, untersetzter, aber solariengebräunter Mann von etwa vierzig Jahren mit einer großen Kartoffelnase im Gesicht. Er trug ein blaues Satinhemd, gelbe Leinenschuhe und war ohnedies nicht gut auf mich zu sprechen, weil ich ihn einmal dabei ertappt hatte, wie er bei einer schweren Geburt nicht weiterwusste und einen Kollegen zu Hilfe rief — seither fühlte er sich irgendwie durchschaut.
Nun ließ er sich die Sache kurz erklären und wetterte dann los: Sozialschmarotzer! Unverlässlicher Mensch! Einschleichschwein! Vollhormon! Als pervers wurde ich beschimpft, als krank, abnorm, unfähig, da nützten alle Erklärungen von wegen Stöhnforschung, Fortschritt für die Menschheit, Errettung im Stöhnen und freier Wille nichts. Der Oberarzt war überzeugt, meine Aufnahmen hätten nur den einen Sinn, ihn und die ganze Klinik vor ein Arbeitsgericht oder ein Gesundheitsamt zu bringen.
— Aber überhaupt nicht, mir geht es nur um das Gefühl.
— Ich werde Ihnen gleich etwas zu fühlen geben.
— Schön wär’s.
— Sie! Und jetzt hören Sie endlich auf, an Ihrem Ohr herumzufummeln.
— Das ist nur, weil mich die Oberhebamme daran gepackt hat. Ich habe eine Haptophobie, das heißt, ich habe Angst, mich durch Berührung anzustecken.
— Ich weiß, was das bedeutet! Aber Sie sind nicht der Michael Jackson. Der karamellbraune Oberarzt war außer sich vor Zorn. Ich empfand dagegen nichts. Äußerlich war ich geknickt, betrübt und voller Reue, aber innen drinnen kam nichts an mich heran. Das Gebärstöhnen hatte sich also als Irrweg herausgestellt.
— Und außerdem, ergänzte die Oberhebamme, hat er den Patientinnen immer Kochsalzlösungen verabreicht. Statt Schmerzmittel und Wehenhemmer immer Kochsalzlösungen. Das war zwar glatt gelogen, sollte aber für den Fall nachträglicher Klagen eigenmächtig getätigte Sparmaßnahmen legitimieren, mit denen die Sportwagen-Mamsell entweder der Klinik zu einer ausgeglichenen Bilanz oder sich selbst zu einem Luxusschlitten verhelfen wollte.
Alfred Kaguru tobte, er lasse das nicht zu, diese Einschleichmethoden seien ihm persönlich zuwider und die Ausrede mit der Stöhnerei das Dümmste, was ihm jemals zu Ohren gekommen sei. So einen Blödsinn habe er überhaupt noch nie gehört. Stöhnforschung? Aber immer nur heraus mit der Sprache. Wer sei mein Auftraggeber? Die Gewerkschaft? Das Gesundheitsamt? Die Krankenkasse?
Da ich nicht wusste, wie man sich in solchen Fällen verhält, machte ich eine tiefe Verbeugung und bot ihm eine Vorführung der Stöhnsammlung an, was er anscheinend als weitere Provokation auffasste, worauf er mich noch unflätiger beschimpfte: Trabant! Schwuler Affenschädel! Kloake! Rennt mit einer Handtasche herum! Immer Handschuhe! Dolm! Die anderen Hebammen lauschten diesen Schmähungen ebenso andächtig wie die Gebärende in ihrem vanillefarbenen Spitalshemd. Ja sogar das Kind, das zwischen Vakuumschädel und Arschgeige beinahe unbemerkt in die Welt rutschte, schien sprachlos. Nicht einmal der Kaffee konnte mich jetzt noch retten. Ich wurde meiner Anstellung entbunden, fristlos, und von allen Krankenhäusern und Privatkliniken abgenabelt. Berufsverbot. Andere an meiner Stelle wären jetzt wohl traurig gewesen, mich ließ es kalt. Nur das mitleidige Schulterklopfen der anderen Hebammen war ein Horror. Noch Tage später wurde ich das Gefühl nicht los, mir ständig die Schulter abbürsten zu müssen.
Das N der Vögel
Da stand ich nun wie ein aus der Gebärmutter vertriebener Fötus und versuchte meine zerfahrenen Gedanken zu ordnen. Eines war klar, ich musste die Branche wechseln. Also wandte ich mich von der Zucht zur Unzucht, wurde, weil die Schienen meines Lebens dahin führten, weil ich mich an Huffingvilis Unterteilung hielt, Puffmutter oder vielmehr Puffvater — also eine Mischung aus Hausmeister, Portier und Anstandswauwau, dessen vordringlichste Aufgabe es war, dafür zu sorgen, dass in der Glasschüssel am Eingang immer genügend Mentholzuckerl waren. Die Gäste wollten ein Mentholzuckerl, wenn sie kamen, um den Alltagsmief aus ihrem Maul zu vertreiben, und eines, wenn sie gingen, um den Puffgeschmack wieder loszuwerden. Wenn sie Auto fuhren, wollten sie auch noch ein zweites für etwaige Alkoholkontrollen. Die Mentholzuckerl waren das Wichtigste am ganzen Puff.
Schiefer Turm von Pisa hieß das Etablissement, es war vor allem auf Gangbangs und Bukkake spezialisiert. Was das ist? Mama, wenn ich es dir sage, bereust du es und wünschst, nie danach gefragt zu haben. Sagen wir mal so, es ist eine Art Suppe aus Hunderten Mentholzuckerln, die man der Pechmarie über den Schädel schüttet.
Dass man von Liebe heutzutage nicht mehr sprechen kann, das Wort Liebe völlig verbraucht, benutzt, abgelutscht, ja, tot ist, dass man es für die nächsten hundert Jahre unter Quarantäne stellen müsste, ist die eine Sache, aber dass es dafür solche ungustiösen Sachen gibt? Ich weiß nicht. Nicht, dass es mich berührt hätte, aber …
Gangbangs und Bukkake sind der Albtraum jeder Musterungskommission, ein Melken wie in einem Kuhstall, dass man meinen könnte, der europäische Milch- und Butterüberschuss würde da produziert. Etwas völlig anderes als mein unschuldiges Hochzeitspielen mit Oma und Hexi, unserem Dackel. Du erinnerst dich, ich habe mich mit einem alten Zylinder als Bräutigam verkleidet, und Oma war die Braut, mit einem Store als Kleid und einem Fliegennetz als Schleier, während Dackeldame Hexi einen alten violetten Anorak bekam und auf Pfarrer machte. Manchmal war auch Hexi die Braut und Oma der Pfarrer. Würdig schritten wir vom Gemüsebeet, vorbei an der Blutbuche, der Hundehütte und dem Hühnerstall, zum aufgebockten Autowrack, summten den Hochzeitsmarsch, küssten einen alten Skipokal, tranken Himbeersaft, aßen Oblaten und schworen ewige Treue oder jaulten Bis dass der Tod uns scheidet, steckten uns Plastikringe an und warfen Konfetti in die Luft. Nachher gab es Kakao und Gugelhupf und Knochen.
Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, unser unschuldiges Heiraten mit den Gangbangs zu vergleichen — die waren nämlich ziemlich unziemlich. Oder anders gesagt, wer bei der Kraniotomie übersehen worden ist, beteiligt sich an dieser Gießerei, die Männer in Spritzkannen verwandelt.
So war ich also in den Schiefen Turm von Pisa geraten, zwischen Freier und Unfreie. Die meisten Mädchen wurden wie Sklavinnen gehalten, lebten ohne Pass und Einkommen, ohne Sinn und Ziel, einzig als Zielscheibe für Geschäftsleute, Manager, Bankbeamte. Sie waren wegen märchenhafter Versprechungen gekommen, wegen der Aussicht auf einen gutbezahlten Job als Aupair-Mädchen, Kellnerin oder Krankenschwester. Jetzt mussten sie ihre Reisekosten abarbeiten. Tagsüber lasen sie Prospekte von Volkshochschulen oder sahen sich im Fernsehen Seifenopern an, träumten von einer anderen Zukunft, Familie, Kindern, Eigenheim, davon, dass sie eines Tages alles hinter sich lassen würden. Sie begriffen sich selbst als Schauspielerinnen, die nur eine Rolle spielten.
Das Licht in einem Puff ist anders als in einer Klinik. Tagsüber roch es nach Putzmitteln, abends nach üppigen Parfüms. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wer hier alles Kunde war und mir die Mentholzuckerl wegfraß: der Männergesangsverein, die Freiwillige Feuerwehr, eine Delegation des Rings der Freiheitlichen Jugend, Gewerkschaftsbosse, ein Priesterseminar, Fußballvereine, Diplomaten, Tierschützer, Umweltaktivisten, halbe Schauspielensembles, Opernsänger, Friedensaktivisten, Pfadfinder, Generäle, Schriftsteller, sogar ein Ärztekongress samt Alfred Kaguru gingen hier ein und aus.
Manchmal, wenn ich beim Saubermachen (auch hier trug ich immer meine Vinylhandschuhe) ein größeres Quantum Kindermilch (so nannten die Nutten das Sekret) fand, gab ich es den Zuhältern und beteiligten Geschäftsleuten in den Kaffee. Es hat sich nie jemand beschwert. Wir sind eine zur Sparsamkeit erzogene Generation. Nichts darf weggeschmissen werden, das hat mir Oma beigebracht.
Immer hat es geheißen, iss nicht so viel, telefonier nicht so viel, schau nicht so viel fern. Und heute heißt es, du kannst essen, so viel du willst, telefonieren, so lange du willst, dich vergnügen, so viel du kannst. Und so ist es auch beim Sex. Bei Gangbangs versammeln sich die, die immer Angst haben, zu kurz zu kommen, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um sich freien Lauf zu lassen, sich auszugießen. Es ist so eine Art Pauschalreise in Sachen Blasmusik. Eine Ejakulationseskalation. Aber das Stöhnen, das dabei herauskommt, ist kein Schreien bis zum Teufel komm heraus, nicht aus einem Guss, es ist unecht, outriert und ungustiös, kein schönstes Geräusch der Welt. Da hätte ich gleich in einer Telefonsexzentrale arbeiten können.
Mir ging es ja nicht um das röchelnde Gekeuche, den Lustschrei als solchen, sondern um das Sich-Verlieren, um den Moment, wenn sich der Geist vom Fleisch löst, hochsteigt wie ein Flugdrache, nur vom Nylonfaden gehalten noch am Leben hängen bleibt. Mir ging es um die Seele, dieses kleine, nach den Forschungen des Duncan MacDougall durchschnittlich einundzwanzig Gramm wiegende Persönchen, das bei mittelalterlichen Sterbebildern als kleiner Mensch aus dem Mund entweicht und auch im Lustgestöhn den Körper kurz verlässt. Und mir ging es um das Universum der Gefühle, um den Urknall der Empfindungslosigkeit — obwohl ich damals noch nichts von den Dämonen wusste, nichts von der Möglichkeit einer Strafbesessenheit.
Glaubst du, Mama, an die Unendlichkeit des Universums? Manche meinen ja, dass das unmöglich ist, weil es dann unendlich viele Sonnen gäbe und unser Himmel immer hell erleuchtet wäre. Aber vielleicht sind diese unendlich vielen Sonnen einfach unendlich weit von uns entfernt, sodass ihr Licht uns noch unendlich lange nicht erreicht? Oder sollten sich kosmische Wolken davorgeschoben haben? Wenn es aber endlich wäre, wie hätten wir uns seine Grenzen vorzustellen? Mit einem rot-weiß-roten Schranken, Zollhüttchen und Grenzpatrouillen? Mit Schildern: Ende Gelände! Achtung! Hier endet das Universum! Verlassen auf eigene Gefahr! Und was wäre dahinter? Das Nichts? Vielleicht ist das Universum wie ein Bauchinnenraum — und beim Stöhnen macht es einen Quantensprung, gerät es an seine Grenze, überspringt sie und wechselt die Dimension? Aber nicht beim Stöhnen im Schiefen Turm, das war ein Fake, ein nur unzureichend von Mentholzuckerlgeschmack übertöntes Magengären, ein Im-Sportwagen-sitzen-und-nicht-Hochkommen.
Manche meinen, dass in der sexuellen Befreiung etwas Revolutionäres steckt, eine anarchische, furchtlose Freiheit, manche meinen, erst im Rudelbumsen emanzipiere sich der Mensch von allen Konventionen fehlgeleiteter und falsch verstandener Individualität. Für mich war das Milieu nur schmuddelig, ein Ort finsterer postmasturbatorischer Traurigkeit, wo auf allem eine leichte Fettschicht lag, wo wildfremde Menschen einander gegenseitig angriffen. Ein Horror. Schon allein die Vorstellung … Auch heute noch empfinde ich das Hotel Orient als unsauberen, anstößigen, aus der Zeit gefallenen Ort, den ich freiwillig nicht aufsuchen würde, weil er mich zu sehr an den Schiefen Turm von Pisa erinnert.
Aber damals liebte frau mich für den Kaffee, die Mädchen waren nett. Ich begleitete sie zu ihren wöchentlichen Touren zum Amtsarzt, wo sie ihren Deckel, wie man den Gesundheitspass nennt, bekamen. Manche bekochten mich dafür mit Borschtsch, schenkten mir dünne russische Zigaretten oder gaben mir von ihrem Räucherkäse ab, mit dem ihre Verwandten sie versorgten. Wenn wir Wodka tranken, wurden sie sentimental, sangen und erzählten von ihren einfachen Dörfern, von Ochsenkarren, Marktweibern und betrunkenen Vätern, von Atommeilern und Krankenhäusern aus Asbest. Einige boten mir dann aus reiner Dankbarkeit sogar an, mich zu entjungfern. Aber ich hatte nicht nur panische Angst, mich zu verlieben, sah mich schon als tätowierten Zuhälter, sondern hatte auch herausbekommen, dass keine Einzige von ihnen jemals einen Orgasmus gehabt hatte, nicht im Schiefen Turm. Auch diejenigen, die am lautesten Ich-komme-immer posaunten, kamen nie. Vielleicht war dieser ganze Orgasmus nur ein großangelegter Bluff, ausgedacht von machtgierigen Frauen, um ihre Männer zu unterjochen. Aber das glaubte ich nicht. Ich war nach wie vor davon überzeugt, dass mich das echte Stöhnen zu den wahren Empfindungen bringen würde.
Also war meine Zeit dort endlich, war es nur eine Frage der Gelegenheit, bis mein Lebenszug mich fortzog, ich mich nicht länger mit paarungswilligen Spritzbuben und falschen Stöhnern sogenannter Sexarbeiterinnen — die Begriffe Hure, Nutte und Prostituierte waren im Gewerbe längst verpönt — beschäftigen wollte. Für meine Stöhnstudien konnte ich mich bald nicht mehr mit unaufrichtigen Aufrichterinnen, einseifenden Versteiferinnen, geriebenen Abreiberinnen, volllippigen und vollbusigen Flachlegerinnen und Milky-Way-Fratzen abgeben, sondern mit Daniederliegenden, Hingestreckten, Todgeweihten. Gibt es einen freien Willen? Oder war es Bestimmung, dass ich nach dem Puff gleich in eine Hospizabteilung kam, wie man die Krankenhausstation der Hinscheidenden euphemistisch nennt?
Vorher aber ließ ich noch den Schiefen Turm von Pisa hochgehen, was den versklavten Mädchen aus Russland, der Ukraine und dem Kaukasus die Freiheit brachte, zumindest die Freiheit von ihren Zuhältern. Als ich sie im Gefängnis, in dem sie auf ihre Abschiebung warteten, besuchte und ihnen Würste, Bananen und Zigaretten brachte, haben sie Hildy! Hildy! gebrüllt und mir tausendfach gedankt. Ihre Augen hättest du sehen sollen, groß wie Weintrauben, feucht wie volle Kinderwindeln. Sie waren so freundlich und liebesbedürftig, so sanft und treuherzig, dass ich mich hinreißen ließ und ihnen streng vertraulich anvertraute, dass ich es gewesen war, der die Anzeige gegen den Schiefen Turm eingegeben hatte. Na, da hättest du ihr Fluchen hören sollen. Dagegen war das Kaguru-Gezeter in der Klinik direkt lieblich. Beschimpft haben sie mich, mir tausend Teufel in den Leib gewünscht, Pest, Krätze und alle Geschlechtskrankheiten. Undankbares Pack.
Totenvögel
Im Hospiz, in der Wartehalle zur letzten großen Reise, wollte ich die Stöhnlaute studieren, die finalen Seufzer, letzten Schreie, das Lazarus-Syndrom. Und ich wollte endlich mal etwas empfinden. Natürlich konnte ich es so einrichten, dass mich auch hier niemand berührte. Erstens trug ich seit meiner Zeit als Hebammer immer Handschuhe, zweitens hatte ich meist eine hölzerne Gurkenzange bei mir, mit der ich besonders unappetitliche Dinge greifen konnte.
Dabei war es herzzerreißend. Menschen mit langen, dunklen Schatten, die nach ihrer Mama riefen, um Vergebung baten oder sich selbst anklagten, dieser oder jener Versuchung nicht nachgegeben zu haben, sich dieser oder jener Sünde enthalten zu haben. Alle bereuten sie, aber nicht nur ihre begangenen, sondern vor allem ihre nicht begangenen Sünden. Alle trauerten sie ihren verpassten Gelegenheiten und nicht genützten Chancen nach. Die Welt, die mich hier umgab, erregte mich — zumindest an der Oberfläche, innerlich kam nichts an mich heran. Ausgemergelte Gesichter, bleiche Totenschädel mit dünner, gelber Haut und großen gebrochenen Augen, Skelette. Mehr tot als lebendig. Alle an Dialysegeräten, Infusionsflaschen, Herz-Kreislauf-Maschinen.
Manche meinen ja, im Angesicht des Todes wird alles lächerlich, manche sagen, der Tod bricht alles runter auf ein winzig kleines Maß. Aber das stimmt nicht, das Gegenteil ist wahr. Im Angesicht des Todes hat alles Bedeutung, Größe, Anmut, beneidet man jeden, der noch lebt, jeden, der mit seinem Hund Gassi gehen und Scheiße aufwischen darf, jeden, der lasches Fastfood-Essen kaut, billige Zigaretten raucht, sein Gesicht hinhält, die Geburt mit dem Aussteigen aus einem tiefergelegten Sportwagen vergleicht oder mit seinem Ehepartner zankt, auf einen Strafzettel flucht, jede noch so verlebte, verwachsene, missmutige Gestalt. Im Angesicht des Todes will man mit jedem tauschen, der noch lebt.
Du musst dir vorstellen, Mama, eine ganze Abteilung mit Krepierenden gefüllt, mit Menschen, die sich nicht mehr rühren können, nur noch aus Haut und weit vorstehenden Knochen bestehen, Menschen, die das Haar verlieren, mit einer Chemo kämpfen, deren Organe der Reihe nach versagen, die nur noch auf eines warten, nämlich auf den Tod. Einzig dir fehlt nichts. Da läuft es dir kalt über den Rücken, entschließt du dich, einen strengeren Maßstab an dich selber anzulegen, dich zu bessern, Sport zu treiben, gesünder zu leben, deine Zeit bewusster zu genießen, dankbar zu sein für jeden Tag — selbst wenn du kein Mitleid hast, dich alles nicht berührt.
Im Hospiz herrschte wie schon in der Gebärklinik ein strenger Ammoniakgeruch. Ständig hatte man einen metallischen Geschmack im Mund. Hier hingen keine Störche an den Wänden, keine Babyfotos und auch keine marmornen Riesenpenisse wie im Schiefen Turm. Hier war alles seltsam aufgeräumt, als gelte es, den Todgeweihten das Gefühl größtmöglicher Ordnung zu vermitteln. Keine Mentholzuckerl, nur Kaugummi kauende Notare, die hier aus und ein gingen, um die letzten Verfügungen der Eingehenden zu ändern. Wenn man stirbt, hat man so gut wie alles verloren, nur eines nicht, sein Testament, womit man sich an seinen Hinterbliebenen rächen kann, dafür, dass sie einen nicht retten, weiterleben, nur an sich denken. Das Testament ist die letzte Waffe, und gemeinsam mit den Notaren spitzen sie die Todgeweihten, sofern sie noch bei Bewusstsein sind, täglich zu und füllen sie mit Gift.
Meine Aufgabe war es, Kurse abzuhalten. Heben im Alter — hier habe ich einen halbseitig Gelähmten aufgefordert, einen Tisch zu tragen, den ich dann selbst, weil er sich weigerte, aufzustehen, kaum schleppen konnte. Stressbewältigung im Alltag, mein Lieblingskurs, ich ließ die Teilnehmer ihre schlimmsten Stresssituationen beschreiben, um dann regelmäßig mit der Feststellung, dass sich heute leider kein weiteres Thema mehr ausgehe, die Einheit zu beenden. Fitnessstudio — hier wurden die Patienten an Crosstrainer, Ergometer, Hantelbänke und ähnliche Geräte gesetzt und dann allein gelassen. Mit furchtbaren Ergebnissen.
Da das Hospiz für all diese Kurse von den Krankenkassen Geld bekam, musste ich mich auf jedem Gebiet als Kapazunder ausgeben, mich immer anders verkleiden und mit ausländischem Akzent sprechen. Einmal war ich ein bulgarischer Osteopath, dann wieder ein iranischer Psychotherapeut oder ein australischer Fitnessguru. Irgendwann habe ich begonnen, diese völlig unsinnigen und nur zur Geldbeschaffung ausgerichteten Kurse in Gesprächsrunden umzufunktionieren, die Sterbenden mit kleinen Geschichten erfreut, Geschichten von Sumpfing und vom besoffenen Poldl, seinen Moslemweibern, vom Saurüssel und der Oma. Geschichten vom Stöhnen und den Strategien, Berührung zu vermeiden — hier war die hölzerne Gurkenzange ein schönes Vorzeigeobjekt.
Bald habe ich den Sterbenden erklärt, dass beim Sterben das Nichtige ihrer Existenz herausgestöhnt wird, in dem Moment, in dem sie selbst nichts werden, kein Nichts mehr in ihnen übrig bleibt, also kann auch kein Nichts mehr in ihnen sein, sondern ein Alles. Indem sie nichts werden, haben sie alles in sich. Sterben ist wie Kaffeekochen, so wie der Geschmack vom Pulver in das Wasser geht, löst die Seele sich im Universum auf. Doch was war das Ergebnis? Starben die Todgeweihten hoffnungsfroh? Stöhnten sie, die da schwer wie Getreidesäcke in ihren Betten lagen, noch einmal herzerquickend? Gaben sie mir Beispiele für mein Stöhnarchiv? Nein, diese undankbaren Gerippe wurden gesund, sprangen aus den Betten, jauchzten. Unheilbar Kranke, Menschen ohne Organe, solche mit künstlicher Beatmung, mit tödlichen Viren, sie alle erholten sich, genasen und verließen binnen weniger Tage die Station, statt mich mit finalen Stöhnern zu erfreuen. Schändliches Pack! Ein paar umarmten mich auch noch. Entsetzlich. Tagelang wurde ich dann das Gefühl nicht los, beschmutzt worden zu sein.
Schon bald kamen Beschwerden: Priester, Erben, Beinahe-Witwen, Menschen, die auf frei werdende Wohnungen oder vakante Arbeitsplätze spekulierten. Es gibt ja immer genügend, denen es gar nicht schnell genug gehen kann. Auch die Anatomen und Pathologen waren unzufrieden. Den Sezierkursen der medizinischen Fakultät gingen die Leichen aus, den Chirurgen die Organe, den Sargproduzenten, Totengräbern und Blumenhändlern fehlten die Begräbnisse, den Druckereien die Partezettel. Sie alle reichten Protestnoten ein, was zur Folge hatte, dass der Vorstand der Abteilung, Hermann Kaguru, Bruder des dir bereits bekannten Alfred, mich zur Brust nahm. Dieser Bruder, der zweite Kaguru, dieselbe Kartoffelnase, dieselben Vogelaugen, mied Solarien. Er war schon von Natur aus anämisch, seit der gegen null gehenden Sterblichkeit aber bleich wie ein Leichentuch, was seine Zähne noch gelber erscheinen ließ. Er war die ungebräunte Ausgabe seines Bruders. Zwei Tiefkühlputer, einer roh, der andere gegrillt.