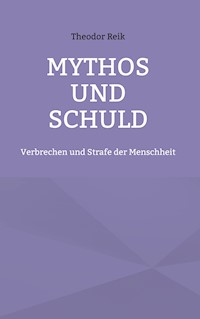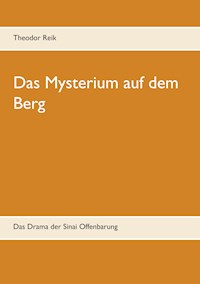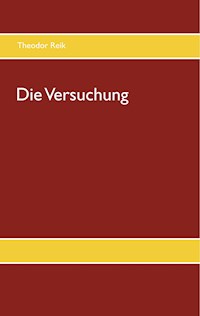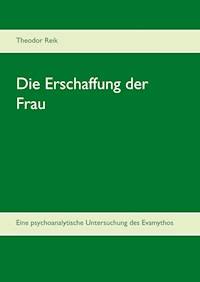
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Das Buch entfaltet eine breite Bandbreite kulturhistorischer und kulturphilosophischer Informationen zum Verhältnis Mann und Frau. Ausgehend von Freuds Buch Totem und Tabu zeigt Reik, dass die biblische Geschichte der Erschaffung der Frau ihren Ursprung in den Initiations- und Pubertätsriten vorgeschichtlicher Völker hat. Die Lektüre dieses Buches lohnt sich besonders wegen des reichen Materials, das Reik hier vorlegt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uxori meae
dedico
hanc translationem
Inhalt
Vorwort des Übersetzers
Motto
Vorwort
Teil Eins: Der Mythos und das Geheimnis von Eva
I Die zwei Geschichten
II Das erste menschliche Wesen – ein Mann-Weib?
III Adam und die Tiere
IV Die Rabbiner
V Der Zankapfel
VI Die Dichter
VII In allzu ruhigem Fahrwasser
VIII Die Exegeten
IX Intermezzo – aus Kindermund
X Die psychoanalytische Interpretation
XI Ein neuer Weg ist notwendig
Teil Zwei: Die Lösung
XII Das große Stammesmysterium
XIII Neue Anhaltspunkte
XIV Adams Beschneidung
XV Da sitzt der Haken
XVI Ein Betrug in der Steinzeit
XVII Albernheit und Gespött im Evamythos
XVIII Tradition und die Geheimnisse der Vergangenheit
XIX Spähend durch Risse
Nachwort
Anmerkungen
Vorwort des Übersetzers
Betrachtet man das Gesamtwerk von Theodor Reik, so fällt auf, dass am Anfang und am Ende seines Schaffens religionspsychologische Werke stehen. Besonders Gestalten und Elemente der jüdischen Religion haben ihn immer wieder herausgefordert. So finden sich in seinem 1919 erschienenen Buch „Probleme der Religionspsychologie“ zwei Beiträge zu jüdischen Themen. Der eine Beitrag behandelt das Kolnidre, das bekannteste Gebet oder Lied des jüdischen Versöhnungstages, in dem anderen Beitrag geht es um die Bedeutung des Schofar, einem altertümlichen Instrument in der jüdischen Liturgie. 1923 folgte dann das Buch „Der eigene und der fremde Gott“. Das Werk „Dogma und Zwangsidee“ erschien 1927. Beide Schriften sind nicht speziell jüdischen Themen verpflichtet und beziehen auch christliche Motive mit ein. Den vorläufigen Abschluss religionspsychologischer Werke bildet das 1931 erschienene Buch „Gebetmantel und Gebetriemen der Juden“.
Erst 1957 beginnt Reik mit dem Schreiben einer zweiten Serie religionspsychologischer Werke. Das erste ist „Myth and Guilt“, eine Abhandlung über den Ursprung menschlicher Schuld. 1959 erscheint „Mystery on the Mountain“, die Geschichte der Gesetzgebung am Berg Sinai. Es folgen „The Creation of Woman“ 1960, die Geschichte von Adam und Eva, „The Temptation“ 1961 mit der Geschichte von Abraham und Isaak und schließlich „Pagan Rites in Judaism“ 1964 mit verschiedenen Themen.
Was Reiks Bücher interessant und lesenswert macht ist die Fülle von Informationen, die er verarbeitet hat. Er schöpft aus Talmud, Midrasch, jüdischen Legendensammlungen und frühchristlichen, vor allem apokryphen Quellen. So gelingt ihm eine farbige und anschauliche Darstellung der entsprechenden Themen.
Bei der Übersetzung habe ich versucht, die Sprache und das Idiom seiner frühen deutschen Bücher wiederzugeben. Das Englisch Theodor Reiks ist nicht die Umgangssprache seiner Zeitgenossen in den Vereinigten Staaten. Die Bücher waren eher an eine europäische Lesergemeinde gerichtet.
Deutschsprachige Zitate oder Zitate englischer Übersetzungen deutschsprachiger Autoren habe ich, soweit möglich, in der Originalsprache zitiert.
Englische Autoren (zum Beispiel Shakespeare) habe ich meist in gängigen deutschen Übersetzungen zitiert, wo diese fehlten, habe ich diese selbst übersetzt. Die Herkunft englischer Zitate habe ich, wo sie fehlen, nach Möglichkeit in eckigen Klammern angegeben.
Einige wenige englische Sprichwörter habe ich wegen deren Unübersetzbarkeit stehen gelassen.
Reiks Vorliebe für französische Zitate habe ich nicht angetastet. Diese Zitate blieben meist unübersetzt.
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Gen 1, 26 f.
Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. ... Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen; denn vom Mann ist sie genommen. Darum verläßt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch.
Gen 2, 7. 21 – 24
Vorwort
Könnte man einen Augenblick aus der Vergangenheit in die Gegenwart verpflanzen, wären einige Auszüge aus einer Gerichtsszene (die New York Times nannte sie die erstaunlichste in angelsächsischer Geschichte) die beste Einführung für dieses Buch. Die Geschichte spielt in der kleinen Stadt Dayton in Tennessee, an einem der heißesten Tage im Juli 1925.1 Die zahlreichen Besucher von Dayton wurden mit Plakaten empfangen, auf denen stand: „Lies deine Bibel täglich!“, „Wo wirst du die Ewigkeit verbringen?“ und „Meine Lieben, kommt zu Jesus!“ Es ist der vierte Tag des Prozesses gegen John T. Scopes, der es wagte, die Evolutionstheorie an einer Schule in Tennessee zu unterrichten. Die Vernehmung der Zeugen findet im Hof außerhalb des Gerichtssaals statt. Hier, in brennender Hitze, betritt William Jennings Bryan, ein unermüdlicher Prediger des Fundamentalismus, den Zeugenstand als ein Experte der Bibel. Ohne Jacke, mit aufgekrempelten Ärmeln, fächelt er sich mit einem Palmblatt kühle Luft zu. Der Verteidiger, Clarence Darrow, der ihn in den Zeugenstand gerufen hat, ist ebenfalls hemdsärmlig. Er fragt ihn:
„Herr Bryan, glauben Sie, dass Eva die erste Frau war?“
Antwort: „Ja.“
Frage: „Glauben Sie, dass sie buchstäblich aus Adams Rippe gemacht wurde?“
Antwort: „Ja.“
Damals fragte Darrow seinen Freund Arthur Garfield Hayes, der sich ihm als Verteidiger des Lehrers Scopes angeschlossen hatte: „Ist es nicht schwer zu glauben, dass ein solcher Prozess in den Vereinigten Staaten im 20. Jahrhundert möglich ist?“ Tatsächlich fällt es einem nicht schwer, sich einen ähnlichen Prozess auch heute wieder, nur 34 Jahre später, in unserem Zeitalter von Anpassung, religiöser Erneuerung und Bigotterie vorzustellen.
Dieses Buch befasst sich allerdings nicht mit jenen zeitgenössischen Problemen. Die Erinnerung an jene Gerichtsszene, die noch nicht lange zurückliegt, sollte nur dazu dienen, den Vorhang zu einer Vorstellung zu öffnen, die uns zu den Anfängen der Zeit, der Morgendämmerung der Schöpfung, zurückführt. Ohne belehrende Absichten geschrieben nimmt diese Abhandlung den Mythos – falls Mythos das passende Wort ist – von der Erschaffung der Frau als ihren Ausgangspunkt, derselbe Mythos, der in jenem berühmten oder berüchtigten Scopes-Prozess Gegenstand der Verhandlung war. Wir werden deshalb mit der biblischen Erzählung beginnen – mit einigen wenigen Sätzen des 2. Kapitels des Buches Genesis. Aber weder Exegese noch wissenschaftliche Forschung ist unser Ziel. Jene wenigen Verse (Gen 2, 21 – 24) werden hier in einer Weise behandelt, die jener des Archäologen vergleichbar ist, der eine rätselhafte antike Inschrift entziffert.
Freud2 bemerkte einmal, die biblische Geschichte von der Erschaffung Evas „hat etwas ganz Sonderbares und Singuläres“. Ich bin überzeugt, dass die verborgene Bedeutung dieser biblischen Erzählung bis jetzt noch nicht aufgedeckt worden ist. Der Genesisbericht der Erschaffung der Frau strotzt noch immer von Geheimnissen wie ein Stachelschwein von Stacheln. Unsere erste Aufgabe wird die Wiederherstellung der ursprünglichen Tradition sein, aus der sich die biblische Erzählung, die oft verändert und entstellt wurde, entwickelte. Neue Anhaltspunkte aus einer unerwarteten Quelle führten mich auf einen verborgenen Pfad. Die analytische Erforschung dieses ursprünglichen Verstecks ermöglichte es mir, die unbekannte ursprüngliche Überlieferung des Mythos aufzudecken. Seine Wiederherstellung versorgt uns mit neuen Einsichten, die auf keinem anderen Weg hätten erreicht werden können. Die Entdeckung der ursprünglichen Bedeutung des Schöpfungsmythos wird dann als eine Art Guckloch dienen, durch das wir in geheime Bereiche der Vorgeschichte blicken können. Es ist deshalb zu hoffen, dass die zukünftige Forschung im Gebiet des antiken Nahen Ostens und in vergleichender Religionswissenschaft viele verborgene Schätze des Wissens ausgraben wird, deren Ausgangspunkt zuerst in dem Versuch, der hier unternommen worden ist, aufgezeigt worden ist.
Dieses Buch gehört in den Bereich der archäologischen Psychoanalyse. Ich gab diesen Namen einem noch unentwickelten Zweig psychoanalytischer Forschung, der die Probleme der Vorgeschichte untersucht.3 Dies geschieht durch Anwendung der miteinander verbundenen Methoden der vergleichenden Geschichtswissenschaft und Anthropologie auf die analytische Beobachtung und Bewertung von Einzelheiten, die bis jetzt vernachlässigt wurden. Der großen Tradition meines Lehrers und Freundes Sigmund Freud folgend habe ich in verschiedenen Büchern und Aufsätzen gezeigt, dass solche Probleme, die vergeblich in Angriff genommen worden sind, von anderen Methoden der Forschung mit der Hilfe der neuen Werkzeuge, die die Psychoanalyse bereithält, näher an eine Lösung herangeführt werden können. Wenn ich mich nicht irre, wird das gegenwärtige Abenteuer in psychoanalytischer Forschung ein neues Licht nicht nur auf die frühesten Traditionen der Bibel sondern auch auf den Ursprung seines Volkes werfen.
Theodor Reik
New York, Oktober 1959.
Teil Eins
Der Mythos und das Geheimnis von Eva
Kapitel I
Die beiden Geschichten
Die Erschaffung des Menschen ist ein zentrales Thema in den Mythen der meisten Naturvölker und antiken Kulturen. Doch war sie zunächst kein Rätsel. Das wurde sie erst, nachdem der Mensch einen bestimmten Grad von Selbstbewusstsein erreicht hatte, als er sich selbst als einen separaten Teil der Natur empfand. Sogar dann war der Wunsch nach Wissen nicht drängend und die Neugier über den Ursprung des Menschen wurde nur gelegentlich geäußert und mit einfachen Mitteln zufriedengestellt. Für einen Eingeborenen von Südaustralien genügte es zu erfahren, daß Bunjil, der Würgeadler, Menschen und Dinge machte. Der Buschmann war zufrieden mit der Information, dass Cagn, die Gottesanbeterin, der Schöpfer war. Bei den eingeborenen Stämmen in Amerika spielten der Kojote, die Krähe, der Rabe oder der Hase die Hauptrolle bei der Erschaffung des Menschen.
Die ersten Mythen sind wahrscheinlich von Männern für Männer produziert worden. Sie werden oft zu wahren Ammenmärchen, aber erst lange nachdem die Männer des Stammes sie verächtlich zurückgewiesen haben. Frauen beschäftigen sich viel öfter mit der Erschaffung des Menschen als über sie nachzudenken. Ihre Vorstellungsgabe ist nicht auf die Lösung der Frage, wie der erste Mensch erschaffen wurde, gerichtet. Dies ist kein Problem für sie. Sie wissen es. Sie konnte ihrer Meinung nach nicht sehr verschieden sein von der Art, wie ihre eigenen Kinder geboren werden. Die Mythen und Legenden der Schöpfung, einschließlich jenen der Bibel, setzen ein Publikum von Männern voraus.
Schon 1683 entdeckte C. Vitringa in den Anfangskapiteln des Buches Genesis einen doppelten Bericht von der Schöpfung des Menschen. Er erkannte, dass das erste und zweite Kapitel eine auffallende Diskrepanz aufweisen. Im ersten Kapitel wird der Herr als Schöpfer aller Lebewesen im Wasser und in der Luft und als Gestalter aller Tiere auf dem Festland geschildert. Schließlich erschuf er am sechsten Tag den Menschen. Nach Gottes Ebenbild geformt ist der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung. Mann und Frau wurden gleichzeitig erschaffen („Als Mann und Frau erschuf er sie.“). Wenn wir uns dem zweiten Kapitel zuwenden, wird ein völlig anderes Bild gezeigt. Im Gegensatz zum ersten Bericht und im Widerspruch zu ihm erfahren wir, dass Gott den Menschen zuerst erschuf, dann die Tiere und zuallerletzt – fast als nachträglichen Einfall – die Frau, die er aus Adams Rippe bildete.
Die Unterschiede in Anordnung und Inhalt sind offensichtlich. Die Chronologie in den beiden Berichten ist umgedreht. In der zweiten Erzählung wird erwähnt, dass der Mensch nach dem Bild seines Schöpfers geschaffen wurde. Er wurde aus dem Staub der Erde geformt und Gott blies in seine Nasenlöcher den Lebensatem. Erst dadurch wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. In der ersten Fassung erscheint der Herr als ein Schöpfer, in der zweiten als ein Gestalter und Urheber des Menschen.
Exegeten fügen diesen Unterschieden einige andere hinzu. In der ersten Fassung wird Gott Elohim genannt, während die zweite eine Kombination von Jahwe und Elohim verwendet. Ferner finden sich handgreifliche Unterschiede im Stil. Der eine Bericht, vom ersten Kapitel bis zum dritten Vers des zweiten, so erklären die Kritiker1, wirkt systematisch und stereotyp, wortreich und chronologisch. Im zweiten Kapitel findet ein vollständiger Stilwechsel statt: es ist frei, dichterisch und bildhaft gestaltet.
Die Exegese führte diese Widersprüche auf die Tatsache zurück, dass die beiden Berichte von zwei unterschiedlichen Hauptquellen abgeleitet sind, einer älteren, die dem Jahwisten zugeordnet wird und einer jüngeren Erzählung, der Priesterschrift. Es sollte en passant erwähnt werden, dass die Geschichte des Jahwisten selbst keineswegs einheitlich ist. Mehrere Widersprüche und Unregelmäßigkeiten sind in ihr enthalten. Das Paradies ist, entsprechend Gen 2,8, im Osten gelegen, gemäß Gen 2,20 im Westen und nach Gen 2,16 im Norden. Die Vertreibung aus dem Garten Eden wird zweimal erzählt, die Verfluchung des Menschen wird wiederholt, und so weiter. Die zwei Stränge, aus denen der Jahwist gebildet ist, werden gewöhnlich in Ji und Je unterschieden.
Wir werden nicht in die Diskussion über die Definition und Scheidung des Materials entsprechend der Quellen eintreten. Bibelgelehrte, die Kapitel und Vers zitieren, haben da verschiedene Meinungen. Diese Untersuchung hat deshalb auch nicht die Absicht, die individuellen Quellen bis zu den mythologischen Mustern der Menschen des antiken Orients zurückzuverfolgen. Es genügt zu wissen, dass der erste Bericht oft mit der assyrisch-babylonischen Kosmogonie, mit der einige bemerkenswerte Ähnlichkeiten entdeckt wurden, verglichen wurde. Es wurden einige Versuche unternommen, um die jahwistische Erzählung von der Erschaffung des Menschen in der einen oder anderen Geschichte eines bestimmten antiken Volkes wiederzufinden, aber bis heute hat man keinen vergleichbaren Bericht gefunden. Es besteht jedoch eine Möglichkeit, eine gemeinsame semitische Tradition, von der die beiden Kosmogonien abgeleitet wurden, zu entdecken.
Der deutsche Gelehrte Gerhard von Rad verglich kürzlich den gesamten biblischen Bericht über die Schöpfung mit einer Struktur, die auf zwei mächtigen mythologischen Säulen ruht, die wir den Jahwisten und die Priesterschrift nennen. Doch der gleiche Gelehrte hat uns gewarnt, die Genauigkeit der Traditionen, wie sie auf uns gekommen sind, nicht überzubewerten.2 Er sagt, dass, wie spät man den Jahwisten auch datiere, gemessen an der Tradition, die in seiner Erzählung eingeschlossen ist, sein geschriebener Bericht „ein Ende für diese Stoffe bezeichnet, die bis dahin schon eine lange Geschichte hinter sich hatten“3. Diese alte mündliche Tradition interessiert uns viel mehr als der aktuelle biblische Text.
Es sind einige Bemerkungen zur Beziehung zwischen den beiden Quellen, aus denen die zwei Herausgeber ihr Material nahmen, notwendig. Bibelgelehrte nehmen an, dass der Jahwist, oder die Gruppe von Schreibern, denen man diesen Namen gegeben hat, der ältere Herausgeber ist. Sein Text wurde vermutlich um 850 v. Chr. im Südreich Juda geschrieben. Die Priesterschrift wurde im 6. Jahrhundert während des Exils verfasst. Die ältere Erzählung ist volkstümlicher und bietet, wie J. G. Frazer bemerkt, „mehr Vergleichspunkte mit den kindlichen Erzählungen, mit denen der Mensch in vielen Zeitaltern und Ländern das große Geheimnis vom Anfang des Lebens auf der Erde zu erklären versucht hat“. Die meisten Gelehrten schlossen aus dem Alter des Jahwisten, dass er viele Berichte von primitiver Einfachheit bewahrt hat, die die spätere Priesterschrift getilgt hat. Doch die Tatsache, dass der Jahwist jene Berichte festgehalten hat bedeutet nicht notwendig, dass das Sagenmaterial, das er benützte, selbst älter und primitiver ist als das seiner späteren Kollegen.
Es ist gut möglich, dass der Jahwist (obwohl er mindestens 250 Jahre früher gelebt hat als der Herausgeber der Priesterschrift und einfacher und primitiver in der Behandlung der Sagen ist) aus jüngerem Erzählmaterial geschöpft hat als der andere, der sich mit der Tradition in einer mehr „modernen“ Art befasste. Wir vergessen zu leicht, dass beide Herausgeber ursprünglich Geschichtenerzähler waren, und ihr Hauptzweck war die Bewahrung und Weitergabe von Traditionen, die viele Jahrhunderte bei den hebräischen Stämmen lebendig waren und die an den Lagerfeuern und in den Zelten erzählt wurden.
Die Zeit, in der ein Schreiber lebt und seine Art zu schreiben sind nicht die einzigen Faktoren, die für die Bestimmung der Periode, in die der vorliegende Stoff gehört, entscheidend sind. Shakespeare schrieb das Drama Richard II., der nicht so lange vor ihm lebte und unser zeitgenössischer Dichter Richard Beer-Hofmann schrieb ein Drama über König David. Mit anderen Worten, es ist denkbar, dass der Herausgeber der Priesterschrift, obwohl er sehr viel später lebte, älteres Material verwendete als sein Vorgänger. Der Jahwist, der denselben allgemeinen Stoff behandelt – zum Beispiel die Geschichte von der Erschaffung der Frau – könnte eine viel jüngere Version der mündlichen Tradition des Volkes für seinen Bericht in Genesis gewählt haben.
Um Klarheit zu schaffen, muss ein weiterer Aspekt der Frage nach den zwei Hauptströmungen erwogen werden. Die Diskrepanzen zwischen den zwei biblischen Berichten wurden natürlich schon sehr früh bemerkt. Die Rabbiner aus der Zeit des Talmud dachten sehr oft über sie nach und versuchten die gegensätzlichen Erzählungen in Einklang zu bringen. Ebenso machten es die Kirchenväter und ihre Nachfolger, die christlichen Theologen. Einige Exegeten unserer Zeit haben auch verzweifelte, wenn auch nutzlose Versuche zur Versöhnung in dieser Richtung unternommen. Während die moderne Bibelkritik zufrieden ist, die Unterschiede der Fassungen festzustellen und sie auf ihren Ursprung in den zwei Hauptquellen der Tradition zurückzuführen, verleugnen strenge Verteidiger der Einheit der Bibel entweder die Existenz von irgendwelchen Disharmonien oder sie rationalisieren und bagatellisieren sie beiläufig.
Indem wir uns selbst auf die Behandlung unseres Themas, den Mythos der Frau beschränken, werden wir die wichtigsten Antworten skizzieren, die auf die Fragen gegeben wurden, die von den beiden gegensätzlichen Fassungen hervorgerufen wurden. Die Sage ihrerseits fand einen geistreichen Weg, die beiden Berichte in Übereinstimmung zu bringen. Falls in der einen Fassung Gott den Menschen als Mann und Frau erschuf und in der anderen die Frau aus Adams Rippe gebildet wurde, muss unser frühester Vorfahre ein Witwer oder ein geschiedener Mann gewesen sein, als der Herr ihm Eva zuführte. Oder hatte Adam zwei Frauen gleichzeitig? Dies dürfte die beiden biblischen Erzählungen harmonisch verbinden. Einige Legenden erzählen uns, dass es eine andere Frau in Adams Leben gab, bevor Eva erschien. Ihr Name war Lilith. Die Gestalt der Lilith ist vielleicht ursprünglich die eines babylonischen Nachtdämons. Lilith war vermutlich Adams erste Frau, die zusammen mit ihm aus Erde geschaffen wurde. Gemäß der Legende blieb diese erste Frau Adams nur kurze Zeit bei ihm und verließ ihn dann, weil sie darauf bestand, sich völliger Gleichheit mit ihm zu erfreuen. Sie flog davon und löste sich in Luft auf. Adam erklärte dies dem Herrn, und sagte zu ihm, dass seine Frau ihn verlassen habe. Die Engel fanden sie dann im Roten Meer. Lilith weigerte sich jedoch, zu ihrem Ehemann zurückzukehren und lebte weiter als böser Dämon, der neugeborene Babies verletzte.4 Diese Sage, die man im Buch Sohar finden kann, haben einige Juden der Ghettos des Ostens im Gedächtnis behalten. Ältere Quellen sprechen sogar von einer „ersten Eva“. In einigen Legenden erscheint Lilith als männlich und weiblich zugleich.
Der andere Weg, auf dem die Diskrepanzen zwischen den zwei Schöpfungserzählungen behandelt wurden war, ihre Existenz zu leugnen. Strenge Verteidiger der fundamentalistischen Anschauung bringen alle Arten von sophistischen und irreführenden Argumenten vor, die auf verkehrten Urteilen basieren, aber für die Gläubigen überzeugend sind. So ist oft behauptet worden, dass das zweite Kapitel des Buches Genesis keine neue Erzählung der Schöpfung präsentiert, sondern einfach die Geschichte der Erschaffung des Menschen mit größerer Genauigkeit fortsetzt.
Man hat argumentiert, dass die Gelehrten, die auf unterschiedlichen Quellen bestehen, eine willkürliche Voraussetzung machen und einen Widerspruch schaffen, wo keiner existiert. Von diesem Standpunkt aus erscheint das zweite Kapitel nicht als Duplikat, sondern als Fortsetzung des ersten, dessen Inhalt es als richtig betrachtet. Die Geschichte der Schöpfung wird nicht wiederholt. Die Absicht des Autors bestand nicht darin, wie andere Kritiker behaupten, das gleiche Thema nochmals auf unterschiedliche Weise zu behandeln. Gemäß dieser Argumentation kehrte der Erzähler weder die chronologische Ordnung um, in der die Schöpfung stattfand, noch die Zeit, die dazu notwendig war. Er verringerte nicht die Anzahl der Tage von sechs auf einen. Das erste Kapitel der Bibel beschreibt die Erschaffung des Universums in einer Art Synthese des Ganzen. Es geht ohne Unterbrechung „von dem beginnenden unbelebten Muster bis zu dem Höhepunkt des ganzen großen Prozesses in der Erschaffung des Menschen als Ebenbild Gottes“5. In Kontrast, aber nicht im Gegensatz zu diesem Bericht diskutiert das zweite Kapitel nicht die abstrakte Ordnung der Schöpfung, sagt nichts über die Erschaffung von Himmel, Erde und den Sternen, sondern beginnt mit dem Bepflanzen des Gartens von Eden.
Doch die Widersprüche zwischen den zwei Schöpfungserzählungen sind so zahlreich und offenkundig, dass jeder Versuch, sie in Einklang zu bringen, zum Scheitern verurteilt ist. Wenn deshalb die Verteidiger der traditionellen Ansicht zweifellos auf dem falschen Weg sind, macht dies die Meinungen ihrer Gegner richtiger? Beseitigt die Annahme von zwei verschiedenen Quellen für die Schöpfungsgeschichte die Schwierigkeiten? Wie können wir daneben die Bewahrung von zwei Versionen mit solchen erstaunlichen Verschiedenheiten erklären? Haben jene Gelehrten recht, die behaupten, dass der Autor des zweiten Kapitels nicht beabsichtigt haben kann, die Geschichte der Schöpfung nachzuerzählen, die in seinem Bericht nicht nur skizzenhaft und unbefriedigend wäre, sondern auch der anderen Tradition widersprechen würde?
Eine neue Interpretation würde nicht nur jene Unstimmigkeiten und Verschiedenheiten zu erklären, sondern auch die lange Kontroverse zu klären und zu lösen haben. Sie würde auch erklären müssen, wie die voneinander abweichenden Berichte innerhalb der Heiligen Schrift bewahrt worden sind.
Die Wahrheit über die ursprüngliche Tradition der Schöpfung wird nicht zwischen den extremen Ansichten der Fundamentalisten und wissenschaftlicher Forschung liegen, sondern jenseits davon, auf einer anderen Ebene.
Kapitel II
Das erste menschliche Wesen – ein Mann-Weib?
J. G. Frazer beschreibt die ursprünglichen Vorstellungen des Ursprungs der Menschheit bei den Griechen, Hebräern, Ägyptern und Babyloniern.1 Er zweifelt nicht daran, dass jene primitiven Vorstellungen den zivilisierten Menschen der Antike von ihren wilden und barbarischen Vorfahren überliefert wurden. Ähnliche Geschichten sind unter den wilden Stämmen von gestern und heute aufgezeichnet. Wir werden vielleicht Gelegenheit haben, uns auf einige von ihnen zu beziehen und sie mit dem biblischen Bericht der Erschaffung von Mann und Frau zu vergleichen.
Dieser Vergleich lässt an eine andere Assoziationskette denken, die das universale Interesse der Naturvölker am Unterschied der Geschlechter betrifft. Vor kurzem stieß ich auf ein jüngst erschienenes Buch, dessen Gegenstand uns in die Welt der Wilden der Steinzeit versetzt, wie sie Frazer erwähnt, mit dem charakteristischen Titel „Adam with Arrows“.2 Der Autor Colin Simpson beschreibt das Leben der wilden Kikuyu in Neuguinea heute und an einer Stelle präzisiert er dieses Interesse. Er untersucht nicht ihre Geschichten von der Erschaffung des Menschen, sondern er denkt über die Gefühle nach, die die Eingeborenen erfahren haben, als die ersten Weißen ihre Welt betraten. Wer kann zum Beispiel sagen, welche Wirkung das erste Flugzeug auf die Steinzeitmenschen hatte? Wir können nur raten. Vielleicht hat einer der Freunde des Schriftstellers recht, wenn er denkt, dass das monströse brüllende Objekt mit starren Flügeln ihnen als „Drachenvogel“ erschienen sein mag. Eine Schar von Kikuyus kam zur Landebahn und brachte mit Nahrungsmitteln gefüllte Körbe für das Flugzeug mit. (Nach allem, was man weiß, müssen Lebewesen etwas essen.) Die verwegensten Eingeborenen gingen nieder auf ihre Hände und Knie und spähten unter den Rumpf. Ein Polizist der Marobe grinste mit überlegenem Wissen und erklärte, dass sie nach seinen Genitalien suchen würden, um zu sehen, ob der „Drachenvogel“ männlich oder weiblich sei. (Man könnte eine Menge über solch ein monströses Ding erfahren, wenn man sein Geschlecht herausfinden würde.).
Indem wir zu unserem Gegenstand zurückkehren, denken wir an das erste Kapitel der Heiligen Schrift, das uns erzählt, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen habe: „Als Mann und Frau erschuf er sie.“ Frazer3 bemerkt, es scheine, dass die Verschiedenheit der Geschlechter an der Göttlichkeit teilhat, „obwohl, wie die Unterscheidung in Einklang gebracht werden kann mit der Einheit der Gottheit ein Punkt ist, über den uns der Schriftsteller keine Information gewährt“. Frazer übergeht dieses theologiche Problem, weil er es als zu tief für menschliches Verständnis hält.4 Andere Gelehrte erwogen die Schwierigkeit innerhalb des Bereichs menschlichen Verstehens und fanden bequeme Erklärungen dafür.
Einige biblische Exegeten wiesen vergeblich darauf hin, dass das Wort „erschaffen“ nicht metaphorisch, sondern realistisch verstanden werden müsse.5 Der Ausdruck, der für die Produktionsmethode des Herrn verwendet wird, ist mit demselben Wort umschrieben, das im Alten Testament (Jes 29,10; Jer 18,4) für den Töpfer, der Ton formt, verwendet wird. Es half jenen Exegeten wenig, dass sie nachweisen konnten, dass in verschiedenen orientalischen Texten vergangener Zeiten beschrieben wird, wie ein Gott oder eine Göttin den Menschen bildet.
Einige Exegeten behaupten, dass sich die biblische Geschichte Adam als männlich und weiblich zugleich vorstellt. Der Plural in dem Satz „erschuf er sie“ und sein beabsichtigter Gegensatz zu dem vorausgehenden Singular „erschuf er ihn“ schienen die Annahme eines ursprünglich androgynen Wesens auszuschließen. Gleichwohl führen sie aus, dass der heutige Text von der Erschaffung nach Gottes Ebenbild spricht und sie fragen, mit zarter Anspielung auf die Stelle „als Mann und Frau erschuf er sie“, wie man sich jenes „Ebenbild“ anders als männlich und weiblich zugleich vorstellen könne. Sie leugnen, dass es nur eine grammatikalische oder semantische Frage sei, die hier steht. Nicht zufrieden mit der Information, dass für den Herrn alles möglich ist, stellen sie das Geheimnis der Dinge so dar, als ob wir, um mit Lear zu sprechen, Gott ausspionieren würden. Seltsam genug waren es nicht Zweifler und Agnostiker, sondern religiöse Menschen, die zuerst solch unehrerbietige Neugier zeigten.
Die Interpretation, dass Adam als Mann – Frau, als Androgyn erschaffen wurde, taucht schon in der rabbinischen Literatur auf.6 Der Kirchenvater Eusebius wies darauf hin, dass diese Ansicht mit jener in Platons Symposion (189d, 190d) verwandt ist, wo der Mythos eines ursprünglich doppelgeschlechtlichen Wesens berichtet wird. Alfred Jeremias hat gezeigt, dass man eine ähnliche Ansicht bei den Babyloniern finden kann.7 In den philosophischen Interpretationen des Philon von Alexandrien ist die mythologische Vorstellung des ersten androgynen Lebewesens „noch erkennbar“.8 Sie ist jedoch von den Gnostikern klar formuliert worden.
In den Legenden der Juden und in talmudischen Kommentaren (besonders aus späteren Zeiten) ist die Tradition eines ursprünglich androgynen Wesens bewahrt worden. Zum Beispiel sagte Rabbi Jeremiah ben Eleazar9: „Adam hatte zwei Gesichter, weil gesagt worden ist: ‚Du umschließt mich von allen Seiten.’“ (Ps 139, 5) Das eine Gesicht war männlich, das andere weiblich. Andere Rabbiner erklären, dass Adam und Eva Rücken an Rükken geschaffen wurden und an den Schultern verbunden waren. Dann trennte Gott sie mit einem Beilhieb oder indem er sie in zwei Hälften zersägte.
In einer jüngst erschienenen Monographie verfolgt Ernst Benz den Mythos des androgynen Adam von den gnostischen Schriftstellern bis zu den modernen Mystikern.10