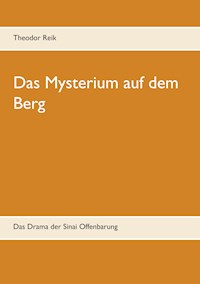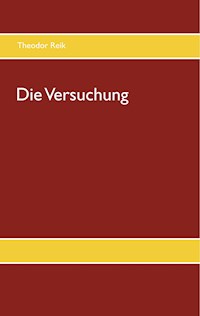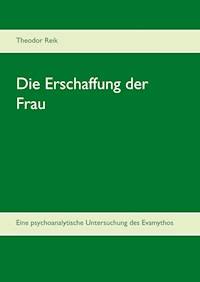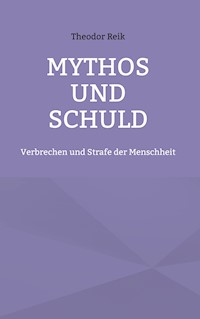
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch interpretiert Reik die biblische Sündenfallgeschichte (Gen 3) psychoanalytisch. Dabei werden sowohl die Folgen der bösen Taten der Menschen für das Individuum ausgeführt als auch die Folgen verbrecherischer Handlungen eines Diktators für sein Volk. Völkerpsychologisch gesehen sind die Ausführungen, die Reik nach dem Ende des 2. Weltkriegs formuliert hat, gerade heute wieder hochaktuell.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Liberis meis
Anna, Pia et Franz
dedico
hanc translationem
Inhalt
Vorwort des Überetzers und Herausgebers
Die Geschichte dieses Buches
Erster Teil: Das bedeutendste Problem in der Evolution der Kultur
I Das wenige, das das Wissen vom Bewusstsein weiß
II Ursprung und Wesen der Schuldgefühle
III Das Schuldgefühl der Welt
IV Mythen und Erinnerungen
V Niemals erinnert, doch nicht vergessen
VI Das ist immer noch ein Geheimnis für mich
Zweiter Teil: Das Verbrechen
VII Die Interpretationen
VIII Text und Kontext
IX Die Strafuntersuchung
X Der richtige Schlüssel
XI Die Fassade und die darin enthaltene Geschichte
XII Prähistorische Wirklichkeit im Mythos
XIII Der Mensch ohne Vergangenheit
XIV Du bist wen du isst
XV Die Antworten der Wissenschaft und der Religion
XVI Der Durchbruch der Erinnerungen
XVII Das Auftauchen des Schuldgefühls
XVIII Die Spannung vor Christus
Dritter Teil: Die Strafe
XIX Auf dem Weg zur Wiederholung der Vorstellung
XX Der Christusmythos und der historische Christus
XXI Die Strafe muss zum Verbrechen passen
XXII Uns entgeht etwas
XXIII Das Kreuz und der Baum
XXIV Die unbewusste Bedeutung der Kreuzigung
XXV Der erste und der zweite Adam
XXVI Die sexuelle Umdeutung
Vierter Teil: Der Mensch, der moralische Aufsteiger
XXVII Der Apostel der Heiden
XXVIII Sterbend eines anderen Tod
XXIX Der unsichtbare Gott
XXX Die „splendid isolation“ der Juden
XXXI Wie seltsam von den Juden …
XXXII Hybris
XXXIII Der Mensch, der moralische Aufsteiger
Nachwort
Vorwort des Übersetzers und Herausgebers
Dieses Buch eröffnet die Reihe der späten religionspsychologischen Schriften Theodor Reiks. Hier geht es um die Frage des Ursprungs des Schuldbewusstseins. Ausgehend von der biblischen Sündenfallgeschichte im Buch Genesis analysiert Reik mit Hilfe der psychoanalytischen Methode die Bedingungen, die den Menschen schuldfähig machen. Ihn interessiert dabei nicht nur das Wissen um individuelle Schuld, sondern auch das Verständnis kollektiver Schuld. Dieses Thema ist gerade heute wieder aktuell. Es geht um die Frage, inwieweit ein ganzes Volk für die Verbrechen einer einzigen Person mitverantwortlich sein kann.
Als Schüler Sigmund Freuds hat Reik die zentralen Theorien seines Lehrers übernommen. Manches muss daher heute kritisch gesehen und gelesen werden. Wegen der immensen Belesenheit des Autors und seiner freigebigen Darlegung zahlreicher Nebenschauplätze halte ich dieses Buch für ein interessantes und spannendes literarisches Werk.
Reiks Vorliebe für französische Zitate, die in der Regel unübersetzt bleiben, habe ich respektiert. Bei den Zitaten deutscher Autoren habe ich nach Möglichkeit den deutschen Originaltext verwendet.
Die Geschichte dieses Buches
Es ist schwer zu beschreiben, welchen Eindruck Freuds Buch Totem und Tabu auf uns, seinen Wiener Kreis, machte. Ich erinnere mich lebhaft an das Treffen unserer analytischen Vereinigung im Jahre 1913, bei dem uns Freud den letzten und bedeutendsten Teil seines Werkes über die Rückkehr des Totemismus in der Kindheit präsentierte. Wir waren enthusiastisch und verstanden sofort, dass dies eine intellektuelle Herausforderung für Generationen von Psychologen und Kulturhistorikern war. Privilegiert, mit dem Autor dieses großen Buches zu sprechen, diskutierten wir mit ihm über die zahlreichen Ideen, zu denen die meisten von uns angeregt worden waren. In den folgenden Monaten sprachen Otto Rank, Hanns Sachs und ich – man nannte uns in Berlin das psychoanalytische Trio – oft bis zum frühen Morgen über zukünftige Forschungsarbeit, die jeder von uns zu tun hoffte. Wir waren Freunde und halfen einander, wo immer wir konnten. Es gab keine kleinliche Eifersucht, keinen Streit über die Priorität von Ideen, keine Furcht vor geistigem Diebstahl, der später manchmal die Diskussionen von Psychoanalytikern belastete.
Unter dem tiefen Eindruck von Freuds Theorie war mir eine neue Interpretation der biblischen Geschichte des Sündenfalls eingefallen. Die Verzweigungen jener neuen Interpretation führten zu unerwarteten Vorstellungen der frühen Evolution der Zivilisation. Ein sehr ehrgeiziger Plan einer Erforschung des Ursprungs des Schuldgefühls in der Menschheit tauchte auf. Das analytische Verstehen der unbewussten Bedeutung der Erbsünde führte zur Entdeckung versteckter Verbindungen mit dem Kern der Christusmythe. Ich erinnere mich noch, bei welcher Gelegenheit die Idee aus vagen Gedanken und Ahnungen auftauchte und eine klare, konkrete Gestalt bekam. Am 30. Juni 1913 feierten wir Totem und Tabu mit einem Festessen auf dem Konstantinshügel im Prater (einem netten Restaurant auf einem kleinen Hügel, von dem aus man auf die Kastanienbäume im alten Park, in dem wir als Kinder gespielt hatten, blickte). Wir sprachen scherzhaft von jenem Essen als einem totemistischen Mahl. Freud war sehr guter Laune. Er betrachtete manchmal nachdenklich eine antike Tierfigur, die ihm ein ehemaliger Patient bei jener Gelegenheit gegeben hatte. Wir waren sicher mehr als zwölf am Tisch, aber etwas musste mich an Christus und seine Apostel beim letzten Abendmahl erinnert haben. Ich erinnere mich noch, dass dieser Gedanke eines der Verbindungsglieder zwischen den beiden Teilen des Ideengebäudes war, dessen Entwurf ich klar sah, als ich an jenem Juniabend durch die dunklen Alleen des Praters heimging. (Während ich dies schreibe, klingt in mir eine vertraute Melodie nach: „Im Prater blühn wieder die Bäume.“)
Ich wusste schon, dass ich mein Leben der psychologischen Forschung widmen würde, besonders dem Weg, den Freud erleuchtet hatte und ich fühlte leidenschaftlich jene „heilige Neugier“, von der Einstein oft sprach. Mit der Einbildung eines jungen Mannes tagträumte ich, dass ich etwas Wertvolles entdeckt hätte und bildete mir ein, dass es revolutionäre Wirkungen auf dem Gebiet der vergleichenden Religionswissenschaft haben würde. Ich habe seitdem niemals mehr das Drängen und die Macht des kreativen Impulses so intensiv gespürt.
Ich habe mich oft gewundert, warum ich mit Freud nie über meine Entdeckung gesprochen habe, mit dem ich sonst freimütig über andere Forschungspläne diskutierte. In jenen langen Gesprächen mit Otto Rank und Hanns Sachs wurden alle Aspekte der neuen Idee erwogen. Es gibt sogar einen literarischen Beweis für jene Diskussionen der folgenden Monate. In seinen Psychologischen Beiträgen zur Mythenforschung erwähnte Rank zweimal den Plan, den ich ihm und Sachs vollständig präsentiert hatte.1 Er sagt dort: „In einer vorbereiteten Arbeit hat Dr. Th. Reik … eine wietere Schicht der Sage gedeutet, welche ihren ursprünglichen Sinn nach einer anderen Richtung ergänzt“ und dass ich in jenem zitierten Werk „die ursprüngliche Form des Mythos und die Elimination des weiblichen Elements in der Genesiserzählung diskutieren würde“.
Nachdem ich den Entwurf im Sommer 1913 notiert hatte, schrieb ich keine einzige Zeile jenes Buches. In einem nicht uninteressanten Fragment einer Selbstanalyse späterer Jahre wurde mir klar, welche unbewussten Tendenzen die Entstehung meines Buches verhinderten, das in meinen Gedanken schon lange vollendet gewesen war. Meine Beziehung zu Freud spielte bei dieser Verhinderung natürlich eine wichtige Rolle.
Max Beerbohm schuf eine Serie von Karikaturen mit Dialogen zwischen dem jungen Selbst und dem alten Selbst. Ein solches Zusammentreffen passiert uns allen gelegentlich und als ich dieses Buch schrieb, stellte ich mir es mehr als einmal vor. Nachdem ich die melancholische Überraschung auf die Sicht des jungen Mannes, der ich gewesen war – „Dort kommt ja dieser Träumer“ (Gen 37,19), überwunden hatte, würde ich ihn ernsthaft fragen, was er darüber dächte, eine bedeutende Aufgabe 43 Jahre lang aufzuschieben. Ich würde ihn an ein irisches Sprichwort erinnern, dass einem Gedanken, einem Schwert und einem Spaten niemals erlaubt werden sollte zu rosten. Welche Gründe hätte er für ein solches grauenhaftes Zaudern? Aber ich bin sicher, er könnte mir keine befriedigende Erklärung geben. Er würde vielleicht unverschämt werden wie junge Männer und sagen, dass ich, ein alter komischer Kauz, kein Recht hätte, Rechenschaft über sein Benehmen zu geben. Er würde mich auch daran erinnern, wie oft ich in viel reiferen Jahren einen Forschungsplan beiseite gelegt oder aufgeschoben hatte.
In jenen mehr als 40 Jahren schrieb ich eine Reihe von Büchern; doch ich war unfähig, dieses eine zu schreiben. Und dann geschah etwas Überraschendes. Der Plan, den ich mehr als vier Jahrzehnte zurückgelegt hatte, bewegte sich von den Rändern in das Zentrum meiner Aufmerksamkeit und verlangte sofortige Verwirklichung. Es war, als ob ein alter Mann zu einer Frau zurückkehrte, um die er, als er 25 Jahre alt war, vergeblich geworben hatte. Ich machte wieder die Erfahrung der Ungeduld und des Hochgefühls wie einst im Frühling des Lebens. Doch es gab darin eine neue Note, etwas Trauer und etwas verzweifelte Bestimmung. Beim Schreiben des Buches fühlte ich, was Tennysons Ulysses sagt:
Das Alter hat seine Ehren und seine Plagen.
Der Tod beendet alles. Aber kurz vor dem Ende
Mag manche Arbeit von edler Gesinnung noch getan werden,
Nicht ungeziemend für Menschen, die nach Göttlichkeit streben.
Dieselbe Aufgabe, die nicht getan werden konnte, weil unbekannte emotionale Kräfte es verboten hatten, musste jetzt getan werden, weil es andere unbewusste Tendenzen befahlen. Die innere Forderung erhielt einen besitzergreifenden Charakter. Alles ordnete sich der einen Idee unter, die es anderen Interessen nicht erlaubte, neben ihr zu existieren. Sie war despotisch und exklusiv wie Jahwe, der Eine und Einzige.
Nach 43 Jahren war jener alte Plan wieder aufgetaucht und hatte von mir Besitz ergriffen. Die Idee, die geheime Bedeutung der Sündenfallgeschichte und ihrer Fortsetzung im Christusmythos aufzudecken, begann meine Gedanken so sehr zu beschäftigen, dass alle anderen Forschungsprojekte zurückgestellt werden mussten. Mit voller Aufrichtigkeit hätte ich die Zeilen eines schottischen Dichters, Thomas Campbell, zitieren können, der vor 140 Jahren in das Album einer jungen Dame schrieb:
Etwas Einzigartiges, holde Maid, wollt Ihr mich gewinnen
Zu schreiben – aber wie soll ichs anfangen?
Denn ich fürchte, ich habe nichts Ursprüngliches in mir
Außer der Ursünde.
New York, Januar 1957.
1 Leipzig und Wien, 1919 (nicht ins Englische übersetzt), S. 115. 118.
Erster Teil
Das bedeutendste Problem in der Evolution der Kultur
„ ... Zunächst vermute ich bei den Lesern den Eindruck, daß die Erörterungen über das Schuldgefühl den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen ... entspricht aber durchaus der Absicht, das Schuldgefühl als das wichtigste Problem der Kulturentwicklung hinzustellen …“
Sigmund Freud , Das Unbehagen in der Kultur
Kapitel I
Das Wenige, das das Wissen vom Bewusstsein weiß
Psychologische Forschung arbeitet auf einigen Gebieten ruckartig und bewegt sich auf anderen im Schneckentempo. Es fällt auf, dass sie auf Gebieten mit geringerer Bedeutung mit Schnellzugsgeschwindigkeit fortschreitet, während sie bei Problemen, die für uns von größtem Interesse sind, ihre ganze Energie zu benötigen scheint, um an derselben Stelle zu bleiben. In einem seiner letzten Bücher stellt Freud das Schuldgefühl „als das wichtigste Problem der Kulturentwicklung“ dar und sagt, „daß der Preis für den Kulturfortschritt in der Glückseinbuße durch die Erhöhung des Schuldgefühls bezahlt wird“2. Wenn das Schuldgefühl der Prüfstein der zivilisierten Menschheit ist, ist es nicht erstaunlich, dass psychologische Forschung auf diesem Gebiet kaum irgendeinen Fortschritt gemacht hat, seit Freud es vor mehr als 27 Jahren als das bedeutendste Problem der Zivilisation charakterisierte? Besprechungen der Literatur zu diesem Gegenstand, zum Beispiel in den Büchern von H. G. Stocker und Max Nachmansohn, werden den Eindruck bestätigen, dass seit Freuds Untersuchung keine Forschung von irgendeiner Bedeutung beobachtet werden kann. Die Psychoanalytiker scheinen in ihren Veröffentlichungen das Problem ebenfalls zu vermeiden. Es sieht so aus, als ob sie hofften, es werde verschwinden, wenn sie es nicht erwähnen.3 Doch die Gültigkeit von Freuds Feststellung kann man nicht bestreiten. Wir leben in einem „Zeitalter der Angst“ – und was ist Schuldgefühl anderes als soziale Angst? – und mehr noch als jene von 1930. Wenn der dänische Prinz aus seinem Grab in Elsinore auferstehen würde, würde er sagen: „Jenes Gewissen macht aus uns allen Feiglinge!“
Die Tatsache, dass die Diskussion des Problems zu einem Stillstand kam, gibt mir Mut, einen bestimmten Faden nach 35 Jahren aufzugreifen. Im August 1922 sandte ich Freud einige Aufzeichnungen, die ich nach einem zufälligen Gespräch mit meinem Sohn Arthur, der damals sieben Jahre alt war, notiert hatte. In seinem anerkennenden Brief sagte Freud4 „Der Beitrag Ihres kleinen Sohnes ist sehr hübsch; verdient einen Kommentar.“ Die Gelegenheit für eine solche analytische Diskussion bot sich, als ich am Institut der Wiener Psychoanalytischen Gesellschaft 1924 eine Vortragsreihe hielt. Die damals gehaltenen Vorträge wurden in meinem Buch „Geständniszwang und Strafbedürfnis“5 veröffentlicht, das Freud ein „gedankenvolles und äußerst bedeutendes Buch nannte“. Er betrachtete den darin gemachten Versuch, die Rolle des Über-Ichs darzustellen „so legitim wie ertragreich“. Der Beitrag meines kleinen Sohnes (den Freud für erleuchtend hielt) erschien unter dem Titel „Zur Entstehung des Gewissens“, einem Kapitel des Buches. Da es nicht ins Englische übersetzt ist, werden die folgenden Auszüge jenes Kapitels eine geeignete Einleitung zu einer Erforschung des Schuldgefühls in menschlicher Zivilisation sein.6
Wir meinen, die analytischen Funde lassen die Geschichte der Moral und einige ihrer wichtigsten Probleme in einem neuen Lichte erscheinen und lösen Widersprüche, welche bisher unüberbrückbar schienen. Das psychologische Problem des Gewissens gehört hierher. Die lange Reihe von Untersuchungen über die Natur des Gewissens lassen erkennen, wie hoch die Bedeutung des Gewissens als psychologisches Phänomen eingeschätzt wird. Es erscheint auch, wenn man von Monographien wie die von Paul Rée und Ebbinghaus absieht, in jedem System der Ethik von Sokrates bis auf Paulsen und Wundt, in der katholischen ebenso wie in der protestantischen Moraltheologie.
Wir wollen von dem sprachlichen Ausdruck ausgehen, wobei wir uns wichtige Aufschlüsse aus Wundts „Ethik“ holen. Das Wort Gewissen weist unmittelbar auf ein Mitwissen hin. Das Präfix Ge- ist ursprünglich mit dem lateinischen con identisch. Gewissen ist die direkte Übersetzung des lateinischen conscientia, das sich als Wurzel der Bezeichnungen für Gewissen in so vielen modernen Sprachen erhalten hat. Die „Stimme des Gewissens“ verdankt nach Wundt sicherlich einem mythologischen Gedanken ihre Entstehung; die Sprache, welche das Wissen ein Mitwissen nannte, hat darunter ursprünglich ein göttliches Mitwissen verstanden. Wundt sagt wörtlich: „Der Affekt und das Urteil, die sich mit dem Bewußtsein der Motive und Tendenzen des Handelnden verbinden, gelten hier nicht als dessen eigene psychische Akte, sondern als Vorgänge, die von einer fremden, auf sein Bewußtsein rätselhaft einwirkenden Macht herrühren.“ Wie erklärt sich aber eine solche Zuerkennung an die Macht der Götter? Wundt meint, der Gedanke bewege sich hier wie so oft im Zirkel. Zuerst objektiviere der Mensch seine eigenen Gefühle und dann suche er aus den so entstandenen Objekten wiederum seine Gefühle zu erklären. Es ist zugestanden, daß die Bewußtseinspsychologie hier alles gesagt hat, was sie über das Thema sagen konnte, aber das ist noch immer kläglich genug.
Ich möchte Ihnen nun gerne Gelegenheit geben, diese Erkenntnis der alten psychologischen Betrachtung mit denen der Psychoanalyse zu vergleichen. Günstige Umstände erlauben es mir, dabei von einem konkreten Beispiel auszugehen, das gleichzeitig wichtige Beziehungen zwischen den Funktionen des Gewissens und dem Geständniszwang zeigt.
Mein Sohn Artur, dem der folgende Beitrag zur Psychologie des Gewissens zuzuschreiben ist, ist jetzt acht Jahre alt.7 Wie mir scheint, ist er ein ziemlich normales Kind, intellektuell gut aber nicht über den Durchschnitt begabt, impulsiv und heiteren Temperaments, ohne besondere Neigung zur Nachdenklichkeit. Er spielt lebhaft und gerne, ist manchmal so schlimm wie andere Buben und liest nur, wenn er muß. Zu seinen Eltern zeigt er großes Vertrauen und unterhält sich freimütig mit ihnen. Er stellt, wie ich glaube, ein typisches Großstadtkind einer bestimmten sozialen Schicht dar.
Als er mit mir einmal spazieren ging, trafen wir einen bekannten Herrn, der sich mir anschloß und im Laufe des Gesprächs sagte, eine „innere Stimme“ habe ihn von etwas zurückgehalten. Artur fragte mich, nachdem der Herr uns verlassen hatte, was das sei, die innere Stimme, und ich antwortete zerstreut: „Ein Gefühl.“ Am nächsten Tag entwickelte sich ein Gespräch, das Artur begann und das ich wortgetreu nach der Niederschrift vom Abend desselben Tages wiedergebe: „Papa, jetzt weiß ich schon was die innere Stimme ist.“
„Nun, sag‘ es!“
„Ich bin schon daraufgekommen. Die innere Stimme ist der Gedanke von einem.“
„Was für ein Gedanke?“
„No, weißt du, zum Beispiel so: manchmal gehe ich oft, (sic) ohne den (!) Händen zu waschen, zu Tische, dann ist so ein Gefühl, als sagte mir jemand: wasch‘ dir die Hände. Und wenn ich manchmal abends mich niederlege, so spiele ich mit dem Gambi (er hat diese Bezeichnung für Penis seit früher Kinderzeit beibehalten) und da sagt mir die innere Stimme: spiel nicht mit dem Gambi! Wenn ich es weiter mache, dann sagt mir wieder dieselbe Stimme: spiel nicht!“
„Ist das wirklich eine Stimme?“
„Nein, es ist ja niemand da. Das Gedächtnis sagt mir’s ja.“
„Wieso das Gedächtnis?“
Artur zeigt lebhaft auf seinen Kopf: „No, die Gescheitheit, das Gehirn. Wenn du zum Beispiel am vorderen Tag (er meint, am Tage vorher) sagst: ‚Wenn das Kind laufen und fallen wird‘ und ich laufe den nächsten Tag, dann sagt mir der Gedanke ‚lauf nicht‘!“ (Das Beispiel knüpfte an etwas Aktuelles an: der Knabe war, nachdem er oft gewarnt wurde, nicht so wild zu laufen, vor einigen Tagen gefallen und hatte sich am Knie so beschädigt, daß eine eitrige Wunde entstanden ist und er jetzt einen Verband trug. Er hatte von den Eltern Vorwürfe wegen seines Ungehorsams gehört.)
„Wenn du aber doch läufst?“ fragte ich.
„Wenn ich aber doch gelaufen bin und falle, dann sagt mir die Stimme: ‚Hab ich dir nicht gesagt, da´du fallen wirst?‘ Oder wenn ich einmal die Mama ärgere, auch wenn ich dich ärgere, so sagt mir das Gefühl: ärgere die Mama nicht!“
Wir wurden hier unterbrochen. Als ich einige Minuten später wieder ins Zimmer trat, begann Artur spontan:
„Jetzt weiß ich aber, was die innere Stimme ist! Es ist ein Gefühl von sich selbst und die Sprache von einem Anderen.“
„Was heißt das: die Sprache von einem Anderen?“
Artur machte eine zweifelnde Miene und meinte nachdenklich: „Nein, das ist nicht wahr.“ Nach kurzer Pause sagte er lebhaft: „Es ist aber doch wahr. Was du zuerst geredet hast! Zum Beispiel: die Mama hat mich einmal zum Greißler8 geschickt und du hast mir gesagt: ‘Gib acht, daß kein Auto kommt!‘ Und wenn ich nicht achtgegeben hätte, hätte mir die Stimme gesagt: ‚Gib acht, daß kein Wagen kommt!‘ Hat jeder Mensch eine innere Stimme?“
„Ja.“
„Nicht wahr, die innere Stimme kommt nicht zur äußeren Stimme? Doch nicht? Aber doch schon! Ich kann das nicht so sagen, weil ich es nicht so weiß. Eines von den beiden wird schon sein. Die innere Stimme, wenn man wirklich eine hat, kommt nicht zur äußeren Stimme, nur wenn man redet davon.“
Am nächsten Nachmittag begann er wieder: „Papa, die innere Stimme ist eigentlich, wenn man etwas getan hat und dann Angst hat. Zum Beispiel wenn ich den Gambi angerührt hab‘, so hab‘ ich die Angst, ich weiß nicht, welche Angst. Ich weiß aber doch, Angst, weil ich das getan habe. Es ist halt so ein Gefühl!“
Etwa eine Stunde später fragte er: „Nicht wahr, Papa, die Diebe haben zwei innere Stimmen?“
„Wieso zwei?“
„No, die eine, die sagt ihnen, sie sollen stehlen und die andere sagt ihnen, sie sollen nicht stehlen. Aber nein, nur die, welche sagt: ‚Nicht‘ ist die eigentliche Stimme.“
Seit jenem Gespräch waren etwa acht Monate vergangen; das Kind hatte nur zweimal die innere Stimme seither erwähnt. Einmal sagte er spontan: „Wenn die Mama der Großmama nicht gefolgt hat, so hat sie auch eine innere Stimme, die sagt, sie soll der Großmama immer folgen. Und wenn sie das nächste Mal nicht gefolgt hat, so hat sie Angst.“ Ein anderes Mal fragte er: „Nicht wahr, man hat nicht immer eine innere Stimme? Nur wenn man’s braucht.“
Als ich mich erkundigte: „Wann braucht man sie denn? Erklärt er: „Wenn man etwas Schlechtes tun will.“
Der Wert der vorliegenden Kinderaussage wird vornehmlich der sein, daß sie einen glänzenden Beweis für die Richtigkeit der analytischen Annahmen über die Entstehung und Entwicklung einzelner Ichinstanzen bietet und daß hier in statu nascendi gezeigt werden kann, was die Analyse in der Rückverfolgung seelischer Vorgänge beim Erwachsenen rekonstruieren mußte. Ein beträchtlicher Teil der psychischen Prozesse, die später unbewußt sein werden, ist hier noch bewußtseinsfähig, ein anderer Teil ist freilich schon auf dieser Stufe dem Bewußtsein entzogen. Ich erinnere Sie auch daran, daß die Scheidung zwischen bewußt und unbewußt beim Kinde nicht so scharf durchgeführt werden kann als beim Erwachsenen. Das Bewußte hat nach Freud beim Kinde noch nicht alle seine Charaktere gewinnen können, es ist noch in Entwicklung begriffen und verfügt noch nicht völlig über die Fähigkeit, sich in Sprachvorstellungen umzusetzen. Die Unbefangenheit, Lebendigkeit und von Widerständen ungehemmte Natürlichkeit, mit der der Kleine seine Aussagen über sein Seelenleben macht, erhöht zwar ihre wissenschaftliche Beweiskraft als die einer festgehaltenen Selbstbeobachtung eines wichtigen Stückes der infantilen Ichentwicklung, das sich sonst der Aufmerksamkeit der Erwachsenen entzieht, allein wir haben auch die notwendige Begrenztheit der psychologischen Verwertung dieser Kinderaussagen zu betonen.
Diese Grenzen werden vornehmlich aus zwei Momenten abzuleiten sein: das Kind zeigt kein allgemeines theoretisches, nur dem Verständnis und der Erklärung seelischer Vorgänge zugewendetes Interesse. Es hat einen ihn befremdenden Ausdruck („Innere Stimme“) zufällig gehört, möchte verstehen was er bedeute, und vergleicht nun die seelische Situation, welche jener Herr geschildert hat und die der Knabe gewiß nur teilweise verstehen konnte, mit ähnlichen Erfahrungen aus psychischen Prozessen, von denen ihm Erinnerungsreste erhalten geblieben sind. Darüber hinaus geht sein Interesse praktisch nur so weit, als er sich über die Wirkungsweise dieser „inneren Stimme“ klar werden will. Seine Fragen zeigen, daß er das, was er introspektiv bei sich gefunden hat, mit dem vergleichen will, was ich, der Erwachsene, ihm darüber sagen kann. Gewiß ist dieses psychologische Interesse für sein Alter ein bemerkenswertes, seine Begabung für Selbsbeobachtung keine alltägliche, aber es ist nicht zu erwarten, daß er systematisch die Fäden verfolgt. Das wiederholte Zurückkehren zu den ihn bewegenden Fragen, das Emportauchen derselben Probleme nach längeren Zeitintervallen zeigt indessen von seinem Bemühen, Klarheit über seine seelischen Vorgänge zu gewinnen; es ist selbstverständlich, daß seinem Bestreben enge Grenzen gesetzt sind. Auf der anderen Seite meinte ich, seine Aufmerksamkeit nicht künstlich auf Fragen lenken zu dürfen, für die er nicht reif ist und die nicht in ihm selbst laut geworden waren. Ich beschränke meine Äußerungen also – in einer der Analyse ähnlichen Art – auf vorsichtige Fraugen und Aufforderungen, nur das näher zu erklären, was er mir selbst gesagt hatte. Dies war auch der einzige Weg, alle Suggestion auszuschließen. Dieser Sachlage entsprechend werden Sie die Auskünfte des kleinen Jungen, sowohl was den Umfang als auch was die Tiefe der hier auftauchenden Probleme betrifft, zu bewerten haben.
Das zweite Moment ist ein sprachliches; das Kind kämpft hier mit einer Materie, die es schwer bewältigen kann. Sein Wortschatz ist beschränkt und seine Wortwahl kann natürlich unseren Ansprüchen auf Präzision nicht genügen. Für die schwierigen Begriffe, die er diskutieren will und deren Abgrenzung und Bestimmung auch uns Erwachsenen so viele Schwierigkeiten bereiten, reichen begreiflicherweise seine sprachlichen Fähigkeiten nicht aus. Sie bemerken gewiß, wie unsicher er in der Bezeichnung dessen, was er sagen will, ist, wie er die „innere Stimme“ bald als Gedanke, bald als Gefühl fassen will und wie er sich bemüht, die Bezeichnung „Sprache von einem Anderen“ in seiner Definition näher zu präzisieren als das, was ich zuerst geredet habe. Es ist übrigens erstaunlich, wie ihn das Bedürfnis nach Klarheit zu immer schärferer Formulierung antreibt. In der Überwindung der Unzulänglichkeiten seiner Kindersprache ist ihm da ein kleines Kunststück gelungen.
Versehen wir nun die Aussagen des Kleinen mit einer Art psychoanalytischen Kommentars, der die in der Analyse regressiv gewonnene Anschauung von der Ichentwicklung zum Vergleich heranzieht, so können wir folgendes sagen: Das Kind erklärt sich die „innere Stimme“, die wir als die zensurierende Instanz des Gewissens erfassen können, zuerst als „den Gedanken von einem“. Es ist charakteristisch, daß ihm, da er Beispiele zur Erklärung sucht, jene zwei einfallen, die sich auf das Waschen und auf die Unterlassung des Spielens mit dem Penis beziehen. Die innere Stimme entfaltet also ihre Wirkung als hemmender Faktor auf dem Gebiete der Analerotik und der Onanie für ihn am auffälligsten. Es kann nicht zufällig sein, daß gerade diese beiden Beispiele ihm zuerst einfallen; die enge Beziehung des neurotischen Waschzwanges zur infantilen Analerotik und zur onanistischen Betätigung, wie sie die Analyse bei Erwachsenen aufzeigt, wird hier in ihren seelischen Voraussetzungen aus der Kinderzeit bestätigt. Das weitere Beispiel zeigt wieder, wie sich die zensurierende Instanz für die Einhaltung des Realitätsprinzipes gegenüber den Tendenzen zur Lustbefriedigung geltend macht. Während er läuft, wird sich die selbstkritisierende Instanz warnend einmengen, und der Gedanke nach dem Fall („Hab‘ ich dir nicht gesagt, daß du fallen wirst?“) zeigt bereits, daß er das Fallen vorbewußt erwartet hatte, daß es die vorausgesehene Selbstbestrafung für seinen Ungehorsam war.
An dieser Stelle ist es ihm bereits möglich, die „innere Stimme“ als die Erinnerung an etwas Gehörtes, an eine Warnung oder Ermahnung des Vaters zu agnoszieren, und diese Erkenntnis wird während der wenigen Minuten, in denen er allein war, so weit klar, daß sie sich zu der Definition gestalten kann, daß die „innere Stimme“ ein Gefühl von sich selbst und die Sprache von einem Anderen ist. Diese Definition ist ganz korrekt und kann als Rückübersetzung der analytischen Anschauung über die Entstehung des Gewissens und des unbewußten Schuldgefühles in die Kindersprache angesehen werden. Das Kind hat da eine ganz respektable psychologische Leistung vollbracht. Vergleichen Sie seine Definition mit der analytischen Theorie, so ergibt sich folgendes: Freud hat bereits in seinem Aufsatz „Zur Einführung des Narzißmus“ die Entstehung einer zensurierenden Instanz, die das Aktual-Ich am Ichideal mißt, geschildert. Die Anregung zur Bildung eines Über-Ichs geht von dem durch die Stimme vermittelten kritischen Einfluß der Eltern aus, an die sich erst später der der Erzieher, Lehrer und anderer Personen angeschlossen hat. In seinem Buche „Das Ich und das Es“ hat Freud diesen Faden weiter verfolgt; es wird darin gezeigt, daß das Über-Ich sich im Anschluß an die primäre Identifizierung des Kindes mit dem Vater bildet und daß sich das infantile Ich für die Verdrängungsleistung, die von ihm erwartet wird, dadurch stärkt, daß es dieselben Hindernisse, die ihm früher der Vater entgegengestellt hat, in sich selbst aufrichtet. Es lieh sich dazu gewissermaßen die Kraft vom Vater. Das Über-Ich erweist sich so als „Erbe des Ödipuskomplexes“. Die Spannung zwischen den Ansprüchen des Über-Ichs und den Leistungen des Ichs wird als Schuldgefühl empfunden.
Wir sehen im Falle Arturs diesen Prozeß in den ersten Stadien; wir sehen den primären Niederschlag der Identifizieruung mit dem Vater, können verfolgen, wie sich hier noch die Spannung zwischen den fortwirkenden Ansprüchen des Vaters und den aktuellen Leistungen des Kindes als Schuldgefühl äußert. Wir können beobachten, wie sich das Vetorecht des Über-Ichs aus den Mahnungen und Verboten des Vaters entwickelt. Der kategorische Imperativ des Über-Ichs ist hier noch in seiner Entstehungsgeschichte aus dem Vaterkomplex klar ersichtlich. Das Über-Ich ist in seiner Genese hier gleichsam mit Händen zu greifen. Wenn das Kind das Schuldbewußtsein auf „ein Gefühl von sich selbst und die Sprache von einem Anderen“ zurückführt, so ist es regressiv den richtigen Weg gegangen. Das „Gefühl von sich selbst“ hat sich eben unter dem nachwirkenden Einfluß der kritisierenden, warnenden, verbietenden „Sprache von einem Anderen“, nämlich der Stimme des Vaters, entwickelt – „Was du zuerst geredet hast“. Es liegt hier nahe, die Psychogenese der religiösen Gefühle der Massen mit der Ausbildung des individuellen Gewissens durch Einbeziehung der richtenden Vaterinstanz ins Ich zu vergleichen. „Gott“, sagt Kant in seinen Vorlesungen über philosophische Religionslehre, „ist gleichsam das moralische Gesetz selbst, aber personifiziert gedacht“. Auch die Kirche selbst erklärt das Gewissen – und dies ist ja die innere Stimme Arturs – als „die Stimme Gottes im Menschen“, also als die forttönende, fortwirkende Stimme des erhöhten Vaters im Individuum.
Wir haben durch die Analyse gelernt, die Stimmen, die bei der Symptomatologie der paranoiden Erkrankungen eine so deutliche Rolle spielen, zu verstehen. Sie wissen, daß diese Kranken Stimmen hören, die in der dritten Person zu ihnen sprechen und ihr Tun und Lassen unaufhörlich beobachten und kritisieren. Diese kritische Instanz führt uns nach Freud auf die elterliche Kritik zurück und die Entwicklung des Gewissens wird von den Kranken regressiv reproduziert, indem sie die Stimmen nun wieder in die Außenwelt, von der sie kamen, zurückprojizieren. Es ist charakteristisch, daß die Stimmen, welche die Kranken hören, in dritter Person über sie sprechen; man meint hier die Spur der beobachtenden Pflegepersonen, die miteinander über das Kind sprechen, verfolgen zu können, die später durch andere Personen und schließlich durch die Gesellschaft (die „öffentliche Meinung“) ersetzt werden wird. Andererseits ist darin ein deutlicher Hinweis auf die Entstehungszeit jener beobachtenden Ichinstanz, die sich aus der primären Identifizierung mit dem Vater entwickelt und sich in der Institution des Gewissens im Ich konstituiert hat, enthalten; es muß die Zeit gewesen sein, wo das Kind von sich noch in dritter Person sprach, aber das Ich schon den Gegensatz zwischen dem eigenen Triebleben und der von außen wirkenden Aufforderung zur Triebunterdrückung mehr oder minder deutlich erfassen konnte.
Artur fragte, ob „die innere Stimme zur äußeren kommt“. Dies kann nur den Sinn haben: ob die innere Stimme nicht zur äußeren Stimme werden kann. Nach einigen Zweifeln kommt er zu dem Schluß, daß dies nur der Fall ist „wenn man redet davon“. Die Stimmen der Paranoiden geben ein anderes Beispiel eines solchen äußeren Lautwerdens der inneren Stimme, die einmal wirklich äußere Stimme war. Es ist signifikant, daß man sich das Gewissen als eine Sprachinstanz vorgestellt hat.
Der königliche Schurke in Shakespeares König Richard III. sagt:
Hat mein Gewissen doch viel tausend Zungen. Und jede Zunge bringt verschiednes Zeugnis, Und jedes Zeugnis straft mich einen Schurken. (Act V, Scene 3) (Übersetzung von Schlegel)
Wir können nach Freuds Ausführungen die Bedeutung vorbewußter Wortvorstellungen auch bis zum Über-Ich verfolgen, das seine Abkunft aus Gehörtem verrät. Diese Wortvorstellungen als Erinnerungsreste an Wahrnehmungen sind isoliert sogar dem Bewußtsein, dem das Über-Ich entzogen ist, oft zugänglich. Wir beobachten, wie oft sich Menschen an von den Eltern gebrauchte Sprichwörter, Vergleiche, Redensarten erinnern und sie zitieren („Mein Vater pflegte zu sagen“), ohne sich dem Wert jener Ansichten für das eigene Leben bewußt zu werden.
Die Vermittlungsrolle vorbewußter Wortvorstellungen als Erinnerungsreste scheint sogar über das oben gesagte weit hinaus zu gehen und sich bis in die Anfänge der Denkprozesse fortzusetzen. Die Bedeutung der Eltern für diese Entwicklung ist offenbar. Einige Bemerkungen Ludwig Feuerbachs in seinem Buch „Wesen des Christentums“ weisen in dieselbe Richtung: Zum Denken gehören ursprünglich zwei. Erst auf dem Standpunkt einer höheren Kultur verdoppelt sich der Mensch, so daß er jetzt in und für sich selbst die Rolle des anderen spielen kann. Denken und Sprechen ist darum bei allen alten und sinnlichen Völkern ein und dasselbe; sie denken nur im Sprechen, ihr Denken ist nur Konversation. Gemeine Leute, das heißt nicht abstrakt gebildete Leute verstehen noch heute Geschriebenes nicht, wenn sie nicht laut lesen, nicht aussprechen, was sie lesen. Wie richtig ist es in dieser Beziehung, wenn Hobbes den Verstand des Menschen aus den Ohren ableitet.“ Manches rätselhaft scheinende Gebot und Verbot der Zwangsneurose, manche absurd scheinende Zwangsvorstellung und manches sonderbare Symptom der Hysterie wird sich auf eine solche unbewußt gewordene und vom Unbewußten benützte Rede des Vaters (der Mutter) zurückführen lassen. Der Respekt und die hohe Einschätzung, die wir bestimmten moralischen Anschauungen entgegenbringen, sind nicht ihrem absoluten Wert zuzuschreiben, sondern eben den unbewußten ersten Objektidentifizierungen und Objektbesetzungen, das heißt also insbesondere der unbewußten Nachwirkung der Liebe, die wir früh den Menschen entgegenbrachten, welche uns jene Anschauungen vermittelten. Ja, man kann sogar behaupten, die Tenazität gewisser Moralbegriffe, die sich überlebt haben, hänge von der Unsterblichkeit solcher frühen Objektidentifizierung ab.
Freud hat uns verstehen gelehrt, daß die ursprünglichen Konflikte der Kindheit zwischen den Forderungen unserer Triebe und den Ansprüchen der Zivilisation durch die Erzieher des Kindes entstehen. Jene frühen Konflikte setzen sich in einer späteren Phase fort als Zusammenstoß der Stärke der Triebe mit den Forderungen des Über-Ichs. Ich habe andernorts eine kleine Szene aus dem Leben Arturs, als er drei Jahre alt war, erzählt. Sie zeigt jene Konflikte in diesem Alter. Das Kind war damals trotz Ermahnungen schlimm gewesen und von seiner Mutter bestraft worden. Als man ihm Vorwürfe machte, erklärte er schluchzend: „Bubi will schon brav sein, aber Bubi kann nicht brav sein.“ Nichts anderes als diesen in so frühem Alter gespürten und so naiv ausgesprochenen Konflikt meint der Apostel Paulus, wenn er schmerzvoll ausruft: „Ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, das tue ich.“ (Röm 7,15) Vor fast sechzehn Jahrhunderten schrieb der Punier Augustinus, den die Kirche den Heiligen nennt, in seinen „Confessiones“ die merkwürdigen Zeilen: „Es befiehlt der Geist dem Körper und findet dort Gehorsam, es befiehlt der Geist sich selbst und findet Widerstand … Der Geist befiehlt sich, zu wollen, der Geist, der gar nicht befehlen könnte, wenn er nicht wollte, und doch tut er nicht, was er befiehlt. Aber er will nicht ganz, deshalb befiehlt er auch nicht ganz … Ich war es, der wollte, ich, der nicht wollte.“ Augustinus hatte schon als Jüngling zu dem Herrn gefleht: „Gib Keuschheit, Herr, aber nur nicht gleich!“
Die Identifizierung mit dem Vater, auf der im Wesentlichen die Konstituierung des Über-Ichs beruht, kann man übrigens in den Spielen der Kinder noch deutlich beobachten. Artur suchte einen Hund, den wir später erhielten, zu verschiedenen kleinen Künsten abzurichten und gebrauchte in seinen Dressurversuchen mit Vorliebe die Ausdrücke des Lobes und Tadels, der Ermunterung und Ermahnung, die ihm gegenüber gebraucht worden waren. Viel früher schon konnte man aus allerlei Anzeichen die Objektintrojektion in ihrer Verknüpfung mit dem Schuldgefühl in den Spielen des Kindes verfolgen. Das Kind war, als es noch nicht fünf Jahre alt war, einmal in der Spielschule allzu lebhaft gewesen und hatte zur Strafe für kurze Zeit in der Ecke, dem Winkel des Schulzimmers, stehen müssen. Als wir davon erfahren hatten, neckten wir ihn oft damit und nannten ihn mit scherzhaftem Spottnamen „Artur Winkelsteher“. Darüber ärgerte er sich sehr, er protestierte lebhaft gegen diese Bezeichnung. Wir beobachteten indessen, daß er denselben Spottnamen auf imaginierte Kinder anwendete. Es war so, als habe er seine Eigenschaft auf ein fremdes, im Spiel imaginiertes Objekt projiziert und bestrafe es jetzt mit dem kränkenden Beinamen. Die Entlastung des Schuldgefühles durch solche Projektion ist uns durch Freud verständlich geworden. Es war deutlich, daß sich das Kind in seinen Spielen mit dem Vater oder ihn repräsentierenden Instanzen identifiziert hatte und so die Schwäche und Unzulänglichkeit des Ichs zeitweise überwand.
Aus jener Zeit stammt eine Aufzeichnung, die folgendes besagt: Artur spielte, von der Spielschule zurückkehrend, in seinem Zimmer in Anwesenheit seines Fräuleins Polizeimann und hatte anscheinend eine größere Anzahl von Missetätern, die er einvernahm, vor sich. Er fragte also einen imaginären Verbrecher mit strenger Miene: „Was haben Sie getan?“ dann einen zweiten: „Und was haben Sie angestellt?“ und so weiter. Schließlich wandte er sich an den letzten der in seiner Phantasie anwesenden Frevler mit Worten, die das Fräulein aufhorchen ließen: „Und du, Artur Winkelsteher? Ah, ich weiß schon. Du hast einen Revolver gestohlen. Du wirst eingesperrt!“ Das Fräulein unterbrach ihn hier, indem sie erstaunt rief: „Aber Artur, du hast doch keinen Revolver gestohlen!“ „Oh ja! Da!“ sagte der Kleine lebhaft und zog einen kleinen Blechrevolver, den er vormittags aus der Spielschule mitgenommen hatte, aus seiner Tasche. Wir haben seither nichts von dergleichen Neigungen bei dem Kinde beobachten können. Aber es spricht für die psychische Nachwirkung der damaligen Erfahrung, wenn Artur sich jetzt darnach erkundigt, ob die Diebe zwei innere Stimmen haben.
Wir können auch in dieser kleinen Szene das Wirken jener psychischen Instanzen, die zur Konstituierung des Über-Ichs entscheidend beigetragen haben, studieren. Es entspricht der Ableitung des Über-Ichs aus der Introjektion des Vaters, wenn Artur nun die Rolle des Polizisten, eines typischen Vertreters der richtenden Autorität, spielt und sich selbst beschuldigt. Hier ist der Übergang von der Objektidentifizierung zur Konstituierung des zensurierenden Über-Ichs deutlich zu beobachten. Wie hier der Polizist, den Artur vorstellt, dem Ich, das im Spiel auf ein imaginäres Objekt nach außen projiziert erscheint, gegenübersteht, so ähnlich wird sich später das Über-Ich dem Ich gegenüber verhalten. Es ist klar, daß die geschilderte Spielszene die gefürchtete Bestrafung antizipiert, daß sie vom unbewußten Strafbedürfnis inspiriert ist. Das Kind spielt die Szene der Einvernahme, um ihr ihre Schrecken zu nehmen. Das Schuldgefühl hat seinen Ursprung in der Angst vor dem Liebesverlust. Das Geständnis, das in dem Spiele liegt, soll diesem Verlust vorbeugen, beziehungsweise ihn rückgängig machen.
Wir stoßen also auch in der Analyse dieser Kinderszene und des in ihr enthaltenen Geständnisses auf die Tatsache, daß das Geständnis das Strafbedürfnis befriedige und entlaste. Es ist unzweifelhaft, daß der Effekt, den das Spiel hatte, einen Rückschluß auf sein Motiv zuläßt; das Spiel wird zu einem Ersatz der Beichte; das Geständnis erfolgt ja dann wirklich. Es scheint mir sicher, daß diese latente Bedeutung des Spieles sich nicht auf diesen Einzelfall beschränken kann. Die Beobachtung würde ergeben, daß viele Kinderspiele unbewußt dargestellte Geständnisse sind. Das gespielte Geständnis verdient wirklich die Aufmerksamkeit der Psychologen und Pädagogen.
Das Buch, dem diese Auszüge entnommen sind, führte den unbewussten Geständniszwang als Ausdruck von Schuldgefühlen in die psychologische Literatur ein. Wir werden den Problemen wieder begegnen, die in der Diskussion jener Kindheitsszene auftauchte. Der Konflikt derselben emotionalen Kräfte wie in einem Kinderspiel kehrt wieder in der Schlacht der Riesen, die die Bestimmung des Menschen determiniert.
2 Civilization and Its Discontents, London, 1930, p. 123; Das Unbehagen in der Kultur, Wien, 1930, S. 117.
3 Einige lobenswerte Ausnahmen sind Herman Nunbergs „The Feeling of Guilt“, in: Practice and Theory of Psychoanalysis, New York, 1948 und Ludwig Jekels Aufsatz „Die Psychologie des Schuldgefühls“, in: Psychoanalytische Bewegung IV, 1932. Edmund Berglers Battle with the Conscience, Washington, 1946, präsentiert nur reiches klinisches Material.
4 zitiert in meinem Buch The Search Within, New York, 1956, S. 642
5 Leipzig und Wien, 1925.
6 Der folgende Abschnitt ist dem genannten Buch im Original entnommen: S. 179 – S. 198. Der Einschub mit dem Shakespeare-Zitat S. 13 fehlt im deutschen Text S. 190.
7 Diese Angabe bezieht sich auf das Jahr 1923, aus dem die hier verwerteten Notizen stammen.
8 Wienerisch: Gemischtwarenhändler.
Kapitel II
Ursprung und Wesen der Schuldgefühle
Vor 200 Jahren wandte sich Jean Jacques Rousseau, der oft sehr dumme Dinge in einer sehr schönen Sprache sagte, an das Gewissen: „Du unfehlbarer Richter über Gut und Böse, der den Menschen dazu macht, der Gottheit zu gleichen.“9 Später sah man das Phänomen des Gewissens weniger enthusiastisch, sondern eher realistisch. Die Forschung auf dem Gebiet der sogenannten „sozialen Instinkte“ war lange Zeit für Biologen und Philosophen reserviert. Die erste Gruppe suchte im Sozialleben der Tiere nach den Wurzeln jener Instinkte. Ein Beispiel der Behandlung jener Gegenstände durch einen der größten Naturforscher soll das verdeutlichen. Charles Darwin untersuchte bestimmte charakteristische Züge der Schwalben.10 Zur rechten Zeit scheinen diese Vögel “den ganzen Tag von dem Verlangen erfüllt fortzuziehen. Ihre Gewohnheiten ändern sich, sie werden unruhig, sind laut und versammeln sich in Scharen. Während der Muttervogel seine Nestlinge füttert oder bebrütet, ist der Muttertrieb möglicherweise stärker als der nomadische Trieb, aber der Instinkt, der beharrlicher ist, erlangt den Sieg und schließlich, in einem Augenblick, wenn ihre Jungen nicht in Sicht sind, ergreift sie die Flucht und verlässt sie. Am Ende ihrer langen Reise und wenn der Wanderinstinkt aufgehört hat zu wirken, würde die Schwalbe Reue fühlen, wenn sie mit großer geistiger Aktivität ausgestattet wäre und an ihre Jungen denken, die im rauen Norden an Kälte und Hunger sterben“.
Paul Rée, ein heute zu Unrecht vergessener Philosoph und Physiker und enger Freund von Nietzsche, der ihm die meisten Leitgedanken seiner Genealogie der Moral verdankte, nahm die Gelegenheit wahr, diesen Abschnitt von Darwin, dessen Zeitgenosse er war, zu diskutieren. Er dachte, dass Darwin unrecht hätte: jene Schwalbe würde Bedauern, aber keine Reue empfinden. Das Bewusstsein, schlecht, böse oder sündig gehandelt zu haben würde fehlen. Rée, der sehr an der Frage nach der Entstehung des Gewissens interessiert war, fragte sich11, welche Ereignisse vorausgehen müssten, damit jene Schwalbe nicht nur Sympathie, sondern auch moralisches Bedauern fühlte. Es sind die folgenden Ereignisse: Unter dem Schwalbenvolk muss ein Schwalbenprophet erscheinen und verkünden: „Ihr Schwalben, hört! Der Schwalbengott, dessen Flügel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang reichen und dessen Nest in den Wolken ist, offenbart euch durch meinen Mund: ‚Ich verurteile die Schwalben, die ihre Jungen verlassen, bevor sie flügge sind. Wehe den Müttern, die das Bild des Nils und seiner schönen Ufer von ihren Kindern wegnimmt! Sie werden mit ewiger Strafe geschlagen!’“ Rée stellt sich vor, dass eine Schwalbenmutter, die von dem Drang auszuwandern verführt wird, ihre Küken trotz jener Offenbarung verlassen wird. Sie würde dann nicht nur Bedauern aus Mitleid fühlen, sondern auch moralisches Bedauern, das Bewusstsein vom Zorn Gottes und von ewiger Strafe. Wie, fragte Rée, kam Darwin dazu, seiner Schwalbenmutter auch moralisches Bedauern oder Reue zuzuschreiben? Wie jeder, der durch die Zivilisation erzogen wurde, hat Darwin von früher Kindheit an gelernt, sich erbarmungslose Handlungen als Übel vorzustellen, das Bestrafung verdiente. Er nahm an, dass die Schwalbe auch in derselben Weise denken würde. Er schrieb seine eigenen moralischen Urteile den Tieren zu.
Dieses interessante Beispiel einer philosophischen Diskussion des Problems von Gewissen und Schuldgefühlen ist charakteristisch für die Einstellung, wie Fragen dieser Art vor noch nicht einmal 60 Jahren behandelt wurden. Sie unterscheidet sich nicht sehr von der Art, wie Psychologen nach der Jahrhundertwende die Natur und die Psychogenese von Schuldgefühlen erörterten. Die Psychoanalyse fand einen neuen Zugang zu diesen alten Problemen.
Freuds Aufsätze, die die neue Wirkung des Über-Ichs in die analytische Theorie einführten, hatten unsere Aufmerksamkeit auf den Part des unbewussten Schuldgefühls im individuellen Leben als auch in den Bildungen sozialer Institutionen gerichtet. Die neue Einsicht in das Gebiet der Psychologie vom Ich half, sich mit einigen jener Probleme zu befassen. Sie ließ andere ungelöst und schuf neue. Fragen, die die Rolle von unbewussten Schuldgefühlen bei der Entwicklung der Neurose und der Genese von bestimmten Formen des Masochismus betrafen, blieben unbeantwortet. Viele Versuche, die die Psychoanalytiker zur Lösung unternommen hatten, waren erfolglos, unter ihnen mein eigener in „Der Schrecken“, veröffentlicht 192912. Freud schrieb in einem Brief an mich13, mit Beziehung auf diesen Beitrag: „Die Dunkelheit, die noch immer über den unbewussten Schuldgefühlen liegt, scheint nicht von einer der Diskussionen über sie erleuchtet zu sein. Die Schwierigkeit wächst nur.“
Die Morgendämmerung für dieses zentrale Problem kam 1930, als Freud die Diskussion in seinem Buch „Das Unbehagen in der Kultur“ wieder aufnahm. Im zweiten Teil dieses Buches, das eine Analyse der Struktur unserer Zivilisation enthält, hat Freud nun einen besonderen unabhängigen Aggressionstrieb anerkannt und zugegeben, dass er den universalen nichterotischen Tendenzen der Menschheit bei der analytischen Interpretation des Lebens nicht ihre gebührende Bedeutung gegeben hatte. Er erklärt nun, dass diese angeborene Triebdisposition das mächtigste Hindernis zur Kultur errichtet. Eine der bedeutendsten Maßnahmen der Zivilisation, diese Aggression unschädlich zu machen, kann man bei der Evolution des Individuums studieren. Es wird von jenem Teil des Ich, genannt Über-Ich, das jetzt in der Form von „Gewissen“ Aggressivität gegen das Ich ausübt, nach innen gewendet, verinnerlicht und übernommen. Die Spannung zwischen dem strengen Über-Ich und dem untergeordneten Ich nennt man „Schuldgefühl“ und es manifestiert sich als Bedürfnis nach Strafe.
Woher kommt das Schuldgefühl? Seine erste Stufe kann man am besten als Furcht, Liebe zu verlieren, bezeichnen. Eine schlechte Tat ist eine, der, wenn sie entdeckt wird, Verlust von Liebe (und von Schutz) für das Kind folgt. Auf dieser Stufe ist das Schuldgefühl noch „soziale Angst“. Das wird im Wesentlichen so bleiben. Es bedeutet Angst, dass der Vater oder die Mutter und später die Gemeinschaft den Übeltäter verurteilt und bestraft.
Dinge ändern sich nur, wenn die gefürchtete Autorität verinnerlicht worden ist, das heißt, nachdem das Über-Ich etabliert worden ist. Die neue Autorität des Über-Ichs scheint nicht zwischen verbotener Tat und bösen Wünschen zu unterscheiden. Es scheint alles zu wissen, was in den Tiefen des Selbst vor sich geht. Es ist allwissend, wie Gott. Genau wie er quält es gerade jene Leute, die tugendhaft sind. Wie Gott ist das Über-Ich strenger gegen jene, die auf viele Triebbefriedigungen verzichten als gegen jene, die nachgiebig sind und sich manche Befriedigung erlauben. Das Über-Ich entwickelt eine besondere Strenge gegenüber Personen, die Versuchungen nicht nachgeben. Da es bestimmte Wünsche so behandelt, als ob sie wirkliche Vergehen wären, ist Verzicht keine Hilfe und schützt das Ich nicht gegen die Strenge der inneren Autorität. Das Über-Ich verstärkt seine Strenge bei Personen, die eine starke Triebunterdrückung in ihrem Leben praktizieren. Es gibt weniger innere Absolution für den Heiligen als für den Sünder. Der gefürchtete Verlust von Liebe und Furcht vor äußerer Bestrafung wird durch die Spannung ersetzt, die durch das Schuldgefühl und durch eine bleibende Glückseligkeit geschaffen wird.
Schuldgefühle treten zuerst auf, nachdem einer eine verbotene Tat begangen hat und diese Tat gesteht. Freud würde diese ursprünglichen Emotionen eher Gewissensbisse nennen. Ihr frühes Auftreten setzt voraus, dass die Fähigkeit, sich schuldig zu fühlen, schon vor der Tat existierte. Das heißt, dass Schuldgefühle auf eine mehr oder weniger bestimmte Weise schon da waren, bevor die Wirkung des Gewissens entstanden war. Gewissensbisse sind die Reaktion auf eine verbotene Tat. Sie sind im Allgemeinen bewusst. Das Schuldgefühl, das sich später einstellt, ist oft unbewusst und wird manchmal nur als eine vage Art von Furcht oder Unbehagen wahrgenommen, zum Beispiel bei vielen Zwangsvorstellungen. In seinen späteren Phasen ist es die Furcht vor dem Über-Ich. Wir Analytiker vermuteten zunächst, dass jede Art von vereitelter instinkthafter Belohnung eine Erhöhung des Schuldgefühls zur Folge hat. Freuds neueste Einsichten überzeugten ihn, dass dies nur für den Aggressionstrieb gilt. Mit anderen Worten, der Ursprung der Schuldgefühle liegt im Bereich des Aggressionstriebs. Die allgemeine Prämisse für das Auftauchen von Schuldgefühlen ist natürlich die Unterdrückung von instinkthaften Tendenzen. Aber nur die aggressiven Anteile an ihnen werden später in ein Schuldgefühl umgewandelt.
Wir akzeptierten nur zögernd die neue und engere Vorstellung von Schuldgefühlen. Aber nach und nach wurde es offensichtlich, dass sie eine fundamentale Wirkung in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht hat. Sie hat eine besondere Bedeutung für die Probleme der Zivilisation. Obwohl wir wussten, – der Abschnitt, den ich aus seinem Brief an mich zitiert habe beweist es – dass Freud mit unserer Forschung über den Charakter der Schuldgefühle nicht zufrieden war, kam seine neue Vorstellung für uns, seine Mitarbeiter, überraschend. Im Gegensatz zu früheren Annahmen erschien der Ursprung des Schuldgefühls jetzt auf die aggressiven Triebe eingeschränkt. Wir hatten oft beobachtet, dass unterdrückte sexuelle Wünsche von intensiven unbewussten Schuldgefühlen begleitet waren. In der Symptomatologie der Neurose als auch der Perversionen, besonders beim Masochismus hatten wir die unbestrittene Tatsache gefunden, dass Schuldgefühle in allen Fällen die unterdrückten sexuellen Trends betreffen. Die Fäden waren zwischen jenen zwei Arten der Handlungen, den unterdrückten sinnlichen Bemühungen und den Schuldgefühlen für uns so offensichtlich, dass wir ihre Wirkung als selbstverständlich annahmen.
Wir hatten große Schwierigkeiten, uns selbst an einige neuere Beobachtungen von Freud zu gewöhnen, zum Beispiel die Tatsache, dass zwanghafte umfassende sexuelle Zurückhaltung oder Abstinenz das Schuldgefühl intensiviert. Dies scheint den Ursprung des Schuldgefühls in den unterdrückten Sexualtrieben zu bestätigen. Ich selbst hatte in einem Seminar in Wien den Fall eines neurotischen Patienten präsentiert, der während einer langen Periode von Masturbation fast kein Schuldgefühl oder Furcht zeigte, aber der anwachsendes Schuldgefühl in der Zeit entwikkelte, als er diese sexuelle Aktivität aufgab und ein enthaltsames Leben führte. Könnte diese paradoxe Haltung mit Hilfe von Freuds neuen Einsichten erklärt werden? Schuldgefühl ist das Ergebnis unbewusster Versuchung. Es kann sogar als jene besondere Art von Furcht definiert werden, die durch den Drang zurückgewiesener Triebe geweckt wurde, das heißt es ist Versuchungsfurcht. Ich hatte gelegentlich darauf hingewiesen, dass jene aufgestauten Wünsche besonders gefährlich und drängend sind, wenn sie unterdrückt werden. Dem Hl. Hieronymus, dessen Imagination tausend wollüstige Bilder aufrief, erscheinen die Waffen der Frauen als Fänge Satans. Dem Habitué vom Moulin Rouge sind sie nur die schwach parfümierten Glieder eines Mädchens. All diese Eindrücke sind bis zu einem bestimmten Grad richtig. Doch sie entkräften nicht Freuds Vorstellung vom Ursprung der Schuldgefühle im Bereich aggressiver Züge. Klinisches Material reicht hier nicht für eine Entscheidung, weil die „sexuellen“ Triebe, deren Wirkung wir beobachten, auch einen gemischten Charakter haben und aggressive und destruktive Elemente enthalten.
Ein genaueres Verstehen der Überlegungen Freuds führte auch zu dem bedauerlichen Schluss, dass unsere Eindrücke nicht schlüssig gewesen waren. Die Beobachtung, dass sexuelle Unterdrückung Schuldgefühle weckt oder intensiviert, ist gültig, aber sie ist nicht identisch mit der Rolle der Ursache, die wir sexuellen Wünschen zugeschrieben hatten. Die Unterdrückung intensivierte nur das Drängen ihrer Macht und das Anwachsen der Versuchung. Schuldgefühl kommt nicht vom unerfüllten erotischen Sehnen, sondern von einer anderen Seite. Die aufgestauten Sexualtriebe rufen bei Verhinderung sexueller Befriedigung verstärkte Aggression hervor. Aber jene Personen werden geliebt oder bewundert und respektiert und die aggressiven Tendenzen, die trotzdem geweckt worden waren, wurden gerade auf Kosten dieser Liebe unterdrückt. Die Energie der unterdrückten Aggressivität wird in Schuldgefühle umgewandelt. Die Aggression, die auf das Über-Ich übertragen wird, wendet ihre strafende Macht gegen die Person selbst.
Wir wollen einen Augenblick zu dem Fall meines vorher erwähnten Patienten zurückkehren und die emotionale Situation erneut prüfen. Solange er täglicher Masturbation nachging, war er fast frei von Schuldgefühlen und beklagte sich nur, dass diese Art von sexueller Tätigkeit ihn von der Gesellschaft von Frauen abhielt. Das paradoxe Auftauchen von Schuldgefühlen, die anwuchsen, je länger er in einer späteren Phase seiner Neurose enthaltsam lebte, kann nicht durch Übertragung auf die Macht der unterdrückten Sexualtriebe erklärt werden. Der Patient kannte natürlich ihre Wirkungen und kämpfte verzweifelt gegen ihren Drang. Aber er wurde selbst durch das Fehlen von Furcht während der vorhergehenden Periode exzessiver Masturbation verwirrt. Der Charakter dieser Furcht war zuerst nicht klar, aber er zeigte sich in der Analyse der Phantasien des Patienten als unbewusstes Schuldgefühl. Die Bilder, die er dabei aufrief, zwangen ihn, zur Masturbation zurückzukehren, aber wann immer er diese aufgeben wollte, musste er an einen bestimmten Leiter in einem Lager denken, der ihn einst, als er zwölf Jahre alt war, masturbierend ertappt und ihn streng ermahnt hatte. Er unterdrückte dann den Sexualwunsch. Er schrieb die Furcht, die er danach fühlte, der Tatsache zu, dass er jetzt die sexuellen Trends als Ausdruck moralischer Schwäche betrachtete. Es war jedoch offensichtlich, dass jene Emotion seine Reaktion auf die unbewusste Wut gegen den bewunderten Lehrer war. Die aufwallende Wut, die sein Vorwurf einst in dem Jungen erweckt hatte und die wieder auftauchte, wann immer er jetzt, als ein Mann, versucht war zu masturbieren, war unterdrückt worden, da sie mit dem bewussten Respekt und der Neigung, die er noch immer für jenen Ratgeber fühlte, in Konflikt kam. Die wahre Natur jener Furcht als verkleidetem Schuldgefühl wurde bei den folgenden Gelegenheiten offensichtlich: Kurz nachdem er den Drang zu masturbieren wieder unterdrückt hatte, beging er innerhalb von zwei Stunden eine große Anzahl von selbstschädigenden Handlungen wie Verstauchen eines Fußknöchels, Verbrennen seiner Finger an einem Feuerzeug und Verlieren seiner Brieftasche. Unbewusstes Schuldgefühl manifestierte sich hier, wie so oft, als Selbstbestrafung. Jenes Schuldgefühl betraf nicht die unterdrückten Sexualwünsche, sondern die aggressiven Tendenzen gegen jenen Ratgeber, die zurückgekehrt waren und die er vor sich geleugnet hatte.
Unsere Beobachtungen waren gewissenhaft und korrekt gewesen, aber die Schlüsse, die wir aus ihnen zogen, waren nachlässig und irrig – ein Fall, der in der Forschung nicht ungewöhnlich ist. Als wir die Situation nochmals prüften, wunderten wir uns, wie wir zwischen zwei Gruppen von Trieben geraten konnten. Erkannten wir nicht, dass wir ein feines Spinnennetz zwischen der Unterdrückung von Sexualtrends und dem Ursprung von Schuldgefühlen ausspannten? Hatten wir nicht wahrgenommen, dass die Sexualtriebe nicht mit den Emotionen verwandt sind, die wir in unserer Theorie mit der Idee von Schuld verbunden haben? Doch Ausdrücke wie Gewissensbisse, Gewissensängste und ähnliche als auch die Gleichnisse der Dichter beziehen sich deutlich genug auf den Aggressionstrieb als denjenigen, in dem das Schuldgefühl seinen Ursprung hat. (Shakespeare nennt das Schuldbewusstsein „voll von Skorpionen“ und sagt, dass große Schuld „den Geist grimmig beißen wird“.) Sexualtriebe gehören sozusagen zu einer anderen Familie, sie sind nicht aus dem gleichen Stoff. Bei diesem Ausdruck legt sich ein Vergleich nahe: Eine Frau, die Material für ein Kleid kaufen will, prüft die verschiedenen Stoffe, die die Verkäuferin ihr zeigt, mit drei Fingern ihrer rechten Hand und beurteilt ihre Qualität und Dichtigkeit. Sie „fühlt“, ob sie grob oder fein sind, fest oder locker, u.s.w. Weiß sie irgendetwas von Fabrikmanufaktur, hat sie irgendein wissenschaftliches Wissen über die Anordnung von Fäden oder andere Faktoren? Nein, doch ihre Meinung ist fast immer richtig. Als wir den Ursprung der Schuldgefühle unterdrückten erotischen Gefühlen zuschrieben, hatten wir einen bedauerlichen Mangel an psychologischem Einfühlungsvermögen gezeigt. Wir hatten kein unterscheidendes Gefühl in unseren Fingerspitzen.
Eine Erklärung für die falsche Schlussfolgerung zu finden, die wir gezogen hatten, ist vielleicht einleuchtender als Selbstbeschuldigung. Der Fehler in unserer Rechnung hatte verschiedene Gründe. Zuerst folgten wir bei jener Zuordnung der Linie des geringsten psychologischen Widerstands. Es war leichter, die Geburt von Schuldgefühlen sexuellen Trends als der Aggression zuzuschreiben, besonders da jene beleidigenden, hasserfüllten und mörderischen Triebe gegen bewunderte oder geliebte Personen gerichtet sind – denselben Personen, von denen die sexuellen Verbote kamen. Zweitens sprechen so viele Phänomene, die der Psychologe wahrnimmt, oberflächlich betrachtet zugunsten der Vorstellung, dass sexuelle Überschreitungen Schuldgefühle produzieren.
Ein solcher oberflächlicher Blick machte die Akzeptanz von Freuds Meinung auch für Analytiker schwierig. Gerhart Piers und Milton B. Singer zum Beispiel bezweifeln ernsthaft Freuds Annahme, dass Schuld ausschließlich vom aggressiven und nicht von irgendeinem anderen Trieb erzeugt wird.14 Sie sagen: “Ich möchte diesen Standpunkt in Frage stellen. Es scheint mir, dass in unserer christlichen Kultur, ob unter dem Protektorat des Hl. Paulus oder Calvins ein besonderes Schuldgefühl, das mit dem Suchen nach sinnlich-sexuellem Vergnügen verbunden ist, klar zu unterscheiden ist, besonders bei Frauen.“ Dieser rein phänomenologische Gesichtspunkt zieht nur in Betracht, was beobachtet werden kann und vernachlässigt dabei Tiefenpsychologie und verzichtet auf alle Vorteile analytischer Durchdringung. Sonst hätten die Autoren erkannt, dass ein besonderes bewusstes Gefühl von Schuld „besonders bei Frauen“ in „unserer christlichen Kultur“ Freuds Vorstellung nicht ungültig macht. Sie verstanden die emotionale Dynamik nicht, die den Umweg bei der Entwicklung von Schuldgefühlen bestimmt. Dieser „besondere Sinn von Schuld, verbunden mit Suchen nach sinnlicher Freude“ entsteht, wenn diese Triebe, die Vergnügen suchen, vereitelt werden und Protest und Aggression gegen Eltern oder Erzieher, die sie behinderten und frustrierten, erweckt haben. Das Schuldgefühl ist hier auch mit der Unterdrückung jener aggressiven Tendenzen verwurzelt und äußert sich selbst als Reaktion mit energischer Unterdrükkung jener Bestrebungen. Den Fehler, den wir in unserer vorherigen Vorstellung des Schuldgefühls machten, wurde durch einen dritten Faktor ermöglicht: Es gibt einige aggressive Elemente in den Sexualtrieben als auch einige sexuelle (dies bedeutet hier sadistische) Qualitäten in der Aggressivität. Es ist beinahe unmöglich, in unserem klinischen Material Tendenzen zu finden, die eindeutig zu der einen oder anderen Gruppe von Trieben gehören.
Doch es gab einen Indizienbeweis für die Verwandtschaft der Aggressivität mit Schuldgefühlen. War es zum Beispiel nicht bemerkenswert, dass eine Erhöhung des Schuldgefühls unter bestimmten Bedingungen wieder zu aggressiven Durchbrüchen führt – als ob es in das Originalmaterial, dem es entnommen war, zurückverwandelt wurde? In meinem Buch „Der unbekannte Mörder“15 beschrieb ich die Wiederkehr unterdrückter aggressiver und mörderischer Impulse bei einigen Gruppen von Verbrechern als Folge erhöhter Schuldgefühle. Es scheint, dass ein außerordentlich intensiviertes Schuldgefühl das Auftauchen solcher unterdrückter Bestrebungen favorisiert. Ein bestimmter Typ eines neurotischen Verbrechers, dessen Dynamik Freud beschrieben hat, gehört in diese Kategorie von Individuen, die der Druck eines vorher existierenden Schuldgefühls dazu treibt, ein Verbrechen zu begehen. Das Schuldgefühl agiert hier in seiner antreibenden und herausfordernden Funktion, als ob es selbst ein Trieb wäre. Aber es erweist sich als ein Abkömmling der angeborenen Aggression, mit der es trotz aller Unterschiede eine entschiedene Familienähnlichkeit hat.
Es folgen zwei Beispiele einer solchen Rückverwandlung von verstärktem Schuldgefühl in Zorn und folgender Attacke: Eine junge Frau, die sich von ihrem Chef im Büro unrecht behandelt fühlte, beschloss, ihm „ihre Meinung zu sagen“ und sagte ihm mit scharfen Worten „alles“, was sie gegen seine Unfairness hatte. Am Abend dieses Tages fühlte sie sich sehr reuevoll und wollte sich bei ihm entschuldigen. Als sie am nächsten Morgen in das Büro kam, fühlte sie sich noch immer schuldig. Die Szene, die zwischen ihr und ihrem Chef folgte, begann mit ihrer Entschuldigung, aber sie hat sie überraschenderweise mit weiteren Anklagen fortgesetzt. Sie erreichten schließlich eine solche Schärfe, dass sie aus ihrem Beruf entlassen wurde. Ein ähnlicher psychologischer Fall kann mit einem alltäglichen Ereignis im Eheleben beschrieben werden. Ein Ehemann bedauert, dass er die Gefühle seiner Frau bei einer kleinen Meinungsverschiedenheit, die mit einer Diskussion über unbedeutende Dinge begonnen hat, verletzt hat. Je mehr er Reue empfand, desto drängender wird sein Wunsch, sich zu versöhnen und zuzugeben, dass er ungerecht und rücksichtslos gewesen war. Mit dieser Absicht beginnt er sich bei ihr zu entschuldigen, aber als er über seine eigene Ungerechtigkeit spricht, beginnt er ihre Haltung zu kritisieren und sie zu beschuldigen, bis er wieder mitten in einer Erörterung ist, diesmal schlimmer als die andere, für die er sich entschuldigen wollte und eine, in der er die Gefühle seiner Frau mehr als vorher verletzt. Der emotionale Prozess ist in diesen Fällen mit einem heftigen Kampf zu vergleichen, in dem sich manchmal die überlegene Kraft einer Partei durchsetzt, gefolgt von einer überraschenden Anstrengung der anderen, die erfolgreich das Seil auf ihre Seite zieht. Der Einwand, den man hier erheben kann, ist natürlich, dass ein solcher Wettkampf zwischen Schuldgefühl und Trieben auch auf dem Gebiet der Sexualität normal ist und häufig zum Ergebnis hat, dass die sexuellen Wünsche gerade nach einer höchsten Anstrengung der unterdrückenden Kräfte überraschend die Oberhand gewinnen. Rodins Bild der Versuchung des Hl. Antonius zeigt eine ähnliche Situation der Wiederkehr des Unterdrückten: Der Heilige, der von sündhaften sexuellen Phantasien überwältigt ist, findet seine Zuflucht in reuevollen Gebeten, während er am Fuß eines riesigen Kruzifixes betet. An der Stelle, an der der Erlöser mit ausgestreckten Armen hängt, erscheint die Vision einer nackten Frau.
Aber das Argument, dass solche Beispiele einer plötzlichen überwältigenden Unterdrückung für die Möglichkeit eines sexuellen Ursprungs der Schuldgefühle sprechen, überzeugt nicht. Die Wiederkehr des Unterdrückten ist die herausfordernde und rebellische Tendenz gegen die Autoritäten, die sexuelle Befriedigung verhindern. Die Kraft, die in jenem heftigen emotionalen Kampf siegreich ist, ist die aggressive Energie, die für den Durchbruch verantwortlich ist. Es gibt andere Beispiele klinischen Materials, die die Vorstellung der Entstehung von Schuldgefühlen aus unterdrückter Aggression bevorzugen. Viele Fälle einer gemischten Bildung wie die Symptome trotzigen Gehorsams und selbstschädigender Auflehnung zeigen offensichtlich, aber nicht immer deutlich den Effekt einer latenten Verbindung von Aggression mit dem Schuldgefühl.
Das letzte und meiner Ansicht nach überzeugendste Argument für die Blutsverwandtschaft von Schuldgefühlen und Aggression und gegen die Hypothese ihrer Entstehung aus anderen instinktiven Quellen ist die Form, in der sich unbewusste Schuldgefühle selbst manifestieren. Eines der interessantesten und verwirrendsten Zeichen ist ein unbewusstes Bedürfnis nach Bestrafung, die Mittel findet, sich selbst in Akten von Selbstschädigung, Selbstsabotage und Selbstvereitelung auszudrücken. Es sieht so aus, als ob dieses Bedürfnis nach Selbstbestrafung die vollziehende Gewalt und Vertreter des stummen Schuldgefühls wären. Da mein Buch „Geständniszwang und Strafbedürfnis“, das 1926 veröffentlicht worden ist, nicht ins Englische übersetzt ist, möchte ich hier darauf hinweisen, dass ich bei der Behandlung des unbewussten Bedürfnisses nach Bestrafung, das der charakteristischste Ausdruck des Schuldgefühls ist, auf derselben Spur wie Freud gewesen war, vier Jahre vor Freud. Auf Seite 84 behauptete ich, dass sich „im unbewussten Strafbedürfnis, das vom Über-Ich ausgeht, eine der gewaltigsten, schicksalsformenden Mächte des Menschenlebens überhaupt erkennen lässt“. Es bereitet mir Genugtuung, dass Freud diesen Beitrag in seinem Buch „Hemmung, Symptom und Angst“16, anerkannte und ihn in seinem Brief vom 13. Januar 1925 “etwas besonders Gutes” nannte.
Warum traten wir in diese ausführliche Diskussion von Freuds neuen Gedanken ein? Wir erinnern den Leser daran, dass das Schuldgefühl dem alten Meister „als das bedeutendste Problem unserer Kultur“ erschienen ist. Wenn Freuds Behauptung richtig ist, ist dies dann nicht für den Fortschritt in der Zivilisation und für die menschliche Situation heute und morgen von größter Bedeutung? Und ist seine Feststellung, dass dieser Fortschritt „bezahlt wird mit Einbußen von Glück durch die Erhöhung von Schuld“ nicht von größtem Interesse für jeden von uns? Wenn wir Freuds Behauptung vertrauen, müssten wir individuelles Glück als das Opfer betrachten, das die menschliche Evolution von uns verlangt. Das Glück würde in einer Schlacht die Rolle einer vermissten Person spielen. Niemand weiß, wo es ist und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir es schließlich in dem Krieg, den die Zivilisation gegen die instinktiven Triebe führt, auf die Verlustliste setzen müssen. Kann uns Freuds bestimmte Prophezeiung über die Zukunft der Zivilisation unberührt lassen? Er erklärte, dass die Zivilisation ihr Ziel nur durch Schüren eines anwachsenden Schuldgefühls erreichen kann. Diese Verstärkung ist unvermeidlich mit der Entwicklung der Zivilisation verbunden und kann zu einer Stärke anschwellen, die kaum zu ertragen ist.