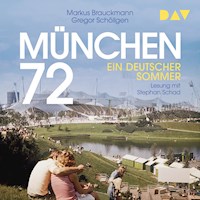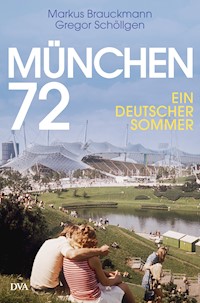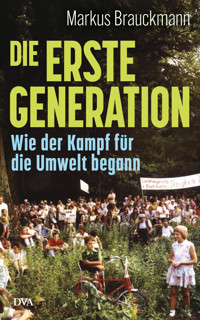
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Frische Luft, klares Wasser, ein gesunder Wald – wie die Deutschen begannen, für ihre Umwelt zu kämpfen
Platz 6 der WELT-Sachbuch-Bestenliste im Mai 2025!
Sie waren die Generation, die Greenpeace und Robin Wood gründete, die gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens demonstrierte, die auf die Vergiftung des Rheins aufmerksam machte. Ganz normale Bürgerinnen und Bürger begannen in den siebziger und achtziger Jahren, sich für die Natur einzusetzen. Aus diesen oft lokalen Initiativen wurde eine mächtige Bewegung, die unser Land, unsere Politik und unsere Umwelt für immer verändern sollte.
Etliche Schauplätze dieser Kämpfe klingen heute noch vertraut: Wyhl, Kalkar, die Startbahn West, Wackersdorf. Doch die Geschichten dieser Umweltpioniere in West und Ost hat Markus Brauckmann für sein packend erzähltes Buch nun erstmals recherchiert. Er erzählt von den kreativen Protestaktionen der ersten Stunde, von Gemeinschaft, Liebe und Verantwortung. Sein Buch zeigt, was Menschen mit Mut und Leidenschaft bewegen können und wie es möglich ist, die Politik zum Handeln zu zwingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frische Luft, klares Wasser, ein gesunder Wald – wie die Deutschen begannen, für ihre Umwelt zu kämpfen
Sie waren die Generation, die Greenpeace und Robin Wood gründete, die gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens demonstrierte, die auf die Vergiftung des Rheins aufmerksam machte. Ganz normale Bürgerinnen und Bürger begannen in den siebziger und achtziger Jahren, sich für die Natur einzusetzen. Aus diesen oft lokalen Initiativen wurde eine mächtige Bewegung, die unser Land, unsere Politik und unsere Umwelt für immer verändern sollte.
Etliche Schauplätze dieser Kämpfe klingen heute noch vertraut: Wyhl, Kalkar, die Startbahn West, Wackersdorf. Doch die Geschichten dieser Umweltpioniere in West und Ost hat Markus Brauckmann für sein packend erzähltes Buch nun erstmals recherchiert. Er erzählt von den kreativen Protestaktionen der ersten Stunde, von Gemeinschaft, Liebe und Verantwortung. Sein Buch zeigt, was Menschen mit Mut und Leidenschaft bewegen können und wie es möglich ist, die Politik zum Handeln zu zwingen.
Markus Brauckmann, Jahrgang 1968, ist Autor und Regisseur. Nach Studien in Berlin und den USA arbeitete der Politologe für verschiedene Fernsehsender sowie in mehreren Bundestagswahlkämpfen. Seine TV-Dokumentationen wurden im In- und Ausland mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, 2016 gewann er die »Romy« für einen Film über Niki Lauda. 2022 veröffentlichte er, gemeinsam mit Gregor Schöllgen, das Buch München 72: Ein deutscher Sommer (DVA). Markus Brauckmann lebt in Köln.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Markus Brauckmann
DIE ERSTE GENERATION
Wie der Kampf für die Umwelt begann
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Bildredaktion: Blaublut Edition
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildungen: © Leo Horlacher / Archiv Soziale Bewegungen e.V., Freiburg im Breisgau (Vorderseite); © Stiftung Günter Zint (Rückseite)
Satz: satz-bau Leingärtner
ISBN 978-3-641-32229-8V002
www.dva.de
Inhalt
EinleitungSimone & Ernst
Berlin 2023
Kapitel 1:Bernd & Irmgard
Wyhl 1971 – 1976
Kapitel 2:Marie-Luise & Horst
Ruhrgebiet 1973
Kapitel 3:Walter & Dora
Boxberg 1978 – 1987
Kapitel 4:Martin & Moby
Der Rhein 1980
Kapitel 5:Monika & Harald
Nordenham 1980 – 1981
Kapitel 6:Christa & Marieluise
Bonn 1983
Kapitel 7:Erdmann & Karl
Hamburg / Berlin 1983 – 1984
Kapitel 8:Ursula & Josef
Kalkar-Hönnepel 1985 – 1986
Kapitel 9:Irmtraud & Udo
Antarktis / Franken 1985 – 1987
Kapitel 10:Wolfgang & Arthur & Hans & Wolfgang
Wackersdorf 1986
Kapitel 11:Christian & Christine
DDR 1987
Kapitel 12:Klaus & Justitia
Startbahn West 2024
Anmerkungen & Quellen
Bildnachweis
Register
Einleitung Simone & Ernst
Berlin 2023
Berlin, ein Morgen im Frühjahr 2023. Draußen ist es kühl und grau, drinnen im Café dampfen die heißen Getränke in bunten Tassen. Aus der Ferne weht der Sound der Metropole herüber, aufgeregtes Hupen und manchmal Martinshörner. Die Nachrichten sind wieder voll von der Letzten Generation. Von ihren Protesten, von den Sitzblockaden, vom Festkleben – aber mehr noch vom Zorn der Bürger über diese Taten. Die Reaktion scheint inzwischen größer als die Aktion. Da sagt die Freundin, die ich zum Kaffee treffe, über ihr Smartphone hinweg: »Mein Opa hat schon vor fünfzig Jahren für die Umwelt demonstriert.«
Simone, die ich schon ein halbes Leben kenne, erzählt mir von ihrem Großvater Ernst aus dem Südwesten Deutschlands. Heute würde man ihn einen Aktivisten nennen. Damals kämpfte er mit Zehntausenden in seiner Heimat am Kaiserstuhl gegen die Zerstörung der Natur und den Bau eines Atomkraftwerks. Sie warfen alles in die Waagschale, was sie hatten: ihre Energie und Leidenschaft, ihren Sinn für Recht und Ordnung, ihre Furchtlosigkeit und die Überzeugung, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Simones Opa schrieb seinerzeit sogar Lieder, mit denen er die Demonstranten unterstützte – und die zur Folklore des Protests gehörten, so wie Plakate, Banner und gereimte Slogans, die auf Kundgebungen skandiert wurden. Auf einmal steht in diesem Café in der Hauptstadt die Frage im Raum: Sag mal, wenn wir heute dauernd von der Letzten Generation hören – gab es eigentlich auch eine »Erste Generation«, mit der die Proteste um Umwelt und Natur begannen?
Dieses Buch ist die Suche nach der Antwort. Simones Eltern – der Sohn und die Schwiegertochter des inzwischen verstorbenen Ernst Schillinger – waren die ersten Gesprächspartner bei der Recherche. Ihnen folgten Dutzende weitere: Erzieherinnen und Bäcker, Elektriker und Hausfrauen, Krankenpfleger und Diplom-Ingenieurinnen. Aus Dörfern und Städten, aus allen Himmelsrichtungen, inklusive dem Osten des einst geteilten Deutschlands. Eine grüne Revolution aus der Mitte der Gesellschaft, getragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich in ihrer überwiegenden Mehrzahl den klischeebehafteten Labeln »Chaoten« und »Störer« entzogen. Die sich erstmals in ihrem Leben gegen den Staat stellten. Die Verantwortung übernahmen. Die häufig ihre Freizeit und manchmal sogar ihren Ruf opferten. Beschimpft von den Gegnern in Politik, Wirtschaft, Industrie und einigen Medien als »Radikale« und »Spinner«. Auf den Straßen des Heimatortes nicht einmal mehr gegrüßt von denen, die auf der anderen Seite standen.
Die Recherchereisen zu den Umwelt- und Naturschützerinnen führten zumeist in die deutsche Provinz. Es gibt Gemeinden, deren Vorwahl länger als die Telefonnummer ist. In ihren Wohnzimmern und Küchen und Arbeitszimmern haben sich die Aktivisten viel Zeit genommen, um ihre persönliche Geschichte und Geschichten zu erzählen. Erlebnisse, die sich zu geteilten Erfahrungen verdichteten. Gerne bei starkem Kaffee und Apfelkuchen.
50 dieser mehrstündigen Interviews habe ich im ganzen Land geführt. Und so hört man in diesem Buch vornehmlich den Originalton derer, die dabei waren. Ihre Biografien, Beweggründe und Konflikte sind der Öko-Treibstoff, der diese Erzählung voranbringt. Packendes und Persönliches bilden die höchst subjektiven Auswahlkriterien für die Hauptfiguren dieser Popgeschichte – im Gegensatz zu einer historisch-akademischen Darstellung der bundesdeutschen Umweltbewegung in Gänze, von der abgesehen wurde.
Etliche dieser Natur- und Umweltschützer entstammen (in Westdeutschland) der Generation der sogenannten »Boomer«, also den zwischen 1946 und 1965 geborenen Nachkriegsdeutschen. Ihnen wird häufig vorgeworfen, den Aktivisten der Gegenwart, die ihre Enkel sein könnten, eine Krise riesigen Ausmaßes hinterlassen zu haben. Der Autor Tillmann Prüfer hat die Anklage im Zeit Magazin pointiert so beschrieben: »Sie hätten, so der Vorwurf, in Saus und Braus gelebt, hemmungslos Ressourcen verbraucht und massenhaft Kohlendioxid fabriziert.«
Womöglich ist diese Generation eine verkannte: Denn aus ihrer Mitte kamen die Frauen und Männer, die im Kampf für die Umwelt seinerzeit Demokratie und Partizipation, Transparenz und das Recht einforderten, Widerstand gegen das drohende Unheil zu leisten. Und die am Ende vielleicht auf der richtigen Seite der Geschichte standen – ohne dass ihnen jemals dafür ein Dankeschön zuteilwurde. Sie bilden die Erste Generation, wie sie in diesem Buch durchgängig und ohne Anführungszeichen genannt wird.
Der Startpunkt der Bewegung liegt Anfang der siebziger Jahre. Ein paar Schnappschüsse aus jener Zeit: Das europäische Naturschutzjahr wird ausgerichtet, der erste »Earth Day« gefeiert, Greenpeace gegründet, der Spiegel packt das Thema »Vergiftete Umwelt« auf das Cover, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kritisiert Horst Stern bildgewaltig Wald- und Naturschäden, in Stockholm findet die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen statt, der Bericht des Club of Rome erscheint mit dem warnenden Titel Grenzen des Wachstums, und die »Gruppe Ökologie« präsentiert ihr einflussreiches Ökologisches Manifest. Überall in der Bundesrepublik engagieren sich Menschen in Bürgerinitiativen – mal gegen den Autobahnausbau, mal für saubere Luft, mal gegen ein Kraftwerk –, bis es 1972 so viele werden, dass eine Dachorganisation mit einem sehr deutschen Namen gegründet wird: Bundesverband der Bürgerinitiativen Umweltschutz, kurz: BBU.
Der Begriff »Umwelt« existiert zu dieser Zeit in der heute geläufigen Bedeutung erst ein paar Jahre. Erfunden haben ihn nicht Naturfreunde, sondern ein Bürokrat namens Peter Menke-Glückert in der Hauptstadt Bonn. Nach dem US-Vorbild des environment schlägt der Mann im November 1969 dem neuen Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) die deutschsprachige Bezeichnung vor – als Sammelbegriff für die im Hause gebündelten »grünen« Kompetenzen. Einen Bundesumweltminister gibt es seinerzeit nicht, das Amt wird erst 1986 in Reaktion auf die nukleare Katastrophe von Tschernobyl geschaffen.
Übrigens: Die DDR hob bereits 1972 ein Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft aus der Taufe. Knapp zwei Jahrzehnte später, nach den für die Öko-Bewegung prägenden Dekaden der Siebziger und Achtziger, endet mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 der Erzählzeitraum dieses Buches.
Die Frauen und Männer der Ersten Generation waren selbstverständlich nicht die allerersten, die sich auf deutschem Boden für die Natur einsetzten. Aber sie gingen in die Geschichte als Pioniere ein, die sich nicht scheuten, für ihre grünen Ziele die Autorität des Staates und die imposante Macht von Industrie und Wirtschaft herauszufordern. Vieles davon hatte man im Naturschutz in dieser Kombination so noch nicht erlebt: die Konfrontation mit der Obrigkeit; die bis dato unbekannte Vehemenz der Auseinandersetzungen; die vernetzte Organisation der Umweltschützer; die effektiv betriebene Kommunikation; das kraftvolle Narrativ von David gegen Goliath; das erworbene Wissen, um mit den offiziellen Experten mitzuhalten; die massenhafte Mobilisierung vor Ort und das Suchen nach innovativen Lösungen. Und natürlich die kreativen und zornigen und ungewöhnlichen Protestformen – von der mittelalterlichen Wagenburg über das Erklimmen von Schornsteinen bis zum gecharterten Schiff, das mit Jugendlichen und einem Labor an Bord den Rhein hochfährt.
Wenn sich auch diese Opposition nicht gegen ein totalitäres Unrechtsregime wie die Nazi-Diktatur richtete, taucht der Begriff des »Widerstands« in vielen Erzählungen der siebziger und achtziger Jahre immer wieder auf. Er ist Teil der hier vorliegenden »Oral History« und gehört zu den persönlichen Erinnerungen an die ausgefochtenen Kämpfe gegen scheinbar übermächtige Gegner. Folglich wird der Ausdruck im Sinne der Protagonisten in diesem Buch entsprechend benutzt.
Das Engagement gegen Atomkraft darf getrost zu den Aktivitäten dieser Ersten Generation gezählt werden, auch wenn die Gefahr unsichtbar war und das Risiko hypothetisch erschien. Eine Versündigung an der Schöpfung stellte sie in den Augen von Aktivisten allemal dar. Im vorliegenden Buch werden hierzu beispielhaft Geschichten von drei Schauplätzen erzählt: Wyhl, weil es am Anfang stand und den Widerstand an weiteren Standorten nachhaltig prägte. Kalkar, weil die Story des örtlichen Anführers Josef Maas zeigte, wie hoch der persönliche Preis für den Protest bisweilen ausfiel. Und Wackersdorf, weil dort im Sinne der grünen Sache ein einmaliges »deutsches Woodstock« der einheimischen Rockmusik stattfand. Vor dem Hintergrund dieser Auswahl wird auf eine weitere dezidierte Behandlung von Brokdorf, Gorleben, Grohnde und anderen bekannten Namen in eigenen Kapiteln verzichtet. Stattdessen fließen die dort gemachten Erfahrungen kontinuierlich in den Text ein.
Der Kampf der Umwelt- und Naturschützerinnen in den siebziger und achtziger Jahren ist mal Drama und Dokumentation, mal True Crime und Tragödie, mal Klamauk und Krawall, ja sogar bisweilen: Farce. Mit spektakulären Stunts, legendären Locations, rasanten Wendungen und Storys, die nicht immer gut ausgehen. Und mit einer ganz besonderen Besetzung, die niemand je für eine Hauptrolle auf der deutschen Bühne vorgesehen hatte: den Heldinnen und Helden des Alltags.
Der Ersten Generation.
Sie sind die Pioniere des Protests: die Frauen und Männer, die in Wyhl am Kaiserstuhl gegen den Bau eines Kernkraftwerkwerks kämpfen. »Wir waren die Ersten«, sagt Irmgard Schneider, eine von ihnen. Aus der Mitte der Gesellschaft entspringt im Südwesten die Quelle des Konflikts, der das Land auf Jahre prägt: Bürgerinnen und Bürger gegen die Obrigkeit – im Ringen um Umwelt und Natur.
Kapitel 1: Bernd & Irmgard
Wyhl 1971 – 1976
Die jungen Leute aus der Gegend sind Kinder des Wirtschaftswunders. Von Aufschwung und Wohlstand, von Maß und Mitte. Sie stammen aus dem Südwesten Deutschlands, einem konservativen Landstrich. Zweimal hintereinander hat in ihrem Bundesland Baden-Württemberg die CDU in den siebziger Jahren absolute Mehrheiten geholt. Und die meisten Älteren unter den rechtschaffenen Menschen, die sich an diesem Abend im Oktober 1976 hier in der Provinz versammeln, dürften vermutlich einst Konrad Adenauer gewählt haben, der »Keine Experimente« versprach. Woanders im Land mögen linke Aufrührer in den Sechzigern versucht haben, die Welt aus den Angeln zu heben – in Südbaden ist diese Welt noch in Ordnung.
Randale und Chaos sind den Einheimischen gemeinhin fremd. Revolutionäre Konzepte von Kommunen, freier Liebe und neuem Bewusstsein kennt man auf den Dörfern bestenfalls vom Hörensagen. Man befindet sich schließlich am Kaiserstuhl – und nicht in Kreuzberg. Hier besetzt man keine Häuser, man besitzt sie. Die Frauen und Männer, die hier vor einer Dorfgaststätte zusammengekommen sind, würde man als Leistungsträger der Gesellschaft bezeichnen, aber das Wort wird im Jahr 1976 kaum benutzt. Leute, die morgens früh aufstehen, um tagsüber ihren Beitrag zur Erfolgsstory der Bundesrepublik zu leisten. Fleißig und ordentlich, gesetzestreu und bürgerlich. Eine Mehrheit, die eher schweigt als herumschreit. Demokratie und Rechtsstaat genießen höchstes Ansehen.
Jetzt umringen die Menschen ihren Ministerpräsidenten, der aus Stuttgart in einer imposanten Karosse zu ihnen aufs Dorf gefahren wurde. Das scheint zunächst ins vertraute Bild zu passen. Doktor Hans Filbinger von der CDU nimmt heute eine seiner sogenannten Landesbereisungen vor, »die eher fürstlichen Inspektionsreisen als demokratischen Informationsveranstaltungen« ähneln, spottet die Zeit.
Seine Agenda richtet sich nach den ländlichen Gegebenheiten. Nach einem Besuch der Fachschule Hochburg, wo man ihm Wein, Kirschen und Nüsse reicht, nach dem feierlich verkündeten Landeszuschuss in Höhe von 255 000 Mark zur neuen Ortsdurchfahrt Nimburg sowie der anschließenden Besichtigung der Ruine Hochburg, ist der Regierungschef in Kiechlingsbergen angekommen, einer kleinen Gemeinde am Kaiserstuhl, unweit der Grenze zu Frankreich. 1970 zählte man hier exakt 853 Einwohner. Auf Filbingers Programm steht an diesem Freitag ein Gespräch zur Energiepolitik in der Gaststätte Stube. Es soll der vorletzte Termin der Reise sein.
Irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr öffnet sich die Tür des Lokals. Zuerst kommen Sicherheitsbeamte und Funktionäre heraus, dann ertönt ein Ruf: »D’r künnt, d’r künnt!« Der Ministerpräsident tritt vor sein Volk. Hunderte erwarten ihn. Unter ihnen: der Bäcker Bernd Nössler und die Erzieherin Irmgard Schneider, beide 23 Jahre alt.
Und dann geht es los.
Die Bürger schimpfen und schreien, brüllen und bedrängen den Ministerpräsidenten. Filbinger kann weder vor noch zurück. Die Polizei schätzt die aufgebrachte Menge auf 200 bis 400 Menschen, die Demonstranten gehen von bis zu 1 000 Leuten aus. Jemand hält ein Transparent hoch: »Stuttgarts Argumente«, symbolisiert durch einen Teppichklopfer, mit dem früher Kindern der Hintern versohlt wurde. Es ist höllisch laut, weil die Menschen ihre Wut herausbrüllen: »Kein Atomkraftwerk in Wyhl«. »Wir sind keini Radikali«, »Dräckschmurli«. Und mit feiner Ironie: »Wir wollen unseren Führer sehen«. Irmgard Schneider hört, wie ältere Leute »Nazi, Nazi« skandieren. Alle stehen so dicht beieinander, dass sich an den Füßen der jungen Frau blaue Flecke bilden. Bernd Nössler spürt, dass die brodelnde Masse wie beim Schunkeln in Wallung gerät. Immer wieder ertönen Donnerschläge, die die Winzer der Gegend sonst zur Vertreibung der Vögel in den Rebbergen einsetzen.
Währenddessen wird Hans Filbinger »in der Menge völlig eingekeilt und gewissermaßen in Wellenbewegungen hin und her geschoben«, so seine persönliche Beschreibung im Nachgang. Die Manschettenknöpfe werden ihm abgerissen, er wird mit Trauben beworfen. Die Situation verschärft sich von Minute zu Minute. Von »Schlägereien« berichtet die Badische Zeitung nachher. Am Hemd eines Mannes aus dem Umfeld des Ministerpräsidenten sieht jemand angeblich Blut. Ein anderer will beobachtet haben, dass ein Unbekannter mit einem Metermaß auf Filbinger einschlägt. Obwohl der Dienstwagen nur 30, 40 Meter entfernt parkt, kann der Ministerpräsident ihn nicht erreichen. Nicht nach zehn, nicht nach 15 und auch nicht nach 25 Minuten. Fast erdrückt wird er, so ein Reporter. Die Bürger, die ihn einkesseln, haben die Oberhand. »Hochbrisant« sei die Situation, findet Nössler, auf keinen Fall dürfe sie weiter eskalieren.
Er beschließt, etwas zu tun.
Die Nacht von Kiechlingsbergen ist eine Zäsur. Eine Situation, wie sie noch kein konservativer Ministerpräsident der Nachkriegsrepublik erleben musste. Ein Dammbruch aus Sicht des politischen Establishments. Eine Rebellion, wie sie ein Mann von Filbingers Profil eher von langhaarigen Rädelsführern erwartet hätte. Aber nicht von seinen badischen Schäfchen, die heute Abend fast zu Wölfen werden – getrieben von einer Mischung aus Mut und Wut.
Vielleicht stellt sich der CDU-Mann dieselbe Frage wie mancher Beobachter der ungewöhnlichen Szenerie: Was sind das für Leute? Was treibt sie an? Welchen Wandel und Weg haben sie hinter sich – von der Kindheit am Kaiserstuhl bis zum Krawall von Kiechlingsbergen?
* * *
Bernd Nössler will das Gymnasium besuchen und nach dem Abitur Theologie studieren. Doch in den sechziger Jahren ist die große Freiheit noch nicht im kleinen Wyhl angekommen. Die Selbstbestimmung muss zurückstehen hinter der Tradition: Die Familie besitzt eine Bäckerei in der Rheinstraße. Fast alles dreht sich um das Geschäft, »da war man schon als Kind früh eingespannt und hat mitgeholfen«. Gleichzeitig wird man auf diese Weise auch fest in das Dorfleben eingebettet. Zu Nösslers in den Laden kommen sie alle.
Die Gegend ist konservativ geprägt, Vereine und Feste sind von Bedeutung, den Alten bringt man Ehrfurcht entgegen. »Die Großeltern haben am Küchentisch mitbestimmt«, erinnert sich Bernd. Und so siegt auch im Hause Nössler die Familientradition über die ursprünglichen Lebenspläne des Jungen: Bernd erlernt den Bäckerberuf. »Aus Respekt vor den Generationen vor mir«, sagt Nössler feierlich im Interview für dieses Buch. »Ich habe es akzeptiert.«
Auch wenn die klischeebehaftete Losung vom »Schaffe, schaffe« aus dem schwäbischen Teil des Bindestrich-Bundeslandes Baden-Württemberg stammt, trifft sie auf die badische Familie Nössler zu. Der Arbeitstag in der Bäckerei hat in der Regel zwölf bis 14 Stunden. Freitagabends singt Bernd im Chor, da bleiben später nur wenige Stunden Schlaf bis zum Samstag. Am Wochenende wird den Wyhlern die Spezialität des Hauses angeboten: ein Flachgebäck namens »Granatsplitter«, mit ganz viel Rosinen. Für zehn Pfennig greifen die Kunden gerne zu, die Köstlichkeit schmeckt besser als massenproduzierte Schokoriegel.
Als Ausgleich zum Schuften in der Backstube engagiert sich Bernd in der katholischen Jugendarbeit. Politisch ordnet er sich damals als »sehr bürgerlich« ein, aber Raum für »linke Dinge« bleibt auch: Er verfolgt aufmerksam das Wirken von Befreiungsbewegungen, »kleine und größere Revolutionen«, wie er das nennt, zum Beispiel in Südamerika, er leistet Unterschriften für Solidaritätsaktionen und betreut viele Dritte-Welt-Projekte der Kolping-Jugendarbeit. Seit er 16 Jahre alt ist, liest Bernd regelmäßig den Spiegel und Bild der Wissenschaft. »Ich war von der Wissenschaft fasziniert und vertrat ursprünglich die Meinung, jeder kann sich ein kleines Kernkraftwerk in seinem Haus bauen.«
Diese Begeisterung wird sich bald legen. Und sein Heimatort, das kleine Wyhl mit seinen 2700 Einwohnern, weit über seine Grenzen bekannt werden.
* * *
Als der Herrgott hat die Welt erdacht, / Hat er zuerst den Kaiserstuhl gemacht, heißt es in einem regionalen Gedicht. Alles in höchster Vollendung, mit allen Raffinessen, / Denn wahrlich, hier blieb wirklich nichts vergessen.
Nicht nur die Einheimischen preisen ihre Gegend mit blumigen Worten, auch die Berichterstatter aus dem fernen Hamburg sind bei ihren Besuchen vor Ort entzückt von der Schönheit der Landschaft. »Mittelmeerländische Gefilde« sieht der Reporter des Spiegel, und als das für seinen Enthusiasmus nicht mehr ausreicht, steigert er sich innerhalb weniger Zeilen desselben Artikels zu »paradiesischen Gefilden«. Sein Kollege vom Stern berichtet im Superlativ vom »sonnigsten Flecken Baden-Württembergs«.
Seit Jahrhunderten bauen die Menschen im äußersten Südwesten Deutschlands Wein an. Fast jeder hier bewirtschaftet in den siebziger Jahren – im Hauptberuf oder als Nebenerwerb – »ein Stück Reben«, erzählt Irmgard Schneider, natürlich auch ihre eigene Familie und die Nösslers. Der Kaiserstuhl bietet beste Bedingungen: Die Temperaturen in dem trockenen und heißen Klima erreichen nach den überschwänglichen Angaben einer örtlichen Publikation »bis zu 50 Grad Celsius« (die sich freilich in keiner Wetteraufzeichnung finden). Als Hauptsorten werden Silvaner, Müller-Thurgau, Ruländer und Spätburgunder angepflanzt. Es gibt nur wenige Orte in der Bundesrepublik, die mehr Sonnentage haben als Wyhl und seine Nachbargemeinden. Einen Steinwurf entfernt plätschert der Rhein friedlich vor sich hin. Großindustrie oder rauchende Schornsteine sind weit und breit nicht zu sehen. Wahrscheinlich hat der Mann vom Spiegel recht.
Die Frage klingt rhetorisch: Wer würde auf die Idee kommen, diese idyllische Natur mit einem riesigen Atomkraftwerk zu verschandeln?
Die Antwort ist ein Fakt: die Landesregierung von Baden-Württemberg und der teils staatliche Energieversorger Badenwerk AG. Und nicht irgendein Atomkraftwerk – sondern mutmaßlich eines der größten auf der Welt. Zwischen Rhein und Reben soll im Norden des nahe gelegenen Ortes Breisach ein Kernkraftwerk mit vier Reaktorblöcken und insgesamt 5200 Megawatt Leistung gebaut werden. Anfang Juni 1971 stellt das Badenwerk den Antrag bei der zuständigen Genehmigungsbehörde des Landes.
Es soll der Startschuss für viel mehr sein: Eine ganze Perlenkette von Reaktoren soll am Oberrhein entstehen. Die Planer haben Großes vor – und machen daraus kein Geheimnis. Im offiziellen Staatsanzeiger von Baden-Württemberg kann man Anfang der siebziger Jahre nachlesen: »Rückt nämlich die EWG [Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Vorläufer der EU] noch näher zusammen, was allgemein erwartet wird, so wird das Rheintal zwischen Frankfurt und Basel die Wirtschaftsachse überhaupt werden. Ob dann noch Platz für Umweltschutz ist, muss bezweifelt werden. Sachverständige Leute sind deshalb der Ansicht, die Ebene sollte für die gewerbliche und industrielle Nutzung freigegeben werden.« Übersetzt bedeutet dies: Die örtliche Natur und die lokale Lebensart sind gleichermaßen in Gefahr. Am Kaiserstuhl fällt erstmals das hässliche R-Wort: Ein zweites Ruhrgebiet solle der Oberrhein werden – angetrieben vom Strom der Kernkraftwerke.
Vom designierten Standort Breisach nach Wyhl sind es keine 20 Kilometer. Bernd Nössler legt die Zeitschrift Bild der Wissenschaft zur Seite und kauft sich in der Universitätsstadt Freiburg Bücher über Strahlenwirkung und die Erfahrungen mit Atomkraftwerken in den USA. Das Thema beginnt die Menschen vor Ort umzutreiben. Aus einer eher abstrakten Angelegenheit wird eine persönliche. Meinrad Schwörer, ein Freund der Nösslers, kommt in die Backstube und fragt: »Hast du das mitbekommen? Die planen jetzt ein Atomkraftwerk in Breisach.« Gerüchte und Nachrichten wandern von Mund zu Ohr zu Mund. Schwörer hat schon vor der offiziellen Bekanntgabe von den Plänen gehört. Ein Angler, in Sorge um die Fische, hat es ihm geflüstert. Jetzt packt er ein Bündel Flugblätter der Initiative »Oberrheinisches Komitee« auf die Ladentheke des Bäckers. »Und dann war ich einer der vier Mitglieder in diesem Komitee, das damals in unserem Dorf tätig war«, sagt Bernd Nössler, mit einem Mal örtlicher Aktivist der ersten Stunde.
Der Umweltschutz-Neuling läuft mit Unterschriftenlisten gegen das AKW durch das Dorf. Er ist zu diesem Zeitpunkt 17, vielleicht 18 Jahre alt. Damit ist man in der Bundesrepublik der frühen siebziger Jahre nicht einmal volljährig. An den Haustüren macht der junge Mann »interessante Erfahrungen«, wie er es im Interview nennt. Die meisten Dorfbewohner hätten zurückhaltend reagiert, insbesondere die Frauen. »Das soll besser der Mann entscheiden, haben sie mir gesagt«, erinnert sich Nössler. »Sie haben sich nicht getraut.« Aufhalten kann das sein Engagement nicht: Sogar in Diskotheken spricht er Leute auf das Thema an. Man könne das doch nicht alles hinnehmen, sagt er den Tanzenden.
Sein Aha-Moment, wie er es nennt, ist eine Veranstaltung im Winzerkeller in Oberrotweil. Der Raum ist überfüllt, vorne sitzt die »klassische Männerriege, Frauen sind damals noch gar nicht auf dem Podium«, sagt Nössler. Es wird Klartext geredet: über die Risiken, die der Atommeiler birgt, über die eventuellen Auswirkungen auf den Weinbau und die Folgen für das Klima – ausgelöst durch die Dunstwolken aus den riesigen Kühltürmen des geplanten AKW, von denen jeder einzelne höher als das gewaltige Freiburger Münster ist.
Das Örtchen Oberrotweil ist für Bernd ein Stück Heimat. Von hier stammen seine Urgroßeltern und Großeltern, die Familie besitzt Weinflächen. Als Kind hat er hier gespielt, viele schöne Erinnerungen schießen ihm durch den Kopf. »Ich habe gedacht, ich muss das jetzt unterstützen«, sagt er. »Das war der Anstoß, mit Herzblut einzusteigen.« Ist er nun Umwelt- oder Naturschützer? Nössler überlegt. Weder noch, sagt er. Er sei Heimatschützer.
Das Magazin Stern ist in dieser Zeit eine Art Thermometer der Öffentlichkeit. Einmal die Woche messen die Medienmacher aus Hamburg die Temperatur der bundesdeutschen Gesellschaft. Als die Verantwortlichen am Ende des Sommers 1972 den Reporter Peter Born an den Kaiserstuhl entsenden, stellen sie fest, dass die Stimmung vor Ort ziemlich erhitzt ist. Im Stück mit dem Titel »Aufruhr im Weinberg« berichtet der Journalist von der Sorge vor kilometerlangen Nebelschwaden der Kühltürme, die den Wein zerstören, von Protestfahrten mit dem Trecker und sogar von einem älteren Winzer, der sich angeblich müht, Dynamit zu kaufen, um einen Messturm des Badenwerkes in die Luft zu jagen.
Im Mittelpunkt der Kritik der Einheimischen, so vermeldet Born, steht erstaunlicherweise die CDU, sonst eine feste Größe und Autorität in der Region. Selbst Stammwähler würden sich inzwischen abwenden. Er zitiert einen Winzer aus Oberrotweil, naja, er schreibt es auf, so gut das eben mit dem für norddeutsche Ohren ungewohnten Dialekt möglich ist: »Es isch bald Wahl. Jetzt höret mir schöne Wort, ond über Nacht isch des Atomding da und macht onser Gottesländle on die Exischtenz hin.« Dem CDU-Ministerpräsidenten Hans Filbinger, so diktieren die Bürger dem Besucher aus Hamburg in den Notizblock, sei nicht mehr zu trauen. Ein Sprecher der aufgebrachten Weinbauern sagt: »Der Bauherr, die Badenwerk AG, ist eine hundertprozentige Tochter des Landes. Aufsichtsratsvorsitzender ist Doktor Filbinger. Wir bezweifeln daher, dass unsere zahlreichen Einsprüche beim Land etwas nützen.«
Zum unvorteilhaften Bild Filbingers trägt mutmaßlich auch eine aktuelle Story von Borns Konkurrenten beim Spiegel bei. Im Jahr 1972 berichten die Reporter des Hamburger Nachrichtenmagazins, dass Hans Filbinger als Marinestabsrichter noch drei Wochen nach Ende des Zweiten Weltkrieges einen deutschen Soldaten wegen »Gehorsamsverweigerung« und »Widersetzung« vor Gericht verurteilt habe. Der angeklagte Gefreite habe »zersetzend … für die Manneszucht gewirkt«, heißt es im Urteil Filbingers aus dem Frühling 1945. Von aufrichtiger Reue über sein damaliges Verhalten kann auch später in den Nachkriegsjahren kaum die Rede sein. So ein Urteil sei notwendig gewesen, gibt der Ministerpräsident noch Anfang der siebziger Jahre zu Protokoll, »um die Disziplin im Lager zu halten.« Und selbstverständlich sei »seine antinazistische Einstellung bekannt und beglaubigt«. Später wird der Spiegel das ehemalige NSDAP-Mitglied Hans Filbinger mit einer markigen Aussage zitieren, die ihm als Ausdruck fehlenden Unrechtsbewusstseins ausgelegt wird: Was damals rechtens war, das kann heute nicht Unrecht sein.
Das ist der Gegner, mit dem es die Menschen am Kaiserstuhl zu tun haben.
* * *
Im Herbst 1972 hat Bernd Nössler allen Grund zu bester Laune. Das mühsame Klinkenputzen, die Proteste und die vielen Infoveranstaltungen zeigen Wirkung. Mehr als 60 000 Unterschriften haben sie gesammelt – gegen das geplante Kernkraftwerk in Breisach. Das ist im Zeitalter vor dem Internet und Social Media eine respektable Zahl, erst recht in einer ländlichen Gegend, die sonst von satten CDU-Mehrheiten geprägt ist. Ein Chronist der Umweltbewegung schreibt beglückt nieder: »Die Verantwortlichen des Energiekonzerns Badenwerk und die Landesregierung erkannten, dass der Atomkraftwerksstandort Breisach politisch nicht durchsetzbar ist. Zu stark war der Protest der mehrheitlich konservativen Bevölkerung.«
Das ist eine sehr gute Nachricht, der schon bald eine sehr schlechte für Nössler und seine Mitstreiter folgen wird.
Am 19. Juli 1973 wird um 19 Uhr in den Radionachrichten des Südwestfunks bekanntgegeben: Das Kernkraftwerk wird nicht in Breisach gebaut.
Sondern in Wyhl.
Die Bevölkerung hat keiner gefragt.
* * *
Niemand muss der Umweltschützerin Irmgard Schneider die Bedeutung einer intakten Natur nahebringen – das Bewusstsein dafür ist ihr bereits in die Wiege gelegt worden. Irmgard Schneider kommt im Mai 1953 in Endingen als Tochter einer Bauernfamilie zur Welt, etwa fünf Kilometer von Wyhl entfernt. »Wir hatten einen Hof mit Tieren, Obst, Ackerbau. Am Kaiserstuhl wächst ja alles. Da sind wir reich gesegnet«, erzählt sie im Interview für dieses Buch. Von klein auf erlebt sie ganz selbstverständlich, dass Natur nicht nur etwas für eine malerische Aussicht, den Wochenendausflug oder den Urlaub im Grünen ist. »Sie spielt im Alltag eine große Rolle, wenn man von einem Hof kommt«, sagt Irmgard. Das Kind eines Landwirts erlebt in der Praxis aus nächster Nähe, wenn ein Unwetter die Existenz bedroht und die Ernte verhagelt wird oder erfriert. Landschaft, Natur und die Heimat seien untrennbar miteinander verbunden. »Das sind die Wurzeln, das prägt einen schon sehr.«
Zusätzlich betreibt die Familie die kleine Gastwirtschaft Zum Ochsen. Nur Getränke, keine Speisen. Irmgard erlebt, dass Leute aus Italien kommen, erst Gastarbeiter, dann Touristen. Sie tragen exotische Vornamen wie Francesco. Später trifft sie auch Spanier und Türken. Eine neue Welt öffnet sich. »Das hat mich neugierig gemacht«, sagt Schneider. Ihre Eltern heißen die Menschen herzlich willkommen und »haben keinerlei Berührungsängste«. Auch die Tochter wird ein Leben lang offen sein, Vorurteile vermeiden und sich selbst ein persönliches Bild von den Leuten und den Dingen machen.
Als sie 15 Jahre alt ist, öffnet sich die Welt ein zweites Mal. Irmgard wechselt auf ein Mädcheninternat nach Freiburg, um die Mittlere Reife zu erlangen. Und weil das Pendeln mit der Kaiserstuhl-Bahn nicht so recht klappt, zieht der Teenager direkt dorthin. Mitten rein in die Breisgau-Metropole, die sich zu Endingen und den Dörfern ungefähr so verhält wie München zu Oberbayern.
Die junge Frau aus der Provinz trägt in der Stadt Jeans, am liebsten kunstvoll geflickte (»Das war modern«) und Schlaghosen. Ihre Lieblingsband sind die Beatles. Sie besucht ein Konzert von Udo Jürgens in der Stadthalle und macht einen Tanzkurs. Ab und zu geht sie zum Fußball – zum damals führenden Verein vor Ort, dem Freiburger FC. Das alles klingt nach Aufbruch. Steht ihr jetzt als Frau in der Bundesrepublik der späten sechziger, frühen siebziger Jahre die Zukunft offen? »Nein«, sagt sie klipp und klar. Dafür sei es noch zu früh gewesen. Zuhause, am Kaiserstuhl, sind die Rollen weiterhin klar verteilt. »Für die Kindererziehung und die Pflege der Alten waren die Frauen zuständig.« Neben der Arbeit in der Landwirtschaft oder den Betrieben, versteht sich.
Ein besonders politischer Mensch ist Irmgard Schneider damals nicht. Klar, sie findet Willy Brandt charismatisch und toll, aber das tun viele in ihrem Alter. Als es in Freiburg zu Demonstrationen gegen die Erhöhung der Straßenbahntarife kommt (Slogan: »Haut dem [Bürgermeister] Keidel auf den Scheitel«) – nimmt sie daran nicht teil. Und Atomenergie? Darüber weiß sie wenig, gibt sie zu, hin und wieder steht etwas über Atomversuche in der Badischen Zeitung, dem Regionalblatt, das in der Gegend die mediale Hoheit besitzt. Es ist alles so weit weg.
Bis es auf einmal gefährlich nahe kommt. Und Irmgard mehr Demokratie wagt.
* * *
An einem Tag im Juli 1973 wird dem Heimatschützer Bernd Nössler vor Augen geführt, gegen wen und was er kämpft. Nicht nur gegen ein Kraftwerk, sondern noch viel, viel mehr: Macht und Geld, Unwissen und Propaganda, Angstmache und Einschüchterung. Und das hat unter anderem mit einem Schwimmbad, einem Teekessel und einigen Schnitzeln zu tun.
In Wyhl findet in diesem Sommer in einer Turnhalle die erste Bürgerversammlung statt. Nur Einwohner des Dorfes dürfen teilnehmen. Die interessierte Bevölkerung der umliegenden Gemeinden Weisweil, Sasbach und Endingen ist ausgeschlossen – ganz so, als würde sie das riesige Atomkraftwerk in der Gegend nichts angehen. Notgedrungen haben sie sich vor den Fenstern des Gebäudes versammelt. Zum Protest trommeln sie gegen die Scheiben – und werden im Gegenzug vom Wyhler Bürgermeister verhöhnt. Sie seien ja nur »neidisch«. Aus dem Publikum ist Gelächter zu hören.
Zum Auftakt des Abends wird die Euphorie um einen billigen Strompreis geschürt. Nössler hört von oben den völlig ernst gemeinten Satz: »Jeder hat das Recht auf das eigene elektrisch beheizte Schwimmbad!« Er bewahrt vorerst die Fassung. Doch was dann folgt, regt ihn wirklich auf: Ein Bild wird gezeigt, zu sehen ist ein dampfender Teekessel, scheinbar fachkundig kommentiert von einem Ingenieur des Badenwerks: »So funktioniert ein Atomkraftwerk. Sehen Sie diesen Teekessel. Da ist ein Deckel drauf und da kommt Dampf raus. Meine Damen und Herren, da kann gar nichts passieren.«
Das sei doch Volksverdummung, grummelt Nössler und fragt sich: Wie kann der Gemeinderat das einfach so akzeptieren? Die Antwort bekommt er, als er seinen Blick in die Runde schweifen lässt: Die Menschen scheinen überwiegend guter Dinge, sie hoffen, dass mit dem AKW viele Arbeitsplätze und noch mehr Steuereinnahmen ins Dorf kommen. Es wird sogar von einem Frei- und Hallenbad, einer Umgehungsstraße sowie einer Mehrzweckhalle geraunt. Wenn Kritiker wie Bernd Nössler in diesen Jahren bei Versammlungen ihren Unmut kundtun und das Wort ergreifen wollen, lässt der Bürgermeister ihnen häufig das Mikrofon abdrehen.
Und die Schnitzel?
Das Badenwerk veranstaltet ab Juli 1973 in hoher zweistelliger Zahl perfekt organisierte Bustouren zu den existierenden KKW-Anlagen in Philippsburg, Biblis und Obrigheim. Offiziell firmieren sie als »Informationsveranstaltungen«, in Wirklichkeit sind sie eine krude Mischung aus »Kaffeefahrten« und manipulativer Imagepflege. Vom Kernkraftwerk selbst bekommen die Teilnehmer wenig zu sehen. Man besichtigt lediglich einige Nebengebäude und schaut sich einen Diavortrag an. Das Wichtigste scheint das Essen zu sein. Ein Teilnehmer erzählt Bernd Nössler freimütig: »Weißt du, ich habe da drei Schnitzel bekommen. Noch nie in meinem Leben habe ich drei Schnitzel umsonst bekommen. Da habe ich gedacht: Die Herren sind so gut zu uns, das müssen wir jetzt unterstützen.«
Die Frage drängt sich auf: Wie will man als David gegen einen Goliath bestehen, der über solche Mittel verfügt? Der Politik und Wirtschaft, Gesetze und Öffentlichkeit massiv beeinflusst, von der Regierung bis zum Gemeinderat? So einen Kampf hat in Deutschland bislang niemand aufgenommen. Sicher: Es gibt Anfang der siebziger Jahre in der Bundesrepublik Hunderte von engagierten Bürgerinitiativen, die Flagge zeigen und sich einmischen wollen. Etwa ein Fünftel, so schätzt man, sind im Umweltschutz aktiv. Aber Wyhl – das ist eine andere Dimension: Bürger, die sich nun Kompetenzen aneignen. Aktivistinnen, die aufklären. Frische Protestformen, mit denen Teile der lokalen Bevölkerung gegen einen bestens organisierten Staatsapparat antreten. Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlicher Milieus werden vereint, von Studentinnen bis Handwerkern, von der Bäuerin bis zum Professor. Eine Kultur von Protestsongs und gestalteten Postern entsteht. Bisher staatstreue Menschen wenden sich gegen die Obrigkeit.
Das alles ist in dieser Kombination völlig neu.
Es ist der erste große Kampf der Ersten Generation von bundesdeutschen Frauen und Männern, die energisch für die Umwelt und die Natur einschreiten. Es gibt keine Vorbilder, denen sie nacheifern können. »Wir waren die Ersten«, sagt Irmgard Schneider, »und das war unser Glück, weil die Politik und Polizei uns nicht richtig einschätzen konnten.«
Am Kaiserstuhl verläuft die Frontlinie in einer Auseinandersetzung, die in der Bundesrepublik so bislang nicht geführt wurde. Hier entspringt die Quelle des Konflikts, der die folgenden Jahrzehnte von Umweltprotesten definiert: engagierte Bürgerinnen und Bürger gegen Staat und Industrie. Eine Blaupause für neue soziale Bewegungen nennt dies später eine Expertin. Es ist der Urknall und das Vorbild für viele, die danach kommen. Ende der siebziger Jahre tragen Demonstranten in Gorleben ein Banner: »Bürger helft Euch selbst. Wyhl – ein Beispiel«. Am Kaiserstuhl, urteilt der Deutschlandfunk, sei ganz konkret der Grundstein für das gelegt worden, was heute als Umweltbewegung gilt.
Alle schauen auf Wyhl – aber in Wyhl schaut Bernd Nössler, der Geschäftsführer der örtlichen Bürgerinitiative, in jenen Tagen eher pessimistisch drein. Obwohl selbst die Weltpresse inzwischen berichtet und der Briefträger häufig Postkarten und Briefe mit ermutigenden Grüßen in die Backstube trägt. Manchmal sind sie lediglich adressiert an: »Die Kämpfer von Wyhl«.
Nössler ist ein Stück weit skeptisch, ob er und seine Mitstreiter die Zerstörung der Heimat wirklich verhindern können. Klar, versuchen will er es, daran lässt er keinen Zweifel. Dafür ist er sogar bereit, weitere persönliche Opfer zu bringen: Vor zwei Wochen hat er Waltraud kennengelernt. Die Romanze ist noch ganz frisch. »Du«, sagt Bernd jetzt zu ihr, »jetzt geht’s mit dem Atomkraftwerk los, da bin ich nicht immer da.« Waltraud nickt und akzeptiert. Sie weiß: Die Auseinandersetzung ist der Dreh- und Angelpunkt in Bernds privatem Leben.
Waltraud, die später Nössler heißen wird, ist nicht die einzige Frau, die Bernd und seine Sache mit ganzem Herzen unterstützt.
* * *
In der Universitätsstadt Freiburg mag eine WG Anfang der siebziger Jahre Studenten-Alltag sein – in Irmgard Schneiders ländlicher Heimat ist das noch etwas ganz Besonderes. Als sie nach der Ausbildung als Erzieherin zurück an den Kaiserstuhl zieht, gründet sie im Dörfchen Amoltern eine Wohngemeinschaft. »Eine der ersten«, lacht sie. In einem alten Haus mit Plumpsklo zieht sie mit Berufskollegen zusammen. Zwei Männer, zwei Frauen. »Wir waren aber nicht verbandelt«, stellt sie klar. So viel Ordnung muss dann doch sein, selbst Jahrzehnte später in der Rückschau.
Zuhause, auf dem Hof der Familie, steht in diesen Tagen ein riesiges Plakat mit der Aufschrift »Wir lassen uns die schöne Heimat nicht zerstören – KKW Nein«. Einer ihrer Brüder engagiert sich inzwischen in der Bürgerinitiative Endingen gegen das Atomkraftwerk Wyhl. Seine Schwester Irmgard folgt ihm wenig später. »Ich war dort eine der jüngsten Frauen.« Sie kleben Plakate, treffen sich zu Versammlungen und verschreiben sich voll und ganz dem Kampf um die Heimat. Nachfrage: Warum ergibt sie sich damals nicht dem Hedonismus und genießt das süße Leben wie andere Gleichaltrige, sondern opfert ihre gesamte Freizeit für ein fast unerreichbares Ziel? »Wir waren jung und hatten viel Energie. Man hat sich immer weiter damit auseinandergesetzt«, sagt Schneider. »Irgendwann hat es einen angefressen.«
Und dann klingelt am Freitag, dem 10. Januar 1975, bei Irmgard das Telefon.
Wie ein Lauffeuer hat sich am Kaiserstuhl herumgesprochen, dass der CDU-Wirtschaftsminister Rudolf Eberle nach Wyhl unterwegs ist. Der Statthalter des Ministerpräsidenten Filbinger kommt in einer Zeit des Zorns: Nach 18 Monaten Protest hat sich bei den AKW-Gegnern gehöriger Unmut angestaut. Mit ihnen spricht die Politik, wenn sie denn überhaupt spricht, nur von oben herab, häufig garniert mit Drohungen und Einschüchterungsversuchen. Die Kommunikation ist frustrierend, die Partizipationsmöglichkeiten quasi nicht existent. Der Ministerpräsident selbst macht um die Gegend einen großen Bogen. Jetzt schickt er immerhin einen Abgesandten. Diese Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Ein befreundeter Aktivist sagt zu Schneider: »Denen muss man zeigen: So geht es nicht!«
Irmgard Schneider springt nach dem Anruf sofort in ihren VW, »fünf Leute waren wir«, und braust los. »Unterwegs haben wir auch andere Leute aus der Bewegung getroffen.« Die Idee des zivilen Ungehorsams in diesem Fall: Straßensperren zu errichten, um Filbingers Minister zur Rede zu stellen. »Eine Art Gasse, wo man mit dem Auto noch durchkommt«, stellt Schneider klar. »Selbstverständlich gewaltfrei.« In Sasbach am Ortseingang fehlen noch Posten. »Also sind wir da hingefahren.«
Sie warten.
Bernd Nössler sitzt zu diesem Zeitpunkt in Wyhl in der Veranstaltung, an der Minister Rudolf Eberle teilnimmt. Der Bäckermeister von der Bürgerinitiative ist stinksauer. In mühsamen Vorgesprächen war zuvor vereinbart worden, dass hier und heute nur »normale« Bürger aus Wyhl miteinander diskutieren. Und dann marschieren auf einmal ein Dutzend Vertreter der Atomwirtschaft und des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums herein, angeführt von Eberle und seinem Staatssekretär Erwin Teufel. Ein klarer Wortbruch!
Die Situation spitzt sich im Laufe des Abends weiter zu. Nur selten kommen die KKW-Gegner vernünftig zu Wort, die Redeanteile liegen überwiegend bei den Experten der Befürworter. Der Gipfel der Demütigung: Als Nösslers Bruder Jürgen, seriös gewandet in Sakko und Schlips, am Mikrofon höflich um »gleiche Waffenstärke« bittet und darum, dass nun auch die Gegner ihre vor der Tür wartenden vier Sachverständigen hereinrufen dürfen – da lehnt der Bürgermeister brüsk ab. Die Umweltschützer, angeführt von Jürgen Nössler, verlassen aus Protest den Saal. Wenig später endet die Versammlung. Bernd geht direkt in die Backstube. Minister Eberle und Staatssekretär Teufel besteigen einen Mercedes mit Freiburger Kennzeichen. Statt der gewohnten Route über Endingen nehmen sie heute einen anderen Weg.
Erwartet hat das keiner.
Im kleinen Sasbach parken rechts und links des Ortseingangs ein paar Autos der Aktivisten. Man quatscht ein bisschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Herren aus Stuttgart hier lang kommen, ist gering. Und dann geht alles ganz schnell. »Bremsen quietschen, Autotüren schlagen, Menschen laufen, Stimmen schreien und kreischen. Ein Mercedes mit Freiburger Nummer fährt in die Menschenmenge.« So berichtet es die Augenzeugin Rosi Blust-Ehret in dem Buch Kein Kernkraftwerk in Wyhl und auch sonst nirgends, das den Vorfall später dokumentiert. Irmgard Schneider braucht am Ort des Geschehens einen Moment, bis sie realisiert: Das sind ja Eberle und Teufel!An unserer Straßensperre! Der Wagen wird prompt von Menschen umringt. Er wird anhalten müssen, denken alle. Bis jemand schreit: »Er geht uns durch!«
Schneider sieht mit großen Augen, wie der Fahrer »rücksichtslos zurückfährt und eine Frau, die dahinter steht, gerade noch zur Seite springen kann, danach ist er über den Acker und ab durch die Mitte«. Sie rennen zu den Autos und wollen die Verfolgung aufnehmen. »Aber wir haben ihn natürlich nicht mehr eingeholt«, sagt Irmgard. Die Nacht von Sasbach verdeutlicht, was das Ringen um das AKW Wyhl mit den Menschen inzwischen macht: Gestern mögen sie noch brave Bürgerinnen gewesen sein, heute hetzen sie voller Adrenalin einem Minister-Mercedes in der Dunkelheit hinterher.
Das Opfer des Unfalls liegt im Dreck: Rosi Blust-Ehret. Sie konnte gerade noch ausweichen, nur der Kotflügel des Wagens hat sie touchiert. Puh, Glück im Unglück, wir sind noch mal davongekommen, denken Rosi und Irmgard.
Sie irren. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
* * *
Die Polizei klingelt bei Bernd. Und bei Irmgard. Und am Ende bei Rosi. Ministerpräsident Hans Filbinger hat angekündigt: Die Taten von Sasbach werden geahndet. Er versucht, Wort zu halten.
In die Bäckerei kommen zwei Tage später, gegen zehn Uhr, zwei Männer in Mänteln. »Die sind einfach reinmarschiert«, sagt Bernd Nössler. Er knetet gerade den Teig, sein Vater steht am Ofen. Die Polizisten deuten auf den Sohn, ohne ihren Namen zu nennen, ohne den Dienstausweis vorzuzeigen. Dann fangen sie an zu sprechen: Er sei beobachtet worden. »Ich habe zuerst gedacht: Wie, was, bin ich im falschen Film? Um was geht es hier überhaupt?«
Die Männer lösen das Rätsel auf. »Die haben unterstellt, dass ich bei den Straßensperren in Sasbach dabei war.« Bernd Nössler ist perplex, in seiner Welt sind Polizisten bisher geachtete Vertreter von Recht und Ordnung. »Ich habe dann nur gesagt: Nee, ich war nicht dabei. Ich bin direkt nach der Veranstaltung in die Backstube gegangen. Mein Vater kann das bezeugen.«
Dann wird es ganz still, und Vater Nössler, ein angesehener Bürger in der Dorfgemeinschaft, ergreift das Wort, ruhig und eindringlich. »Wenn ihr das nicht glaubt, dann nehmt mich gleich mit in Handschellen. Ich sag vor einem Freiburger Gericht dann aus, dass mein Sohn gleich in die Backstube kam.« Er ist noch nicht fertig mit den Polizisten: »Und ich würde mich schämen, wenn ich mein Geld auf dieselbe Art verdienen würde wie Sie.« Die angesprochenen Männer sind sichtbar irritiert, so redet man in der Nachkriegsrepublik gewöhnlich nicht mit Uniformierten. »Und außerdem stellt man sich bei uns auf dem Dorf zuerst mal vor und nennt seinen Namen«, sagt Vater Nössler. »Ich stehe lieber in der Backstube und schwitze und verdiene mein Geld auf ehrliche Weise.«
Bei Schneiders müssen die Beamten am Protestschild gegen das KKW vorbei. Die Eltern führen ein offenes Haus, regelmäßig schauen Leute vorbei, die zu ihren Kindern wollen. Sie realisieren überhaupt nicht, dass diese Besucher Polizisten sind. Die Männer fragen zunächst nach dem Bruder, am folgenden Tag erscheinen sie bei Irmgard auf der Arbeitsstelle, die Erzieherin ist damals in einer Gehörlosenschule tätig. Diskret kann man das Vorgehen nicht nennen. »Zwei Herren haben dann in der Verwaltung alle wissen lassen, dass sie von der Polizei sind.« Die Situation ist heikel. »Der Staat war ja mein Arbeitgeber, und dann ging auf einmal herum, ich wäre in geheime Staatssachen verwickelt.« In den Siebzigern, der Zeit der Rote Armee Fraktion und ihrer mörderischen Taten, kann ein derartiger Anwurf die Reputation einer Bundesbürgerin zerstören.
Schnell wird klar, was die Polizisten wirklich wollen. Oder besser wen: Rosi, die angefahrene Frau, die aus einer Familie von Kommunisten kommt – was in Westdeutschland während des Kalten Krieges schon per se verdächtig ist. Irmgard bleibt so stoisch, wie man das mit 22 Jahren im Angesicht der Staatsmacht sein kann: »Ich habe nichts gesagt und ständig wiederholt, ich sei mir in Bezug auf die Straßensperre keiner Schuld bewusst, was ja auch stimmte. Eingeschüchtert war ich trotzdem.«
Irgendjemand plaudert. Ein paar Tage später taucht die Polizei bei Rosi im Geschäft auf, hält ihrer Chefin die Marke unter die Nase, schafft sie mit einem VW-Bus nach Freiburg, führt bei ihren Eltern eine Hausdurchsuchung durch, nimmt Fingerabdrücke, macht Bilder, fahndet in ihrem Auto nach Adressen und Flugblättern – das komplette Programm wie bei einer Kriminellen. Es bleibt erfolglos.
In einem Buch über die Ereignisse berichtet Rosi, wie es weitergeht: Am nächsten Tag schmeißt ihr Chef sie raus. Seine Begründung: Eine Verkäuferin, die von der Kriminalpolizei abgeholt wird, sei geschäftsschädigend und verderbe den guten Ruf. Sie dürfe jetzt gleich gehen. Der ausstehende Lohn und die Arbeitspapiere würden nachgesandt. Auf das Geld und die Dokumente habe sie freilich noch acht Wochen lang warten müssen, sagt Rosi und fügt mit sarkastischem Humor hinzu: »Wo blieb da der gute Ruf?«
Schon einen Monat später kommt es zu einer weiteren Begegnung mit der Polizei. Im Wald von Wyhl. Und diesmal gibt es garantiert nichts zu lachen.
* * *
Den Code hat Irmgard Schneider bis heute nicht vergessen: »Im Rhein schwimmen lauter grüne Fische«. Ein befreundeter AKW-Gegner hat ihr eingeschärft: Mädle, wenn die Polizei kommt und du weißt es vor mir, rufst du mich an und sagst: Im Rhein schwimmen lauter grüne Fische. Warum eine geheime Losung? Weil Schneider und ihre Mitstreiter misstrauisch davon ausgehen, dass sie abgehört werden. Dem Staat und seinem Apparat trauen sie inzwischen fast alles zu.
Am Abend des 19. Februar 1975 ist die Stunde für die Übermittlung des Codes gekommen. »Wir haben an dem Abend den Tipp gekriegt, dass sich in Emmendingen die Polizei versammelt«, erzählt die Erzieherin. »Uns war klar, die wollen später nach Wyhl.« Schneider und ein anderes Mitglied der Bürgerinitiative fahren umgehend los, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Geraunt wird von einer großen Polizeistreitmacht mit Panzer-Spähwagen, Wasserwerfern und vielem mehr.
Im Wyhler Wald, wo das Kernkraftwerk entstehen soll, hat das Badenwerk ein paar Tage zuvor begonnen, Bäume abholzen zu lassen, obwohl noch ein entscheidendes Gerichtsurteil aussteht. Der Rheinauenwald falle den Motorsägen zum Opfer, vermeldet das öffentlich-rechtliche Radio und beklagt, dass dies in einem »einmaligen Vogelparadies« geschehe. Als Reaktion darauf besetzen die KKW-Gegner den Bauplatz – eine Protestform des zivilen Ungehorsams, die sie von französischen Freunden in Marckolsheim jenseits der Grenze übernehmen. Dort war ein großes Bleichemiewerk geplant. »Drüben auf der anderen Rheinseite habe ich zum ersten Mal an einer Demonstration teilgenommen«, erinnert sich Bernd Nössler an die länderübergreifende Solidarität. Aber er beherrscht doch gar kein Französisch? Er lächelt: »Wir sprechen doch alle alemannisch.« Auch die nahe gelegene Schweiz ist Teil dieses ökologischen Länderdreiecks, in dem man sich immer wieder bei Protesten hilft und gegenseitig inspiriert.
»Die Baumaschinen und Motorsägen werden durch Menschen gestoppt, die sich vor gefräßige Baggerschaufeln oder unter zu fällende Bäume setzen«, heißt es nun aktuell im Südwestfunk. Einer seiner Journalisten interviewt auf dem besetzten Bauplatz einen Mann und fragt nach seiner Motivation. Seine Antwort zeigt, dass es nicht vorrangig um Technologie, sondern um die Umwelt geht. »Ich bin zwar Elektromeister, und ich lebe an und für sich von der Energie, die hier erzeugt wird«, sagt der Demonstrant, »aber ich bin einfach gegen diese Art der Energieerzeugung, weil ich halt diese Gegend liebe und weil ich sehe, dass hier eines der ökologisch intakten Gebiete offensichtlich zerstört werden soll.« Der Mann und seine Mitstreiter halten sich strikt an das Prinzip der Gewaltfreiheit.
Die illegale Besetzung will sich Ministerpräsident Hans Filbinger nicht bieten lassen, und er setzt seine Ordnungsmacht im Morgengrauen in Bewegung. Es ist der 20. Februar 1975. Bernd Nössler schaut um 4.30 Uhr aus dem Fenster der Backstube. Er sieht Dutzende von Fahrzeugen, zum Teil mit Wasserwerfern. »Damals waren die Straßen nicht beleuchtet, und ich bin in meiner Backstubenkleidung auf der Straße gestanden.« Er greift zum Vergleich mit einem Ereignis, das für seine Generation einen politischen und moralischen Tiefpunkt darstellt: »Mich hat es an die Niederschlagung des Prager Frühlings erinnert.« Das war 1968, als die Panzer der kommunistischen Weltmacht Sowjetunion durch die tschechoslowakische Hauptstadt rollten und die zarten Blütenträume von demokratischen Ansätzen niederwalzten. Derweil sieht Irmgard Schneider das Polizeiaufgebot durch das Stadttor in Endingen an ihrem Elternhaus vorbeifahren. Sie hat Angst vor dem, was kommt: »Du hast dir Gedanken gemacht, was draußen auf dem Bauplatz jetzt wohl passieren wird.« So etwas habe sie noch nie gesehen, sagt sie. »Ich habe Rotz und Wasser geheult.«
Nössler versucht, seine Leute von der Ersten Generation zu mobilisieren. Aber das Telefon ist tot. »Wir konnten nur noch das Krankenhaus erreichen. Als ich versucht habe, verschiedene Leute früh morgens um fünf anzurufen, um sie zu warnen, dass die Polizei in den Wyhler Wald kommt – da hat es nur noch in der Leitung geknackt.« Auch Irmgard Schneider wird die lange vorbereitete Losung von den grünen Fischen nie am Telefon aussprechen können. Im Zeitalter vor den Mobiltelefonen wird jetzt vor Ort ganz analog gehandelt: Die Feuerwehr lässt Sirenen heulen, Kirchenglocken werden geläutet. »Sie signalisieren denen, die zuhause sind, dass der erwartete Polizeieinsatz beginnt«, kommentiert der Südwestfunk.
Alles wird abgeriegelt. Keiner kommt mehr vom Bauplatz herunter, keiner mehr hinauf, auch Nössler und Schneider nicht. Vom Platz berichten können lediglich einige Augenzeuginnen, deren folgende Zitate dem von Bernd Nössler und anderen verfassten Buch Wyhl. Kein Kernkraftwerk in Wyhl und auch sonst nirgends entnommen sind. »Nach dreimaliger Aufforderung, den Platz zu räumen, ging die Polizei mit brutalster Gewalt daran, die Leute fortzuzerren«, sagt Hilda Vogel, eine Hausfrau und Winzerin aus Kiechlingsbergen. »Mit Berechnung wurden Leute genommen, die nicht kaiserstühlerisch sprachen. Eine junge Frau wurde weggerissen, ihr Kind flog in hohem Bogen weg.« Wasserwerfer hätten die Leute so bearbeitet, dass ihr die Worte fehlten, alles in Gänze zu beschreiben. Auch Maria Kollhöfer, eine 50 Jahre alte Hausfrau, ist auf dem Bauplatz: »Radikale gab es nicht abzuräumen. Wir waren ganz gewöhnliche Menschen, die sich dagegen wehrten, dass ihnen ein Atomkraftwerk aufgezwungen werden sollte, von dem sie nichts wissen wollten.« Dann holt sie zu einem in der Nachkriegsrepublik unerhörten Vergleich aus: »Viele von uns haben die Nazizeit erlebt, und wir glauben nicht mehr blind, dass wer die Macht hat, auch unbedingt im Recht ist.« Weitere Eindrücke dieses Tages übermitteln die Kameras und Mikrofone der anwesenden Reporter.
Man sieht: Aus nächster Nähe werden Wasserwerfer auf die Menschen gerichtet, die Polizei marschiert so martialisch auf, dass sich der Vergleich zu einer Armee aufdrängt, in einer Gegend, die häufig genug den Krieg zwischen Deutschen und Franzosen gesehen hat.
Man hört: verzweifelte Schreie und schluchzende Menschen. Eine Frau im Mantel sagt mit tränenerstickter Stimme zu den Polizisten: »Es ist eine Schande. Wenn ihr ein Herz im Leib hättet, würdet ihr so was nicht tun.« Neben ihr weint eine Dame mit buntem Kopftuch: »Was ist das für eine Demokratie?« Dann spricht wieder die erste Frau: »Wir sind keine Linksradikalen, wir sind friedliche Bürger und Verteidiger unserer Heimat.« Von hinten hört man aus der Gruppe noch einen Satz, der diesen bewegten Tag zusammenfasst und ihm die Richtung gibt:
Der Staat hat den Bogen überspannt.
Hier und heute geht im Wald von Wyhl etwas kaputt. Ein Urvertrauen der Menschen in die Mächtigen, in das System, in die Demokratie, in den Rechtsstaat. Es ist Donnerstag. Die nächsten drei Tage über das Wochenende werden zum Buch Genesis der bundesdeutschen Umweltbewegung.
Der vermeintliche Sieg des Staates über die Erste Generation vom Kaiserstuhl verwandelt sich in eine Niederlage. »Es war eine Initialzündung«, sagt Irmgard Schneider. Ein Lauffeuer geht durch Schulen und Betriebe. Nössler spricht ein zweites Mal in seinem Leben von einem Aha-Moment: »Tausende sind dann in den Wyhler Wald gepilgert. Eigentlich ist die ganze Region nachher raus nach Wyhl. Die Straßen waren rund um die Uhr voll.« Diesen Akt der Solidarisierung vergesse man nie, befindet Schneider: »Man fühlte sich wie getragen.«
Bernd Nössler verlässt den Laden, fährt in den Wald und bringt den Polizisten am Zaun frisch gebackenes Brot und Dosenwurst. »Denen wurde ja erzählt, dass sie ein paar Kommunisten vertreiben müssen.« Der Bäcker will aufklären und diskutiert so lange, bis der entnervte Einsatzleiter ihn stoppt und zu Bernd sagt: Sie demoralisieren meine Männer.
Am Sonntag, drei Tage nach der Räumung, kommen geschätzt 28 000 Menschen nach Wyhl. »Sie ließen sich nicht mehr abschrecken von deutschen Polizeiuniformen und deutschen Schäferhunden, von Knüppeln und Wasserwerfern«, heißt es mit großem Pathos in der Film-Dokumentation S’Wespennest, gefertigt von der Medienwerkstatt Freiburg. In der Sache haben sie recht: Irgendwann kann die Polizei das etwa 40 Hektar große Areal tatsächlich nicht mehr halten. Oder wie sie inzwischen im Radio melden: »Die Polizei ist machtlos, ein mehr oder minder geordneter Rückzug findet nicht mehr statt.«
Bernd Nössler schleicht sich durch einen alten Rheinarm auf das Gelände. »Ich bin dann bis fast zum Bauch durchs Wasser gewatet, es war eiskalt im Februar.« An seiner Seite: ein Elsässer von der anderen Seite des Rheins. Am späten Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang, erreichen sie beide die hintere Seite des Areals. »Wir haben uns dann umarmt«, erinnert sich Bernd.
Irmgard Schneider ist zu dieser Zeit im großen Pulk, der sich nicht mehr aufhalten lässt und den Weg auf den Bauplatz einschlägt. Für die Einheimischen ist der Wyhler Wald ihr Sherwood Forest, sie kennen jeden Winkel. Fernsehbilder zeigen, wie die Truppen der baden-württembergischen Sheriffs am Ende mit gesenkten Schildern im Gänsemarsch abziehen. Etwa so wie eine römische Armee, die in einem Asterix-Abenteuer gegen die Gallier verloren hat. Ein Beamter gibt gegenüber einem TV-Reporter resigniert zu: »Ich fand die ganze Sache von vornherein unvernünftig.«
Am nächsten Tag spricht Hans Filbinger im Fernsehen zur Bevölkerung: Er trägt einen dunklen Anzug mit schwarz-grauer Krawatte zum weißen Hemd. Der Ministerpräsident hat in den letzten Jahren alles in die Waagschale geworfen, was er hatte, um den Bau des KKW am Kaiserstuhl durchzudrücken: Polizei, politische Macht, ökonomische Ressourcen und Einfluss auf die öffentliche Meinung. Alles, was ihm nach diesem historischen Ereignis von gestern scheinbar noch bleibt, sind Angstmache und Diffamierung.
Er schaut direkt in die Kamera und beginnt umgehend damit, Furcht zu verbreiten – vor Arbeitslosigkeit, Niedergang und einem Blackout: »Wer die Arbeitsplätze sichern will, der muss Vorsorge für Energie treiben. Die Kernenergie ist unverzichtbar. Wir werden deshalb das Kernkraftwerk Wyhl bauen.« Noch im selben Monat ergänzt er in einer Regierungserklärung: »Ohne das Kernkraftwerk Wyhl werden zum Ende des Jahrzehnts in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgehen.« Viel mehr Panikmache und vermeintliche Alternativlosigkeit ist kaum vorstellbar.
Er fährt fort. »Wir lassen jetzt aber vier Wochen Zeit, um eine Trennung unserer Bevölkerung, die besonnen ist, von den Extremisten zu erreichen.« Wieder findet die Kommunikation des Politikers von oben herab statt. Der Landesvater gibt sich nach außen gutmütig und willens, seinen Landeskindern zu verzeihen, die unseligerweise auf einen Irrweg geraten sind, vermutlich angeleitet von radikalen Kräften aus der Fremde. »Wir haben sie niemals in einen Topf geworfen mit den Extremisten und den Kommunisten, denen es nicht um den Umweltschutz geht«, sagt Hans Filbinger wörtlich im TV. Worum es ihm selbst geht, wird hingegen klar und deutlich: einen Keil in die Protestbewegung zu treiben.
Es ist ein zentrales Argument seines politischen »Spins«, wie man neuerdings sagt, also seiner strategischen Interpretation der Ereignisse. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg kann oder will sich nicht eingestehen, dass der Wyhler Widerstand tatsächlich von den Einheimischen initiiert und getragen wird. Die Bürger müssten, das ist seine einzige Erklärung für die unvorhergesehene Rebellion, von »Auswärtigen«, von Linksradikalen und Extremisten überwältigt worden sein. »Als ob wir hier die Baader-Meinhof-Bande seien«, empört sich eine Winzersfrau im Spiegel. Übrigens bestreitet in der Gegend niemand, dass sich auch radikale Linke unter den Demonstranten befinden. Aber sie seien nicht allzu gefährlich, versichert ein lokaler Vertreter der Bürgerinitiative, die Ortsansässigen hätten weiterhin die Oberhand.
Diese Lesart bestätigen auch Filbingers eigene Leute von der CDU. Die Landesregierung müsse endlich zur Kenntnis nehmen, so wird der Partei-Kreisverband Emmendingen zitiert, dass hinter der Protestaktion die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung stehe. CDU-Mitglieder schicken ihre Parteibücher zurück, in manchen Orten ist von Massenaustritten die Rede. »Wyhl« habe seinen Ursprung, so hauen die Emmendinger ihrem Herrscher in Stuttgart noch um die Ohren, »im ungeschickten und unklugen Verhalten der Landesregierung«.
Hans Filbinger hat so ziemlich alle Mittel ausprobiert, die man als machtvoller Politiker zur Verfügung hat. Nur eines nicht: Nähe sowie Kommunikation auf Augenhöhe mit den Bürgern. In diesem Geiste beendet er seine Fernsehansprache unbeirrt mit dem Hinweis, dass die Besetzung des Bauplatzes »rechtswidrig« sei.
Und mit dem Recht, so spottet man am Kaiserstuhl, kennt er sich als Jurist der Nazizeit ja aus.
* * *
Auf dem erneut besetzten Bauplatz werden diesmal nicht nur Zelte aufgeschlagen, sondern auch eine feste Struktur errichtet: das Freundschaftshaus – ein Rundbau mit 25 Metern Durchmesser, der auf hellen Balken ruht. In der Mitte lodert ein Lagerfeuer, der Rauch zieht durch ein kreisförmiges Loch nach oben ab. Man kann auf Holzbänken sitzen oder auf dem Boden. Für ungefähr 500 Menschen ist hier Platz. Der Bauplatz wirkt ein wenig wie eine Goldgräberstadt im Wilden Westen. »Einen Jahrmarkt des gewaltlosen Widerstands«, nennt es der Journalist Peter Brügge im Spiegel.
Die Idee haben die Wyhler Aktivisten wieder einmal von der anderen Rheinseite mitgebracht, vom gemeinsamen französisch-deutschen Widerstand gegen das Bleichemiewerk im elsässischen Marckolsheim. Das solide Haus ist ein Signal, dass man diesmal gekommen ist, um zu bleiben. Gleichzeitig ist es eine Chance, etwas völlig Neues zu kreieren. Einen Ort, an dem »wir uns und unseren Mitstreitern Informationen und Wissen verschaffen«, sagt Irmgard Schneider. Sie gehört zu den führenden Köpfen der unkonventionellen Einrichtung, die irgendwann den Namen »Volkshochschule Wyhler Wald« erhält. Das passt ganz wunderbar, denn es ist eine Volks-Hochschule im Wortsinne. Es gibt keinen Geschäftsführer, keinen akademischen Rat, und die Menschen bestimmen selbst, zu welchen Themen sie mehr erfahren wollen. Frank Baum, auch einer der ersten Stunde, sagt in dem Buch Siebenunddreißig Wyhl-Geschichten über die VHS: »Sie war ein gutes Instrument, um nach außen zu zeigen, dass der Widerstand Hand und Fuß hat.« Man wolle »sachlich und korrekt« über die Atomenergie aufklären.
Niemand hat die Erzieherin Irmgard Schneider darauf vorbereitet, solche Veranstaltungen für politisch interessierte Erwachsene zu managen. Ist sie von sich selbst überrascht? »Ja, wie es im Leben einen oft überrascht«, antwortet sie gelassen. »Jeder hat nach seinen Fähigkeiten einen Beitrag geleistet.« Bernd Nössler mischt auch regelmäßig mit, er trägt auf dem Bauplatz immer seine Bäckerskleidung, um zu zeigen, dass sich hier ganz normale Leute vom Kaiserstuhl engagieren und keine Chaoten von auswärts, wie es die Landesregierung weiterhin unterstellt.
Die Programme hebt Irmgard Schneider sorgfältig in einem blauen Aktenordner auf. Und so wissen wir: Am 13. April 1975 findet um 20 Uhr die erste Veranstaltung der ungewöhnlichsten Volkshochschule Deutschlands statt. In Schreibmaschinenschrift ist die folgende Ankündigung zu lesen: »cand. phys. P. Grosse-Wismann (Freiburg): Wie funktioniert ein Atomkraftwerk?« Veranstalter sind die Badisch-Elsässischen Bürgerinitiativen, Postanschrift: Wyhler Wald, Freundschaftshaus. Auf der Rückseite werden die Interessenten gebeten: »Bitte bringen Sie sich evtl. eine Sitzgelegenheit mit!« Und: »Bitte geben Sie dieses Blatt weiter.« Das Ambiente wirkt alternativ: Die Menschen kauern sich hin, Bilder und Folien werden auf eine Leinwand projiziert, in der Mitte knackt das Feuer, rundherum sieht man Wandzeitungen.
Die Programme umfassen stets einen Zeitraum von vier Wochen und sind säuberlich nach Oberthemen sortiert. Dienstags »Kernkraftwerke und Alternativen«, mittwochs »Reisen-Fahrten-Fremde Länder«, donnerstags »Fragen der modernen Landwirtschaft«, freitags »Natur- und Umweltschutz«. Die Bandbreite reicht von der Landwirtschaft in Albanien bis zum Trip mit dem Faltboot in Alaska, von der Schwarzwald-Autobahn bis zur alternativen Stromerzeugung. Die Botschaft ist so kraftvoll wie revolutionär: Das Wissen überlässt man nicht mehr nur den Experten – wie man es bisher in Deutschland gewohnt ist. Als es im italienischen Seveso zu einer Dioxin-Katastrophe kommt, »ist direkt einer von uns hingefahren und hat das Ganze fotografisch dokumentiert und darüber dann einen Vortrag gehalten«, berichtet Irmgard Schneider.
Die Referenten der Vorträge erhalten in der Regel keine Honorare, bestenfalls werden Fahrtkosten erstattet. Sie kommen zunächst hauptsächlich aus der Region. Später treten sogar US-Experten im Freundschaftshaus auf, wie der berühmte Professor Ernest Sternglass oder Clyde Bellecourt, Mitbegründer des American Indian Movement. »Man hat sich dann immer bange gefragt, oh je, wie kriegt man das hin?«, sagt Bernd Nössler. »Irgendwie haben wir es immer gestemmt.« Die VHS Wyhl wird ein Magnet der neuen sozialen Bewegung und zieht auch Öko-Promis wie Petra Kelly, Robert Jungk oder den Autor Holger Strohm an. Penibel wird nach den ersten 28 Programmwochen die Berufsstruktur der Vortragenden erfasst: An der Spitze stehen 18 Physiker und 14 Landwirte, am Ende ein Gewerkschaftssekretär und ein Fischermeister.
Die Werbung läuft über eine große Anzahl gedruckter Programme, die häufig in den Orten des Kaiserstuhls an speziellen Holztafeln aushängen. Auch die Eigenpublikation Was wir wollen, der Radiosender Dreyeckland und Artikel in der Badischen Zeitung weisen den Menschen den Weg in den Wyhler Wald. Die, die kommen, sind zur einen Hälfte Schüler, Studentinnen und Akademiker, zur anderen Handwerker, Angestellte, Arbeiter und Landwirte. Dies ergibt eine Auswertung von Fragebögen, zitiert in der grundlegenden Schrift zur VHS von Axel Mayer. Finanziert werden die Vortragsreihen durch Spenden. Jeden Abend geht ein Korb herum, das »Kirschkrättle« – am Ende ist es meist gut gefüllt.
Mit der Zeit nehmen die »heimatbezogenen Veranstaltungen« zu. Hier hat Bestand, was auch für die Vorträge gilt: Der Auftritt wird nicht mehr nur etablierten Persönlichkeiten überlassen. Jedermann und jede Frau ist gefragt. Ein schönes Beispiel für all die Sänger, Künstlerinnen und Liedermacher ist ein Mann, der tagsüber in einem Klärwerk arbeitet: Ernst Schillinger