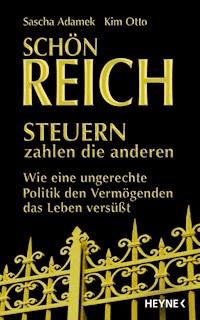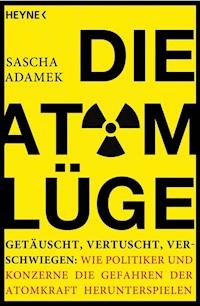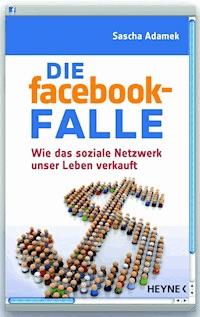
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vernetzt, verraten, verkauft – hinter den Kulissen des Facebook-Imperiums
20 Millionen Nutzer im deutschsprachigen Raum, 500 Millionen weltweit – das ist der Stoff, aus dem Facebook Milliarden macht. Und bereitwillig laden wir täglich Unmengen von privaten Fotos und Daten auf die Seiten. Hemmungslos betreibt das größte und erfolgreichste soziale Netzwerk die kommerzielle Verwertung der persönlichen Daten seiner Nutzer. Wollen wir diesen Preis wirklich zahlen?
Sascha Adamek und Kim Otto decken auf:
• mit welchen Methoden ein als »soziales Netzwerk« getarnter US-Konzern die Welt erobert,
• wie Nutzer ins Visier von Rasterfahndungen und Geheimdiensten geraten,
• wie selbst Großstadtgangs und Mafiaclans über Facebook Mitglieder werben,
• wie Sexualstraftäter und Pädophile über Plattformen wie Facebook ihre Opfer ausmachen,
• wie Kinder und Jugendliche in den Fokus von aggressiven Online-Marketingaktivitäten geraten,
• warum die Freiheit des Internets oft eine vermeintliche ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Dieses Buch widme ich in Liebemeinen Kindern Anna, Nils und Max;Mélanie;meinen Eltern;und den Freunden, mit denen ich so viel teile.
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu geh’n. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steh’n. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, daß ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt.
REINHARD MEY
Von dem, was die anderen nicht von mir wissen, lebe ich.
PETER HANDKE
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Die Legende vom »sozialen« Netzwerk
Wäre Facebook ein Land, wäre es schon heute das drittgrößte der Welt. Ein wirklich erstaunliches Land, wo Menschen in siebzig unterschiedlichen Sprachen miteinander kommunizieren und ihr Privatleben in großen Gruppen von durchschnittlich 130 Freunden miteinander teilen.1 Rund die Hälfte der gut 500 Millionen »Bürger« dieses Landes meldet sich jeden Tag bei der Zentrale dieses weltumspannenden sozialen Netzwerks an. Im Schnitt verbringen die Mitglieder von Facebook pro Monat rund 700 Milliarden Minuten im direkten Austausch mit ihren Freunden. Monat für Monat laden die Nutzer drei Milliarden Fotos und zehn Millionen Videos hoch. Wäre Facebook ein Staat, wäre dessen »Regierung« auf diesem Wege bestens über die privaten Belange, Konsumvorlieben oder politischen Haltungen seiner Bürger informiert. Selbst über Dinge, die diese Bürger nicht einmal ihren Freunden anvertrauen würden. Denn wie restriktiv jeder Facebook-Nutzer seinen Privatsphäre-Filter auch einstellt, alles, was eingespeist wird, landet unweigerlich in den 40 000 Großservern rund um den Globus und verbleibt dort ohne Zeitbegrenzung. Selbst die Profile von Verstorbenen bleiben erhalten, sie werden im »Gedenkzustand« weitergeführt.
Was fasziniert uns so an Facebook? Ein befreundeter Dokumentar- und Musikfilmproduzent schwärmte schon vor Jahren von MySpace, später dann von Facebook. Wie er begeisterten sich anfangs viele Angehörige der alternativen Kulturszene für Facebook, für sie ein Symbol des öffentlichen, des gemeinsamen Netzes. Dahinter steckte zu einem Gutteil die diffuse Sehnsucht nach einem emanzipatorischen Aufbruch, vielleicht auch nach einem Gegenpol zu den herrschenden Verhältnissen. Das Internet wurde vielfach als ein Medium der Befreiung empfunden, das Menschen an den entlegensten Flecken der Erde soziale Teilhabe ermöglicht. Google sei der moderne Kiosk der Medienwelt, schreibt der Blogger und Medienexperte Jeff Jarvis. Und was ist dann Facebook? Dessen Gründer Mark Zuckerberg möchte seine Erfindung zum Fenster des World Wide Web machen, und er ist tatsächlich auf dem besten Wege dahin. Um zu expandieren, integriert Facebook die Skype-Internet-Telefonie, eine Suchmaschinenfunktion und sogar eine eigene E-Mail-Funktion. Allein in Deutschland haben sich fast 13 Millionen Menschen in dem Netzwerk angemeldet, und es werden immer mehr. Facebook ist in kürzester Zeit ein Mainstream-Medium geworden. In einigen Branchen ist es als Kommunikationsmedium mittlerweile sogar unverzichtbar. Wer dort nicht präsent ist, der existiert nicht. Spätestens wenn wir gezwungen sein werden, dort mitzumischen, wird das freiwillige »soziale« Netzwerk von Freunden endgültig zur Legende.
Aber wer steckt hinter diesem Netz, dem wir uns bislang begeistert anschließen? Bei aller Euphorie über die Vision eines weltumspannenden, herrschaftsfreien Dialogs müssen wir die Frage stellen, wer die Gönner und Macher im Hintergrund sind, die an dieser Vision arbeiten, und welche Interessen sie verfolgen. Eine der Schlüsselfiguren bei Facebook neben Mark Zuckerberg ist beispielsweise ein milliardenschwerer Futurologe und Hedgefonds-Manager, der globale Probleme am liebsten dadurch lösen würde, dass er den Staat als Hüter des Gemeinwohls verbannt. Einer, der findet, die Menschheit habe überhaupt keine Probleme, und wenn doch, dann seien sie allein durch den technischen Fortschritt zu lösen. Er steckt Millionen Dollar in die Erforschung Künstlicher Intelligenz und träumt von einem transnationalen, technischen Zeitalter. Und ein weltumspannendes Datenmonstrum wie Facebook ist, wie wir auf den folgenden Seiten sehen werden, bestens geeignet, diesem fragwürdigen Ziel näherzukommen.
Bei den Recherchen für dieses Buch bin ich ganz ›facebooklike‹ vorgegangen. Ich habe Freunde und die Freunde der Freunde von Facebook gesucht, um mir ein Bild davon zu machen, wer welche Interessen mit der weltweiten Expansion dieses Netzwerks verbindet. Gelandet bin ich teilweise in ziemlich rückwärtsgewandten Kreisen, die so gar nicht zum Image des liberalen, weltoffenen Netzwerks passen. Ich stieß auf Menschen mit Kontakten zur CIA, auf Obama-Hasser und auf den bereits erwähnten Futurologen. Facebook-Gründer Zuckerberg ist sicher kein CIA-Agent, und Facebook ist ganz gewiss keine Staatsverschwörung. Aber man muss sich stets vor Augen halten, dass man auf den Seiten dieses sozialen Netzwerks nicht nur Freunde trifft. So leistet sich Facebook beispielsweise einen Lobbyisten in Washington, der unter anderem Kontakte zum US-Geheimdienstsektor unterhält, was sowohl Google als auch Microsoft und Apple bislang gemieden haben. Längst nutzen große Konsumgüter-Konzerne sogenannte »Opinion Mining«-Programme, um unsere Meinung in sozialen Netzwerken auszuforschen. Alles, was wir uns auf Facebook mitteilen, wird auf Stichworte hin durchforstet und analysiert: Sind wir einem Produkt gegenüber aufgeschlossen, oder kritisieren wir es? Die Programme erkennen sogar unseren »Tonfall«. Genau derselben Methode bedienen sich von der CIA bezahlte Firmen, um die Meinung der Weltnetzgemeinde abzuhören. Die Freiheit des Internets droht sich gegen uns alle zu kehren.
Dessen ungeachtet lieben wir alle das Netz und können nicht von ihm lassen. So haben die Aktivitäten von Google Street View in Deutschland im Jahr 2010 zwar Politiker aller Parteien auf den Plan gerufen, weil sie die Privatsphäre bedroht sahen, aber all diese Kritiker sollten sich besser fragen, wann sie selbst zum letzten Mal beispielsweise vor Antritt einer Urlaubsreise bei Google Maps stöberten, um sich zu vergewissern, ob der Strand wirklich sauber, der Weg dorthin nicht zu weit oder die Straße nicht zu nah ist. Wir alle sind das Internet – und ohne uns gäbe es kein Facebook. Und dieselben Politiker, die sich für Datenschutz und die Wahrung der Privatsphäre im Netz stark machen, geben selber auf Facebook ihr Privatleben preis, um bei einem Teil ihrer potenziellen Wähler zu punkten. Die Aufregung der Politik über Google Street View steht in keinem Verhältnis zu den wirklich privaten Daten, die Nutzern und Nichtnutzern digitaler Dienste im World Wide Web aus ihren Computern gesaugt werden. Und die diese bereit sind, mit der Weltnetzgemeinde zu teilen. Die Satirezeitschrift Titanic stieß bei ihrer getürkten Aktion »Googlehomeview« auf erstaunlich wenig Widerstand und konnte zahlreiche deutsche Wohnzimmer filmen. Aber was treibt uns, einst dem engsten Freundeskreis vorbehaltene Informationen und intime Details im Internet auszubreiten? Definiert sich das Private heute anders, und was ist noch wirklich privat?
All diesen Fragen geht das vorliegende Buch nach, und es werden Menschen vorgestellt, denen ihr virtuelles Treiben im realen Leben zum Verhängnis wurde. Mit den Spuren, die sie im Netz hinterließen, gefährdeten sie nicht nur ihren Ruf, sondern auch ihre Jobs und sozialen Beziehungen. Und natürlich sind nicht nur Arbeitgeber auf die Idee gekommen, des Öfteren einen Blick in die Facebook-Profile ihrer mitunter gelangweilten Angestellten zu werfen. Auch Geheimdienste, Kriminalpolizei und private Ermittler haben längst erkannt, dass ihre Klientel sich zwar real versteckt hält, ihre virtuellen Handlungen manchmal jedoch alles andere als verbirgt.
Vorgestellt werden auf den folgenden Seiten darüber hinaus Menschen, die sich um die Schattenseiten der Facebook-Welt kümmern, darunter eine Publizistin, die unter Polizeischutz gegen Kinderporno-Ringe im Netz kämpft, BKA-Beamte, die im Internet ermitteln, und ein Privatermittler auf den Datenspuren von Top-Managern. Außerdem eine Journalistin, die gegen Umtriebe von Rechtsextremisten auf Facebook vorgeht.
Schließlich spürt dieses Buch der großen Frage nach, ob und vor allem wie Facebook die Welt verändert. Mark Zuckerberg selber geriert sich öffentlich als radikaler Verfechter persönlicher Transparenz. Er glaubt, dass Menschen verantwortlicher handeln, wenn sie ihre Persönlichkeit, ihre Lebensverhältnisse, ihr Denken und Handeln öffentlich machen, weil auf die Weise die Folgen ihrer Handlungen öffentlich würden. Was die Welt auf Dauer ein Stück besser mache. Es ist eine etwas naive Theorie über das globale Dorf, in dem alle sich liebhaben.
Dabei ist Facebook in Wahrheit ein geniales Geschäftsmodell – genial wie Google, aber deutlich expansiver. Geschätzte fast 1,1 Milliarden Dollar aus Werbeeinnahmen und Spiele-Tantiemen wurden im Jahr 2010 in die Firmenkasse gespült. Der Wert des noch nicht börsennotierten Unternehmens wird mittlerweile auf mehr als 30 Milliarden Dollar taxiert. Facebook, darin sind sich alle Beobachter einig, ist längst zum großen Herausforderer von Google geworden und der Internet-Suchmaschine womöglich auf lange Sicht überlegen. Google wertet quantitativ aus, welche Websites wie häufig angeklickt werden. Das Google-Ranking macht den Wert einer Website für Werbekunden aus. Weil Google auch unsere IP-Adresse registriert, kann das Unternehmen Anzeigen auf den von uns angeklickten Seiten platzieren, die genau auf unsere Interessen und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Facebook dagegen weiß noch sehr viel mehr über seine Nutzer – und das in Echtzeit. Dort kennt man unsere Namen, unser Alter, unsere Interessen, Bedürfnisse Vorlieben und Abneigungen noch sehr viel besser, sodass der Konzern Werbung weit zielgenauer platzieren kann. Für die Werbeindustrie bedeutet dies langfristig den Abschied von der Belästigung durch unerwünschte Werbung, denn Facebook bindet die Konsumenten ein. Der »Gefällt-mir«- oder »Like«-Button hat inzwischen 350 000 Websites erobert. Wenn ich beispielsweise bei einem Musikvideo auf »Gefällt mir« klicke, sind alle meine Facebook-Freunde sofort über meinen musikalischen Geschmack informiert. Und seien wir ehrlich: Gibt es eine bessere Werbung als die Empfehlung durch unsere Freunde? Zugleich aber bietet dieses Instrument Facebook die Möglichkeit, unsere Interessen an die werbetreibende Industrie zurückzumelden.
Was für die werbetreibende Wirtschaft vermutlich die beste Idee seit Jahrzehnten ist, wirft uns zugleich auf den mit Widrigkeiten gepflasterten harten Boden zwischenmenschlichen Zusammenlebens zurück. Denn wer sagt mir denn, dass meine Freunde überhaupt wissen wollen, was ich gerade gut gefunden habe? Ich hätte es höchstwahrscheinlich längst wieder vergessen, wenn ich einen von ihnen persönlich träfe. Facebook jedoch sorgt dafür, dass Unwichtiges dauerhaft Gewicht erhält. Und selbst deutsche Politiker lassen sich hier zu peinlichen Banalitäten hinreißen. Und während Facebook, Twitter und Co. in demokratischen Staaten das Niveau der politischer Information noch weiter verflachen, tappen in diktatorischen Ländern Menschen scharenweise in die Facebook-Falle. In Iran schlossen sich Menschen Online-Mobilisierungen der Opposition an und wurden anschließend verhört oder inhaftiert. Denn auch das Regime betreibt Facebook-Accounts, um seine Gegner auszuforschen.
Die Möglichkeit, uns vielen anderen gleichzeitig mitzuteilen, verlockt Menschen auf der ganzen Welt – aus unterschiedlichen Motiven. Wir alle dürfen uns wie Publizisten, Fotografen und Kameramänner fühlen. Ein Freund, der sich selbst als facebooksüchtig bezeichnet, schwärmt, die Plattform sei einzigartig, weil »ich ständig mit der ganzen Welt im Dialog stehe«. Er liebt es, auf der Straße oder in einem Lokal von Menschen erkannt zu werden, die ihn bislang nur von Facebook kannten. »So etwas ging früher nur, wenn man Dinge tat, die auch in der Zeitung oder im Fernsehen publiziert wurden.« Ist es also dieses aus der vermeintlichen Bedeutung des eigenen Tuns und der Beachtung der eigenen Person durch wildfremde Menschen im Netz resultierende Glücksgefühl, das uns alle zu mehr oder weniger Facebook-Süchtigen macht? Facebook ist Geben und Nehmen von Informationen, und wer sich einigelt und zu wenig von sich preisgibt, ist schnell wieder raus. Wer sich nach seiner Anmeldung bei Facebook in der Folge an Kommunikation nicht sonderlich interessiert zeigt und sich vielleicht nur alle paar Tage oder gar Wochen einloggt, der wird, so der Facebook-Jargon, »gedeadded«, sprich: ihm wird die Freundschaft gekündigt, er ist sozial tot. So jemand wird zum »Unfriend«, ein Wort, das die Herausgeber des Oxford American Dictionary im Jahr 2009 zum Wort des Jahres wählten.
Das Ganze erinnert ein wenig an die Nöte von Sigmund Marx in Aldous Huxleys literarischer Zukunftsvision Schöne neue Welt. Dort ist die Familie abgeschafft, und monogame Beziehungen sind geächtet. Jeder soll mit jedem alles teilen, und je mehr Sexualpartner jemand hat, desto besser. Huxleys Protagonist findet sich in dieser Welt nicht zurecht. Nicht weil er sexuell überfordert wäre, sondern weil er einfach mal für sich sein will. So fliegt er mit seiner Angebeteten namens Lenina einmal in einem Hubschrauber über das Meer. Er schaltet das Radio ab, weil er die Dauerberieselung nicht mehr erträgt und ausschließlich mit ihr den Anblick des Mondes genießen möchte:
»Ich habe das Gefühl, als wäre ich mehr ich selbst, wenn du das verstehen kannst. Als wäre ich etwas Selbständiges, nicht nur ein Teilchen von etwas anderem. Nicht mehr nur eine Zelle im sozialen Organismus. Fühlst du das nicht auch, Lenina?«
Lenina schluchzte: »O wie schrecklich’, wiederholte sie immer wieder, ’wie schrecklich! Und wie kannst du solche Dingen sagen, kein Teil des Ganzen sein zu wollen?«
Ganz so gruselig geht es im Facebook-Land natürlich nicht zu, und Facebook kann durchaus Spaß machen, wie jeder von uns schon erfahren hat. Also »teilen« Sie mit mir die Geschichten dieses Buches, wie Facebook sagen würde. Und seien Sie gewiss: Sie sind nicht allein.
KAPITEL 1
In der Facebook-Falle
Wie uns die Zurschaustellung des Privaten ins Verderben reißen kann
Mark Zuckerberg ist ein egozentrisches Arschloch. Diesen Satz hätte ich nie zu schreiben gewagt. Denn ich habe den Facebook-Gründer nie kennengelernt und auch kein Interview mit ihm erhalten, weil er keine Interviews gibt. Ich fand diese Formulierung in einer Rezension des Kinofilms The Social Network in der Berliner Zeitung, und die Autorin wagte sogar, sie ohne Anführungszeichen zu schreiben.2 Die Welt platzierte diese charakterliche Einschätzung des Gründers und Chefs von Facebook sogar im Titel ihrer Filmkritik: »Zuckerberg – ein einsames selfmade Arschloch«.3 Die Suchbegriff-Kombination »Zuckerberg Asshole« ergibt bei Google 310 000 Treffer, die deutsche Kombination immerhin noch 17 700.4 In David Finchers Film wird Zuckerberg mehrfach als Arschloch bezeichnet. Gleich in den ersten Minuten macht seine genervte Freundin mit ihm Schluss und sagt: »Ok, du wirst später bestimmt mal ein sehr erfolgreicher Computermensch und wirst ein Leben lang glauben, dass die Frauen nicht auf dich stehen, weil du ein Nerd bist, ich möchte dir von ganzem Herzen mitteilen, dass das nicht der Fall sein wird, es wird daran liegen, dass du ein Arschloch bist.« Am Ende des Films taucht das Arschloch-Motiv abermals auf. Der Prozess um den angeblichen Ideenklau Zuckerbergs bei zwei reichen Harvard-Sprösslingen steht kurz vor dem Abschluss. Eine junge Anwältin, die ihn allem Anschein nach sympathisch findet, sitzt wieder mal mit ihm allein in einem Raum. Und wieder gelingt es ihr nicht, dem offenkundig sozial inkompetenten Zuckerberg menschliche Nähe abzuringen. Bevor sie den Raum verlässt, sagt sie, er sei gar kein Arschloch, tue aber alles, eines zu sein. Das Arschloch vom Anfang des Films wird in gewisser Weise abgeschwächt, aber in den Medien bleibt das Attribut an dem realen Mark Zuckerberg hängen.
Der reagierte gelassen auf den Film. In einer Talkshow wenige Tage vor dem Kinostart kommentierte er den Streifen knapp als »interessant, aber Fiktion«. Zugleich verkündete er, 100 Millionen Dollar für Schulen in der armen Region um Newark/New Jersey spenden zu wollen. Arbeitet Zuckerberg nun aktiv an seinem Ruf? Nach dem Film, der zu einem beträchtlichen Teil auf Aussagen von Zuckerbergs Weggefährten und Freund Eduardo Saverin beruht, der in dem Milliardenspiel um Facebook ausgebootet wurde und bereits in Ben Mezrichs Buch Milliardär per Zufall5 zu Wort kam, dürfte ihm dies schwerfallen.
In dem Film sagt Saverin zu Zuckerberg, er verliere den »einzigen Freund«, den er je hatte – ein für das Image eines Unternehmensgründers, der aufgebrochen ist, alle Welt zu »Freunden« zu machen, tödlicher Satz. Mark Zuckerberg war 19 Jahre jung, als er Facebook startete. Sieben Jahre später ist er 6,9 Milliarden Dollar schwer und kann eine Erfolgsgeschichte vorweisen, die Millionen Kinogängern gerührte Freudentränen in die Augen treiben könnte, wäre der Film anders, wären die Spuren aus seiner Vergangenheit einfach gelöscht worden.
Wie rette ich meinen Ruf?
Menschen, die sich Zuckerbergs Netzwerk Facebook anvertraut haben, geht es ähnlich. Sie stehen vor einem kaum zu lösenden Problem: unangenehme Spuren im Netz zu löschen. Jeden Monat stellen die Nutzer von Facebook drei Milliarden private Fotos und zehn Millionen Videos auf die Plattform. Die Chancen, dabei Fehler zu machen, stehen also nicht schlecht. Den einen werden Fotos von Jugendsünden bei ihrer ersten Bewerbung zum Verhängnis, andere schrieben Texte, die sie so nie wieder schreiben würden. Und wer sich früher für erotisch orientierte Facebook-Gruppen interessierte, hat womöglich später als Bankberater oder Topmanager ein Imageproblem. All diesen Menschen gemeinsam ist, dass sie glaubten, sich in einem »sozialen Netzwerk« frei bewegen zu können, bis sie plötzlich feststellten, dass sie sich damit im weltweiten Netz dauerhaft entblößt haben. Die Zahl der Menschen, die solche Fehler gemacht haben und nun ihre digitalen Spuren beseitigen wollen, wächst von Tag zu Tag.
Doch auch im digitalen Kapitalismus gibt es zum Glück Unternehmen, die diese Not zu Geld machen: Die neue Branche heißt Reputationsmanagement und kümmert sich darum, den im Internet angeschlagenen Ruf von Menschen wiederherzustellen. Christian Keppel arbeitet für die Agentur »Dein guter Ruf.de« in Essen. Täglich erreichen die Agentur rund 30 Anfragen von erschrockenen Internet-Nutzern oder, im Fall von Kindern und Jugendlichen, von verstörten Eltern, die Hilfe benötigen. Ich fragte Keppel, was er Zuckerberg raten würde, um sein Arschloch-Image loszuwerden. »Ich würde ihm vorerst zum Stillhalten raten«, sagte Keppel, »denn jede sofortige öffentliche Reaktion bedeutet noch höhere Aufmerksamkeit für diese unangenehmen Geschichten.« Allerdings würde er ihm auch raten, einen Anwalt zu beauftragen, der ohne großes Aufsehen gegen Beleidigungen und mögliche Falschdarstellungen vorgeht. Vermutlich braucht Zuckerberg aber keinen Reputationsberater, denn er hat fast alles richtig gemacht. Er gab keine Interviews zu dem Film und erzeugte zudem mit seiner Schulspende ein positives Echo in allen großen Medien.
Spurenbeseitigung ist ein lukratives Geschäft
Reputationsmanager können viel davon erzählen, was Menschen sich selbst zufügen, wenn sie ihr Privatleben im Netz entblößen. Nehmen wir beispielsweise die Geschichte von Harry Sorglos6, die den einen oder anderen, der einen solchen Zeitgenossen schon einmal erleiden musste, mit klammheimlicher Freude erfüllen mag. Harry hatte sich schon immer exzessiv amüsiert, was nicht weiter tragisch wäre, hätte er es nicht stets auf Kosten anderer getan. In letzter Zeit hat es der 38-Jährige wohl etwas zu bunt getrieben mit der Damenwelt, wofür er prompt die Quittung erhält. Einige der betroffenen Damen gründen eine Facebook-Gruppe mit seinem Namen und dem Attribut »Blender«. Das Profil-Foto präsentiert ihn als klassischen Goldkettchentyp mit offenem Hemd und Sonnenbrille. Es ist ein Foto aus seinem Facebook-Privatalbum, das für die gesamte Facebook-Gemeinschaft einsehbar ist. Auf der Pinnwand der Gruppe erfährt jedermann und jede Frau, dass er »der größte Angeber des Planeten« sei, dass er seinen weiblichen Opfern stets das sage, was sie hören wollten. Gern verspreche er Frauen zur Abwechslung einen coolen Job oder einen schicken Wochenendtrip, um sie ins Bett zu kriegen, was überhaupt sein einziges Trachten sei. Nicht gerade schmeichelhaft für den Gigolo, aber durchaus sachdienlich für seine potenziellen Opfer. Irgendwann muss dem Mann seine unvorteilhafte Netzpräsenz aufgefallen sein, denn er suchte die Reputationsmanager auf und investierte eine Stange Geld, die Gruppe zur Auflösung zu zwingen und die Einträge löschen zu lassen.
Die Geschichten aus dem Reich der Rufrettung beginnen meist bei Dingen, die Menschen auf Plattformen wie Facebook preisgeben, und enden nicht selten mit dem, was andere daraus machen. Manchmal trifft es auch Menschen, die gar nichts mit dem Internet zu tun haben. Ein Lehrer aus der Schweiz hatte das Problem vieler Lehrer. Er war gut drei Jahrzehnte älter als seine Schüler und hatte zwei »Schwächen«: Er lispelte und kämpfte mit einer feuchten Aussprache. Bei seinen Schülern scheint er aber auch aus anderen Gründen nicht sonderlich beliebt gewesen zu sein, sonst hätten sie sich kaum solche Mühe gegeben, ihm digital an den Kragen zu gehen. Sie gründeten eine »Fanpage«, eine »Fanseite«, für ihren Lehrer, samt einem Foto als Profilbild und einer Fülle von Aufnahmen, die ihn während des Unterrichts und bei einer Klassenfahrt zeigten. Allerdings versahen sie die »Fanseite« permanent mit üblen Kommentaren zu seinen Marotten und seinem Unvermögen, ordentlich zu unterrichten. Und auch die Bilder waren wenig schmeichelhaft. Da der Mann ansonsten im Netz kaum in Erscheinung trat, erschien seine Facebook-Fanseite bei Google schon an dritter Stelle – bei insgesamt fünf Treffern, denn Facebook hat ein gutes Ranking bei Google. Welche Schüler hinter der Aktion standen, fand der Mann nicht heraus, denn sie hatten die Seite unter einem Pseudonym gegründet. Also wandte er sich an die Essener Reputationsmanager, die das Löschen der Einträge veranlassten. Der Lehrer selbst war nicht einmal bei Facebook angemeldet.
Laut einer Online-Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aus dem Jahr 2008 waren acht Prozent aller Lehrer schon einmal Opfer einer Cybermobbing-Attacke, auf ganz Deutschland hochgerechnet wären das 50 000 Lehrer.7
Was immer wir getan haben, es holt uns ein
Wir entgehen unseren Taten nicht. Und selbst wenn wir nichts getan haben, kann es uns überrollen. So ergeht es seit vier Jahren einem jungen Pianisten aus dem Rheinland. Er spielt in einer mäßig erfolgreichen Profi-Band und verdient sein Geld ansonsten mit Musikunterricht. Irgendwann bemerkte er, dass Eltern den Unterricht für ihre Kinder plötzlich absagten. Er war ratlos, denn alle hatten sich bei den Vorspiel-Treffen stets zufrieden geäußert. Eine Mutter offenbarte ihm schließlich, dass etwas Schreckliches über ihn im Netz stehe. Bei seiner anschließenden Google-Recherche stieß er gleich auf der ersten Seite auf eine Facebook-Gruppe mit seinem Foto. Es war aber gewissermaßen nur zum Teil sein Foto, weil es ihn zeigte, wie er Adolf Hitler umarmte. Auch war auf der Seite vermerkt, er sei pädophil. Auf diese Weise versucht ein Stalker seit Jahren, ihn zu diskreditieren, und der Betroffene hat nicht die leiseste Ahnung, wer dahintersteckt. Um herauszufinden, woher der Stalker seine Fotos hatte, brauchte der Musiker allerdings nicht lange. Seit Jahren lädt er auf der Musiker-Plattform MySpace Bilder hoch und tauscht mit Freunden Songs aus. Aber irgendjemand dort draußen im Netz scheint ihn zu hassen, sodass er immer wieder für viel Geld die Reputationsmanager beauftragen muss, die Seiten löschen zu lassen. Aber der Stalker hat bis heute nicht aufgegeben.
Mit dem Löschen ist das aber so eine Sache. Jeder Facebook-Nutzer kann sein Konto sofort »deaktivieren«, wie es heißt. Wer glaubt, die Einträge seien damit unsichtbar, wiegt sich jedoch in falscher Sicherheit. Denn vieles findet sich bereits bei Google wieder und kann dort weiterhin aufgerufen werden. Und selbst löschen heißt bei Facebook nicht löschen. Der US-Blog Arstechnica.com berichtete im Oktober 2010, dass Fotos 16 Monate nach ihrer offiziellen Löschung noch immer nicht endgültig aus den Facebook-Servern getilgt waren. Die Autorin Jacqui Cheng fragte deshalb mehrfach bei Facebook an. Nachdem sie den Zustand öffentlich angeprangert hatte, löschte Facebook diese Fotos. Arstechnica-Leser Andrew Bourke berichtete daraufhin, dass es ihm seit zweieinhalb Jahren nicht gelungen sei, Fotos, die seinen Sohn halbnackt zeigten, bei Facebook löschen zu lassen. Facebook-Sprecher Simon Axton wurde schließlich mit den Worten zitiert, das Unternehmen arbeite daran, die Back-Up-Speicherung von gelöschten Fotos nach kurzer Zeit zu beenden. Das Muster ist immer das gleiche. Ein Skandal wird öffentlich, und Facebook beschränkt sich auf die Aussage, man arbeite an dem Problem.
DAS Kommunikationsunternehmen des 21. Jahrhunderts erweist sich auch für Reputationsmanager als äußerst unkommunikativ, wenn es darum geht, Einträge löschen zu lassen. »Bei Facebook hat es mit der ersten Anfrage noch nie geklappt«, sagt Reputationsmanager Christian Keppel. Eine Löschung durchzusetzen dauere in der Regel drei Wochen, Google brauche dagegen nur drei Tage, dort arbeite man in dieser Hinsicht »extrem professionell«.
Schmutzige Rache des Ex-Freundes
Facebook sollte sich ein Beispiel an der Pornobranche nehmen. Bei Löschanträgen sei diese sehr kooperativ und reagiere zügig, berichtet Keppel. Zum Beispiel im Falle einer jungen Lehrerin, die alles andere als exhibitionistisch veranlagt ist. Allerdings war ein Foto von ihr auf der Facebook-Seite ihres Sportvereins zu finden – im Jogginganzug. Das animierte ihren Ex-Freund dazu, ihr Gesicht herauszukopieren und es in ein Gruppensex-Foto hineinzumontieren. Auch fügte er dem Foto ihren Namen zu, sodass es über Google schnell zu finden war. So etwas geschieht häufiger, denn es ist der schnellste Weg, insbesondere Frauen und Mädchen zu diffamieren. Pornoportale beliefern sich gegenseitig mit Material oder kopieren voneinander. Für eine rasante Verbreitung verunglimpfenden Materials ist dadurch stets gesorgt.
Diese Erfahrung hätte beinahe auch ein 19-jähriger Schüler gemacht. Er hatte auf einer Partnerseite mit einer jungen, gut aussehenden Brünetten angebandelt. Zunächst chatteten die beiden ein paar Tage miteinander, danach schickten sie sich E-Mails. Irgendwann bat sie um ein Foto von ihm, was er ihr auch prompt schickte. Als die junge Dame kurz darauf anfragte, ob er kein »sexy Foto« von sich habe, schickte er eine Nacktaufnahme von sich aus dem Wohnzimmer. Er sah nun jeden Morgen und jeden Abend in seine Mails. Nichts geschah. Bis er eines Tages eine sehr ungemütliche Antwort erhielt. Seine angebliche Brünette forderte ihn auf, 50 Euro zu zahlen. Andernfalls werde sein Nacktfoto auf einer Facebook-Fanseite oder einer Gruppenseite mit seinem Namen erscheinen. »Es ist manchmal sprichwörtlich, der junge Mann dachte mit seinem gewissen Körperteil«, sagt Christian Keppel. »Oft sind es erst solche negativen Erfahrungen, die den Usern bewusst machen, was geschehen kann.« Menschen fänden sich nur zu gern im Internet wieder: »Sie verhalten sich wie Menschen, die vor jedem Spiegel stehen bleiben, um sich zu betrachten.«
Gerade Frauen machen sich oft einen Spaß daraus, sinnliche Fotos von sich in ihren Chatroom zu stellen. Es sind schöne Fotografien von schönen Frauen oder solchen, die es gerne wären. Aus ihnen spricht immer auch eine Spur Narzissmus und eben nicht nur das Verlangen nach sozialer Wärme und Anerkennung, wie sie uns das reale Leben vielleicht manchmal verweigert.
Falscher Glaube an die Glücksversicherung
Daniela Hein8 hat viel über Privatsphäre gelernt. Die 35-Jährige gehört zur großen Zahl der Jobnomaden, die berufsbedingt fast immer online sind. Ihr iPhone dient ihr als mobiles Büro. Sie ist bei Xing angemeldet, um als freie Übersetzerin für pharmazeutische Texte und als Pharmareferentin stets im Netz präsent zu sein. Mit einem verlegenen Lächeln gibt sie zu, die Suche nach männlichen Bekanntschaften sei ein Grund gewesen, auch Facebook zu nutzen. Zuvor war sie lange Jahre in dem Netzwerk MySpace aktiv, außerdem hat sie einen Studi-VZ-Account, der allerdings brachliegt, seit viele ihrer Freunde zu Facebook gewechselt sind. Ihren Ex-Freund Ralph hat sie trotzdem nicht über Facebook kennengelernt, sondern während einer Konzertnacht in der Berliner Kulturbrauerei. »Leider hat sich das nach vier Monaten wieder zerschlagen«, erzählt sie. Allerdings war Ralph ebenfalls bei Facebook und beide machten sich einen Spaß daraus, ihre gemeinsamen Erlebnisse und vor allem jede Menge Fotos auf ihren Seiten auszubreiten. »Es war wie ein Rausch, wir konnten nicht anders als all unseren Freunden zu zeigen, wie glücklich wir waren.« Ihre Freundeskreise waren sehr unterschiedlich, und es wäre übertrieben zu sagen, dass Daniela die Freunde von Ralph mochte. Irgendwann war es dann vorbei mit der Verliebtheit, und Ralph hatte auch schon wieder eine neue Flamme gefunden. Und diese neue Freundin, Madeleine, löcherte ihn wegen seiner gerade beendeten Beziehung mit Daniela.
Drei Monate nach ihrer Trennung besuchte Daniela Hein mit einer Freundin den Privatklub in Berlin-Kreuzberg. Als sie ein paar Minuten vor der Toilette wartete, tippte ihr jemand von hinten auf die Schulter. Sie drehte sich um. Vor ihr stand eine zierliche Frau in Minirock, schwarzen Netzstrümpfen und schwarzem Anorak. Die Frau sah ihr direkt in die Augen und sagte: »Endlich lerne ich dich kennen, Daniela.« Daniela dachte kurz an eine Verwechslung, dann fiel ihr in Sekundenbruchteilen ein, dass diese Frau gerade »Daniela« zu ihr gesagt hatte. Vor ihr stand Madeleine, die neue Freundin von Ralph. »Ich war geschockt, dass mich ein fremder Mensch einfach so kennt«, erzählt sie, »da ist mir bewusst geworden, dass wir auf Facebook so eine Art Teilprominenz bekommen.« Madeleine hatte sich die Fotogalerie von Ralph ausführlich angesehen, und dort wimmelte es nur so von Danielas.
Noch in derselben Nacht schrieb Daniela Hein ihrem Ex-Freund, er möge die Fotos bitte löschen. Sie selbst lud die Fotos auf ihren Rechner und löschte sie komplett aus ihrem Facebook-Account. Auf Facebook mag sie trotz dieses Vorfalls nicht verzichten. Sie ist davon überzeugt, dass die Menschen ihr Verhalten solchen Erfahrungen anpassen. »Es ist ein ständiges Lernen, aber es bringt gleichzeitig so viel Freude.« Ihren Beziehungsstatus »Auf der Suche nach Bekanntschaften« hat sie bislang nicht geändert, und bis jetzt seien alle, die ihr eine Mail geschickt hätten, ziemlich nett gewesen. Daniela Hein schätzt es, erst einmal »auf Distanz« bleiben zu können, wenn sie jemanden kennenlernt. Das sei auf Facebook einfacher als im realen Leben. So wie die Dinge liegen, kennt unsere Suche nach dem Glück auch im Netz keine Grenzen. Aber leider hält die Facebook-Welt ebenso wenig eine Glücksversicherung für alle bereit wie die wirkliche Welt.
Facebook tötet nicht, nur manchmal
Dass solche Geschichten aus dem Internet uns besonders erstaunen, mag an der Neuartigkeit dieses Mediums liegen. Wenn wir uns bequem zurückgelehnt einen Tatort im Fernsehen ansehen, müssen wir nicht fürchten, selber umgebracht zu werden. Wenn wir mit der gleichen Lässigkeit die Bühne des Internets betreten, können wir hingegen sehr wohl verletzt, gebrandmarkt oder getilgt werden wie im richtigen Leben. Denn was wir im Netz tun, ist nur ein Spiegelbild unseres realen Verhaltens, und uns treiben die gleichen Emotionen an wie im realen Leben. Verletzte Eitelkeit, Neid oder Hass lassen Menschen auch virtuell boshaft und verleumderisch agieren. Oder verleiten sie gar, Straftaten zu begehen. Im »echten« Leben mögen wir uns über Menschen freuen, die uns bewundern. Wir lieben das Gefühl der Gruppenzugehörigkeit, das Gefühl, dass andere Menschen unsere Interessen teilen. Auf Facebook kann das
Wort »Fan« oder »Gruppe« einen teuflischen Beigeschmack erhalten. Der scheinbar sichere Ort hinter dem eigenen Rechner verlockt Stalker und Mobber, im Netz zu tun, was sie im realen Leben niemals wagen würden: andere Menschen verletzen, entstellen, vernichten. Zumal sie wissen, dass sie niemanden »real« umbringen. Nur beinahe. Doch manchmal eben tatsächlich »real«.
Wenn Zeitungen über Cybermobbing berichten, fällt meist der Name Holly Grogan.9 Holly war 15 Jahre jung, als sie in der englischen Stadt Gloucester von einer Brücke in den Tod sprang. Ihre Eltern waren überzeugt davon, dass ihre Tochter im Internet gemobbt worden war und deshalb den Freitod gewählt habe. Holly Grogan war in drei sozialen Netzwerken aktiv, neben Facebook auch in MySpace und Bebo. Mehrere Mädchen hätten Holly auf ihrer Facebook-Seite dauernd beschimpft, berichteten Freunde von ihr. Aber dabei blieb es nicht: Auch in der Schule wurde sie stigmatisiert – ihr virtuelles und ihr reales Leben wurden ihr zur Hölle gemacht. Funktioniert mitunter die Flucht in virtuelle Welten, um der realen zu entfliehen, so versagte dieser ohnehin problematische Weg bei Holly. Das Mädchen fühlte sich umstellt.
Holly Grogan ist der dritte bekannt gewordene Selbstmord in zwei Jahren, der mit Cybermobbing, oder – wie es Experten nennen – Cyberbullying (to bully, engl.; drangsalieren) in Verbindung gebracht wurde. Der Spiegel schrieb dazu: »Der Online-Psychoterror wird zum Massenphänomen. Das Problem dabei: Die meisten Jugendlichen nehmen ihn nicht ernst genug – manche aber zerbrechen daran.«
Cybermobbing unter Schülern weit verbreitet
Bei einer nicht repräsentativen Umfrage unter Schülern befragten die Psychologinnen Stephanie Pieschl und Sina Urbasik von der Universität Münster 419 Schülerinnen und Schüler zu ihren Erfahrungen mit Cyberbullying.10 Sie erwarteten eine eher geringe Betroffenheitsquote, da die von ihnen befragte Gruppe relativ alt (im Durchschnitt 18 Jahre), hochgebildet (86% Gymnasiasten) und überwiegend weiblich (70%) war. Trotzdem gaben 35 Prozent der Befragten an, mindestens einmal in den letzten zwei Monaten Opfer von Cyberbullying geworden zu sein, von Beleidigungen und Gerüchten, die in ihren sozialen Netzwerken wie SchülerVZ oder auf Instant Messenger verbreitet wurden. Eine Schülerin berichtete laut Umfrage von einer nur schwer auszuhaltenden Attacke: »Ein Mädchen hat verbreitet, dass mein Freund mich zum Sex zwingen würde und hat erzählt, dass ich schwanger war und abgetrieben habe.«
Die zweite Zahl aus der Studie ist noch brisanter, denn sie zeigt, dass zu einem Phänomen mit so vielen Opfern auch viele Täter gehören, und manchmal sind Jugendliche beides zugleich: 55 Prozent der Befragten gaben an, im gleichen Zeitraum mindestens einmal als Täter aktiv gewesen zu sein. »Ich schicke vielleicht mal einer Freundin ein Bild, um ihr zu zeigen, wie dämlich dort jemand aussieht. Aber das ist eher nur ein Scherz. Ich mache das ja nicht, um jemanden bloßzustellen, sondern um Spaß zu haben«, wird ein Schüler zitiert. Die Grenzen zwischen Spaß und Ernst verschwimmen in dieser neuen Kommunikationskultur. Damit unterscheidet sich das Internet nicht von einer realen Gerüchteküche, von Intrigen und falschen Gerüchten, wie sie dort gang und gäbe sind. Dafür sprechen auch die Zahlen einer Studie der Kölner Sozialpsychologin Catarina Katzer. Fast 80 Prozent der Jugendlichen, die auf dem Schulhof oder in der Klasse mobben, täten dies, so Katzer, auch im Internet. Zugleich erlitten 63 Prozent der »realen« Mobbing-Opfer dasselbe im World Wide Web.11
Erfahrungsberichte aus der Welt des Schüler-Mobbings
Meine Söhne gehen auf ein gut organisiertes Gymnasium. Gewaltexzesse sind dort unbekannt, und der Unterrichtsalltag verläuft in ruhigen Bahnen. Ich wollte wissen, ob es auch dort ein zweites Leben im Internet gibt. Mein Sohn Max ist zwölf Jahre alt und seit gut einem Jahr in dem Netzwerk Schueler.CC angemeldet. Die meisten Schüler melden sich dort unter Pseudonymen an, um zu verhindern, dass ihre Daten außerhalb der Schule missbraucht werden. Eine vernünftige Praxis, die allerdings auch ihre Tücken hat. Max hat sich in der Schule umgehört. Eine Schülerin und ein Schüler berichteten ihm von ihren Erlebnissen. Ein Erfahrungsbericht aus dem Blickwinkel der jüngsten Internetgeneration12:
»Als ich online war, hab ich eine unglaubliche und gar nicht gute Entdeckung gemacht. Aus meinen 77 eingeladenen Freunden wurden erst 50, und eine halbe Stunde später waren es nur noch 45. Ich wollte deshalb mit meiner Freundin Susi chatten und sie fragen, was das soll. Sie antwortete nicht. Und entfernte mich als Freundin. Ich schickte ihr eine E-Mail und fragte, was denn mit ihr los sei, weil, sie ist ja immer noch meine beste Freundin oder vielleicht auch gewesen. Sie antwortete nicht. Als ich sie am nächsten Tag in der Schule fragte, sagte sie mir dann direkt ins Gesicht, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben wolle und dass sie mich bei Schueler.CC ignoriert habe. Sie hatte Tränen im Gesicht und sagte, dass sie mit Sicherheit nicht mehr meine beste Freundin oder überhaupt meine Freundin sei, nachdem ich angeblich nur Dreck über sie erzählt hätte. Sie ging weg, ja sie rannte schon beinahe weg. In dem Moment kam mein Kumpel Jordan auf mich zu und fragte, warum ich denn so geschockt aussähe. Ich erzählte ihm alles. Er sagt: »Ich hab dasselbe auch mal erlebt, das ist ein Mensch, der mobbt dich und erzählt überall Sachen, die gar nicht stimmen, das nennt man ›Cybermobbing‹«. Ich loggte mich am Abend wieder bei Schueler. CC ein und sah, dass ich eine neue E-Mail hatte. Ich klickte auf die Schaltfläche ›Posteingang‹ und dann auf die Nachricht von Jordan. Darin stand, dass er sich, nachdem ich ihm alles erzählt hatte, mal schlau gemacht und für mich rausgefunden habe, wer diese Lügen über mich schreibt: einer mit dem Schueler.CC-Kürzel ›xdaka-/- profipro‹. Ich suchte nun selbst das Profil von ›xdaka-/-profipro‹. Ich fand es, aber es war ein Profil ohne irgendwelche Angaben wie Beziehungsstatus, Freunde, Hobbys, Wohnortangaben oder ein Profilbild. Und sein Status war ›off‹. Ich klickte dann bei ihm rechts im Profil auf ›Neue E-Mail schreiben‹. Ich schrieb: ›Hallo xdaka-/-profipro, ich wollte dich mal fragen, was der ganze Unfug soll?!? Ich weiß ganz genau, wer du bist und was du tust, und wenn du damit nicht aufhörst, werde ich die Polizei auf dich hetzen und dein Profil in der Schueler.CC-Zentrale als falsch anzeigen!‹ Das war natürlich geflunkert. Denn ich wusste nichts über ihn. Nebenbei sah ich, dass Jordan online war. In dem Augenblick, als ich die Nachricht verschickt hatte, war Jordan plötzlich ›off‹. Gleichzeitig ging nun aber dieser ›xdaka …‹ online. Da wurde mir klar: Jordan war auch ›xdaka-/-profipro‹. Er war es, der nur Dreck über mich erzählt hatte. Das bewies er mir auch am nächsten Tag. Er lief an mir vorbei. Ich wollte mit ihm reden und er rannte weg.«
Unter Schülern hat sich zwar längst herumgesprochen, dass man im Netz nicht zu viele private Daten preisgeben sollte. Aber dass zu den schützenswerten Dingen vor allem das eigene Passwort gehört, musste ein Schüler auf äußerst unangenehme Art erst noch lernen:
»›Ein neuer Statuskommentar‹ stand rechts in der Liste mit Neuigkeiten. Ich klickte darauf, und darin verkündete ein Mädchen, das ich nicht kannte: ›Ich bin dabei!!!‹ Ich war neugierig und guckte in meinem Profil nach, was sie denn da kommentiert haben könnte. Ich fiel fast vom Stuhl. Da stand doch tatsächlich unter ›Über mich‹ in meinem eigenen Profil: ›Ich bin ein Junge, und ich bin lesbisch, das geht. Ich möchte andere Lesben gerne in einer Woche zu mir nach Hause einladen, zum Lesbentreffen.‹ Ich war richtig wütend darüber, weil ich das nicht geschrieben hatte. Ich weiß aber, wer es war. Es war Tom, mein jetzt nicht mehr bester Freund, aber irgendwie war es auch meine eigene Schuld. Wieso musste ich ihm auch mein Passwort geben. Na ja, ich dachte, er ist doch meine bester Freund, das war dann wohl zu viel Vertrauen. Ich löschte ihn als Freund und änderte sofort mein gefälschtes Profil und natürlich mein Passwort.«
In ihren Studien kommt Catarina Katzer mit ihren Kollegen zu dem Ergebnis, das zwischen 30 und 40 Prozent aller 10 – bis 19-jährigen entweder als Täter oder als Opfer mit Cyberbullying oder Cybermobbing zu tun haben. Im Unterschied zum Mobbing im realen Leben sei einem Teil der Täter aber oft nicht bewusst, was sie anrichten. »Sie sehen ihr Opfer nicht und können so weder an der Gestik, Mimik noch an Worten erkennen, dass ihr Opfer verletzt ist. Dementsprechend fällt es ihnen natürlich auch leichter, zum Täter zu werden«.
Die technischen Fertigkeiten der Computerkids sind inzwischen so ausgefeilt, dass selbst Erwachsene auf ihre Manipulationen hereinfallen, wie der Fall einer 14-jährigen Schülerin zeigt. Offenbar waren die Täter irgendwie an das Facebook-Passwort des Mädchens gelangt, denn sie entfernten ihr Profilbild und ersetzten es durch eine Fotomontage. Sie zeigte das Gesicht des Mädchens über einen erigierten Penis gebeugt. Entsprechend änderten die Täter auch die Angaben zu ihren (sexuellen) Vorlieben. Anschließend kopierten sie das manipulierte Profil und verschickten es an Lehrer und alle ihre Freunde und Bekannten. Der nächste Schultag war eine Hölle für die 14-Jährige, denn schon auf dem Schulhof wurde sie als Schlampe, Hure und Nutte beschimpft. Niemand sah sie an, als sie die Klasse betrat. Eine Freundin erzählte ihr dann, was passiert war, aber zunächst wollten selbst die Eltern des Mädchens die Geschichte nicht glauben, weil das Profilbild täuschend echt wirkte.
Leider gebe es gerade unter männlichen Jugendlichen eine »Art Trophäenjagd, wer die schönsten und geilsten Aufnahmen seiner Freundin hat«, berichtet Katzer. Und vom Handy bis ins weltweite Netz ist es nur ein Mausklick. So erging es einer 15-Jährigen aus der Nähe von Köln. Ihr Freund hatte sie gefragt, ob er beim Sex ein Video von ihnen drehen dürfe. Sie hatte nichts dagegen. Dass dieses Video nach der Trennung von diesem Freund im Netz landen würde, hätte sie natürlich nie vermutet. Das Filmchen machte so schnell die Runde an ihrer Schule und im gesamten Dorf, dass die Eltern beschlossen, mit ihrer Tochter wegzuziehen.
Abu Ghraib an deutschen Schulen
Das Internet macht uns nicht nur zu Publizisten unserer privaten Wirklichkeit, es macht uns auch zu Kameraleuten. Und die Möglichkeit, alles und jedes in »Echtzeit« aufzunehmen und ins Netz zu stellen, weckt bei manchen die niedrigsten Instinkte. Das irakische Gefängnis Abu Ghraib, in dem US-Soldaten Häftlinge erniedrigten und ihre Misshandlungen per Video dokumentierten, lässt grüßen. So erzählt Catarina Katzer von einem 15-jährigen Jungen, den seine Mitschüler auf der Schultoilette auszogen. Anschließend hätten sie ihn mit dem Kopf in die Kloschüssel gedrückt und seinen nackten Körper mit Wasser bespritzt. Das mit einem Handy gedrehte Video von der Tortur sei später herumgeschickt worden und schließlich auf der Seite einer Facebook-Gruppe gelandet.
81 Prozent der 14- bis 19-Jährigen sind laut der aktuellen Online-Studie von ARD und ZDF in digitalen sozialen Netzwerken wie SchülerVZ, Schueler.CC oder Facebook aktiv.13 Zur Anerkennung in der Schulklasse gehört längst auch die Netzpräsenz. »Das Netz wird aus meiner Sicht immer mehr zum Sozialisationsmedium«, so Katzer. »Wenn Jugendliche nicht in sozialen Netzwerken sind, sind sie out und das nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern sie gelten auch unter Schulfreunden in der realen Welt als Outsider.«
Aus diesem Grund sehen Opfer von Cyberbullying häufig alle »Fluchtwege« versperrt. Denn wer sich abschaltet, stellt sich noch weiter ins Abseits. Und trotzdem ist dies im Zweifel der sinnvollste Ausweg für Menschen, die dem Druck nicht länger standhalten. Die digitale Gesellschaft hat längst ein dichtes Netz aus psychosozialen Kontrollmechanismen über alle gespannt, die sich mit ihren Profilen im Internet präsentieren. Und natürlich steigert das die Erwartungen an die Ehrlichkeit. Wo man früher bei einer Bewerbung unrühmliche Lebens- oder Berufsphasen einfach weglassen konnte, ohne dass es auffiel, hat der digitale Mensch dazu keine Chance. Es kommt heraus, spätestens wenn irgendein versierter Personalchef via Google nach Informationen über einen Bewerber zu suchen beginnt. Entziehen kann sich dem nur, wer nichts oder kaum etwas von sich preisgibt. Die vielen Berichte über Cybermobbing haben auch Facebook zu Reaktionen bewogen. Das Unternehmen bemüht sich nun durch Medienkampagnen, etwa in Großbritannien, auf die Risiken hinzuweisen sowie für Eltern, Schüler und Lehrende Informationsmaterial auf seinen Online-Seiten bereitzustellen. Darin werden vor allem Jugendliche aufgefordert, keine Freundschaftsanfragen von Fremden anzunehmen, Belästigungen zu melden und ihre Seiten für Mobber zu blockieren. In Deutschland allerdings ist von diesen Bemühungen noch nicht viel zu spüren.
Im Jahr 2010 wurde hierzulande vor allem viel über die Privatsphäre diskutiert. Es ging um die Frage, in welchem Ausmaß globale Internetkonzerne sich unsere privaten Daten aneignen dürfen. Was zu wenig diskutiert wurde, war die Frage, warum wir den Netzwerken dieser Konzerne bereitwillig so viel Privates übereignen. Mögliche Motive dafür gibt es viele, und sie müssen sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Es kann unsere Sehnsucht nach Kontakt sein, vielleicht auch pure Langeweile oder die Faszination der neuen Technologie, die unser Privatleben umfassend verwaltet und vernetzt. Zuweilen ist es auch Geltungsbedürfnis und manchmal schiere Dummheit.
Zerplatzte Jobträume
Wie unbedarft sich manche Menschen im Internet verhalten, zeigt das Beispiel eines IT-Experten. Nachdem er die letzte Bewerbungsrunde eines großen Kommunikationskonzerns erfolgreich überstanden hatte und unter zehn Bewerbern als neuer Leiter der Technologie-Sparte ausgewählt worden war, bezog er sein modernes, helles Büro mit eigener Sekretärin und genoss das wohlige Gefühl, endlich am Ziel seiner Träume angekommen zu sein. Die Freude währte indes nicht lange. Denn schon nach vier Tagen war die Sekretärin gar nicht mehr so nett wie am Anfang, und