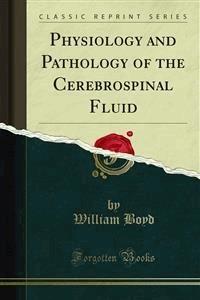11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein Klick, die Blende schließt – der Startschuss zu einem neuen Leben. Mit sieben hält Amory Clay ihre erste Kamera in Händen, eine Kodak Brownie Nummer 2, und mit ihr sind alle Weichen gestellt. Amory Clay, Fotografin, Reisende, Kriegsberichterstatterin. Statt als Gesellschaftsfotografin in London zu reüssieren, lässt Amory alles Vertraute hinter sich und beginnt 1931 ein Leben voller Unwägbarkeiten in Berlin. Ein Berlin der Nachtclubs, des Jazz, der Extravaganz und Freizügigkeit – und der ersten Anzeichen von Bedrohung und Willkür. Amory Clay, eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist, die unerschrocken ihren Weg geht, ihre Lieben lebt, ihre Geschicke selbst in die Hand nimmt. Tief fühlt sich William Boyd in sie ein und versteht es glänzend, Fiktion und Geschichte miteinander zu verschränken: das ausschweifende Berlin der frühen dreißiger Jahre, New York, wo sie den Mann trifft, der alles verändert, das Paris der Besatzungszeit. Nach »Ruhelos« hat Boyd erneut eine unvergessliche Heldin geschaffen, eine verwegene, verblüffend moderne Frau, einen Künstlerroman, der das Porträt einer ganzen Epoche zeichnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Übersetzung aus dem Englischen von Patricia Klobusiczky und Ulrike Thiesmeyer
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-8270-7884-1
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Sweet Caress bei Bloomsbury Publishing Plc; London
© 2015 William Boyd
Für die deutsche Ausgabe © Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München / Berlin 2016
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
FÜR SUSAN
Quelle que soit la durée de votre séjour sur cette petite planète, et quoi qu’il vous advienne, le plus important c’est que vous puissez – de temps en temps – sentir la caresse exquise de la vie.
Wie lange man auch auf diesem kleinen Planeten verweilen mag, was immer einem dabei widerfahren mag, das Wichtigste ist, dass man dann und wann empfänglich ist für die sanfte Liebkosung des Lebens.
JEAN-BAPTISTE CHARBONNEAU,Avis de Passage (1957)
PROLOG
Was hat mich dorthin gezogen, frage ich mich, ans Ende des Gartens? Ich erinnere mich an das Sommerlicht, an das Grün der Bäume, der Sträucher, des Rasens, das im Schein der weichen, wohlwollenden Nachmittagssonne leuchtete. War es das Licht? Doch da war auch noch das Gelächter, vom Teich her, wo ein Grüppchen Leute beisammenstand. Jemand hatte wohl herumgeblödelt und alle zum Lachen gebracht. Es waren das Licht und das Lachen.
Ich war im Haus, in meinem Zimmer, und langweilte mich. Durch das offene Fenster konnte ich die Stimmen der Gäste hören, die sich angeregt unterhielten, und dann das plötzlich aufbrandende Arpeggio fröhlichen Gelächters, das mich veranlasste, vom Bett aufzustehen und ans Fenster zu gehen, um zu den Herren und Damen hinunterzuschauen, zu dem Festzelt und den mit Appetithäppchen und Bowleschüsseln eingedeckten Tischen. Ich wurde neugierig – warum machten sich von dort nun alle auf den Weg zum Teich? Was war der Anlass dieser Heiterkeit? Also lief ich eilig nach unten, um mich ihnen anzuschließen.
Und dann, mitten auf dem Rasen, machte ich noch einmal kehrt und lief zurück ins Haus, um meine Kamera zu holen. Wieso, wie kam ich auf die Idee? Heute, all diese Jahre später, glaube ich eine Ahnung zu haben. Ich wollte den Augenblick einfangen, diese freundliche Zusammenkunft im Garten an einem warmen Sommerabend in England; ihn einfangen und für alle Zeit fixieren. Irgendwie wusste ich, dass es in meiner Macht stand, die unerbittlich verrinnende Zeit anzuhalten und diese Szene, diesen Bruchteil einer Sekunde auf einem Foto zu bannen – mit den Damen und Herren in ihrer vornehmen Kleidung, die gerade so sorglos und unbekümmert lachten. Ich würde sie einfangen, für immer, dank der Fähigkeiten meines Wunderapparats. In meinen Händen lag die Macht, die Zeit anzuhalten; so dachte ich zumindest.
ERSTES BUCH1908–
1. MÄDCHEN MIT KAMERA
Wenn ich es recht bedenke, wurde schon am Tag meiner Geburt ein Fehler gemacht. Heute scheint es nicht mehr weiter von Belang, meine Mutter aber war darüber am 7.März 1908 – wie lange das schon her ist, fast siebzig Jahre – sehr erbost. An jenem Tag also kam ich zur Welt, und mein Vater musste auf strenges Geheiß meiner Mutter eine Geburtsanzeige in der Times aufgeben. Ich war ihr erstes Kind, also wurde die Welt, sprich: die Leserschaft der Londoner Times, pflichtschuldig über die Ankunft des neuen Erdenbürgers in Kenntnis gesetzt. »7.März 1908, Beverley und Wilfreda Clay, ein Sohn, Amory.«
Warum hat er »Sohn« angegeben? Um seine Frau zu ärgern, meine Mutter? Oder kam darin der unterdrückte Wunsch zum Ausdruck, ich möge kein Mädchen sein, weil er keine Tochter wollte? Ist das der Grund, frage ich mich, warum er mich später umzubringen versuchte? Als ich in einem Sammelalbum auf den alten, vergilbten Zeitungsausschnitt stieß, war mein Vater schon seit Jahrzehnten tot. Zu spät, ihn danach zu fragen. Ein weiterer Fehler.
Beverley Vernon Clay, mein Vater – Ihnen und seinen wenigen Lesern (die meisten längst verstorben) aber fraglos besser bekannt als B.V. Clay, Verfasser von Kurzgeschichten zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts – hauptsächlich Spuk- und Schauergeschichten–, gescheiterter Romanautor und Universalliterat. Geboren 1878, gestorben 1944. Der Eintrag über ihn im Oxford Companion to English Literature (dritte Auflage) lautet wie folgt:
Clay, Beverley Vernon
B.V. Clay (1878–1944). Autor von Kurzgeschichten. Gesammelt in Eine undankbare Aufgabe (1901), Das unheilvolle Wiegenlied (1905), Heimliche Vergnügen (1907), Der Freitags-Club (1910) u.a. Bänden. Er ist der Verfasser etlicher phantastischer Erzählungen, von denen »Die Belladonna-Wohltat« am bekanntesten ist. Sie wurde von Eric Maude (s.d.) für die Bühne bearbeitet und im Londoner West End über eine Laufzeit von gut drei Jahren über 1000-mal aufgeführt (siehe Edwardianisches Theater).
Macht nicht viel her, nicht wahr? Nicht eben viele Worte, um ein so verwickeltes, schwieriges Leben zusammenzufassen, aber wohl immer noch mehr, als über die meisten von uns in den diversen Annalen der Nachwelt zu lesen sein wird, die unseren flüchtigen Aufenthalt auf diesem kleinen Planeten verzeichnen. Lustigerweise ging ich immer davon aus, dass über mich, die Tochter B.V. Clays, wohl nie etwas geschrieben würde, was sich jedoch als Irrtum herausstellen sollte…
Nun, wie dem auch sei. Ich habe zwar frühe Kindheitserinnerungen an meinen Vater, begann ihn aber erst nach seiner Heimkehr 1918 aus dem Krieg – dem Großen Krieg – richtig kennenzulernen, mit zehn Jahren, als ich mich bereits ansatzweise zu der Person und Persönlichkeit entwickelt hatte, die ich heute bin. Die durch den Krieg entstandene zeitliche Lücke blieb natürlich nicht ohne Auswirkungen, und auch er, das haben mir seither alle bestätigt, war bei seiner Rückkehr nicht mehr derselbe, war durch seine Erlebnisse unwiderruflich verändert worden. Ich wollte, ich hätte ihn vor diesem Trauma besser gekannt – und wer wünschte sich nicht, in die Vergangenheit zurückreisen zu können und die eigenen Eltern kennenzulernen, ehe sie in die Elternrolle schlüpften? Ehe sie als »Mutter« und »Vater« zu mythischen Figuren im Kosmos der Familie wurden, für immer und ewig eingeschlossen und fixiert im Bernstein jener Bezeichnungen und aller damit einhergehender Konsequenzen?
Die Familie Clay.
Mein Vater: B.V. Clay (geb. 1878)
Meine Mutter: Wilfreda Clay (geborene Reade-Hill, geb. 1879)
Ich: Amory, die Erstgeborene, ein Mädchen (geb. 1908)
Schwester: Peggy (geb. 1914)
Bruder: Alexander, von jeher Xan genannt (geb. 1916)
Die Familie Clay.
*
BARRANDALE-JOURNAL 1977
Ich war auf der Rückfahrt von Oban nach Barrandale, im spukhaften Dämmerlicht eines schottischen Sommerabends, als mir eine Wildkatze ins Auge fiel, die quer über die Straße lief, keine zweihundert Meter vor der Brücke, die zu der Insel hinüberführt. Ich hielt sofort an und schaltete den Motor aus, blickte nach vorn und wartete. Die gemächlich dahinschleichende Katze hielt inne und wandte mir den Kopf zu, beinahe hochmütig, als fühlte sie sich durch mich gestört. Ich griff reflexhaft nach der Kamera, meiner alten Leica, hob sie ans Auge – und ließ sie wieder sinken. Es gibt keine langweiligeren Fotos als Tierfotos – wage ich zu behaupten. Ich sah zu, wie die getigerte Katze, die so groß war wie ein Cockerspaniel, ihre Straßenüberquerung beendete und in das neu angepflanzte Nadelgehölz verschwand. Dann ließ ich den Motor wieder an und setzte, seltsam beschwingt, die Heimfahrt zum Cottage fort.
Ich nenne es »das Cottage«, seine genaue postalische Anschrift aber lautet 6, Druim Rigg Road, Barrandale Island. Wo sich die Hausnummern 1 bis 5 befinden, entzieht sich meiner Kenntnis, denn das Cottage steht ganz allein an der kleinen Bucht, an der die Druim Rigg Road endet. Es ist ein zweistöckiges Haus, erbaut um 1850, mit soliden, dicken Mauern, kleinen Zimmern, zwei Schornsteinen und von einstöckigen Nebengebäuden links und rechts flankiert. Vermutlich hat hier jemand vor hundert Jahren mal das Land bewirtschaftet, aber davon ist heute nichts mehr zu sehen. Die geschindelten Dächer sind grün bemoost, und die mit Beton verschalten Mauern, die sich im Lauf der Zeit zu einem unschönen Graugrün verfärbt hatten, habe ich bei meinem Einzug schneeweiß tünchen lassen.
Es steht direkt an der kleinen, namenlosen Bucht, und wenn man sich nach links wendet, nach Westen, kann man die Südspitze von Mull sehen und den windgepeitschten, endlosen grauen Atlantik dahinter.
Das Cottage auf Barrandale Island, vor der Renovierung und noch ohne neuen Anstrich, um 1960
Ich trat durch die Haustür, und Flam, mein schwarzer Labrador, begrüßte mich mit einem kurzen, tiefen Bellen, wie jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. Nachdem ich meine Einkäufe verstaut hatte, ging ich ins Wohnzimmer, um einen Blick aufs Feuer zu werfen. In die Kaminnische habe ich einen großen Stubenofen mit Glastüren einbauen lassen, in dem ich Torfbriketts verbrenne. Das Feuer war schon ziemlich heruntergebrannt, deshalb legte ich frische Briketts nach. Mir gefiel die Vorstellung, statt Kohle Torf als Brennstoff zu verwenden – als würde ich uralte Landschaften verbrennen, ganze Zeitalter und Erdschichten, die sich in Asche verwandelten, während sie mein Haus heizten und mir zu Warmwasser verhalfen.
Es war noch hell, also rief ich Flam und stapfte mit ihm zur Bucht hinunter. Während Flam an der Flutgrenze und den Gezeitentümpeln herumstöberte, stand ich an dem kleinen, sichelförmigen Strand und beobachtete, wie der Tag in den Abend überging. Bestaunte die wundersamen Farbwandlungen, wie rotglühendes Orange an der Messerschneide des Horizonts unmerklich, wie von einem Dimmer gesteuert, in Eisblau übergehen kann, und lauschte dabei dem Rauschen des Meeres, das unentwegt um Stille zu heischen schien – schh, schh, schh.
*
Zur Zeit meiner Geburt, im edwardianischen England, war »Beverley« ein vollkommen statthafter Männername (wie Evelyn, wie Hilary, wie Vivian). Hat mein Vater womöglich auch deswegen einen so androgynen Namen für mich gewählt: Amory? Namen sind bedeutsam, meiner Ansicht nach, sie sollten nicht leichtfertig vergeben werden – der eigene Name ist wie ein Etikett, das einen einordnet, klassifiziert, er bildet den Begriff, den man von Anfang an von sich selbst hat. Was könnte wichtiger sein? In meinem Leben bin ich nur einem einzigen weiteren Amory begegnet, und es war ein Mann – ein langweiliger Mann noch dazu, fade und reizlos, da half auch der interessante Name nichts.
Mein Vater war bereits im Krieg, als meine Schwester geboren wurde, deshalb zog meine Mutter bei der Namenswahl für dieses neue Kind ihren Bruder zu Rate, meinen Onkel Greville. Gemeinsam entschieden sie sich für etwas »Schlichtes, Solides«, so wurde es jedenfalls in unserer Familie erzählt, und so erhielt die zweite Tochter der Clays den Namen »Peggy« – nicht Margaret, sondern von vornherein die verniedlichte Koseform. Vielleicht war es eine Art Konter meiner Mutter zu »Amory«, dem androgynen Namen, bei dem sie nicht hatte mitreden dürfen. So also kam Peggy in die Welt – Peggy, die Schlichte, Solide. Nie hat wohl ein Kind einen weniger passenden Namen erhalten. Als mein Vater auf Fronturlaub nach Hause kam, um seine inzwischen sechs Monate alte jüngste Tochter zu begrüßen, war der Name jedenfalls fest etabliert, wir kannten sie wahlweise als »Peg«, »Peggoty« oder »Peggsy«, und er konnte nichts mehr daran ändern. Er konnte den Namen nie leiden, und dass er mit Peggy weniger liebevoll umging, fast so, als wäre sie eine Art Findelkind, das wir bei uns aufgenommen hatten, hing, glaube ich, direkt mit seiner Aversion gegen ihren Namen zusammen. Was veranschaulichen mag, was ich mit der Bedeutsamkeit von Namen gemeint habe. Hatte Peggy das Gefühl, den falschen Namen zu tragen, weil ihr Vater ihn oder sie nicht sonderlich leiden konnte? War ihr Name ein weiterer Fehler? Hat sie ihn deswegen später geändert?
Was Alexander betrifft, »Xan«, auf diesen Namen haben sie sich einvernehmlich geeinigt. Der Vater meiner Mutter, ein Amtsrichter, der bereits verstorben war, als ich zur Welt kam, hatte Alexander geheißen. Mein Vater war es, der von Anfang an die Kurzform Xan benutzte, und dieser Rufname bürgerte sich ein. Amory, Peggy und Xan also, damit waren wir komplett – die Kinder der Familie Clay.
In meiner frühesten Erinnerung an ihn steht mein Vater kopf, im Garten von Beckburrow, unserem Haus unweit von Claverleigh, in East Sussex. Dieses Kunststück beherrschte er mühelos, er hatte es sich als Junge beigebracht. Jedes Stück Rasen war ihm recht, um sich in den Handstand zu schwingen und sogar ein paar Schritte auf den Händen zu laufen. Nach seiner Verwundung im Krieg allerdings machte er das immer seltener, wie inständig wir ihn auch darum baten. Er bekomme Kopfweh davon und ihm verschwimme alles vor den Augen. Als wir noch klein waren, bedurfte er keiner langen Überredung. Er stand gern kopf, erklärte er, weil es seine Sinne schärfte, seine Wahrnehmung der Welt. »Ich sehe euch Mädchen von den Füßen hängen wie Fledermäuse«, sagte er gern, während er Handstand machte, »und ihr tut mir leid, o ja, in eurer verkehrten Welt. In der die Erde oben und der Himmel unten ist. Ihr armen Mäuse.« Nein, nein, kreischten wir dann immer aufgeregt zurück, nein – du stehst doch verkehrt herum, Papa, nicht wir!
Ich erinnere mich daran, wie er nach Xans Geburt in Uniform nach Hause kam, auf Urlaub. Xan war drei oder vier Monate alt, es muss also Ende des Jahres 1916 gewesen sein. Xan kam am 1.Juli 1916 zur Welt, dem ersten Tag der Schlacht an der Somme. Es ist die einzige Erinnerung, in der ich meinen Vater als Soldaten vor mir sehe, in seiner Uniform – Captain B.V. Clay, DSO. Es ist anzunehmen, dass ich ihn noch bei anderen Gelegenheiten in Uniform gesehen habe, aber dieser Urlaub hat sich mir besonders eingeprägt, vermutlich wegen der Geburt des kleinen Xan und weil mein Vater seinen Sohn mit einem merkwürdig starren Ausdruck im Gesicht auf dem Arm hielt.
Was den Namen seines dritten Kindes betraf, hatte er anscheinend genaue Anweisungen hinterlassen: Ein Junge sollte Alexander heißen; ein Mädchen Marjorie. Woher ich das weiß? Weil ich Xan mitunter, wenn ich ihm böse war und ihn aufziehen wollte, »Marjorie« nannte, woraus ich schließe, dass das allgemein bekannt war. Alle Familiengeschichten, persönlichen Geschichten, scheint mir, sind so skizzenhaft und vage wie die Geschichte der Phönizier. Wir sollten alles aufzeichnen, die klaffenden Lücken auffüllen, so gut es eben geht. Genau zu diesem Zweck, meine Lieben, bringe ich dies hier zu Papier.
Der Mann, den wir während des Krieges am häufigsten sahen und der zeitweilig sogar bei uns in Beckburrow wohnte, war der jüngste Bruder meiner Mutter, Greville – mein Onkel Greville. Greville Reade-Hill war Foto-Aufklärer bei der britischen Luftwaffe gewesen und eine Art lebende Legende, weil er vier Abstürze unversehrt überstanden hatte, bis er beim fünften Absturz einen fünffachen Knochenbruch im rechten Bein erlitt und als dienstunfähig ausgemustert wurde. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er in seiner Uniform in Beckburrow herumhumpelte. Und dann modelte er sich zu Greville Reade-Hill, dem Gesellschaftsfotografen, um. Es missfiel ihm, als »Gesellschaftsfotograf« bezeichnet zu werden, obwohl es genau seiner Tätigkeit entsprach. »Ich bin Fotograf«, sagte er gern mit gekränktem Unterton, »nicht mehr und nicht weniger.« Greville – ich sagte nie Onkel zu ihm, das wollte er nicht – stellte für mein Leben unwissentlich die Weichen, als er mir 1915 zu meinem siebten Geburtstag eine Kodak Brownie No.2 schenkte. Dies hier ist das erste Foto, das ich je gemacht habe. Greville Reade-Hill. Ich will ihn mir vor Augen rufen, kurz nach dem Krieg, als seine Karriere, nach schleppendem Beginn, allmählich Fahrt aufnahm, wie ein halbgefüllter Wasserstoffballon, den es unaufhaltsam aufwärtstreibt. Er war groß, breitschultrig und sah gut aus, bis auf einen einzigen Schönheitsmakel – eine etwas zu große Nase. Die Reade-Hill-Nase, nicht die Clay-Nase (ich habe ebenfalls die Reade-Hill-Nase). Mit einer etwas größeren Nase, da sind Greville und ich uns immer einig gewesen, sieht man interessanter aus – wer will schon konventionellen Schönheitsidealen entsprechen? Ich nicht. Nein danke.
Im Garten von Beckburrow, Sommer 1915
Viel ist mir von jenem ersten Foto nicht in Erinnerung geblieben – von jenem denkwürdigen ersten Klicken der Blende, das sozusagen den Startschuss für mein restliches Leben darstellte. Es war eine Geburtstagsfeier, die meiner Mutter, glaube ich. Ich meine mich auch an ein Festzelt zu erinnern, das zu diesem Anlass im Garten aufgebaut worden war. Greville hatte mir gezeigt, wie man den Film in die Kamera lädt und wie man sie bedient – es war kinderleicht: Schau hinab in das durchsichtige Viereck des Suchers, wähle dein Ziel aus und drück den kleinen Hebel an der Seite nach unten. Klick. Spul den Film weiter und mach noch ein Foto.
Ich hörte das Gelächter im Garten und lief ins Haus zurück, um die Kamera zu holen, flitzte über den Rasen und richtete das Objektiv auf die Damen in ihren Hüten und langen Kleidern, die auf die Birken zuschlenderten, die den Blick auf den Teich verstellten.
Klick. Ich machte mein Foto.
Meine übrigen Erinnerungen an jenen Tag aber haben mehr mit Greville zu tun. Was sich mir am tiefsten eingeprägt hat, als er neben mir kauerte und mir zeigte, wie die Kamera funktioniert, war der Duft der Pomade oder des Makassar-Öls in seinem Haar – ein Duft nach Jasmin und Vanille. Kann sein, dass er »Rowland’s Macassar« benutzte. Er achtete sehr auf eine gepflegte Erscheinung und kleidete sich mit großer Sorgfalt, als würde er immer auf dem Präsentierteller sitzen oder, jetzt, wo ich darüber nachdenke, als wäre er im Begriff, fotografiert zu werden. Vielleicht ist das die Erklärung – als jemand, der Leute in ihrem besten Aufzug fotografierte, entwickelte er ein verstärktes Bewusstsein dafür, wie er selbst aussah, was für ein Bild er abgab. Ich glaube, ich habe ihn niemals ungepflegt oder zerzaust gesehen, bis auf einmal … Aber darauf kommen wir beizeiten zu sprechen.
Beckburrow, East Sussex, unser Zuhause. Geboren wurde ich allerdings in London, in Hampstead Village, wo wir in einer Maisonette-Wohnung im Well Walk zur Miete wohnten, nur hundert Meter vom Heath entfernt. Als ich zwei war, zogen wir aus Hampstead fort, weil mein Vater dank der Tantiemen aus der von Eric Maude erstellten Bühnenfassung seiner Erzählung »Die Belladonna-Wohltat« vorübergehend zu Wohlstand gelangt war. Mit dem unerwarteten Geldsegen kaufte er ein altes Haus mit einem vier Morgen großen Garten, nahe dem Dörfchen Claverleigh in East Sussex (zwischen Herstmonceux und Battle). Er ließ das Haus um einen zweistöckigen Anbau erweitern, für eine neue Küche und zusätzliche Zimmer, sowie, für das Jahr 1910 ungeheuer neumodisch, mit elektrischem Licht und einer Zentralheizung ausstatten. Hier der Eintrag über Beckburrow aus dem Architekturführer The Buildings of England, Stand 1965:
»CLAVERLEIGH, ein kleines Dorf unterhalb der South Downs, ohne Plan errichtet, aber überaus reizvoll. Eine gewundene Straße, die bei einer kleinen Kirche endet, ST. JAMES THE LESS am Südende (1744, neuerbaut 1865 in einer schwachen, verwässerten Form des klassizistischen Stils) … BECKBURROW, ½ Meile östlich an der Landstraße nach Battle, ein solides, geräumiges, ziegelgedecktes Cottage, 18.Jh., aus ansprechenden Materialien – Backstein, Feuerstein, Kalkstein – und mit verbliebenem Fachwerk an einem Giebelende. Die kleinen, längs unterteilten Fenster der alten Fassade wirken ungemein stabil. Nüchterne neogeorgianische Anbauten (1910) mit Walmdach. Harmlos, eher ein Haus zum Bewohnen als ein bauliches Schaustück. Eine solide SCHEUNE mit Stülpschalung.«
The Buildings of England.
Sussex (1965)
Genauso habe ich Beckburrow immer empfunden: als »Haus zum Bewohnen«. Wir waren glücklich dort, die Familie Clay, oder so kam es mir jedenfalls vor. Auch als Papa nach dem Krieg heimkehrte – dünn, reizbar, unfähig zu schreiben–, schien sich an der freundlichen, Geborgenheit spendenden Atmosphäre nichts grundlegend geändert zu haben. Wir hatten ein Kindermädchen, zwei Hausmädchen, eine Köchin (MrsRoyston, die in Claverleigh wohnte) und einen Gärtner/ein Faktotum namens Ned Gunn. Ich besuchte eine kleine private Vorschule in Battle, zu der mich Ned Gunn in einem Pferdewagen kutschierte und wieder abholte, bis wir 1914 ein Automobil erwarben und Ned seiner Liste von Funktionen noch den Rang »Chauffeur« hinzufügen konnte.
Das Einzige, was meinem Vater nach seiner Heimkehr noch Freude zu machen schien, in jenen ersten Jahren nach dem Krieg, waren lange Spaziergänge ans Meer, über die hügeligen Downs zu den Stränden von Pevensey und Cooden. Er marschierte mit großen Schritten vorneweg wie ein etwas verrückter Rattenfänger von Hameln, mit seinen Kindern sowie Freunden und Verwandten, die uns bei diesen Exkursionen begleiten mochten, im Gefolge, und trieb uns an. »Marsch, marsch, keine Müdigkeit vorschützen!«, rief er uns regelmäßig über die Schulter zu, während wir hinter ihm hertrödelten und die Umgebung erkundeten.
Meine Mutter stieß später im Wagen zu uns, so dass wir den Heimweg nach Beckburrow am Ende des Tages nicht zu Fuß zurückzulegen brauchten. Wenn wir am Strand ankamen, schlug die Stimmung meines Vaters jedes Mal radikal um. Die fröhlich-beschwingte Laune, die er unterwegs zur Schau getragen hatte, war auf einmal wie weggeblasen, stattdessen war er mürrisch und einsilbig, während er dasaß und Pfeife rauchend aufs Meer hinausstarrte. Wir dachten uns nie groß etwas dabei. Euer Vater ist nun mal so, erklärte meine Mutter, er denkt ständig über etwas nach. Er ist ein Schriftsteller, der nicht schreiben kann, und das bedrückt ihn. Also fanden wir uns damit ab, dass er phasenweise in langes Schweigen verfiel, das nur gelegentlich, wenn ihm schließlich der Geduldsfaden riss, von wüsten Schimpftiraden unterbrochen wurde. Dann stürmte er aufgebracht durchs Haus und brüllte herum wie von Sinnen. »Nur ein bisschen Ruhe und Frieden, lieber Herr Jesus Christus! Ist denn das zu viel verlangt?« Wir gingen dann immer eilig in Deckung, und Mutter geleitete ihn behutsam in sein Arbeitszimmer, leise auf ihn einflüsternd. Was sie zu ihm sagte, weiß ich nicht, aber es gelang ihr jedes Mal, ihn wieder zu beruhigen.
Eltern, so sonderbar sie auch objektiv betrachtet sein mögen, kommen ihren Kindern immer »normal« vor. Die allmählich aufkeimende Erkenntnis, dass die eigenen Eltern etwas sonderbar sind, ist ein Vorbote der eigenen Reifung; ein Zeichen dafür, dass man langsam erwachsen wird, sich zu einer autonomen Person entwickelt. In jenen frühen Jahren in Beckburrow, von unserem Umzug dorthin bis etwa 1925, schien mit unserer kleinen Welt so weit alles in Ordnung zu sein. Dienstboten kamen und gingen, der Garten gedieh prächtig; Peggy schien sich von früh an zu einer Art Wunderkind am Klavier zu mausern; der kleine Xan wuchs zu einem recht verschlossenen, bedächtigen und fast einfältigen Jungen heran, der sich stundenlang damit vergnügen konnte, eine Handvoll Laub und Zweige in komplizierten Mustern anzuordnen oder den Bach am hinteren Ende des Südrasens mit Dämmen zu stauen und umzuleiten, um ein kleines Reich aus Flüsschen und Seen und Bewässerungskanälen zu erschaffen, in dem er kleine Flöße aus Balsaholz auf Entdeckungsreisen im Miniaturformat gehen ließ. Damit konnte er sich den ganzen Tag lang beschäftigen, bis er schließlich zum Abendessen ins Haus gerufen wurde.
Und unsere Amory? Was gibt es von mir zu berichten? So weit, so wenig bemerkenswert. Nach der Vorschule in Battle kam die Grundschule in Hastings. 1921 dann wurde verkündet, dass ich auf ein Mädcheninternat käme: die Amberfield School in der Nähe von Worthing. Bei der Abreise nach Amberfield (Mutter begleitete mich, Ned steuerte den Wagen), als wir uns auf der Landstraße von Beckburrow entfernten, empfand ich zum ersten Mal im Leben das volle Ausmaß von Schmerz, Enttäuschung und Ungerechtigkeit, das mit einem Verrat einherzugehen pflegt. Meine Mutter wollte davon nichts hören. »Du kannst dich glücklich preisen, es ist eine wunderbare Schule. Mach kein Theater, ich kann Theater nicht ausstehen.«
In den Ferien kam ich natürlich nach Hause, wo ich mich jedoch, als Einzige von uns dreien, die auf einem Internat war, wie eine Außenseiterin fühlte. Die Scheune war zu einem Übungsraum für Peggy umgestaltet worden: getäfelt, gestrichen, mit einem Teppich auf dem Boden und einem Stutzflügel, an dem sie von einer Madame Duplessis aus Brighton unterrichtet wurde. Xan drückte sich im Garten und auf den Feldwegen der Umgebung herum, ein ernster Junge, der nur selten lächelte, sich dann aber vollkommen verwandelte. Mein Vater schien den Großteil der Woche in London zu sein, wo er sich nach einer literarischen Tätigkeit umsah. Er erhielt eine Teilzeitstelle als Redakteur und Mitarbeiter beim Strand Magazine und arbeitete als Lektor für diverse Verlage. Das Vermögen von »Die Belladonna-Wohltat« ging langsam zur Neige. Eine Produktion in New York lief 1919 gerade einen Monat lang, ehe sie abgesetzt wurde, doch es trafen trotzdem weiterhin Schecks per Post ein, das so rätsel- wie dauerhafte Vermächtnis eines einst erfolgreichen Theaterstücks. Meine Mutter war meinem Eindruck nach ganz zufrieden mit ihrem Leben, das darin bestand, ihr großes Haus zu führen, als Laienrichterin am Magistratsgericht in Lewes zu wirken und in den Dörfern rund um Claverleigh Wohltätigkeitsveranstaltungen ins Leben zu rufen und zu organisieren – Feste, Tombolas, Basare.
Greville kam hin und wieder aus London zu Besuch. Nur Greville, das spürte ich, war mein Freund. Er tauschte meine Box Brownie gegen eine Kodak Junior No.2A mit ziehharmonikaartig ausziehbarem Objektiv aus und lehrte mich, bessere Fotos zu machen. Eines Nachmittags dann dunkelte er die Speisekammer restlos ab, packte Schalen und Flaschen mit scharf riechender Flüssigkeit aus und führte mir die verblüffende Alchemie vor, die aus auf Film eingefangenen Bildern unter Einsatz von Chemikalien – Entwickler, Stoppbad, Fixierbad und Wässerungen – Negative zauberte, von denen sich anschließend Schwarzweißabzüge herstellen ließen.
Dennoch empfand ich weiter bitteren Groll darüber, von zu Hause verbannt worden zu sein. Eines Tages nahm ich all meinen Mut zusammen und stellte meiner Mutter die alles entscheidende Frage – warum musste ich auf ein Internat, während Peggy und Xan zu Hause bleiben durften? Meine Mutter setzte sich mit mir zusammen und nahm meine Hände. »Peggy ist ein Genie«, stellte sie leichthin fest, »und Xan hat Pro-bleme.« Und damit war der Fall für sie erledigt, mehr gab es in der Angelegenheit nicht zu sagen. Bis zu dem Tag, an dem mein Vater schließlich den Verstand verlor.
*
BARRANDALE-JOURNAL 1977
Ich füttere Flam, meinen Hund, meinen lieben, mir treu ergebenen Labrador, und zünde die Petroleumlampen an, während sich langsam die Sommernacht herabsenkt. Den Strom für meinen kleinen Kühlschrank, die Waschmaschine, das Radio und die Stereoanlage erzeugt ein Dieselgenerator. Auf elektrisches Licht und einen Fernseher verzichte ich gern – und wozu, bei der mir noch verbleibenden Lebensspanne, das Haus aufwendig modernisieren? Ich lebe, technisch gesehen, in einem behaglichen Schwebezustand: Einerseits kann ich waschen, Musik genießen, am Weltgeschehen teilhaben und habe stets Eiswürfel für meinen Gin Tonic; andererseits brennt im Ofen ein Torffeuer, und die Petroleumlampe verbreitet ihr ganz eigenes Licht – das unmerkliche Schwanken des Dochts, das leise Flackern der Flamme, wodurch jenes subtile Spiel von Licht und Schatten entsteht, das einen Raum irgendwie lebendiger macht. Als würde er atmen, pulsieren.
Barrandale verdient eigentlich kaum die Bezeichnung Insel. Nur ein schmaler »Sund« trennt es von der Westküste des schottischen Festlands, nicht breiter als fünfzehn, achtzehn Meter, wenn’s hochkommt. Und es führt eine Brücke über den Sund, die »Brücke über den Atlantik«, wie wir Anwohner sie gern hochtrabend nennen. Es gibt noch eine zweite Insel mit einer Brücke, die berühmter ist, älter, eindrucksvoller, aus Stein errichtet (unsere besteht aus Tragbalken und Eisenbahnschwellen), doch da unsere drei Meter länger ist als die andere, fühlen wir uns ein klein wenig überlegen: Wir überqueren einen größeren Abschnitt des Atlantiks. Wie dem auch sei, Barrandale ist und bleibt eine Insel, und durch die Fahrt über die Brücke, über den Sund, stellt sich, fast unbewusst, eine Inselmentalität ein.
Meine Verschickung ins Internat, so fand ich erst später heraus, war das Ergebnis eines Testaments. Eine Großtante mütterlicherseits hatte nach ihrem Tod der Familie Clay eine Geldsumme vermacht, bestimmt für die Ausbildung ihrer Großnichte Amory, der Erstgeborenen. Für die Schulgebühren, die in Amberfield fällig wurden, hätte das unregelmäßige, sich stetig vermindernde Einkommen meines Vaters niemals ausgereicht, doch der Geldsegen war testamentarisch ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, dass ich dorthin oder an eine vergleichbare Schule geschickt wurde. Unser Leben kann durch sonderbare, völlig unbekannte Strömungen geformt werden. Warum haben meine Eltern mir nichts davon erzählt? Warum taten sie so, als wäre es ihre Entscheidung? Ich wurde den vertrauten Annehmlichkeiten und Sicherheiten Beckburrows entrissen, und dafür sollte ich auch noch dankbar sein, mich als privilegiert empfinden.
Meine Mutter war eine hochgewachsene, ein wenig schwerfällige Frau mit Brille. Sofern sie so etwas wie Zuneigung zu ihren Kindern empfand, gelang es ihr jedenfalls glänzend, diese zu verbergen. Es gab zwei Redewendungen, die sie immer und immer wieder benutzte: »Ich kann Theater nicht ausstehen«, und »So ist es nun mal, ob’s dir passt oder nicht«. Sie war immer geduldig mit uns, aber auf eine Art, die nahezulegen schien, dass sie in Gedanken ganz woanders war, dass es interessantere Beschäftigungen gab, denen sie hätte nachgehen können. Wir sagten immer »Mutter« zu ihr, als handle es sich um eine Kategorie, eine Tätigkeitsbezeichnung, wie etwa »Eisenwarenhändler« oder »Historiker«, die unser Verwandtschaftsverhältnis nicht widerspiegelte. Hier ein Beispiel für die Art Austausch, die bei uns an der Tagesordnung war:
ICH: Mutter, darf ich noch eine Portion Pudding haben, bitte?
MUTTER: Nein.
ICH: Warum nicht? Es ist doch noch genug da.
MUTTER: Weil ich es sage.
ICH: Aber das ist ungerecht!
MUTTER: Tja, so ist es nun mal, ob’s dir passt oder nicht.
Ich habe nie erlebt, dass meine Mutter und mein Vater offen ihre Zuneigung gezeigt hätten – und muss gleich hinzufügen, dass ich auch nie irgendwelche Anzeichen von Abneigung oder Feindseligkeit bemerkt habe.
Meine Mutter am Strand von Cooden, 1920er Jahre. Aufgenommen mit meiner Kodak Junior 2A. Xan lacht hinter ihr.
Der Vater meines Vaters, mein Großvater, Edwin Clay, war aus Staffordshire, ein Bergarbeiter, der Abendkurse an einem Working Men’s College besuchte, sich fleißig weiterbildete und qualifizierte. Und sein Ehrgeiz zahlte sich aus: Seine Karriere beendete er als Direktor beim Verlag Edgeware & Rackham, wo er schließlich als Chefredakteur fünf Fachzeitschriften für das Baugewerbe leitete. Er wurde so wohlhabend, dass er seine beiden Söhne auf Privatschulen schicken konnte. Mein Vater, ein kluger Junge, errang ein Stipendium fürs Lincoln College an der Universität Oxford und wurde Schriftsteller (sein jüngerer Bruder, Walter, verlor 1916 in der Skagerrak-Schlacht sein Leben). Der Aufstieg innerhalb einer einzigen Generation war beachtlich, nehme ich an, und doch spürte ich bei meinem Vater immer jene vertraute Mischung aus Stolz auf seine Leistungen und – nicht direkt Scham, aber Befangenheit, Unsicherheit, eine sehr englische Unsicherheit. Würde man ihn, den Sohn eines Bergarbeiters, als Schriftsteller überhaupt ernst nehmen? Die Entscheidung, Beckburrow zu erwerben, durch einen Anbau zu vergrößern und dort dann ein Leben auf dem Lande zu führen, ging wohl auch auf den Wunsch zurück, sich selbst zu beweisen, dass diese Unsicherheiten nunmehr jeder Grundlage entbehrten. Er gehörte inzwischen unzweifelhaft dem Bürgertum an; der erfolgreiche Autor einer Reihe positiv aufgenommener Bücher, verheiratet mit der Tochter eines Richters, mit der er drei Kinder hatte und in einem beneidenswert geräumigen Haus im ländlichen East Sussex lebte. Dennoch war er kein ganz glücklicher Mensch. Und dann kam der Krieg und alles lief schief.
Ich glaube, ich könnte heute Abend mal anfangen, all die alten Kartons voller Fotos durchzugehen. Oder vielleicht auch nicht.
*
Es ist das Jahr 1925. Die Amberfield School for Girls, in Wor-thing. Meine beste Freundin Millicent Lowther klebte sich den falschen Schnurrbart auf die Oberlippe und strich ihn mit den Fingerspitzen glatt.
»Es war der Einzige, den ich finden konnte«, sagte sie. »Ansonsten gab es nur Vollbärte.«
»Er ist perfekt«, sagte ich. »Ich möchte nur eine Ahnung bekommen, wie es sich anfühlt.«
Wir saßen auf dem Fußboden, mit dem Rücken an der Wand. Ich beugte mich vor und küsste sie sanft, Lippen auf Lippen, ohne großen Druck.
»Zieh keinen Flunsch«, sagte ich, ohne zurückzuweichen. »So was machen Männer nicht.« Der Kontakt mit dem falschen Schnurrbart war nicht unangenehm, obwohl ich, hätte ich die Wahl gehabt, eine glattrasierte Oberlippe jederzeit vorgezogen hätte. Ich rückte etwas zur Seite, veränderte den Winkel, spürte das Kribbeln der Borsten an meiner Wange. Nein, es war auszuhalten.
Wir älteren Mädchen übten in Amberfield regelmäßig Küssen, doch ich muss sagen, die Erfahrung fühlte sich kaum anders an, als würde man seine Finger oder die Innenseite seines Oberarms küssen. Da ich noch nie einen Mann geküsst hatte, und das mit inzwischen siebzehn Jahren, war mir nicht ganz klar, warum deswegen, wie meine Mutter es wohl ausgedrückt hätte, so ein Theater gemacht wurde.
Wir lösten uns voneinander.
»In irgendwen mit Schnurrbart verknallt?«, fragte Millicent.
»Nicht direkt. Greville hat sich bloß einen stehen lassen, und ich wollte mal sehen, wie es sich anfühlen könnte.«
»Der schöne Greville. Warum lädst du ihn nicht mal hierher ein?«
»Weil ich nicht will, dass ihr Kreaturen ihn angafft. Hast du die Fluppen besorgt?«
Zigaretten kauften wir von einem der jungen Gärtner hier in Amberfield, einem dümmlichen Burschen namens Roy, der eine Hasenscharte hatte.
»O ja.« Millicent griff in ihre Taschen und brachte die in Papier eingewickelten Zigaretten sowie eine Schachtel Streichhölzer zum Vorschein. Ich mochte Millicent sehr – sie war intelligent und spöttisch, fast so spöttisch wie ich–, doch es wäre mir lieber gewesen, wenn sie etwas vollere Lippen gehabt hätte, um besser mit ihr Küssen üben zu können; ihre Oberlippe war so gut wie nicht existent.
Ich steckte eine der kleinen Woodbines in die Zigarettenspitze aus Ebenholz, die ich meiner Mutter entwendet hatte.
»Bloß Woodbines«, sagte Millicent. »Sehr ordinär, fürchte ich.«
»Man kann nicht erwarten, dass ein Proletarier wie Roy Craven ›A‹ raucht.«
»Roy, der arme Plebejer. Vermutlich nicht, aber die brennen schon ganz schön im Hals.«
»Während einem gleichzeitig schwindelig wird.«
Ich gab Millicent Feuer, ehe ich meine Zigarette ansteckte, und wir pusteten Rauch zur Decke hoch. Wir saßen in meiner »Dunkelkammer«, einer Besenkammer unweit des Chemielabors.
»Dem Herrn sei Dank, dass deine Chemikalien so stinken«, sagte Millicent. »Was ist das für ein Geruch?«
»Fixiermittel. Auch als Fixiersalz bekannt.«
»Wundert mich nicht, dass keiner in deinem Kämmerchen je des Zigarettenrauchs gewahr geworden ist.«
»Kein einziges Mal. Ist ›gewahr werden‹ der richtige Ausdruck?«
»Es ist ein Ausdruck, der öfter benutzt werden sollte«, erwiderte Millicent, eine Spur zu selbstgefällig, wie ich fand, als hätte sie das Verb soeben selbst erfunden.
»Aber auch nur, wenn er passt«, mahnte ich.
»Pedantin. Elende Pedantin.«
»Außer uns kommt hier sonst nur die Kindermörderin rein, und die liebt mich.«
»Ist sie eine Lesbe, die Kindermörderin, was meinst du?«
»Nein. Ich halte sie eher für geschlechtslos…« Ich zog an meiner Woodbine, spürte das vertraute Schwindelgefühl. »Ich glaube nicht, dass sie sich über ihre Empfindungen wirklich im Klaren ist.« Bei der Kindermörderin handelte es sich tatsächlich um Miss Milburn, die Naturwissenschaftslehrerin, und ich war ihr zu großem Dank verpflichtet. Sie hatte mir diese Besenkammer zur Verfügung gestellt und mich dazu ermuntert, hier meine Dunkelkammer einzurichten. Ihr Spitzname rührte daher, dass sie dichte, nicht gezupfte Augenbrauen hatte, die über ihrer Nase beinahe zusammentrafen.
»Aber sind wir keine Lesben?«, fragte Millicent. »Wenn wir uns so küssen?«
»Nein«, sagte ich. »Das geschieht ja nur zu Studienzwecken, um zu sehen, wie es mit einem Mann wäre. Wir sind doch nicht verbittert, meine Liebe.« »Verbittert« war Slang und hieß in Amberfield so viel wie »pervers«.
»Warum willst du dann deinen Onkel küssen? Ih, pfui!«
»Ganz einfach – weil ich ihn liebe.«
»Und da behauptest du, du wärst nicht verbittert!«
»Er ist der schönste, lustigste, netteste, spöttischste Mensch, der mir je begegnet ist. Kämst du je in seine Gegenwart – nicht dass das je passieren wird–, würdest du mich verstehen.«
»Es kommt mir bloß etwas sonderbar vor.«
»Wenn man es recht bedenkt, ist alles im Leben etwas sonderbar.« Das war ein Ausspruch, den mein Vater hin und wieder verwendete.
Millicent stand auf, mit der Zigarette zwischen den Lippen, und knetete an ihren kleinen Brüsten herum.
»Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ein Mann das bei mir macht … An meinem Busen herumtatscht. Wie würde sich das anfühlen, wie würde ich reagieren? Vielleicht will ich ihm ja eine knallen.«
»Deswegen ist es gut, dass wir hier schon einmal alles ausprobieren. Eines Tages kommen wir aus diesem Dschungel raus, dann sind wir frei. Wir müssen auf das gefasst sein, was auf uns zukommt.«
»Für dich ist das in Ordnung«, entgegnete Millicent mit einem Anflug von Neid. »Die Welt, in der du dich bewegst – Schriftsteller, Gesellschaftsfotografen. Mein Vater ist ein schnöder Holzhändler.«
»Bei mir ist dein Geheimnis sicher.«
»Luder! Königin der Luder.«
»Ich bin kein Snob, Millicent. Mein Großvater war ein Bergarbeiter aus Staffordshire.«
»Ich hätte lieber einen Schriftsteller zum Vater als einen Holzhändler, mehr sage ich ja gar nicht.« Millicent pflückte sich vorsichtig den falschen Schnurrbart ab und drückte ihre Woodbine aus.
»Wollen wir noch ein bisschen küssen?«, fragte sie. »Wir haben es noch nicht mit Zunge ausprobiert.«
»Verbittertes Weib! Du solltest dich schämen.« Ich rappelte mich auf die Füße und warf einen Blick auf meine Fotos, die zum Trocknen an einer Leine hingen. Irgendwo in einem fernen Flur schrillte eine Glocke.
»Ich fürchte, ich muss einige der jüngeren Kreaturen beaufsichtigen«, sagte sie. »Bis später, Schatz.«
Sie verließ die Kammer, und ich nahm vorsichtig die Fotos von der Leine. Um kein Papier zu vergeuden, machte ich nicht von allen Negativen, die ich entwickelte, einen Abzug. Ich begutachtete das Negativ mit einer Lupe und war mir bei der Wahl, die ich schließlich traf, in der Regel sehr sicher. Der Entschluss, einen Abzug herzustellen, war irgendwie entscheidend dafür, wie ich zu dem Foto stand, und ich gab jedem Bild, von dem ich einen Abzug erstellte, einen Titel. Warum, weiß ich nicht – eine diffuse malerische Anwandlung, nehme ich an–, aber mit einem Titel prägte sich mir ein Foto leichter und dauerhafter ein. Ich konnte mir fast jedes Foto vor Augen rufen, von dem ich je einen Abzug gemacht hatte, wie aus einem Gedächtnisarchiv, einem Album in meinem Kopf. Ich glaube auch, dass der gesamte Prozess des Fotografierens für mich in jener Phase meines Lebens nach wie vor etwas von Zauberei hatte. Der magische Vorgang, ein Bild durch kurze Belichtung auf Film zu bannen und von jenem Augenblick dann durch den genau kontrollierten Einsatz von Chemikalien und Papier ein monochromes Bild zu erzeugen, übte auf mich nach wie vor eine große Faszination aus.
Jetzt, nachdem Millicent fort war, nahm ich die drei neuen, steifen, getrockneten Fotos von der Leine und legte sie auf den kleinen Tisch am Ende der Abstellkammer. Die Titel, die ich den drei Fotos gegeben hatte, lauteten: Xan, fliegend, Junge mit Hut und Schläger und Im Freibad. Ich war mit allen zufrieden, besonders mit Xan, fliegend.
Eines heißen Tages im vergangenen August waren wir im Freibad des Schwimmvereins Westbourne in Hove gewesen, wo es ein unbeheiztes Salzwasserschwimmbecken mit einem siebeneinhalb Meter hohen Sprungturm am hinteren Ende gab. Xan musste dreimal springen, ehe ich mir sicher war, ihn wahrhaft in der Luft erwischt zu haben.
Xan, fliegend, 1924
Ich vermerkte mit einem weichen Bleistift die Titel auf der Rückseite der Abzüge, fügte das Datum hinzu und legte sie in mein Album. Alle drei Fotos zeigten Menschen in Bewegung. Menschen in Bewegung waren mein Lieblingsmotiv – ich fotografierte sie beim Gehen, wenn sie eine Treppe herunterkamen, beim Laufen, Springen und, das war am wichtigsten, ohne dass sie in die Kamera sahen. Ich fand es toll, wie die Kamera diesen unbewussten Stillstand einfangen konnte, ein vollkommen in der Zeit angehaltenes Bild von jemandem – für alle Zeit unvollständig, ohne den nächsten Schritt, die nächste Geste, die nächste Bewegung. Einfach so eingefroren – von mir – von dem Klicken einer Blende. Schon damals war mir, glaube ich, bewusst, dass dazu nur die Fotografie imstande war – so selbstsicher, so mühelos–, nur die Fotografie vermochte die Zeit anzuhalten; verhalf uns mit jener eingefangenen Millisekunde unserer Existenz dazu, ewig zu leben.
Junge mit Hut und Schläger, 1924 (Xan Clay)
Im Freibad, 1924
Zwei Tage darauf saß ich im Studienraum der Oberstufe und lieferte mir ein Wettstarren mit Laura Hassall. Sie hatte mich dazu herausgefordert, aber ich wusste, dass ich gewinnen würde – beim Wettstarren war ich unschlagbar. Bei diesen Duellen war es erlaubt, miteinander zu sprechen, um die Gegnerin abzulenken und so in ihrer Konzentration zu stören, dass sie den Blickkontakt nicht aufrechterhalten konnte.
»Stanley Baldwin ist einem Attentat zum Opfer gefallen«, behauptete Laura.
»Dürftig. Sehr dürftig.«
»Nein. Wirklich.«
»Gut. Grauenhafter Mensch.«
Wir starrten uns weiter an, Auge in Auge, über eine Distanz von sechzig Zentimetern, beide mit auf die Hände gestütztem Kinn. Alle anderen im Raum beschäftigten sich mit ihren Aufgaben, ohne von unserem Wettkampf Notiz zu nehmen.
»Laura?«
»Ja.«
»Romulus und Remus. Schon mal gehört von denen?«
»Äh … Ja«, erwiderte sie gereizt, in aufgesetzt dümmlichem Tonfall.
»Dann stell dir mal vor«, sagte ich, in einem Tonfall, als wäre mir der Gedanke eben erst eingefallen, »stell dir vor, Rom wäre von Remus gegründet worden – und nicht von Romulus.«
»Ja … Und weiter?«
»In dem Fall hieße die Stadt Rem.«
Darüber dachte Laura reflexhaft nach, und damit hatte sie verloren. Ihr Blick flackerte.
»Verflucht! Verdammnis und Schande!«
Es klopfte an der Tür, und eine jüngere Kreatur erschien. Sie sah mich direkt an. Jüngere Kreaturen durften nur sprechen, wenn das Wort an sie gerichtet wurde.
»Was ist, du abstoßendes Kind?«, sagte ich.
»Gott will mit dir sprechen.«
»Gott« war unsere Schulleiterin, Miss Grace Ashe. Ich war vor Miss Ashe auf der Hut – ich hatte das Gefühl, dass sie mich durchschaute, meine wahre Natur erkannte. Ich klopfte an die Tür ihres Büros und wartete, in dem Bewusstsein, dass ich ein wenig nervös war, unruhig, nicht in Bestform. Es kam selten vor, dass man um diese Abendstunde herzitiert wurde. Ich hörte sie »Herein!« sagen, prüfte noch einmal rasch meine Uniform, strich die Knitter vorn an den Knien meiner Baumwollstrümpfe glatt und öffnete die Tür.
Miss Ashes »Büro« wurde seinem Namen nicht gerecht – es war ein Wohnzimmer mit einem großen Schreibtisch aus Wurzelnussholz voller Akten und Unterlagen, der in einer Nische stand. Ich hätte mich in einem Landhaus befinden können. Der Teppich war dunkelblau mit einer scharlachroten Umrandung; es gab eine mit hellem Leinen bezogene Sitzgruppe, bestehend aus einem langgezogenen Sofa und zwei Sesseln mit einer Polsterbank mit Gobelinbezug dazwischen, auf der Bücher lagen. Die Tapete war cremeweiß und kaffeebraun gestreift, und an den Wänden hingen moderne Ölgemälde, stilisierte Landschaften und Stillleben, die Miss Ashes Bruder Ivo gemalt hatte (der im Krieg umgekommen war). Vorhänge aus hellblauem Sackleinen bauschten sich bis auf den Boden hinab, und die Tischlampen mit den Schirmen aus dunklem Pergament verbreiteten ein schummriges Licht. Hier wurde Geschmack zur Schau getragen, wurde mir klar, selbstbewusst und dabei unaufdringlich.
Miss Ashe war, unseren Berechnungen nach, Anfang vierzig, blass und schlank, mit straff zurückgekämmtem dunkelrotbraunem Haar, das zu einem komplizierten Knoten frisiert war. Sie war »schick«, darüber waren wir uns alle einig. Millicent und ich hatten entschieden, dass sie aussah wie eine ehemalige Primaballerina. Tatsächlich hatten wir alle ein wenig Angst vor ihr und empfanden Ehrfurcht vor ihrem eleganten, gelassenen Auftreten, wobei ich aber die Strategie verfolgte, mir diese Gefühle nie anmerken zu lassen. Ich war bemüht, im Umgang mit ihr betont munter und fröhlich zu sein, und ich glaube, sie war infolgedessen verärgert, weil sie merkte, dass ich das ihr zuliebe vortäuschte. Sie ging mit mir immer recht streng und kurz angebunden um. Und sie lächelte nie.
Jetzt aber lächelte sie, während sie mir mit einer Handbewegung einen Sessel zuwies. Was mich kurzzeitig völlig aus dem Konzept brachte.
»Guten Abend, Miss Ashe«, sagte ich, in dem Bestreben, wieder die Oberhand zu gewinnen. »Das ist aber ein schönes Armband.«
Sie blickte das Armband aus schwerem Silber und Bakelit an ihrem Handgelenk an, als hätte sie vergessen, dass sie es umhatte.
»Danke, Amory. Setz dich doch.«
Sie nahm ebenfalls Platz, legte eine Aktenmappe auf ihre Knie und schlug sie auf. Sie trug ein smaragdgrünes Nachmittagskleid, dazu einen zitronengelben Seidenschal. Ohne den Blick von der aufgeschlagenen Akte zu heben, klappte sie eine silberne Box auf dem Beistelltisch neben ihrem Sessel auf, nahm eine Zigarette heraus, suchte kurz nach einem Feuerzeug und zündete die Zigarette an. Uns war aufgefallen, wie demonstrativ Miss Ashe vor den älteren Mädchen zu rauchen pflegte – es war eine Provokation. Derart provoziert, ergriff ich das Wort.
»Ich nehme mal an, das ist mein Dossier.«
Sie sah auf. »Es ist deine Akte. Alle Schülerinnen haben eine Akte.«
»Alle Fakten.«
»Alle Fakten, die wir kennen…« Sie legte den Kopf schräg, wie um mich aufmerksamer zu betrachten. Hellblaue Augen, die nicht blinzelten. Da ich mit Miss Ashe nicht um die Wette starren wollte, senkte ich den Blick und zupfte mir einen unsichtbaren Fussel vom Rock.
»Ich bin mir sicher, dass es viele weitere ›Fakten‹ gibt, die uns unbekannt sind.«
»Das glaube ich nicht, Miss Ashe.« Ich lächelte süß. »Ich habe nichts zu verbergen.«
»Ach ja? Du bist also ein offenes Buch, ja, Amory?«
»Für alle, die mich zu lesen verstehen.«
Sie lachte, als wäre sie aufrichtig belustigt, und ich spürte, wie mir die Hitze den Hals hinauf und in Wangen und Ohren kroch, während ich rot anlief. Dumme Amory, dachte ich. Sag so wenig wie möglich. Miss Ashe war wieder in meine Akte vertieft.
»Du hast die Mittelstufe in allen Fächern mit Auszeichnung abgeschlossen.«
»Ja.«
»Und du hast entschieden, Mathematik, Chemie und Griechisch abzuwählen.«
»Ich interessiere mich mehr für –«
»Geschichte, Französisch und Englisch. Was ist dein Nebenfach?« Sie blätterte eine Seite weiter.
»Erdkunde.«
Nachdem sie sich eine Notiz gemacht hatte, schloss sie die Akte und sah mich wieder an.
»Bist du glücklich hier in Amberfield, Amory?«
»Könnten Sie ›glücklich‹ näher definieren, Miss Ashe?«
»Du antwortest mit einer Gegenfrage. Weichst aus, um Zeit zu gewinnen. Sei einfach ehrlich – aber sag nicht, dass du dich langweilst. Es ist mir einerlei, wenn ein Mädchen dumm oder bockig ist, aber sich zu langweilen ist eine Niederlage, un échec. Wer sich mit dem Leben langweilt, kann ebenso gut sterben.«
Etwas an der unverblümten Direktheit, mit der Miss Ashe diese Ansicht äußerte, versetzte mir einen Stich. Ohne nachzudenken, plapperte ich eine Antwort heraus.
»Also, wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das Gefühl, dass ich mich hier auflöse. Ich jammere nicht, Miss Ashe – ich weiß, dass Ihnen Jammern ebenso zuwider ist wie Langeweile–, aber ich fühle mich … leblos. Alles ist unaufrichtig, steril und rückgratlos. Manchmal fühle ich mich entmenscht, wie ein Roboter –« Ich verstummte. Bereute es bereits, meine gewohnte Zurückhaltung aufgegeben zu haben.
»Du meine Güte. Darauf wäre ich ja nie gekommen.« Miss Ashe drückte sehr sorgfältig ihre Zigarette aus.
Amory, du Idiotin, dachte ich wütend. Du hast sie gewinnen lassen. Ich starrte das Buch an, das auf der Bank zwischen uns lag: Der Weg allen Fleisches von Samuel Butler.
»Eine interessante Sprache, die du benutzt«, sagte Miss Ashe.
»Entschuldigung?«
»Auflösen, leblos, rückgratlos, entmenscht, Roboter. Es ist nur eine Schule, Amory. Wir versuchen dir hier etwas beizubringen, um dich für dein späteres Leben zu rüsten. Wir sind kein autokratisches Regime, das dir das Leben aus dem Leib pressen will.«
»Ich habe das Gefühl zu versauern. Während ich in diesem feigen, asozialen Dschungel festsitze –« Hier verstummte ich wieder. Mir waren die Worte ausgegangen.
»Nun, du verstehst es jedenfalls, dich auszudrücken, Amory. Sehr anschaulich. Das ist eine Gabe. Was mich zum Zweck dieser netten Unterredung bringt.« Sie stand auf und ging zu ihrem Schreibtisch, um ein Blatt Papier zu holen.
»Ich freue mich sehr, dir mitzuteilen«, hob sie mit einer gewissen Förmlichkeit an, während sie über den Teppich zu mir zurückkam, »dass du den ersten Preis im Roxburgh-Aufsatzwettbewerb gewonnen hast. Das werde ich heute Abend beim Gebet offiziell verkünden. Deinen besten Freundinnen darfst du es in der Zwischenzeit aber schon erzählen.« Sie reichte mir das Blatt, das sich als Scheck entpuppte. Ich konnte meine Verblüffung nicht kaschieren, als ich ihn in Empfang nahm. War-um ich mich spontan entschlossen hatte, an dem Wettbewerb teilzunehmen, wusste ich nicht mehr genau. Vielleicht, weil mich das diesjährige Thema gereizt hatte: »Ist es wirklich modern, ›modern‹ zu sein?«. Jedenfalls hatte ich mit einem Aufsatz daran teilgenommen, und nun hatte ich sogar gewonnen.
Miss Ashe setzte sich wieder und musterte mich. Ich starrte den Scheck an und begriff, dass ich mir nun die neue Kamera zulegen konnte, die ich mir schon länger wünschte, eine »Klimax« von Butcher.
»Ich habe nachgedacht, Amory. Über Oxford.«
»Oxford?«
»Nach deinem Abschluss kommst du noch für ein Halbjahr her und bereitest dich auf die Aufnahmeprüfung in Oxford vor. Um dich um ein Stipendium für ein Studium der Geschichte am Somerville College zu bewerben, genauer gesagt. Ich glaube, du hättest da hervorragende Chancen, deiner Arbeit nach zu schließen – und dem Aufsatz nach, den du geschrieben hast.«
Miss Ashe hatte am Somerville College in Oxford studiert. Ich war mir bewusst, nun, da dieser Vorschlag im Raum stand, dass ich im Begriff war, unter ihre Fittiche genommen zu werden.
»Aber ich möchte gar nicht nach Oxford«, sagte ich.
»Das ist eine sehr törichte Bemerkung.«
»Es geht nicht um Oxford speziell. Ich möchte an überhaupt keine Universität.«
»Du willst lieber ›leben‹, nehme ich an.«
Miss Ashe, das spürte ich, war inzwischen ziemlich gereizt. Das Blatt in diesem Gespräch wendete sich, in meinem Sinne.
»Wer will das nicht?«
»Es ist voll und ganz möglich, auch während des Studiums zu ›leben‹, weißt du.«
»Ich würde lieber etwas anderes machen.«
»Und was schwebt dir da vor, Amory?«
»Ich möchte Fotografin werden.«
»Ein faszinierendes und bereicherndes Hobby. Miss Milburn hat mir von deiner Dunkelkammer erzählt.«
»Ich möchte als Fotografin arbeiten.«
Miss Ashe starrte mich an, als würde ich mir einen abstrusen Scherz mit ihr erlauben. Als hätte ich gesagt, dass ich als Prostituierte arbeiten wollte.
»Aber das geht nicht«, sagte sie.
»Wieso nicht?«
»Weil du eine –« Sie biss sich rechtzeitig auf die Zunge, ehe sie das Wort »Frau« aussprach. »Weil das kein seriöser Beruf ist. Für jemanden wie dich.«
»Aber versuchen kann ich’s doch, oder?«
»Selbstverständlich kannst du das, Amory, meine Liebe. Aber vergiss nicht, ein Universitätsstudium schließt eine Karriere als ›Fotografin‹ nicht notwendig aus. Und du hast dann einen Abschluss, etwas, worauf du zurückgreifen kannst.« Sie stand auf und ging wieder durchs Zimmer, um meine Akte auf ihren Schreibtisch zu legen. Das Treffen mit Gott war beendet. Ich machte mich auf den Weg zur Tür, aber sie stoppte mich mit erhobener Hand.
»Das hätte ich fast vergessen. Dein Vater hat mich angerufen. Er hat gefragt, ob er dich morgen Nachmittag zum Tee ausführen darf.«
»Tatsächlich? Aber morgen ist doch Mittwoch.«
»Du kannst beurlaubt werden. Ich lasse die üblichen Regeln ausnahmsweise gern außer Acht. Sieh es als Bonus zu deinem Roxburgh-Preis.«
Ich runzelte die Stirn. »Warum will er mit mir Tee trinken gehen?«
»Er habe etwas mit dir zu besprechen, von Angesicht zu Angesicht. Er wolle es nicht in einem Brief schreiben, hat er gesagt.« Miss Ashe sah mich an, freundlich fast, so kam es mir vor, als würde sie spüren, wie meine Verwirrung nun rasant in Beunruhigung umschlug.
»Hast du eine Ahnung, was er mit dir besprechen möchte?«, fragte sie, während sie mir kurz die Hand auf die Schulter legte.
»Es wird um irgendeine Familienangelegenheit gehen, denke ich. Sonst fällt mir nichts ein.«
Miss Ashe lächelte. »Er hat sich sehr positiv angehört, sehr fröhlich. Vielleicht gibt es gute Neuigkeiten.«
2. FAMILIENANGELEGENHEITEN
Ich stand an der Eingangstür von Gethsemane, dem Haus in Amberfield, in dem ich wohnte, und wartete auf meinen Vater. Ich trug die komplette, demütigende Ausgehtracht: den langen schwarzen Raglanmantel aus Gabardine mit angenähter Pelerine und kirschroter Paspelierung, die Strohhaube, die vernünftigen Schnallenschuhe. Ein Zwischending aus alter Jungfer à la Jane Austen und Krimkriegsveteran, fanden wir. Die ungezogenen Jungen von Worthing jedenfalls hatten immer ihren Spaß, wenn wir als Phalanx durch die Stadt liefen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!