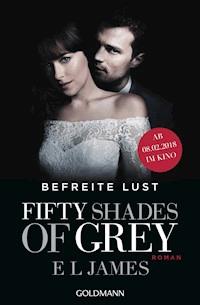3,99 €
Mehr erfahren.
Der junge Lehrer Arnie verfällt den erotischen Reizen seiner Schülerin. Gemeinsam erforschen sie die dunklen Pfade der körperlichen Lust und leben ihre sinnlichen Fantasien aus. Ihre Leidenschaft wird immer mehr zu einem erbitterten Machtkampf. Wer behält die Oberhand?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Ira Miller
Die gelehrige Schülerin
Roman
Aus dem Amerikanischen von Nora Jensen
Copyright
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel SEESAW
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 1983 by Ira Miller
Copyright © 1984 der deutschen Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co., München
Copyright © 2006 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 978-3-89480-969-0
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. KapitelZweiter Teil6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. KapitelDritter Teil13. Kapitel14. Kapitel15. Kapitel16. Kapitel17. Kapitel18. Kapitel19. Kapitel20. Kapitel21. KapitelVierter Teil22. Kapitel23. KapitelÜber das BuchÜber die AutorinCopyright
Erster Teil
1. Kapitel
Die Rolle des Lehrers
Ich stehe erst am Anfang meines Lebens.
Als ich noch ein Kind war, fuhr meine Mutter mich zur Schule, wenn es regnete. Ich bekam ein Taschengeld, das jedes Jahr zu meinem Geburtstag erhöht wurde, genoss ausgewogene Mahlzeiten, die ich manchmal sogar verschmähte, und war, trotz aller Versuche, mich in der Schule radikal zu verhalten und mit den Hippies solidarisch zu erklären, nichts weiter als das Produkt einer behäbigen, abgesicherten Mittelschicht in einer Vorstadt.
Im College bezahlte mein Vater die Rechnungen. Ich nahm an den Vorlesungen teil, schrieb Aufsätze, bestand Prüfungen und führte vier Jahre lang ein behütetes Leben mit dem simplen Zweck, das Examen zu machen. Als das vorbei war, fühlte ich mich aus dem Mutterleib in eine kalte, fordernde, reale Welt gestoßen. Ich war alles andere als darauf vorbereitet. Ich absolvierte eine Ausbildung als Lehrer.
Als auch diese Schule vorbei war, fühlte ich mich wieder verängstigt und von der Unabhängigkeit bedroht. Ich suchte nach Halt bei den Freunden von der High School. Aber wir fielen immer wieder in die Verhaltensweisen von damals zurück. Kartenspielen, Baseball, Drogen, Kneipenbummel. Dabei kam ich mir vor wie ein Teenager, nicht wie ein Erwachsener. Meine Familie hätte mir helfen können, aber ich konnte nicht mehr bei ihr leben – abhängig wie ein kleines Kind! Außerdem musste ich Arbeit finden, richtige, einem Erwachsenen angemessene Arbeit. Nicht irgendeine. Sie musste mit dem etwas zu tun haben, das ich studiert hatte, und ich musste mich in ihr verwirklichen können. Wozu hatte ich sonst studiert?
Und plötzlich konnte ich nicht mehr nur mit irgendwem schlafen. Ich hatte Verlangen nach einer tiefen, beständigen Beziehung.
Kindheit, Jugend und Studium waren nur ein leicht zu absolvierendes Vorspiel gewesen. Ein erwachsener Mann zu sein und dabei unverheiratet, sehr einsam und voller Zweifel, schien mehr der Realität zu entsprechen.
Dabei half es auch nicht viel, der nette jüdische Junge aus New York zu sein, der in Dillistown, Oregon, unterrichtete und unkontrollierbar einen Steifen kriegte.
Wenn die nach süßem Parfüm duftenden Mädchen, ihre eben erblühenden Busen unter sorgfältig ausgewählter Kleidung versteckend, das Klassenzimmer betreten, grüßen sie gewöhnlich: »Guten Morgen, Mr. Lester.«
An dieses »Mister«gerede kann ich mich nur schwer gewöhnen. Einen winzigen Augenblick lang spüre ich dann immer den Drang, über meine Schulter nach hinten zu linsen, um nachzusehen, ob mein Vater dort steht. Vielleicht, in zehn Jahren, wenn ich fünfunddreißig bin, werde ich mich an das »Mr. Lester« gewöhnt haben. Aber heute hätte ich nichts dagegen, einfach nur »Arnie« genannt zu werden, so als ob ich ein Freund wäre und nicht der Allmächtige, der Zensuren verteilt.
Doch die Kinder dürfen sich mit meinem Vornamen nicht vertraut machen. Nicht in einer Schule, in der jeden Morgen Treue auf die Fahne geschworen wird, die Schüler immer noch eine schriftliche Erlaubnis brauchen, um aufs Klo gehen zu dürfen, und der Direktor den Tag mit einer inspirativen Andacht über die Lautsprecheranlage beginnen lässt. Auch meine Kollegen, alle in schulmäßigem Sinne absolut integer, würden einen Anfall bekommen, wenn sie zufällig auf dem Gang eine Teenagerstimme »Was ist los, Arnie?« piepsen hörten. Die Kinder brächten das sicher fertig, wenn man sie lassen würde, aber durch nichts unterbrochene Traditionen (der Direktor trägt eine Krawatte) schnüren ihnen die Kehlen zu.
Am Montag, den 27. November 1978, schloss ich morgens die Tür zu meinem Klassenzimmer auf, schaltete das Licht ein und: wumm! – direkt durch beide Nasenlöcher ins Hirn – Dillistowns hochgradig reinigendes, antiseptisches Bohnerwachs! Die meisten Schüler aus der elften Klasse, die ich in der ersten Stunde unterrichtete, schleppten sich nach einem langen Wochenende herein, kaum fähig, das Kinn über der Tischplatte und die Augenlider offen zu halten. Ich richtete mich auf, zauberte ein eifriges An-die-Arbeit-Lächeln auf mein Gesicht und sagte: »Bitte setzt euch. So schlimm kann es doch nicht sein. Wir haben heute viel zu tun.«
Viel lieber hätte ich gesagt: »Ich bin auch müde. Lasst uns erst mal ausschlafen.«
Aber stattdessen: »Öffnet die Bücher. Seite hundertsiebzehn … Wer kann mir etwas über Benjamin Franklins Beitrag zur amerikanischen Literatur sagen?« Keine Antwort. »Okay. Vielleicht finde ich mit einem kleinen Quiz raus, wer seine Hausaufgaben gemacht hat.«
Was war ich doch für ein Arschloch! Ich hörte mich an wie der senile, faltige Lehrer in einer Fernsehserie.
Hal Mads Hand schoss in die Höhe.
»Hal?«
»Den Arme Leute Almanach.«
Fernsehen bildet, leider.
Ich feuerte noch mehr Fragen auf sie ab, wie ein Maschinengewehr, so schnell, dass sie einfach aufwachen mussten. Wir mussten die frühe amerikanische Literatur durchnehmen, und Ben Franklin war langweilig.
»Ben Franklin ist eine der interessantesten Persönlichkeiten der amerikanischen Geschichte. Er war unser erster Generalpostmeister, er leitete eine Zeitung … Howard, lass Stacys Heft in Ruhe und leg deine Hände auf deinen eigenen Tisch.«
Die Klasse lachte. Howard wurde scharlachrot. Weil ich ihr Lehrer war, wirkte jeder im Ansatz amüsante Satz, jedes vom akademischen Ton abweichende Wort ungemein komisch.
Schließlich hatte Howard keinen Fehler gemacht – er hatte nur versucht, ein wenig Aufmerksamkeit von einem niedlichen kleinen Mädchen zu ergattern.
Aber ich brauchte die ungeteilte Aufmerksamkeit, um eine Unterrichtsstunde in Gang zu halten.
Aus dem Augenwinkel erhaschte ich ein Stück von Stacys rundlichem Busen unter ihrer tief ausgeschnittenen Bluse.
Als Lehrer begegne ich einer Menge Widersprüchen.
Ich würde gern die Dinge mit Schülern besprechen, die sie interessieren, aber ich muss den Lehrplan erfüllen. Nur selten weiche ich vom Stoff ab. So kann ich abschätzen, was passieren wird, und verliere die Kontrolle nicht.
Ein Lehrer gebraucht seine Macht.
Da wir die Schüler nur eine Stunde pro Tag zu sehen bekommen, gibt es selten Augenblicke, in denen wir unsere Schwächen offenbaren. Deshalb erwecken wir immer den Eindruck, stark zu sein. Wo werden Kinder schließlich sonst dazu gezwungen, still zu sein, nur zu sprechen, wenn sie gefragt werden, den Bleistift auf Befehl zu nehmen und zu schreiben, zu lesen, geprüft zu werden und Treue auf die Fahne zu schwören?
Wir Lehrer verstecken uns hinter einer Rolle.
Wir sagen: »Ich befehle hier, ich bin der Einzige, der etwas weiß.«
Aus Angst, die Klasse nicht unter Kontrolle halten zu können, setzen wir diese Maske so lange wie möglich auf. Aber die Unwirklichkeit, die dahinter steckt, macht mir Angst. Auch Lehrer reden über Sex, bohren in der Nase, tratschen, weinen manchmal und können genauso unfair und eigensüchtig sein, wie jeder andere. (Ich hatte das nicht gewusst, bis ich selbst Lehrer geworden war.) Warum kann ich nicht mit den Schülern auf gleicher Stufe stehen und sie trotzdem unterrichten?
Aber ich möchte auch ein gutes Vorbild sein. Schüler brauchen unbefleckte Vorbilder und saubere Institutionen – Schule, Kirche, Bibliotheken –, die ihnen einen Sinn für Rechtschaffenheit vermitteln. Dabei habe ich ein schlechtes Gewissen. Wie kann ich ein gutes Vorbild sein, wenn ich mir beim Lesen des Playboy einen runterhole, die Telefongesellschaft nur allzu gern betrüge und beim Anblick von unverdorbenen, unberührten Teenagerkörpern, die Frühlingsduft und Frühlingsgelüste versprühen, eine Erektion bekomme, die wie ein Leuchtturm in meiner Hose steht?
Ich erlaube mir nie, diese Mädchen als Liebesgefährtinnen zu betrachten. Das wäre zu gefährlich. Ich mache mir immer bewusst, dass sie trotz ihrer äußeren Erscheinung in vielerlei Hinsicht noch kleine Mädchen sind. Sie könnten meine reiferen Bedürfnisse niemals erfüllen.
Aber manchmal kommen Stacy oder Beth nach der Stunde an meinen Lehrertisch, pressen ihre jungen, warmen Körper wie von ungefähr eine Sekunde an mich, flüstern ein paar schmeichelnde Worte, und ich werde ganz geil.
Es ist schwer, jedes Mal widerstehen zu müssen.
Ich betrat die Cafeteria gerade rechtzeitig, um Ed Bullock, einen Bullenkerl, Footballtrainer(!), die Mayonnaise aus dem Mundwinkel tropfend, sagen zu hören:
»Um mich um die kleinen Gören auch noch zu kümmern, kriege ich nicht genug bezahlt!«
Ich bestellte mein Mittagessen und lauschte mit einem Ohr auf die Meckerei an Bullocks Tisch. Es gefiel mir, Lehrer zu beobachten, wenn sie ihre Maske fallen ließen. Aber ich wollte nicht, dass sie mich dabei ertappten. Bullock jagte mir Angst ein. Ich war nicht gerade darauf aus, mich von ihm vor den Kollegen bloßstellen zu lassen. Man sagte, dass er seinen Schülern am ersten Tag immer verkündete:
»Ich kann euch nur das beibringen, was ich als Marinesergeant und Footballtrainer gelernt habe.«
Damit verschaffte er sich Respekt. Er war Mathematiklehrer.
Mit dem Tablett in der Hand sah ich mich nach einem ruhigen Plätzchen in dem von Stimmengewirr erfüllten Raum um. An einem langen Tisch saßen viele Lehrer und unterhielten sich beim Essen. Ein Platz war frei. Der Englischlehrer auf dem Stuhl daneben grüßte mich lächelnd und konzentrierte sich dann wieder auf sein Sandwich. Ich setzte mich allein an einen kleinen Tisch in der Ecke.
Immer hatte ich dieses komische Gefühl, ich wäre nicht gern gesehen. Einige Lehrer hegten Leuten aus dem Osten – oder allen jungen Leuten gegenüber? – grundsätzlich Misstrauen. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, warum ich den ganzen Weg von New York hergekommen war, um in Dillistown zu unterrichten.
Dann wiederum glaubte ich, dass sie sich von mir fern hielten, weil ich Jude bin. Von meinem Namen konnten sie es nicht ablesen, aber ich hatte diese gewisse Nase …
Sie waren nicht direkt bigott. Sie dachten eben nur gern in Stereotypen. Ein Kaufmann hatte einmal zu mir gesagt:
»Gutwilligkeit ist keineswegs uneigennützig. Wahrscheinlich haben die Juden sie gepachtet.«
Vielleicht war ich als einziger Jude in Dillistown auch nur überempfindlich.
Zu Anfang waren einige Leute sehr nett zu mir gewesen. Eine Frau kam mit einem Präsentkorb voll Früchten und Gutscheinen für den Supermarkt, um mich willkommen zu heißen. Aber jetzt, im November, gehörte ich bereits zum Stadtbild. Niemand achtete mehr auf mich.
Um ehrlich zu sein, ich achtete auch nicht besonders auf die Leute. Jeder kannte eben jeden, sie gehörten denselben Vereinen an, und die Frauen waren entweder verheiratet, oder mittlerweile zu alten Jungfern geworden. Viele hatten mich wohl in Verdacht, ein Hippie zu sein oder so was Ähnliches. Dabei ist mein Haar gar nicht so lang.
Ich hatte ein paar Freunde unter den Kollegen.
Irgendwo.
Ein schriller Pfiff und das aufbrausende Johlen einer Teenagermenge machte mich darauf aufmerksam, dass ich gerade den Höhepunkt des Basketballspiels versäumt hatte. Die Dillistown Rebellen spielten gegen die Falken aus Lake Hardy.
Ich hatte dem Mädchen an der Kasse fünfzig Cents für meine Eintrittskarte gegeben. »Danke, Mr. Lester«, hatte sie gesagt und dabei versucht, mir mit einem strahlenden Lächeln in die Augen zu schauen. »Hübscher Pullover«, hatte sie dann noch hinzugefügt, als ich auf die Eingangstür zur Turnhalle zugegangen war.
Unter den mehreren hundert Zuschauern fand ich eine leere Bank auf der Dillistownseite. Was konnte einen fünfundzwanzigjährigen Lehrer an einem Basketballspiel interessieren?
Ich mag Sport. Und außerdem …
Während des Tages, wenn ich Arbeiten zensiere, Vorlesungen halte, den Schülern sage, was sie tun sollen, wenn ich eine extra Toilette benutze, in der Lehrercafeteria esse und mich in einem eigenen Arbeitszimmer aufhalte, fühle ich mich ausgeschlossen. Wenn die Arbeit dann vorbei ist, schreibt mir der Direktor vor, was ich zu tun habe, und die Außenwelt betrachtet mich als einen durchschnittlichen Bürger, der genauso arbeiten geht, wie jeder andere auch.
Bei einem Basketballspiel habe ich das Gefühl, dazuzugehören und etwas wert zu sein.
»Anderson ist unser Mann. Was er nicht schafft, Burnside kann …«, skandierten die Cheerleaders. Sie waren wirklich süß. Sie sprangen in die Luft und feuerten mit ihren bunten Federschwänzen und Pompons die Menge an, animierten die Spieler und strahlten eine Menge von Koketterie und Arbeitseifer aus.
In New York gehörten die Cheerleaders einer aussterbenden Rasse an, aber hier in Dillistown waren sie ebenso wichtig wie die Spieler.
Cathy, die Anführerin, beobachtete mich. Nachdem sie ihr Anfeuerungslied beendet hatte, winkte sie mir lächelnd zu und stieß ihre Freundin Annette an, die ebenfalls zu mir herüberwinkte. Beide gingen in meine Englischklasse.
Ich weiß nicht genau, wie ich mir meine Popularität bei den Schülern erklären soll, besonders bei den Mädchen. Dass ich jung bin, hat ganz sicher etwas damit zu tun, auch dass ich ein Mann bin, aber es steckt noch mehr dahinter. Ich genieße eine gewisse Aura, weil ich aus New York komme. Diese Mädchen sind in dem Alter, in dem sie von einem aufregenden Leben träumen und hoffen, der Enge der Kleinstadt eines Tages zu entfliehen.
Ich halte mich nicht für schön. Ich bin ungefähr ein Meter achtzig groß und ein wenig zu dünn, gut rasiert, habe braune Augen, hellbraunes Haar und eine Haut, die im Sommer leicht bräunt. Mal falle ich auf, aber oft genug bin ich auch ganz unauffällig. Der Eindruck, den ich erwecke, hängt, glaube ich, von meinem Selbstvertrauen ab. Manchmal trete ich auf wie Mick Jagger, und manchmal fühle ich mich so lahm wie Gerald Ford.
Wenn ich an einer Bartheke oder auf einer Party eine Frau treffe, die mir nicht attraktiv erscheint oder nicht mein Typ ist, bin ich entspannt, unbeeindruckt und prompt erfolgreich. Man muss wohl der große Spötter sein, immer über den Dingen stehen können und viele Brusthaare haben, die aus dem weitgeöffneten Oberhemd hervorquellen, um Glück bei Frauen zu haben, zumindest bei denen, die ich mag. Aber mir ist es unangenehm, Mr. Männlichkeit zu spielen. Ich spüre dabei immer genau, dass ich einen Typen vormache, der ich nicht bin, und der mir auch nicht gefällt.
Auch in der Schule bin ich in Wirklichkeit der Macho. Das hängt mit meinem Image zusammen. Die Tatsache, dass ich die Macht habe, hinter dem großen Lehrertisch stehe und aller Augen auf mich gerichtet sind, dass ich aus einer gewissen Distanz heraus immer fremd bleibe und, wie gesagt, keine Schwäche preisgeben muss, verleiht mir die Aura, die den Rettungsschwimmer auf seinem luftigen Podest umgibt, von dem aus er seinen Strand überwacht.
Die Mädchen in meinen Klassen mögen gern kontrolliert werden. Dadurch werde ich zu der älteren, begehrenswerten, wichtigen Person, von der sie träumen. Wäre ich einer ihrer Klassenkameraden, würden sie mich nicht einmal bemerken.
Und manchmal gestalte ich den Unterricht so, dass er Spaß bringt. Das Klassenzimmer zu einem Ort wird, an dem sie sich entspannen können und Freude am Lernen haben. »Hey, Mr. Lester. Gutes Spiel, nicht wahr?«
Adele Lewis schenkte mir ihr rundes Lächeln auf ihrem runden Gesicht über ihrem rundlichen Körper. Jeder schien sich in ihrer Nähe wohl zu fühlen, weil sie einen geradeheraus ansah und immer gelassen wirkte.
»Kann man sagen«, antwortete ich. Die erste Hälfte war vorbei, und wir führten mit zwei Punkten Vorsprung. Ich hätte gern mitgeschrien und den Schiedsrichter ausgepfiffen, aber ich musste meine Rolle wahren.
»Bis auf die Fehlentscheidung«, fügte ich deshalb sachkundig hinzu.
Ein großer, sehniger Junge stieg über die Bankreihen. Wenn seine Pickel mal ausgeheilt wären, würde er sicher ein schönes, narbiges Gesicht bekommen,
»Ich möchte Ihnen meinen Freund vorstellen – Lane Thomas. Er geht in Lake Hardy auf die Schule. Aber heute steht er natürlich auf unserer Seite.«
Adele sah ihn ernsthaft, aber zärtlich an. Lane streckte die Hand aus und gab mir einen kräftigen Händedruck.
»Freut mich, Sie kennen zu lernen.«
»Mich auch.«
»Ich habe ihm alles von unserem Unterricht erzählt, Mr. Lester. Von den Videoprojekten und den Collagen, die wir mit Ihnen gemacht haben. Lane hat mir gesagt, dass sein Lehrer sie immer nur Benjamin Franklin lesen lässt, sonst nichts.«
Ich lächelte. Vermutlich hatte sie die Vormittagsstunde vergessen.
»Sie sind der Beste, Mr. Lester.«
Die Sirene ertönte um anzuzeigen, dass die zweite Halbzeit begann. Lane nahm Adele an die Hand und führte sie wieder nach unten.
»Bis morgen«, rief sie noch über ihre Schulter zurück.
Ich lächelte grüßend. Ich wollte mir ihre Schmeichelei nicht unter die Haut gehen lassen, aber sie tat gut.
Die zweite Halbzeit war so turbulent wie die erste, aber schließlich rissen die Rebellen sich zusammen, und wir gewannen mit zwölf Punkten Vorsprung. Ich wartete, dass die Menge vor mir langsam die Halle verließ.
Eltern freuten sich über einen hart erkämpften Sieg (ihr Sieg?), Schüler bildeten Gruppen, lachten, plapperten und planten, wo sie noch hingehen wollten, um Eis oder Hamburger zu essen. Wer hatte ein Auto?
Die Kinder lebten in einer Art Teenypopperwelt – ein Rückgriff auf die fünfziger Jahre. Am Freitagabend ging alles zum Tanzen und Sonnabendnacht stiegen sie in ihre aufpolierten Autos und kreuzten die Hauptstraße rauf und runter, die von riesigen Scheinwerfern hell erleuchtet war, vorbei an diesem Kino, jenem Drugstore, und so weiter.
Ich glaube, New York und die sechziger Jahre waren Schuld daran, dass meine Tennagerjahre so ganz anders verlaufen waren. Wir rauchten jeden Morgen vor der Schule Pot, brachen mit Vorliebe die Bekleidungsvorschriften, zuerst mit weit ausgestellten Jeans (die Mädchen in Miniröcken), später mit ausgeblichenen, ausgefransten und oft geflickten Jeans, Batik T-Shirts, ausgeleierten Sportpullovern, Sandalen und Stirnbändern. In der achten Klasse gabelte der Direktor mich einmal auf dem Gang auf, drückte mir zwei Dollar in die Hand und sagte, dass er mich von der Schule suspendieren lassen würde, wenn ich mir nicht augenblicklich die Haare schneiden ließe. (Mein Pony fiel kaum in die Augen, die Locken berührten gerade die Schultern.) Zwei Jahre später hatte ich einen langen, wehenden Pferdeschwanz (ich hasste diesen Scheißkerl von Direktor!). Wir schwänzten Stunden, um an Friedensveranstaltungen teilzunehmen. Klar, zu der Zeit war das mehr ein Spaß, aber wir spürten den Vietnamkrieg. Wir hatten Angst, wir wussten, was um uns herum vor sich ging.
Die Menge hatte sich aufgelöst. Ich stand auf und legte meine Jacke über den Arm. Gus, der Hausmeister, fegte die Turnhalle aus. Er fuhr mit einem breiten, flachen Besen über den Boden. Ich winkte ihm zu. Mit seinem warmen, breiten Grinsen rief er: »Das beste Spiel, das ich bisher gesehen habe!« Seine Stimme bildete ein Echo in der leeren Halle.
»Ja. Sie haben gespielt wie ’ne Eins.«
Er wandte sich wieder seiner Arbeit zu, stolz, an so einem wichtigen Ereignis teilgenommen zu haben.
Ich stieg die Treppe zum Haupteingang hinunter. Sechs große Flügeltüren führten hinaus auf den Fahrweg, wo man noch einige Rücklichter der wegfahrenden Autos sehen konnte. Allein in dem Gebäude fühlte ich mich einsam und war überrascht, als ich Annie Alston vor einem der Schaukästen stehen sah. Sie betrachtete aufmerksam die Fotos.
Annie ging in die elfte Klasse, die ich in der ersten Stunde unterrichtete. Ich erkannte sie an ihrer schlanken, jungenhaften Gestalt. Sie war eine ruhige Schülerin, schien immer eine eigene, abgesonderte Welt im Kopf zu haben, in die sie niemandem Einblick gab, außer ihrer Freundin Clara vielleicht, ihrem Schatten.
Immer hingen die beiden zusammen. Sie liefen im Gleichschritt durch die Gänge, kicherten gemeinsam in einer Ecke und wurden sofort still, wenn jemand sich ihnen näherte. Doch Annie stach aus der Menge hervor. Sie schien nicht so überdreht, ihr Selbstvertrauen nicht so aufgesetzt zu sein wie sonst bei Sechzehnjährigen. Sie besaß eine gewisse Reife. Oder Kultiviertheit? Oder Zuversichtlichkeit? Selten beteiligte sie sich am Unterricht, überraschte mich dann aber durch ihre intelligenten Aufsätze. Man konnte sie für schön halten mit ihren langen, glatten, dunklen Haaren, dem schmalen Gesicht und den strahlenden Augen, aber man sah sie nie mit Jungen zusammen.
Gus, der ein schweres Eisengitter vor die Türen schob, um die Halle abzuschließen, erinnerte mich daran, dass es Zeit zum Gehen wäre.
Ich war nicht in der Lage herauszufinden, woran ich bei Annie war, was in ihrem Kopf vorging. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass sie mich ständig zu ignorieren schien, die mich immer ein wenig an ihr faszinierte. Niemals schmeichelte sie mir oder spielte das »Oh, Mr. Lester«-Spiel mit mir wie die anderen Mädchen. Meine Anwesenheit quittierte sie stets mit einem beinahe versteckten Lächeln, das mich verunsicherte.
Bei dem Geräusch von Gus’ Eisengitter drehte Annie sich um. Ein Lächeln erhellte ihr Gesicht. Es war, als hätte sie meine Anwesenheit schon die ganze Zeit über bemerkt (mein Spiegelbild im Fenster?). Ich war verlegen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie wusste, was ich gerade dachte.
»Hallo, Mr. Lester«, sagte sie beiläufig.
»Eh, hast du deine Mitfahrgelegenheit verpasst?«, war alles, was ich herausbrachte. Ich fühlte mich ertappt.
»Meine Mutter kommt erst in zwanzig Minuten nach Hause. Sie arbeitet. Ich werde sie nachher anrufen.«
»Vater?«
»Was?«
»Vater.«
»Ich habe Sie schon beim ersten Mal verstanden«, sagte sie und drehte sich wieder zum Fenster um. Ich wusste nicht, was ich sonst noch sagen sollte und ging deshalb auf den Ausgang zu.
»Gute Nacht, Mr. Lester«, sagte sie wesentlich freundlicher als bei der Begrüßung.
»Ich könnte …«
»Nicht nötig.«
»… dich nach Hause fahren«, stieß ich hervor. Ich hätte es nicht sagen sollen. Lehrer wurden oft gewarnt, Schüler nicht nach Hause zu fahren. Wir waren für ihre Sicherheit total verantwortlich und standen immer mit einem Bein im Gefängnis. »Es macht keine Umstände. Wo wohnst du, Annie?«
»Auf der anderen Seite der Hauptstraße, ungefähr zehn Minuten von hier.«
»Kein Problem«, ich hielt ihr die Tür auf.
Während ich fuhr, war sie wieder still und starrte aus dem Fenster. Ich hatte das Bedürfnis, diese Stille mit einem Laut zu füllen, wusste aber nicht, was ich sagen sollte.
»Hausaufgaben schon gemacht?«
»Immer der Lehrer, wie?«
»Eh, nein. Eigentlich nicht. Nein. Überhaupt nicht. Manchmal lasse ich mich auch gehen. Aber in der Nähe von Schülern ist das etwas schwierig.«
»Wir sind Menschen …«
»Glaubst du, das weiß ich nicht?«
»… nicht nur Schüler!«
Ich schmollte.
»He. Es tut mir Leid. Sie sind gar nicht so übel. Ehrlich. Sie sind ein bisschen anders.«
»Nur ein bisschen?«, fragte ich – nicht ganz so gelassen, wie sonst in meiner Lehrerrolle. Sie hatte mich provoziert.
»Nur ein bisschen«, bestätigte sie. Ich schwieg. »Und ich weiß, dass Sie sich verdammt viel Mühe geben.« Sie kannte mich gut. »Trotzdem behandeln Sie uns immer wie Schüler, nicht wie Menschen. Besonders, wenn Sie uns etwas vormachen … so … gön – ner – haft.«
Sie betonte jede Silbe, als ob dieses Wort eine Vokabel wäre, die sie gerade gelernt hätte.
»Ein bisschen streng, oder?«
»Tut mir Leid. Ich habe doch gesagt, dass Sie sich Mühe geben.« Sie starrte wieder aus dem Fenster. Ich konnte das Gespräch nicht neu anknüpfen.
»Die nächste rechts, dann links, das erste Haus auf der linken Seite.«
Ich befolgte ihre Anweisung pflichtgemäß und fuhr den Wagen in die Auffahrt vor ihrem Haus.
»Du könntest dich auch ein wenig mehr anstrengen«, sagte ich. Angriff ist die beste Verteidigung. Der von den Schülern umschwärmte Mick Jagger hatte sich langsam in den Gerald Ford verwandelt.
Plötzlich entstand eine fühlbare Stille, so als ob wir beide zu atmen aufgehört hätten. Man konnte jedes Geräusch überdeutlich hören. Annie stieg nicht aus. Ich sah sie an, verwundert über ihren eigenartig selbstsicheren Gesichtsausdruck.
Sie kniete sich auf den Vordersitz, lehnte sich über mich und nahm mein Gesicht in ihre Hände. Langsam näherte sich ihr Mund meinen Lippen.
Sie küsste mich lange.
Ich hielt still, wusste nicht, warum ich nicht aus ihrer Umarmung brach. Sie öffnete meine Lippen und stieß ihre Zunge in meinen Mund.
Heiß.
Sie ließ los. Ich war außer Atem.
Dann sagte sie: »Dieser Kuss war nicht von einem Mitglied aus Ihrem Fanclub, das Ihre Aufmerksamkeit sucht. Es war echt. Ich wollte Sie berühren.«
Ich konnte nicht unterscheiden, ob sie nun eine Menge Liebesromane gelesen hatte oder wirklich glaubte, was sie sagte.
Ihr Mund hatte nicht gelogen.
Mein Herz raste wie ein Motor, der an einem kalten Wintermorgen warm läuft.
In dem Augenblick fuhr Annies Mutter in die Einfahrt.
2. Kapitel
Vielleicht war es ein Fehler, »Lolita« zu lesen
Die ganze Sache hätte ja nun ziemlich harmlos aussehen können, doch ich war so verlegen, dass ich mich irgendwo nach einem guten Versteck umsah. Ich suchte krampfhaft nach einer Ausrede für Mrs. Alston, warum ich mich so aufgeregt und erhitzt in ihrer Auffahrt befand, nachdem Annie gerade meinen Wagen verlassen hatte.
Mrs. Alston kam an mein Autofenster. Einen Augenblick lang dachte ich daran, sie zu ignorieren und einfach abzufahren, aber ihr Wagen stand ja direkt hinter meinem.
»Guten Abend, Mrs. Alston. Ich habe Annie nur schnell nach Hause gefahren. Wir haben uns beim Basketballspiel getroffen. Eine gute Schülerin.« Das klang ziemlich normal.
»Sie müssen Mr. Lester sein«, sagte sie lächelnd. Ihre Haare wurden von Spray in Form gehalten. Unter dem geöffneten Mantel entdeckte ich eine Kellnerinnenuniform. »Annie hat mir schon viel von Ihnen erzählt. Englisch ist ihr Lieblingsfach. Sie sagt, dass Sie ein großartiger Lehrer wären.«
»Danke, Mrs. Alston. Annie macht mir auch sehr viel Freude.« Ich wäre fast an meiner Zunge erstickt bei dem Gedanken, dass sie mich missverstehen könnte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!