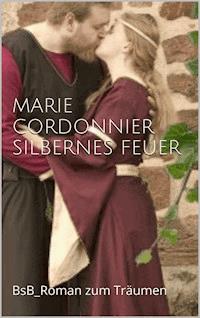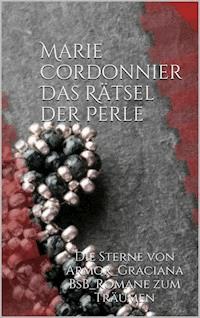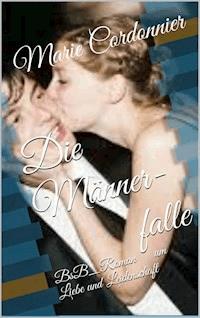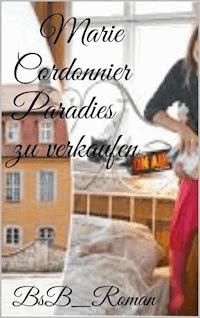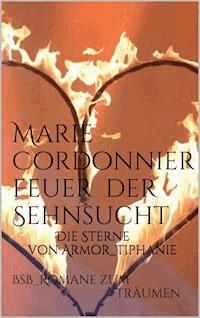Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Erben haben die vier Söhne des Falken sich Reichtum erhofft, doch stattdessen hinterließ ihr Vater ihnen eine heruntergekommene Burg, eine Menge Schwierigkeiten und ein merkwürdiges, geheimnisvolles Mädchen aus dem Orient. Nun nach des Vaters Tod geht jeder Sohn seiner eigenen Wege. Simon, der zweite und gutmütigste der vier Brüder, hilft seinem älteren Bruder bei dessen Grenzstreitigkeiten gegen die Lubins. Bei einem Überfall gelingt es ihm dabei, die schöne Charis zu entführen. Um die Familienfehde zu beenden, ordnet der König Simons Heirat mit Charis an. Während die Familie d'Escoudry und die Lubins hierauf Frieden schließen, fängt eine ganz andere Fehde an: Charis wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, sich Simon zu unterwerfen und seine Frau zu werden… „Die geraubte Rose" ist der Band 2 der Serie „Die Söhne des Falken". „Herzerfrischend, spannend, mit manch vergnüglichen Wortgefechten amüsant zu lesen, absolut empfehlenswert“, sagen Leser der neu nicht mehr lieferbaren Printausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of contents
Normandie – August 1272
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Normandie – August 1272
Ein Zweig aus wilden Rosen schmückte das steinerne Wappenschild mit dem Falken. Der Steinmetz hatte sein Möglichstes getan, dem Ritter, der sich auf Schild und Schwert stützte, die Züge Mathieu d'Escoudrys zu verleihen, aber das Mädchen, das die Rosen gebracht hatte, verließ sich lieber auf seine Erinnerungen als auf die entfernte Ähnlichkeit. Das letzte Mal, als sie dieses Antlitz mit den harten, schroffen Zügen gesehen hatte, hatte der Krieger auf dem Sterbebett gelegen. Ausgezehrt und bereits vom nahenden Tod gezeichnet, während er mit letzter Kraft darum kämpfte, das Wort zu halten, das er einem anderen gegeben hatte. Es war ein Eid, der auch sie mit ewigem Schweigen band und dazu führte, dass sie an einem Tag wie diesem heimlich zweier Toter gedachte und für sie betete. Das steinerne Maßwerk der neuen Kapelle vereinte sich über ihrem gesenkten Kopf wie die zierlichen Zweige eines frommen Waldes. Die geschnitzte Holztür mit den eisernen Zierbändern sperrte die Wärme des Sommertages und den Lärm des betriebsamen Innenhofes von Glain aus. Sie war allein mit ihren Erinnerungen, die mehr und mehr den reizenden Bildern eines Stundenbuches glichen als einmal gelebter Wirklichkeit. Die Liebenden von Damiette, die ihre Eltern gewesen waren, kamen ihr fast schon vor wie Gestalten aus einer Legende, und Dinge, die sie nur aus Erzählungen kannte, mischten sich mit denen, die sie selbst erlebt hatte. Je mehr Zeit verging, um so weniger vermochte sie zu sagen, wo die Wirklichkeit endete und der Traum begann. Und sie hatte keinen Menschen, mit dem sie darüber sprechen konnte, niemanden, der ihre Fragen beantwortete. Diese Machtlosigkeit verstärkte die seltsame Unruhe, die sie bereits seit Tagen empfand. Dieses Unbehagen verdichtete sich zu jener Art von Angst, die zu fürchten sie gelernt hatte, zu einer sicheren Gewissheit kommenden Unheils, dem man nicht entweichen konnte. Die letzten Worte ihres sterbenden Vaters klangen in ihren Gedanken nach. »Gehorche dem Falken. Er hat mir mit seinem Leben für das deine garantiert. Er wird dich in Sicherheit bringen und dafür sorgen, dass du jenes Glück und jenen Frieden findest, die deiner armen Mutter durch meine Schuld nicht gegönnt waren. Wenn ich vor meinen Schöpfer trete, werde ich für dich bitten!« Doch Mathieu d'Escoudry, der stolze Kreuzritter und Lehnsherr von Glain, hatte die ihm zugedachte Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Auch er war ein Opfer der gnadenlosen Seuche geworden, die vor Tunis das Kreuzfahrerheer des Königs von Frankreich in der sengenden Sommersonne des Jahres 1270 vernichtet hatte. Seine Gebeine ruhten in einem der schrecklichen Massengräber, die das Ende des königlichen Traumes von einem eroberten, christlichen Morgenland kennzeichneten. Nichts war geblieben, nur jener finstere Racheschwur, der vor Damiette getan worden war. Ein verzweifelter, wilder Fluch, der das stille Mädchen in der Kapelle von Glain auch nun wieder wie mit Eisesfingern streifte. Denn jener, der ihn ausgestoßen hatte, war mächtig und einflussreich. Wenn er jemals erfuhr, wessen Blut in ihren Adern floss, wenn er Kenntnis davon bekam, dass es sie gab, würde ihr nicht einmal Zeit für ein letztes Gebet bleiben. Der Falke hatte sie dem Schutz seiner vier Söhne anbefohlen. Sie war das Erbe, das er ihnen von seinem letzten Kreuzzug geschickt hatte. Ein Erbe, das Gefahr, Blut und Tod bedeuten konnte und nur wenig Ruhm einbrachte. Und doch, es war das Erbe des Falken, dem sich keiner von ihnen entziehen konnte.
1. Kapitel
Normandie – September 1272
Das gepflegte Viereck des kleinen Kräutergartens lag im Windschatten der mächtigen Burgmauer, und um die Zeit des Vesperläutens wärmte die Sonne nur noch eine Ecke der Beete. Unter den Ranken des rotflammenden wilden Weines saß eine junge Frau auf einer alten Steinbank. Mit flinken Fingern band sie Lavendelrispen zu Büschen, die sie, einen nach dem anderen, sorgsam in einen flachen Korb zu ihren Füßen legte. Der Duft der trockenen Zweige hüllte sie in den Wohlgeruch des scheidenden Sommers. Er haftete an ihren Fingern, legte sich zwischen die Falten ihres schlichten, braunen Barchentrockes und zog in die dicken, rötlich-blonden Zöpfe, die unter dem weißen Schleier bis weit über die Taille hinabhingen. Trotz der einfachen Gewänder war es unzweifelhaft eine Edeldame, die sich der Kräuter annahm. Ihre edle Haltung, die Grazie ihrer Bewegungen verriet sie. Hinzu kam, dass die Farben der St. Lubins unverkennbar waren: die rötlichen Haare und das kräftige Blau der Augen. Der stille Beobachter lächelte. Das Schicksal schien ihm eindeutig geneigt zu sein. Der Anblick der ehrenwerten Demoiselle von Tînténiac, Charis de St. Lubin, brachte seinen flinken Verstand auf eine hervorragende Idee, die in Windeseile Konturen bekam. Dieser Einfall gefiel ihm wesentlich besser als die Vorstellung einer kriegerischen Belagerung, wie er sie ursprünglich im Sinn gehabt hatte. Weshalb sollte er seine Männer unnötig in Gefahr bringen, wenn es eine andere Möglichkeit gab? Charis de St. Lubin griff gerade nach den letzten Lavendelzweigen, als sich plötzlich eine dicke, erstickende, dunkle Wolke um ihren Kopf und ihre Schultern legte. Sie rang in panischem Schrecken nach Luft, kämpfte verzweifelt gegen das Hindernis. Irgend jemand packte sie mit roher Gewalt und hob sie hoch, während ihre wütende Gegenwehr in dem Maße geringer wurde, als sie das Gefühl hatte zu ersticken, bis sie schließlich in einer Mischung aus Luftmangel und Schock die Besinnung verlor. Sie hatte keine Ahnung, wieviel Zeit vergangen war, bis sie wieder zu sich kam. Eines stand jedoch unzweifelhaft fest: In ihrem ganzen Leben hatte sie sich noch nie so grässlich und so unbehaglich gefühlt. Wie es schien, hatte man sie in einen riesigen, schweren Reiterumhang gewickelt, dessen ehemaliger Träger dem Geruch nach dieses Kleidungsstück wohl einen langen Feldzug Tag und Nacht getragen haben musste. Man hatte ihr die Kapuze weit über das Gesicht gezogen, damit sie nichts sehen konnte, und als sie unwillkürlich versuchte, sich zu befreien, musste sie feststellen, dass sie an Händen und Füßen gefesselt war. Charis lag wieder still und versuchte mehr darüber herauszufinden, wo sie war und in wessen Gewalt sie sich befand. Ihr Rücken verriet ihr auf unangenehme Weise, dass sie auf harter Erde lag und sich die Wurzeln eines knorrigen Baumes in ihre Hüfte drückten. Die Feuchtigkeit und die Kühle, die unter die Falten ihres leichten Rockes krochen und sie frösteln ließen, sagten ihr, dass der Abend hereingebrochen sein musste. Die junge Frau schauderte, diesmal nicht nur vor Kälte, sondern vor Angst. Bei allen Heiligen, was war geschehen? Der dicke Stoff des Umhangs dämpfte die Männerstimmen, die sie vernahm, aber nicht genug. Sie verstand, worum es bei diesem Streit ging, und ihr Zittern verstärkte sich. Unzweifelhaft wurde da über ihr eigenes Schicksal verhandelt. »Verschont mich mit derlei Unsinn, mein Junge!« brummte ein mürrischer Kerl, der sich anhörte, als besäße er eine gewisse Autorität über den anderen. »Unsere Aufgäbe ist es, die Salztransporte zu sichern und nicht die Burg von Tinténiac zu schleifen. Ganz davon abgesehen, dass diese Mauern jeder Belagerung standhalten werden und der Fluß zusätzlichen Schutz bietet.« »Wie es scheint, wird der große Bec Noir alt und feige«, erwiderte eine andere Stimme, die jünger klang, gereizter und rauer. »Wir sichern die Salztransporte meines verehrten Herrn Bruders am besten, indem wir ein für alle Mal dafür sorgen, dass sich kein St. Lubin mehr an unserem Hab und Gut vergreift. Und was diese Burg betrifft, so mag sie zwar über beachtliche Bollwerke verfügen, aber an der Flußseite hat sich Eustache de St. Lubin zu sehr darauf verlassen, dass niemand die gefährlichen Stromschnellen überwindet. Seht dorthin, da liegt mein Beweis dafür, dass man an jener Stelle in die Burg gelangen und wieder herauskommen kann, ohne dass auch nur ein Wachposten Verdacht schöpft.« »Beweis? Der Beweis wofür? dass Weiberröcke Euch wieder einmal von allem anderen abgelenkt haben? Zur Hölle, wenn Ihr nicht der wagemutigste Kämpfer dieses Königreiches wäret, dann hätte ich Euch den Dienst schon längst gekündigt.« Charis war eben zu der Überzeugung gekommen, dass sie in die Hände einer Räuberbande gefallen sein musste, als sie plötzlich am Arm gepackt und unsanft auf die Füße gestellt wurde. Jemand riss ihr die Kapuze zurück. dass sie dabei an den Haaren gezogen wurde, entlockte ihr einen empörten Aufschrei. »Hier, Bec Noir!« fuhr der Sprecher fort und packte sie am Kinn, um ihr Gesicht zum Feuer zu drehen. »Seht Euch diesen > Weiberrock< näher an, den ich Euch gebracht habe. Ich möchte mein Schwert gegen Euren rostigen, alten Dolch wetten, dass wir die Dame de St. Lubin persönlich vor uns haben. Eine niedliche, wutschnaubende, hochgeborene Furie!« »Oh, Ihr ... Ihr Grobian! Ihr niederträchtiger, abscheulicher Lümmel! Ihr ...« Charis wußte, dass sie keifte, aber ihr Zorn war stärker als ihre Erziehung. Eine Hand legte sich auf ihren Mund und unterband den Strom ihrer Beleidigungen, noch ehe sie richtig in Fahrt gekommen war. Ein Arm legte sich um ihre Taille, drückte sie gegen eine Männergestalt, deren Waffengehänge und Kürass sie dabei leise klirren hörte. »Eine echte Dame«, stellte der Mann belustigt fest, während Charis hilflos in seinem rohen Griff zappelte. »Eine Geisel, die uns das Wohlverhalten der Brüder St. Lubin garantieren wird. Nun, mein Freund, bin ich immer noch ein Nichtsnutz, der seine Aufgabe über einem Techtelmechtel vergisst?« Charis starrte aus weit aufgerissenen Augen auf den Krieger, der seinen Namen Bec Noir unzweifelhaft verdiente. Er war größer und breiter als jeder andere Mann, den sie kannte; die untere Hälfte seines Gesichtes wurde von einem wüsten, schwarzen Bart bedeckt, der ihm das Aussehen eines missgelaunten Bären verlieh. Alles an seiner Haltung, seiner Kleidung und seinen Waffen verriet den rücksichtslosen Söldner, der sich dem Meistbietenden verkaufte und ohne Rücksicht tötete, wenn es verlangt wurde. Gegen diesen Riesen hätte sogar die grobschlächtige Gestalt ihres Bruders Eustache unbedeutend gewirkt. Ihre jüngeren Brüder Paul und Richard würde er vermutlich mit einem einzigen Schlag zu Boden strecken. Unter seinem finsteren Blick stellte sie ihr unwürdiges Gezappel ein und zwang sich, seinem Blick standzuhalten, obwohl ihr der stechende Ausdruck seiner kleinen, schwarzen Augen einen neuerlichen Schauer über den Rücken jagte. In einiger Entfernung lagerte ein Trupp schwer bewaffneter Krieger, doch das verwunderte Charis nicht. Männer wie dieser zogen Abenteurer und Glücksritter an wie das Licht einer Kerze die Motten. »Was erwartet Ihr?« sagte Bec Noir nun zu jenem Unbekannten hinter Charis, den sie immer noch nicht gesehen hatte, nur spüren konnte. »dass Eustache de St. Lubin Lösegeld für sie zahlt? Man erzählt sich, dass er ihre Verlobung mit dem Seigneur von Blois gelöst hat und jener dem Schöpfer dafür gedankt hat, dass er sie nicht heiraten musste. Sie soll irgendeinen Makel haben. Vielleicht habt Ihr St. Lubin sogar einen Gefallen getan, indem Ihr ihn von der Sorge für dieses Frauenzimmer befreit habt.« Charis biss die Zähne zusammen, dass ihre Kieferknochen schmerzten. So war also ihre Schande bereits Gesprächsthema des halben Königreiches. Sie würde eine alte Jungfer bleiben. Eine gehorsame, demütige Haushofmeisterin für ihre Brüder, die in der Burg ihrer Väter Weiberarbeit tat und deren Folgsamkeit man als selbstverständlich voraussetzte. Eine Gefangene der eigenen Familie, die auf Tinténiac alt und grau werden würde. Denn wer nahm schon eine Edeldame zur Frau, über die bereits die Söldnerhorden überall im Königreich spotteten? Bis zu jenem schmachvollen Tag hatte sie Eustache zwar keine Liebe entgegengebracht, aber wenigstens eine gewisse geschwisterliche Zuneigung und den nötigen Respekt. Doch dann hatte sie lernen müssen, dass all die Sanftmut und Freundlichkeit, die Gelehrsamkeit und die weiblichen Tugenden, um die sie sich so sehr bemüht hatte, nichts zählten gegen die Macht der Männer. dass er das Familienoberhaupt war, gab Eustache St. Lubin das Recht, über seine Schwester zu bestimmen wie über einen Sack Mehl. Es gab keine Instanz auf dieser Welt, bei der eine verratene Schwester Gerechtigkeit oder gar eine verschwendete Mitgift einfordern konnte. »Wir werden diesem heuchlerischen Schurken beweisen, dass man sich nicht ungestraft mit den Söhnen des Falken anlegt. Wie auch immer er ihr gegenüber eingestellt sein mag, sie trägt seinen Namen, und er ist als christlicher Ritter verpflichtet, sie zu schützen. Er wird tun müssen, was wir verlangen, und wir werden ihm eine so deutliche Warnung hinterlassen, dass er keine Zweifel am Ernst unserer Drohung haben kann.« »Ihr seid närrisch«, platzte Charis mitten in diese energische Rede und lachte nervös auf. »Eustache hat an der Leiche unseres Vaters einen Racheschwur getan, und er gehört nicht zu den Männern, die einen solchen Eid zurücknehmen. Er wird alles vernichten, was den Namen Escoudry trägt. Wenn Euch die Brut des Falken zu diesem Zweck angeheuert hat, dann solltet Ihr Euren Sold nehmen und das Weite suchen. Euer Leben ist keinen Pfifferling mehr wert, wenn meine Brüder Euch und Eure Männer entdecken!« Der Ratschlag entlockte Bec Noir dröhnendes Gelächter. Charis, die zwischen Empörung und Panik schwankte, verspürte plötzlich den wilden Wunsch, diesen Giganten zu schütteln, den weder ihre Warnungen noch ihr Zorn beeindruckten. Und obwohl der Unbekannte hinter ihr nicht das wütende Funkeln ihrer Augen sehen konnte, schien er doch zu spüren, was in ihr vorging, und es amüsant zu finden. »Ihr habt eine spitze Zunge, Dame St. Lubin«, meinte er lachend und drehte sie so plötzlich zu sich herum, dass sie Mühe hatte, das Gleichgewicht zu wahren. »Vielleicht sollten wir den Stricken einen Knebel hinzufügen. Es missfällt mir, wenn es eine junge Frau am Respekt fehlen läßt und Drohungen ausstößt.« Charis hatte schon den Mund geöffnet, um ihrer Empörung erneut Luft zu machen, aber es kam kein Laut über ihre Lippen. Aus weit aufgerissenen Augen starrte sie ihren Entführer an. Dieser Schurke war schön, das Idealbild eines kriegerischen Mannes schlechthin! Noch nie hatte sie jemanden wie ihn gesehen! Er war mindestens genauso groß wie dieser Bec Noir, aber seine athletische Gestalt wirkte besser proportioniert. Er hatte beachtlich breite Schultern und einen mächtigen Brustkorb; die Hüften waren schmal. Die engen Lederhosen, die er zu einem ärmellosen Lederwams und einem lässig verschnürten Hemd trug, schmiegten sich um lange muskulöse Beine. Spott funkelte in seinen grünen Augen, und nun legte er den Kopf schief und betrachtete sie wie jemand, der gerade eine Ware erstanden hat und zu befürchten beginnt, dass er sie vielleicht doch ein wenig übereilt gekauft hat. Sein Antlitz war von absoluter Perfektion, wie die in Marmor gemeißelten Züge eines antiken Kriegsgottes. Seine Nase war gerade, die Brauen leicht gewölbt, der volle, sinnliche Mund schien ebenso Lebenslust wie Grausamkeit zu verraten. Aufmerksam betrachtete Charis sein Gesicht. Es wurde ausdruckslos unter ihrer Musterung, sie konnte nicht erkennen, was er dachte. Doch dann verdüsterte ein kaum sichtbarer Schatten seinen Blick, so als ob eine vorüberziehende Wolke das Grün einer Meeresbucht für einen Moment in trübes Grau verwandelt hätte. Doch nicht nur sein Aussehen und seine Kraft faszinierten Charis so sehr. Er strahlte noch etwas anderes aus, etwas, was sie nicht hätte benennen können, was sie jedoch mitten in die Seele traf. Ihr Herzschlag setzte einen Moment lang aus, ehe er stolpernd und unregelmäßig wieder in Gang kam. Charis begriff nicht, was mit ihr geschah, weshalb sie ganz atemlos wurde und wieso sie das Gefühl hatte, dass ihre Knie sie plötzlich nicht mehr tragen wollten. Wie verzaubert stand sie da und konnte ihn nur anschauen. Doch auch Simon d'Escoudry reagierte auf ungewohnte Art, als er Charis so nah vor sich stehen sah. Er hatte sie eine Weile auf ihrer Gartenbank beobachtet, aber er hatte dabei überlegt, wie er die Umstände zu seinen Gunsten nutzen konnte, und sie als Person eigentlich nicht wahrgenommen. Doch nun unterzog er sie einer interessierten Musterung. Sie war zu groß für eine normale Frau, mindestens so hochgewachsen wie die meisten Männer seines Gefolges, ihm jedoch reichte sie knapp bis ans Kinn. Der letzte, rötliche Strahl der untergehenden Sonne warf kupferne Reflexe auf ihre Haare, die unbedeckt waren, da ihr Schleier bei diesem Abenteuer verrutscht war. In dem sanften Abendlicht schimmerte ihre Haut wie Samt; die vollen, schöngeschwungenen Lippen waren ein wenig geöffnet und schienen förmlich zu einem Kuß einzuladen. Lange Wimpern, viel dunkler als ihr Haar, umrahmten ihre klaren Augen von ungewöhnlichem Blau; Augen, die wie Edelsteine funkelten. Sie wirkte ruhig und beherrscht, doch das trotzig vorgeschobene Kinn und das wütende Blitzen ihrer Augen verrieten, dass sie ein ungestümes Temperament und einen Mut besaß, der einem Mann wohl angestanden hätte. Einen Stolz, der sie auch in ausweglosen Situationen aufrecht hielt, und ein ausgeprägtes Gefühl für Recht und Ehre. Er wußte dies, obwohl er sie nicht kannte. Irgend etwas tief in ihm schien alles über Charis de St. Lubin zu wissen. Etwas, was ihn dazu drängte, sie in die Arme zu schließen und sich zu ihrem Ritter zu erklären. Sie mit jedem Atemzug zu beschützen und den Rest seines Lebens damit zuzubringen, das Verfliegen eines jeden einzelnen Tages in ihren Augen zu beobachten. »Wer seid Ihr?« hörte er ihre Stimme, der plötzlich jeder Zorn abhanden gekommen war. Jetzt klang sie wie weicher Samt, wie das melodische Murmeln eines kleinen Baches, der unter Moospolstern in der Sonne dahinhüpft. Sehr weiblich und sehr sinnlich. »Simon d'Escoudry, zu Euren Diensten, schönste Dame«, antwortete er und zwang sich in die Wirklichkeit zurück. »Zweitältester Sohn des Falken und Bruder des Seigneur von Glain. Gehorsamer Ritter des Königs von Frankreich und ... « »Mörder!« Simon stutzte und stellte fest, dass das blaue Feuer ihres Blickes kaltem Eis gewichen war. Er spürte, wie ihr Körper sich versteifte. »Mörder«, wiederholte sie tonlos. »Bruder eines Mörders und Mörder unserer Männer. Wir haben von Euch gehört, Simon d'Escoudry. Ihr seid ein gottloser Haudegen, noch abscheulicher als Euer Bruder, an dessen Händen das Blut unseres Vaters klebt. Verzeiht meinen Irrtum, ich hätte wissen müssen, dass man einen Schurken Eures Kalibers nicht anheuern kann. Männer wie Ihr sind nur in eigenen Diensten und zum eigenen Vorteil unterwegs!« »Beim Beil des Henkers, habt Ihr den Verstand verloren, Weib?« Simon d'Escoudry hatte es noch nie sehr gut vertragen, beschimpft zu werden, und schon gar nicht von einer Frau wie dieser. Irgendwie erschien es ihm wie ein persönlicher Verrat. Wie kam sie dazu, ihm derartige Unverschämtheiten an den Kopf zu werfen? Steckte hinter dieser klaren Stirn etwa ein beschränkter Verstand? »Mathieu hat Euren Vater im fairen ritterlichen Zweikampf getötet! Und auch das erst, nachdem Euer sauberer Vater zwölf Männer seines Gefolges niedergemetzelt hatte! Nennt Ihr das keinen Mord, meine Dame? Und was ist mit den Salztransporten, die Euer Bruder seit Monaten immer wieder überfällt?« »Ihr besitzt kein Recht zum Salzhandel!« Charis erinnerte sich an eine Bemerkung, die sie bei einem Gespräch ihrer Brüder aufgeschnappt hatte. Zufällig nur, denn normalerweise vermieden sie es, in ihrer Gegenwart Pläne zu schmieden. »Die Salzsümpfe sind Bestandteil der Mitgift meiner Schwägerin, Léonie d'Escoudry!« fuhr Simon sie an. Seine Stirn hatte sich zornig gerötet, und er packte die rebellische Gefangene wütend an den Oberarmen und schüttelte sie. »Und sogar wenn dem nicht so wäre, würde es Eurem verdammten Bruder nicht das Recht geben, unsere Handelszüge zu überfallen und unsre Männer zu massakrieren! Ich schwöre Euch, dies wird ein Ende haben, ehe die Sonne morgen über Eurer Burg aufgegangen ist!« Seine Worte ließen sie zittern, genau wie die bedrohliche, männliche Ausstrahlung, die von ihm ausging. Und es empörte sie zudem, dass er sie so gepackt hatte. Noch nie hatte es ein Mitglied ihrer Familie gewagt, Hand an sie zu legen. Selbst Eustache war davor zurückgeschreckt, sie mit purer körperlicher Gewalt zum Gehorsam zu zwingen. Dennoch brachte sie es nicht fertig, den Blick abzuwenden. Sie ertrank fast im Sturm der grünen Augen, und Bec Noirs Stimme drang wie aus weiter Ferne in ihr aufgestörtes Bewusstsein, ohne dass sie zunächst den Sinn seiner Worte begriffen hätte. »Frauen wie sie bedeuten Ärger, mein Junge«, warnte der Schwarze, Böses ahnend. »Weiß der Teufel, aber es wäre mir lieber gewesen, Ihr hättet darauf verzichtet, sie zur Geisel zu nehmen.« »Sie gehört mir«, antwortete Simon d'Escoudry, und Charis spürte, dass er seinen Griff noch verstärkte, als steckte sie in einem Schraubstock. Ihr leiser Schmerzenslaut ging in seiner kühlen Antwort unter. »Sie ist meine Gefangene, und ich schätze, Eustache de St. Lubin wird sich etwas einfallen lassen müssen, wenn er sie zurückhaben will. Vielleicht behalte ich sie sogar ...« »Lieber schmore ich den Rest meines Lebens in der Hölle«, hörte sie sich erstickt antworten, während sie empört an ihren Fesseln zerrte, die sich dadurch nur noch tiefer eingruben. Simon d'Escoudry antwortete mit einem Lachen darauf. Einem so fröhlichen, unbeschwerten Lachen, dass Charis erneut erbebte, diesmal vor Haß und Zorn. »Wir werden sehen, was wir für Euch und Eure Wünsche tun können, Dame St. Lubin«, erklärte er. Er lockerte plötzlich seinen Griff, doch er ließ sie nicht los. Seine Hände wanderten über ihre Arme und Schultern nach oben, legten sich dann um ihren Hals. Seine Daumen lagen auf ihrem Kehlkopf, und Charis war hin- und hergerissen zwischen gegensätzlichen Gefühlen. Was er tat, jagte ihr Angst ein, doch nicht nur Bedrohung lag in seiner Berührung, sondern auch eine merkwürdige Zärtlichkeit, die ihr einen Schauder über den Körper jagte. »Bec Noir! Ruf die Männer zusammen und kümmert Euch um die Boote. Wir werden Tinténiac heute nacht noch einen Besuch abstatten, ehe wir nach Hause reiten!« Charis wußte, was dies bedeutete, und wieder lehnte sie sich gegen ihre Fesseln auf, obwohl ihr klar war, dass dies sinnlos war. Dies und ihre heftig pochende Halsschlagader verriet ihm, wie wütend sie ihre Freiheit begehrte. »Es hat keinen Sinn, meine Schöne.« Er lächelte auf sie herab und sie sah, dass er noch alle Zähne hatte, und makellose dazu. »Findet Euch damit ab, dass Ihr Simon d'Escoudry gehört!« »Eher gehöre ich dem Satan und seinen Heerscharen!« rief sie widerspenstig. »Wer weiß ...« Seine Finger glitten nach oben und fuhren federleicht die Konturen ihrer Lippen nach. »Wer weiß, vielleicht werdet Ihr eines Tages dahinterkommen, dass Simon d'Escoudry und der Teufel ein- und derselbe sind.« Charis war geneigt, ihm beizupflichten. Sie sank hilflos in die Knie, als er sie endlich losließ und mit Bec Noir zu seinen Männern hinüberschlenderte. Gelassen und beherrscht, jeder Zoll ein Mann, der sich seiner Kraft und seiner Aufgabe bewusst war. Ein Mann, dem Eustache nie und nimmer gewachsen sein würde. So wenig wie ihr Vater seinem Bruder gewachsen gewesen war. Charis unterdrückte ein Schluchzen und grub die Zähne so fest in die Unterlippe, dass sie Blut schmeckte. Sie versuchte zu beten, die Unterstützung des Himmels für ihre Brüder und die Menschen von Tinténiac herbeizuflehen. Aber es war ihr nicht möglich, gleichzeitig um die Vernichtung Simon d'Escoudrys zu beten. Sie war zum hilflosen Opfer der eigenen wirren Gefühle geworden. Ungeweinte Tränen brannten in ihren Augen. Die hereinbrechende Dämmerung hüllte das Waldversteck in immer dichtere Schleier. Über dem typischen Geruch nach Moos, Feuchtigkeit, verrotteten Blättern und reifenden Pilzen lag der schwere Duft von blühendem Lavendel, der aus ihren Röcken aufstieg. Es schien in einem anderen Leben gewesen zu sein, als sie keine anderen Probleme hatte, als sich um die Wintervorräte an Kräutern kümmern zu müssen. Ob man sie bereits in Tinténiac vermisste? Das heißt, falls überhaupt jemand sie vermisste, dann höchstens das Gesinde, ihre Brüder sicher nicht. dass sie nicht da war, würden sie erst dann merken, wenn sich kein Essen auf dem Tisch fand und keine neuen Kerzen gezogen wurden. Sie konnte die Blicke nicht von der hünenhaften Gestalt des Mannes lösen, die sich so geschmeidig bewegte. Simon d'Escoudry glich einem goldenen Löwen, der sich seiner Beute und seines Jagderfolges sicher ist, noch ehe er richtig zum Sprung angesetzt hat. Es war ein Fehler, Raubtieren zu nahe zu kommen. Aber hatte ihr das Schicksal denn eine Wahl gelassen?
2. Kapitel
Tinténiac brannte! Charis sah den feurigen Schein, der den Herbsthimmel erleuchtete und die Nacht zum Tage machte. Die Ställe, die Scheunen und Vorratslager, die mit Schindeln und Binsen gedeckt waren, boten eine willkommene Nahrung für die Flammen. Die Ernte, die bis auf ein paar letzte Felder fast eingebracht war und einen Winter ohne Hunger versprochen hatte, war nun dabei, sich in Glut und Asche aufzulösen. Die junge Frau war so weit vom Ort des Geschehens entfernt, dass sie das Brausen nicht hören konnte, das dieses Inferno begleitete. Hier war es still, lediglich das Rauschen des Flusses war zu hören; ab und zu klirrte das Zaumzeug eines der Pferde, die hinter ihr, unter den Bäumen, auf ihre Reiter warteten. Zwei halbwüchsige Knappen bewachten die Tiere und warfen von Zeit zu Zeit scheue Blicke auf die hochgewachsene, schlanke Gestalt, die an den Stamm einer Weide gebunden war und hilflos mit ansehen musste, wie ihre Heimat in Flammen aufging. Charis starrte reglos auf die brennenden Dächer, ohne sich ihre Gefühle anmerken zu lassen. Diese Fehde, die ihr Vater mit den Escoudrys vom Zaun gebrochen hatte, erschien ihr ebenso sinnlos wie rätselhaft. Eustache führte sie nun weiter, und Charis kannte den Bruder gut genug, um zu wissen, dass nicht allein ritterliche Ehre, sondern auch der primitive Wunsch zu zeigen, wer der Stärkere war, seine Entscheidung bestimmt hatte. Doch wie es schien, war er ebenso wie sein Vater an den Falschen geraten. Die Söhne des Falken gehörten nicht zu jenen Männern, deren Eigentum man ungestraft angriff. Die beiden Salztransporte, die Eustache mit seinen Brüdern überfallen hatte, waren es nicht wert gewesen, dass Tinténiac dafür zerstört wurde. Charis erinnerte sich an die sorgsam zusammengetragenen Wintervorräte, an die Stoffballen und Krüge, an die Früchte und Gewürze, die ihrer Aufsicht unterstanden hatten. Alle Sorge und alle Arbeit umsonst! Nur Männer vermochten mit soviel sinnloser Gewalt und Zerstörungswut ihre Fehden auszutragen! Wovon würden die Menschen in Tinténiac im Winter leben? Das leise Scharren eines anlegenden Bootes riß sie aus ihren Gedanken. Sie erkannte die Umrisse der flachen Kähne, die auf Tinténiac dazu verwendet wurden, die Ernte von der anderen Seite des Flusses zu holen, und sie begriff, dass sich Simon d'Escoudry auf jenem kühnen Streifzug, der sie ihre Freiheit gekostet hatte, genau umgesehen haben musste. Und er hatte nicht nur das Boot geraubt, sondern auch noch ein gutes Dutzend mürrischer Männer gefangen genommen, die nun hinter seinen Söldnern her stolperten. Ihre Rüche und vereinzeltes Stöhnen verrieten, dass ein Teil von ihnen verletzt sein musste, und Charis nahm an, dass es sich in erster Linie um die fremden Soldaten handelte, die Eustache mit ihrer Mitgift angeheuert hatte und die im Mannschaftsquartier neben den Ställen hausten. Wie es schien, hatten sich Escoudry und Bec Noir nicht die Mühe gemacht, den Palast der Burg zu stürmen, auf dessen Verteidigungsanlagen Eustache so stolz war. Ein paar gedämpfte, scharfe Befehle flogen durch die Nacht, und ehe Charis auch nur einen Schritt gehört hätte, wußte sie, dass Simon d'Escoudry hinter ihr stand. Entweder bewegte sich dieser Mann mit der Lautlosigkeit eines Nachtschattens, oder sie hatte sich durch die Ankunft der anderen zu sehr ablenken lassen. Nun spürte sie wieder jenes seltsame Prickeln im Nacken, das ihr unweigerlich seine Gegenwart verriet. Die feinen Härchen richteten sich auf. Ein Ruck ging durch ihre Gestalt, als Charis plötzlich begriff, wie es ihm gelungen war, ohne großen Widerstand mit seinen Männern in den Vorhof der Burg zu gelangen. Sie, Charis, war nicht ins Haus zurückgekehrt, und deswegen war auch die schwere Ausfallpforte zu den Gärten offen geblieben. Es kam öfter vor, dass sie sich in ihre Gemächer zurückzog und die abendliche Tafel mied. Die alte Jeanne, die seit ihrer Geburt das Amt einer Kinder- und Kammerfrau bei ihr versah, kam abends die steile Treppe zur Kemenate nicht mehr hinauf. Vor dem nächsten Morgen würde niemand ihr Verschwinden entdecken, also hatte sich auch niemand die Mühe gemacht, eine Tür zu kontrollieren, die normalerweise ohnedies verschlossen war. Sie hatte also selbst dazu beigetragen, dass Tinténiac gefallen war. »Der Himmel wird Euch strafen«, sagte sie aus diesen bitteren Gedanken heraus, ohne auch nur den Kopf zu wenden. »Und ich werde jeden Tag meines Lebens darum beten, dass es so bald als möglich geschieht.« Sie sah nicht, dass Simon d'Escoudry die Stirn runzelte und sich fragte, wie in Dreiteufelsnamen dieses große Mädchen ihn gehört haben konnte. Sie musste über die Ohren eines Luchses verfügen und die Nacht wie eine Katze durchdringen können. Normalerweise bemerkte ihn nicht einmal Bec Noir, wenn er nicht wollte, dass er gehört wurde. »Es wäre sicher besser gewesen, Ihr hättet Euren Bruder in Eure Frömmigkeit mit einbezogen«, riet er ihr gelassen. »Konntet Ihr ihn nicht davon überzeugen, dass das fünfte Gebot >Du sollst nicht stehlen< lautet?« »Bastard!« rutschte es Charis heraus, und sie erschrak über sich selbst. Das war kein Wort, das sich für eine Edeldame ziemte. »Hütet Eure Zunge, Dame!« murmelte er nach einer Weile des Schweigens, das sich unheilvoll und bedrohlich zwischen ihnen dehnte. »Mein Vater war der erste Ritter des Königs, und niemand beleidigt ungestraft den Namen der Escoudrys!« »Dann benehmt Euch wie ein christlicher Ritter und nicht wie ein räuberischer Strauchdieb«, riet ihm Charis spöttisch. »Noch ein Wort, und ich lasse Euch hier zurück, wenn wir reiten«, sagte er gereizt und hob den Dolch, mit dem er eben ihre Fesseln hatte durchschneiden wollen. »Es könnte einige Zeit dauern, bis man Euch in diesem Sumpf findet. Ihr könntet bedauerlicherweise längst verhungert und verdurstet sein bis dahin. Aber wenigstens würdet Ihr schweigen...« »Pah, wenn Ihr Euren Krieg gegen wehrlose Frauen führen wollt, dann tut Euch keinen Zwang an!« fuhr sie ihn an, und ließ sich nicht anmerken, dass seine Drohung ihren Herzschlag aus dem Takt gebracht hatte. Diesem unverschämten Kerl, der in dieser von Wolken und Nebelfetzen durchzogenen Nacht kein Gesicht besaß, traute sie alles zu. »Hexe!« antwortete er lediglich und durchschnitt die Fesseln. »Ich nehme Euch vor mich auf das Pferd. Ich warne Euch jedoch, wenn Ihr Ärger macht, werde ich Euch fesseln und wie einen Getreidesack vor meinen Sattel hängen. Bezähmt also Euer zänkisches Temperament und Eure Freude an Beleidigungen.« Charis massierte sich unwillkürlich die schmerzenden Handgelenke und machte einen Schritt vom Baum weg. Dabei übersah sie jedoch eine Wurzel und stolperte prompt in die Arme, die Simon d'Escoudry hilfreich ausgestreckt hatte, noch bevor er sich selbst dessen bewusst geworden war. Der Duft von Lavendel hüllte ihn ein, und erstaunt stellte er fest, wie weich und schmiegsam sie in seinen Armen lag. Nein, dieses Mädchen gehörte nicht hierher, nicht unter diese raue Kriegerschar, in deren Kleidern der üble Geruch von Blut und Tod hing. Nicht in die Arme eines Mannes wie ihn selbst. Charis fühlte instinktiv den Moment der Schwäche, die den geharnischten Ritter mindestens ebenso überraschte wie sie, und geschickt versuchte sie, Kapital daraus zu schlagen. Sie befreite sich nicht aus seinem Griff, wich nur ein Stück zurück, dass sie ihn besser ansehen konnte, und hob ihr Gesicht zu ihm empor. »Lasst mich gehen, Seigneur!« bat sie mit weicher Stimme. »Ihr habt Eure Vergeltung gehabt. Gebt mir Eure Botschaft an meine Brüder mit, und ich werde tun, was in meiner Macht steht, damit es endlich Frieden gibt zwischen Euch und ihnen.« Was hatte sie nur an sich, welchen Zauber warf ihre sanfte Stimme, dass er jedes mal das Gefühl hatte, er käme nach einem langen Ritt nach Hause, sobald er diesen Klang hörte? Die Stimme, die ihn umfing wie mit Spinnenfäden und ihn alles andere vergessen ließ. »Genügt Euch das Zerstörungswerk nicht, das Ihr hinterlassen habt?« setzte sie eine Spur vorwurfsvoller hinzu und zerstörte damit selbst den Bann, den sie über den Ritter geworfen hatte. Weibliche Vorwürfe waren etwas, was Simon d'Escoudry niemals akzeptierte. Er schüttelte sich einen Moment, als hätte sich der nächtliche Nebel über seine Schultern gelegt und müßte mit dieser Bewegung abgestreift werden. »Überlasst es mir, zu entscheiden, was ich für nützlich halte und was nicht. Im Moment liegt mir daran, dieses Flussufer zu verlassen und meine Gefangenen in Sicherheit zu bringen«, erklärte er und hob sie ohne Mühe auf seine Arme. Ehe Charis wußte, wie ihr geschah, saß sie auf dem Rücken eines mächtigen, schnaubenden Streitrosses, und Simon d'Escoudry schwang sich hinter ihr in den Sattel. Ein knapper Befehl, und der Trupp setzte sich in Bewegung. In seiner Mitte die stolpernden Gefangenen, hinter sich den brennenden Feuerschein von Tinténiac und ... Charis sah über Simons Schulter zurück und fand ihre Befürchtungen bestätigt. »Die Boote? musstet Ihr auch die Boote in Flammen setzen? Es sind weit und breit die einzigen Fahrzeuge, die über den Fluss führen. Weshalb ...« »Aus eben diesem Grund«, fiel er ihr ins Wort. »Eure verehrten Brüder werden einen anderen Weg finden müssen, über die Rance zu kommen, und bis dahin sind wir längst hinter den Mauern von Glain in Sicherheit.« Glain. Charis hatte Eustaches Wutanfall erlebt, als die Botschaft nach Tinténiac kam, dass der junge König das Lehen von Glain für Mathieu d'Escoudry bestätigt hatte. Anstatt den ältesten Sohn des Falken für den Mord an ihrem Vater zur Rechenschaft zu ziehen, hatte Philipp von Frankreich den Lehnseid des Ritters akzeptiert und seine Kerkerhaft aufgehoben. Die Botschaft seiner Majestät hatte keine Zweifel gelassen; er befahl Ruhe zwischen Tinténiac und Glain. Charis hatte nie begriffen, weshalb Eustache diesen königlichen Befehl missachtet und die Salztransporte trotzdem überfallen hatte. Er tat vieles, was sie nicht verstand. So hatte er ihr auch nie erklärt, wieso er ihre Mitgift für seine Zwecke verbraucht hatte. Eustache dachte nicht daran, einer Frau etwas zu erklären, nicht einmal der eigenen Schwester. »Wollt Ihr Lösegeld für mich erpressen?« fragte sie und schrie leise auf, als sie ins Schwanken geriet, als der Hengst sich in Bewegung setzte. Sie war keine besonders geschickte Reiterin, und der gutmütige Zelter, auf dem sie sonst ritt, unterschied sich beträchtlich von dem feurigen Streitross, das sein zusätzliches Gewicht ohne merkliche Beeinträchtigung trug. »Schwätzt nicht, haltet Euch lieber fest«, war die barsche Antwort, und Charis verstummte schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass sie entsetzlich müde war, dass sie seit dem vergangenen Vormittag nichts mehr gegessen hatte und dass sie auf rüdeste Weise vom ärgsten Feind ihrer Brüder entführt wurde. Zwischen Erschöpfung, Hunger, Zorn und mühsam verborgener Furcht schwankend, schien es nur einen einzigen fixen Punkt in ihrer aus den Fugen geratenen Welt zu geben. Jene breite Brust, an die sie von einem starken Arm gedrückt wurde, während die andere Hand die Zügel zwischen den Fingern hielt. Mit klammen Fingern suchte sie Halt am breiten Sattelhorn und zwang sich mit zusammengebissenen Zähnen, die Mühsal des nächtlichen Rittes zu ertragen. Immerhin ging es ihr noch besser als dem Trupp der gefangenen Männer, die im Dunkeln dahinstolperten und grob weitergetrieben wurden, wenn sie Schwäche zeigten. Charis vermochte nicht zu sagen, wieviel Zeit schließlich vergangen war, bis sie das Lager erreichten, in dem sich die Männer des Salztransports versteckt hielten, die Simon d'Escoudry und Bec Noir nicht begleitet hatten bei ihrem Überfall auf Tinténiac. Sie vernahm die Parolen, das Gelächter, die Berichte und die rauen Stimmen der Männer wie aus weiter Feme. In den dicken Umhang Simon d'Escoudrys gehüllt, war sie neben dem Feuer vor Erschöpfung auf die Knie gesunken und hielt die starren Finger der Wärme entgegen. Ihre ordentlichen Zöpfe hatten sich gelöst, und in den Rocksäumen trockneten die Schlammreste vom Flussufer. Sie hätte ihre Seligkeit für einen Kanten Brot und einen Schluck Wasser verkauft, aber sie war zu erschöpft, um darum zu bitten. War es so, wenn man starb? Dieses Abgleiten in Gleichgültigkeit und Vergessen? »Die Frau ist am Ende!« Bec Noirs brummige Stimme übertönte den Lärm, und während Charis sich noch fragte, ob diese mitleidige Feststellung tatsächlich ihr galt, hörte sie Simon d'Escoudrys typisch männliche, rücksichtslose Antwort. »Sie wird es überstehen. Bis morgen abend sind wir in Glain.« »Und was soll sie dort?« fragte Bec Noir aufsässig. »Euer Bett wärmen? Eurer verrückten Bastard-Schwester die Katze nachtragen? Seid ehrlich, Ihr habt Euch von ihrer hübschen Larve zu einer Dummheit verführen lassen. Es war nicht nötig, Eustache de St. Lubin durch die Entführung seiner Schwester noch weiter zu reizen. Ihr handelt Euch mehr Ärger ein, als Ihr vertragen könnt, Seigneur!« »Und Ihr könnt endlich aufhören, mich wie einen unmündigen Pagen zu behandeln, Alter!« vernahm sie Simons unwillige Erwiderung. »Ich weiß, was ich tue! Verlasst Euch darauf!« »Da habe ich so meine Zweifel...« Offensichtlich war Bec Noir gewillt, das letzte Wort zu behalten, Charis wartete vergeblich auf den Wutanfall d'Escoudrys. Bec Noir durfte seinem Herrn und Waffengefährten Dinge sagen, für die er einen anderen längst niedergestreckt hätte. Warum? Weil sie eine Art Freundschaft verband oder weil beide gleich stark waren und eine ständige Herausforderung in allem mitschwang? Oh, sie würde niemals im Stande sein zu begreifen, was im Kopf eines Mannes vorging! Sie spürte nicht mehr, dass Simon ihre verkrampfte Gestalt auf eine Decke in der Nähe des Feuers legte und eine weitere über sie breitete. Und sie bemerkte auch nicht, dass er sich neben ihr auf die Fersen hockte und nachdenklich das blasse, schöne Antlitz betrachtete, das von der letzten Glut des Feuers mit rötlichen Reflexen überhaucht wurde. Charis war nicht die erste schöne Frau, die ihn interessierte, aber bisher hatte sich sein Interesse stets auf sehr eindeutige Dinge beschränkt. Weitergehende Gefühle hatte er niemals empfunden, und schon gar nicht das Bedürfnis, für eine Frau zu sorgen, über ihr Wohlergehen zu wachen. Wie dumm, dass er ständig den Wunsch verspürte, sie anzuschauen, dass er alle Kraft brauchte, um seinen Blick abzuwenden. War es das, was sein Bruder Mathieu empfand, wenn er seine Frau Léonie ansah? Oder war er, Simon, durch den wilden Streich gegen Tinténiac so von Triumph erfüllt, dass er alles im Überschwang sah? Er war geneigt, letzteres zu glauben, denn im Grunde hielt er Mathieu für närrisch. Im Gegensatz zu seinem Bruder hatte er keine Lust, sich an eine Frau zu ketten, und schon gar nicht an eine, die St. Lubin hieß. Dennoch verleugnete er nicht, dass sie Lust in ihm weckte. Er wollte sie berühren, ihre Lippen schmecken, ihre weiche Haut berühren und ihren schlanken Körper spüren. Sie war eine Frau, die einen Mann um den Verstand bringen konnte. Eine Verlockung, das war nicht zu leugnen. Schweigen hatte sich über das Lager gesenkt, und jeder der Männer nutzte die wenigen Stunden bis Tagesanbruch, um noch ein bisschen Ruhe zu finden. Bis auf die Wachposten hatte jeder die Augen geschlossen, auch Simon d'Escoudry, obwohl er als einziger nicht schlief. Dabei gab es eigentlich keinen vernünftigen Grund für die nervöse Spannung, die ihn wachhielt. Der Handstreich in Tinténiac hatte von seinen Männern keine Verluste gefordert, und wenn ihn nicht alles täuschte, würde sich Eustache de St. Lubin jetzt für einige Zeit ruhig verhalten. Um so mehr, als er eine Geisel in seiner Macht hatte, die dies garantieren würde. Eine Geisel, die ihn auf eine Art und Weise beunruhigte, die er nicht recht verstand. Immer wieder musste er sie anschauen. Es war nicht das gesunde, ungestüme Begehren, das er sonst empfand, wenn er ein hübsches Frauenzimmer sah. Von Charis de St. Lubin ging eine andere, viel faszinierendere Anziehung aus. Ein gefährlicher Reiz ... 3. Kapitel
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!