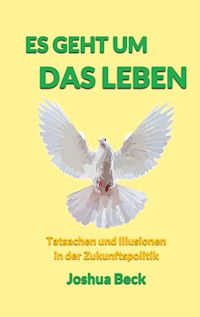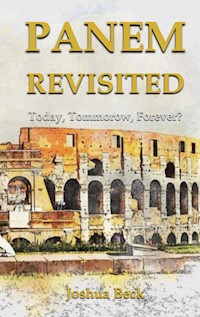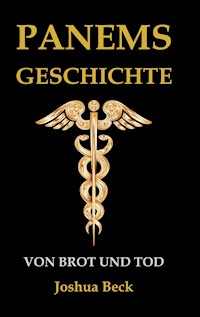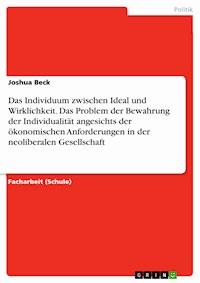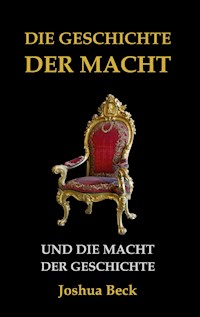
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Snowfall
- Sprache: Deutsch
In diesem erweiternden Band, der aufgrund der Komplexität der Themen zu einem Grundlagenbuch und einer Art »Nachschlagewerk« geworden ist, geht es darum, die Analytik von Politik, Macht und Staat zu verstehen. Warum ist dies wichtig? Viele Menschen verstehen nicht, wie eine Regierung funktioniert. Dies bereitet Verschwörungstheorien einen fruchtbaren Nährboden. Verschwörungsmythen werden uns, so fürchte ich, gerade bei disruptiven politischen Umbrüchen in den nächsten Jahren gesellschaftlich stark begleiten. Schon 1969 bezeichnete es Horkheimer als »unendlich wichtige Aufgabe, an Schulen, diese Dinge zu lehren, sodass die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig sind«. Auch ist es wichtig, dass wir als Gesellschaften begreifen, wie Systeme soziokulturell-historisch gewachsen sind - zum einen, zum anderen aber alle Staatsordnungen ihrem Wesen nach gleich funktionieren, und ein Systemwettstreit, in dem jeder seine Art zu leben als die »einzig Wahre und Richtige« proklamiert, so absurd wie unnötig ist. Vielleicht kann dieser Band einen kleinen Beitrag zur Idee der friedlichen Harmonie in der Welt beitragen, das kollektive Miteinander wenigstens ein Stück weit harmonisieren, wenn er verstanden wird von denjenigen, die ihn lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Anfang war die Macht.
Macht.
Was ist die Macht?
Was kann Macht?
Was macht Macht und macht Macht Macht?
Ist Macht destruktiv und repressiv?
Wie kann Macht Freiheit und Wissen produzieren?
Wird sie je ein Ende finden?
Nur die Macht selbst, was immer das ist, kann uns eine Antwort darauf geben.
Es geht darum, die Mikrobiologie der Machtmechanismen in ihrem Genotyp zu entschlüsseln, ihre feinen Maschen zu durchschauen und zu verstehen, um ihren Phänotyp begreifen zu können.
Inhalt
Danksagung
Vorrede
Vorwort zum erweiternden Band
Einführung: Der Historiker als Archäologe
1. Eine Anatomie der Macht
Vorüberlegungen und Terminologie
1.1 Die
Erfindung
der politischen Macht
1.2 Analytik der Macht
1.2.1 Das Wesen der Macht
a) Macht: Ein perpetuum mobile?
b) Gehorsam und das Panpotikum
c) Drei Thesen zur Macht
1.2.2 Das Wesen des Friedens
1.2.3 Das Wesen der Politik
1.2.4 Das Wesen des Krieges
1.3 Die Macht der Systeme
1.3.1 Eine kurze Geschichte der Weltbevölkerung
1.3.2 Eine kurze Geschichte der Weltreligionen
1.3.3 Eine Anatomie der Religionsmacht
1.3.4 Eine Symbiose von Kapitalismus und Sozialismus?
1.3.5 Zur Soziologie der Organisationen
1.4 Die Macht der Sprache und der Propaganda
1.4.1 Die Macht der Medien
1.4.2 Die Macht der Sprache
1.4.3 Propaganda
1.4.4 Die Konsensfabrik und ihre verborgenen Machtmechanismen
1.4.5 Infantilismus als Herrschaftsinstrument
1.5 Liberalismus
neu
denken
1.6 Ein Modell der Gesellschaft
2. Das Wesen des Faschismus
2.1 Die Macht der infantilen Masse
2.1.1
Masse und Macht
– Elias Canetti.
2.1.2 Ursprung des infantilen Phänomens
2.1.3 Die Ursprünge der infantilen Masse
2.2
Anatomie der menschlichen Destruktivität
– Erich Fromm.
a) Grundsätzliche Überlegungen
b) Leidenschaften und Mensch-Sein
c) Charakterliche Prägungen
d) Charaktere des Menschen
e) Die Liebe zum Toten
Resümee
2.3
Psychoanalyse des Faschismus
– Erich Fromm.
2.3.1 Die Geburt der
Freiheit
a) Die Freiheit der Geburt
b) Die feudalen Fesseln der Freiheit
c) Die extremen Auswüchse des Kapitalismus
d) Das Erbe der Reformation
e) Freiheit und der moderne Mensch
Resümee
2.3.2
Die Furcht vor der Freiheit
a) Flucht ins Autoritäre
b) Flucht in die Destruktivität
c) Die Flucht ins Konformistische
Resümee
2.3.3 Psychoanalyse des Faschismus: 1933 und 2016
2.4
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft
– Hannah Arendt.
a) Totalitäre Führer und ihre Massen
b) Terror und Propaganda
c) Die Welt als Illusion
d) Die Bedeutung des Führers
e) Totale Herrschaft
Resümee
2.5 Die Amerikanische Revolution und der Mayflower Compact
2.6 Das Phänomen Trump
2.6.1 Meuterei auf der Mayflower
2.6.2 Totalitärer Infantilismus
2.6.3 Die Liebe zum Toten
2.7 Die Mahnungen der Geschichte
2.7.1 Das Wesen des Faschismus
2.7.2 Die Macht des Wissens
3. Die Ordnung des Staates
3.1 Systeme sind kultur-historisch gewachsen
3.2 Der historische Preis der Freiheit
3.2.1 Demokratie und Sklaverei
3.2.2 Liberalismus und Kolonialismus
3.3 Die Ordnung des Staates
3.3.1 Menschenbilder und Humanitas
Humanitas bei Cicero
Menschenbild bei Platon
Menschenbild bei Aristoteles
Glückseligkeit nach Aristoteles
Menschenbild bei Kant
3.3.2 Die vier Gesichter des Staates
3.3.3 Die europäische Demokratie: Versuch einer Biographie.
Staatstheorien der Antike
Staatstheorien der Aufklärung
3.4 Vom Ende der epistokratischen Idee
3.4.1
Gegen Demokratie
3.4.2 Für Demokratie
3.4.3 Über Demokratie und illiberalen Liberalismus
3.5 Die wehrhafte Demokratie
3.5.1 Demokratie und Radikalismus
3.5.2 Geschichte des Antisemitismus
3.5.3 Lehren der Geschichte
3.6 Internationale Beziehungen
Resümee
Literatur
Anmerkungen
Danksagung
Aus einem Brief an meinen früheren Englischlehrer, dem ich danken möchte dafür, dass er mein Interesse an Collins Werk geweckt hat:
Betreff: »Grüße aus Panem« und ein kleiner »Brief aus dem Rosengarten«
Lieber Herr E.,
[.] Die aktuellen Entwicklungen in politischer Dimension sind leider wenig erfreulich. Vieles erinnert mich an die Tribute von Panem und in diesem Kontext habe ich mich auch unserer gemeinsamen Englischstunden erinnert. Die Filme haben mich seit über fünf Jahren nicht mehr losgelassen und nun habe ich motiviert durch Collins Viertes Buch begonnen – da es weder Freizeitgestaltung mit Freunden oder ein freudiges, erfolgreiches Studieren gibt – aus der Not eine Tugend zu machen und also ein Buch darüber zu schreiben. Es ist aktueller denn je, mit Blick auf die totalitäre Trump-Bewegung in den USA als auch katalysiert durch die Corona-Schrecken global.
Sutherland schreibt in seinen/seinem (?) Letters from Rose Garden:
Power. That’s what this is about? Yes? Power and the forces that are manipulated by the powerful men and bureaucracies trying to maintain control and possession of that power? Power perpetrates war and oppression to maintain itself until it finally topples over with the bureaucratic weight of itself and sinks into the pages of history (except in Texas), leaving lessons that need to be learned unlearned.
Seine Analyse, so schlicht und kompakt sie auch daherkommen mag, ist vortrefflich zutreffend. Die Mechanismen der Macht, ihre Manifestierung in Machtverhältnissen und also auch in den daraus gebildeten Machtstrukturen zu entschlüsseln, ist eine fast unmögliche Aufgabe, aber ich habe das Gefühl, nach vielen Jahren des Nachdenkens, Sortierens und Analysierens langsam einen Durchblick zu erhalten, Collins Werk also dechiffrieren zu können.
Auch wenn es eine Banalität sein mag, ohne Ihr Eigeninteresse, das Verhalten der Charaktere verstehen zu wollen und uns Schülerinnen und Schüler nach einer Erklärung für viele Absurditäten zu fragen, das Werk also zum Gegenstand des literarischen Diskurses im Unterricht zu machen, hätte es dieses meine Interesse vermutlich so nie gegeben. [.]
*****
Einen besonderen Dank möchte ich auch meinem Freund Steven Schwarz widmen, der mich als Historiker und Politikwissenschaftler in vielerlei Fragen beraten hat, sowie Iris Pilling, mit der ich vor der Veröffentlichung des Manuskriptes intensive Gespräche über die aufgegriffenen Inhalte und erarbeiteten Thesen und ihre Form führen konnte.
Für Fragen der Psychologie und Psychoanalyse danke ich Christine Preißmann, Meike Miller und Julia Klimek sowie für zeitgenössische Erfahrungsberichte, die mir Stefan Sauerwein und Marcel Dehmer zugetragen haben. Aber auch meiner Tante Renate Beck danke ich für den Austausch über kulturgeschichtliche Begebenheiten.
Besonders danken muss und möchte ich aber sechs bedeutenden Denkern, ohne die dieses Buch in dieser Form niemals hätte entstehen können: Hannah Arendt, Elias Canetti, Erich Fromm, Michel Foucault sowie Noam Chomsky und Stephen Hawking, deren Werke mich stark im Denken beeinflusst haben, auch wenn letztere beiden an dieser Stelle nicht direkt Eingang hierin finden.
Der hauptsächliche Dank aber gebührt Suzanne Collins sowie all denen, die an der Verfilmung dieses großartigen Gesamtkunstwerkes mitgearbeitet haben. Dieses Werk hat das Potential, die Welt zu verändern. Für viele Panem-Fans hat das Werk längst ihr Leben ein Stück weit verändert.
J.B., Mai 2021
Vorrede
Wie oft ich die die Filme der Tributen von Panem-Reihe mittlerweile schon gesehen habe, weiß ich gar nicht so genau. Jedes Mal habe ich erneut das Gefühl, wieder ein völlig neues, bisher mir entgangenes Detail zu entdecken. Und mit dem Verständnis des Geschehens der ganzen Filmreihe sowie den Büchern als Beiwerk konnte ich so langsam einen roten Faden entdecken.
Es ist wie eine unendliche Aufgabe, eine unendliche Geschichte in allerlei möglichen Dimensionen nachzuschreiben. Die Tribute von Panem erzählen von einem Staat, dem Leben und Überleben, von Politik, Unterdrückung, Revolution, aber auch Liebe, menschlichem Verhalten und unseren Urbedürfnissen.
Die Deutungen können staatsphilosophischer, psychoanalytischer, religiöser, literarisch-metaphorischer, kulturwissenschaftlicher, ökonomischer, historischer und gegenwärtiger Natur sein. All dies zu ordnen ist eine Aufgabe Vieler. Und mit diesem Buch möchte ich den ersten grundlegenden Anfang machen. Viele der Thematiken sind nicht zuletzt im Rahmen der Corona-Pandemie aktueller denn je geworden.
Die Zielsetzung meiner vorliegenden Arbeit ist mir zu Beginn nicht wirklich klar gewesen, es war mehr der Weg das eigentliche Ziel. Erst mit dem Schreiben und Denken habe ich so langsam eine Idee davon bekommen, was die Quintessenz sein könnte. (Hätte ich das aber schon vorher gewusst, hätte ich ja nicht schreiben müssen.)
Das Werk habe ich aufgrund der Fülle an Themen und vielfältigen Gedanken in vier Bände aufgeteilt und in einem erweiternden Band – Die Geschichte der Macht und die Macht der Geschichte – wichtige »Grundlagen« für die bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesamttextes von der Geschichte Panems in Fragestellungen der Macht, das Wesen des Faschismus und der Entstehung von Staaten ausgelagert. Der Schreibstil ist ein mehr philosophischer und die Gedanken darin sind durchaus wichtig, um Panem als Phänomen richtig begreifen zu können. Jedoch könnte es für interessierte, neugierige, aber etwas ungeduldige Leser den Lesefluss hemmen. Dennoch möchte ich den Band, in den ich auch neuere und aktuelle politische Entwicklungen unserer Zeit eingearbeitet habe, sehr empfehlen.
In der eigentlichen Hauptarbeit setzte ich mich im ersten und zweiten Buch mit der (fiktiven) Geschichte Panems und der Mockingjay Revolution in einer ausführlichen Szenenanalyse auseinander. Zu Beginn des ersten Bandes leiste ich aber noch etwas Vorarbeit, sodass es gelingen kann, Panems Vorgeschichte und die mythologischen Hintergründe von Collins Werk zu verstehen.
Im dritten Teil bemühe ich mich um eine zeitgenössische Einordnung in Form von Essays, in der ich auch gezielt Themen und Menschheitsfragen unserer Zeit beleuchte.
Abschließend setze ich mich im vierten Band intensiv mit dem biographischen Charakter von Präsident Coriolanus Snow auseinander.
Der Leser hat einen Anspruch an mich als Autor, dass ich ihm ein gelungenes Werk anbiete. Aber ebenso habe ich auch als Autor einen Anspruch an den Leser, sich auf eben dieses Werk offen einlassen zu können. Um diese Bereitschaft möchte ich bitten.
Ich wünsche viel Freude und Erkenntnisgewinn beim Lesen,
Joshua Beck, April 2021
Vorwort zum erweiternden Band
In diesem erweiternden Band, der aufgrund der Komplexität der Themen zu einem Grundlagenbuch und einer Art »Nachschlagewerk« geworden ist, geht es darum, die Analytik von Politik, Macht und Staat zu verstehen. Warum ist dies wichtig? Viele Menschen verstehen nicht, wie eine Regierung funktioniert. Dies bereitet Verschwörungstheorien einen fruchtbaren Nährboden. Verschwö-rungsmythen werden uns, so fürchte ich, gerade bei disruptiven politischen Umbrüchen in den nächsten Jahren gesellschaftlich stark begleiten. Schon 1969 bezeichnete es Horkheimer als »unendlich wichtige Aufgabe, an Schulen (.) diese Dinge zu lehren, (.) sodass die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig sind«.
Auch ist es wichtig, dass wir als Gesellschaften begreifen, wie Systeme soziokulturell-historisch gewachsen sind – zum einen, zum anderen aber alle Staatsordnungen ihrem Wesen nach gleich funktionieren, und ein Systemwettstreit, in dem jeder seine Art zu leben als die »einzig Wahre und Richtige« proklamiert, so absurd wie unnötig ist. Vielleicht kann dieser Band einen kleinen Beitrag zur Idee der friedlichen Harmonie in der Welt beitragen, das kollektive Miteinander wenigstens ein Stück weit harmonisieren, wenn er verstanden wird von denjenigen, die ihn lesen.
Einführung: Der Historiker als Archäologe
»Ein Historiker oder Geschichtsforscher ist ein Wissenschaftler, der sich mit der Erforschung und Darstellung der Vergangenheit bzw. Geschichte beschäftigt.«
– Wikipedia: Historiker1
»Der Mensch wird jedoch nicht nur von der Geschichte geschaffen. Die Geschichte wird auch ihrerseits vom Menschen geschaffen.«
– Erich Fromm2
Was ist ein Historiker? Jemand, der Geschichte studiert oder studiert hat? Was bedeutet studieren? Vom lat. studere, streben, ist der Historiker jemand, der nach Wahrheit strebt, nach der unverrückbaren Wahrheit der Geschichte. Orwell glaubt, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft, und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.
Derjenige, welcher die Kontrolle der Gegenwart hat, ist mächtig, weil er eine Deutungshoheit über die Zukunft hat. Er kann Zukunft machen. Dabei können die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen, denn Fiktion kann zur unverrückbaren, objektiven Wirklichkeit erklärt werden. Dieser Zustand ist totalitär, wie Arendt beschriebt. Die Aufgabe des Historiker ist es nun, der Wahrheit selbst Gehör und damit Macht zu verschaffen, indem er erarbeitet, was Wahrheit ist.1 Wahrheit, sagt Arendt, ist das, was der Mensch nicht ändern kann. Foucault versteht hingegen Wahrheit mehr als eine Art Konstrukt:
»Unter Wahrheit ist eine Gesamtheit von geregelten Verfahren für die Produktion, das Gesetz, die Verteilung, das Zirkulierenlassen und das Funktionieren von Aussagen zu verstehen. Die Wahrheit ist zirkulär mit Machtsystemen, die sie hervorbringen und unterhalten, und mit ihr von induzierten und sie weiterführenden Machtwirkungen verbunden. Die Ordnung der Wahrheit. (.) Das wesentliche Problem für den Intellektuellen ist nicht, die ideologischen Inhalte zu kritisieren, die mit der Wissenschaft verbunden wären, oder dafür zu sorgen, dass seine wissenschaftliche Praxis mit einer richtigen Ideologie einhergeht. Sondern zu wissen, ob es möglich ist, eine neue Politik der Wahrheit zu konstituieren. Das Problem ist nicht, das Bewusstsein der Leute oder das, was sie im Kopf haben, zu verändern, sondern die politische, ökonomische und institutionelle Produktionsordnung der Wahrheit. Es kommt nicht darauf an, die Wahrheit von jedem Machtsystem zu befreien – was wäre ein Trugbild wäre, da die Wahrheit selbst Macht ist2 –, sondern die Macht der Wahrheit von den Formen einer (sozialen, ökonomischen, kulturellen) Hegemonie zu befreien, innerhalb deren sie derzeit funktioniert. Alles in allem dreht sich die politische Frage nicht um Irrtum, Illusion, entfremdetes Bewusstsein oder Ideologie; sie dreht sich um die Wahrheit selbst.«3
Fiktion kann der Mensch ändern, Wirklichkeit nicht. Für Arendt kann der Mensch Wahrheit nicht ändern, nach Foucault kann er jedoch stets eine neues Ordnungssystem erschaffen, welches seine eigene Wahrheit produziert. Für mein Begriffsverständnis von Wahrheit würde ich drei Arten derselben benennen: die innere Wahrheit, die subjektiv ist; die äußere Wahrheit, die objektiv ist; und die wahrhaftige Wahrheit, welche wahr ist, jedoch vom Menschen selbst nur in Annäherung erkannt werden kann.
Die innere Wahrheit manifestiert sich durch persönliche Überzeugungen. Gelingt es einem Subjekt, andere von diesen zu überzeugen oder sich von einem anderen von dessen inneren Wahrheiten unvoreingenommen überzeugen zu lassen, so handelt es sich um äußere Wahrheiten. Diese sind jedoch untrennbar mit den Objekten, auf welches sie sich beziehen, selbst verbunden; das Objekt an sich wird nicht mehr in Frage gestellt, das Denken ist rational, aber nicht mehr kritisch.
Wahrhaftige Wahrheit kann immer nur soweit erkannt werden, wie es den Menschen bis zu dem Zeitpunkt des Erkennens möglich ist. Die Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist eine niemals abgeschlossene. Die vielleicht einzige Religion, welche nicht für sich in Anspruch nimmt, universelle Wahrheiten zu proklamieren, ist die Religion der Bahai. Dort glaubt man, dass man Gott immer nur so weit erkennen könne, wie weit er sich den Menschen bis zu diesem Moment offenbart hat.
Geschichte verleiht dem Bedeutungslosen Bedeutung, sie schafft Bedeutung dort, wo keine ist, da ihr Entstehungsprozess auf dem Vergangenen aufbaut. Geschichte ist also das Produkt von Geschichtsschreibung, Geschichte lässt sich, da sie vergangen ist, nicht ändern. Sehr wohl aber unterschiedlich auslegen, interpretieren und sogar umdeuten. Die Fäden des Vergangenen in die Gegenwart sind dünn, und das Gewicht der Gegenwart zerrt an ihnen.
Der Historiker steht daher unter der Herausforderung, diesen Druck einerseits zu lösen, indem er durch seine Geschichtsschreibung das Vergangene für die Gegenwart lebendig macht, zugleich aber auch diesem Druck selbst nicht nachzugeben.
Wer sich auf einen Autor beruft, dem ist eine Naivität unterstellbar, sich in unermessliche Abhängigkeit seines zitierten Autors zu begeben. Er übernimmt dessen eigene Deutung und akzeptiert dessen Deutungshoheit durch das geschriebene oder gesprochene Wort über den Gegenstand des Diskurses.
Wer sich auf einen Historiker beruft, und durch den Prozess der Geschichtsschreibung ist diesen ebenso ein Autor, der steht vor demselben Dilemma. Daher erhebt der Historiker keinen Anspruch auf objektive Wahrheiten. Dies relativiert seinen Bezug zu menschlichen Sollbruchstellen in der Geschichtsschreibung.
Der Historiker studiert, er strebt nach Geschichte. Er strebt danach, sich der Wahrheit unendlich weit anzunähern, weiß jedoch um den Umstand, dass er eben diese niemals vollumfänglich erreichen kann und wird.
Der Historiker ist wie ein investigativer Journalist, der das Offenkundige ebenso bedeutungsvoll behandelt wie das Verborgene. Und da die Vergangenheit zunehmen von der Gegenwart gelöst ist, ist diese eben letzteres.
Der Historiker ist aber kein Journalist, auch kein investigativer, dessen primäres Ziel der Bericht an sich ist. Ein Historiker ist vielmehr ein Archäologe, der nach den verschütteten Resten der Wahrheit sucht. Eben dieser Wahrheit, die niemals jemand im Kern zu erkennen vermag, kann er sich nur möglichst dicht annähern. Diese Wahrheit ist nicht materiell, sondern immateriell. Sie kann sich materiell manifestieren. Man kann sagen, ein Historiker ist ein Archäologe des Immateriellen.
Die Wahrheit ist verschüttet unter Schutt und Asche, Sand und Erde, Gestein und Geröll, Lügen und Unwahrheiten. »Der Historiker weiß, wie verletzlich das ganze Gewebe faktischer Realitäten ist, darin wir unser tägliches Leben verbringen. Es ist immer in Gefahr, von einzelnen Lügen durchlöchert oder durch das organisierte Lügen von Gruppen, Nationen oder Klassen in Fetzen gerissen oder verzerrt zu werden, oftmals sorgfältig verdeckt durch Berge von Unwahrheiten, dann wieder einfach der Vergessenheit anheimgegeben.
Tatsachen bedürfen glaubwürdiger Zeugen, um festgestellt und festgehalten zu werden, um einen sicheren Wohnort im Bereich der menschlichen Angelegenheiten zu finden. Weshalb keine Tatsachen-Aussage jemals über jeden Zweifel erhaben sein kann – so sicher und unangreifbar wie beispielsweise die Aussage, daß zwei und zwei vier ist.«4
Sie manifestiert sich durch ihre auch materiellen Zeugen in Wort und Schrift, Symbolik, Architektur und Bauten. Die Wahrheit ist aber auch verschüttet unter Lügen und Unwahrheiten, sie ist verwischt von Fiktionen. Ihrem Erscheinen an der Oberflächen stehen zunächst Überzeugungen, Deutungshoheiten, Propaganda, ja Fiktionen selbst und schließlich Meme, Prägungen und Volksglauben im Wege.
Dieser Historiker wird so zum Retter der Wahrheit, indem er an den Wärtern und Bewachern der Wahrheit dieser zum Ausbruch aus ihrem geistigen Gefängnis gereicht. Da diese Wächter im Gegenwärtigen leben und ihre eigene Auffassung vom Vergangenen haben, so ist der Historiker nicht selten etwas Unliebsames, ein unbequemer Zeitgenosse seines auch eigenen Zeitgeistes.
»Ein Mensch mit einer Überzeugung, die so stark ist, dass er dem Widerstand der Menge trotzt, ist die Ausnahme und nicht die Regel und wird oft noch von späteren Jahrhunderten bewundert, von den eigenen Zeitgenossen aber meist verlacht.«
– Erich Fromm5
Ist die Wahrheit einmal befreit, so muss sie bewahrt und behütet werden, ihre Wärter sind der Absicht verpflichtet, sie gegen alle Angriffe zu verteidigen. Dies ist jedoch zugleich der Moment, in dem der Befreier zum Bewacher wird.
Der Historiker muss daher vor allem bereit zur Revision der eigenen Deutung sein. Er muss zum Pfleger der Wahrheit werden, er muss sie versorgen. Er wird sie umdeuten. Und eben dies, tut er dies nachlässig und unumsichtig, lässt ihn zum neuen Feind der Wahrheit werden. Der Historiker ist in der Verantwortung, wissenschaftlich zu agieren. Er muss der Wahrheit Raum zum Atmen geben, aber er darf sie nicht entschwinden lassen. Er muss sie festhalten, aber er darf sie nicht erdrücken.
Die Evolution erschafft Leben. Besteht es, entwickelt es sich fort; scheitert es, stirbt es aus. Das Gedächtnis der Evolution des Lebens ist das Überlebende. Macht ist wie ein lebender Organismus: einmal initiiert, erzeugt sie ihre Strukturen selbst. Sie wächst, gedeiht und verschlingt mehr und mehr, bis sie unter ihrer eigenen bürokratischen Masse implodiert.
Geschichte ist das evolutionäre Gedächtnis der Macht. Das Überlebende ist die bestehende Ordnung. Das Lernen aus der Geschichte ist der Prozess, den der Mensch selbst vornehmen muss, da er die Macht erschaffen hat. Sie entwickelt sich nicht von selbst; der Mensch selbst muss sie fortentwickeln. Lernt er nicht aus der Geschichte und wiederholt schwere Fehler, so ist der Untergang besiegelt, denn dann herrscht ein untergegangenes System, welches wieder untergehen wird.
»Wenn die Politik der Unausweichlichkeit wie ein Koma ist, so ist die Politik der Ewigkeit wie Hypnose: Wir starren auf den Strudel des endlos kreisenden Mythos, bis wir in einen Trancezustand verfallen, und dann tun wir auf Anweisung eines Führers etwas Schockierendes. (.) Beide Positionen, Unausweichlichkeit und Ewigkeit, sind antihistorisch. Das einzige, das zwischen ihnen steht, ist die Geschichte selbst. Die Geschichte ermöglicht es uns, Muster zu erkennen und Urteile zu fallen. Sie skizziert für uns die Strukturen, innerhalb derer wir nach Freiheit streben können.«6
– Timothy Snyder
Der Historiker ist wie ein Akrobat, ein Artist. Er ist einer, der ein wahres Kunststück vollbringen muss. Als wäre der Vorgang der Geschichtsschreibung an sich – sich in einer nicht linear vorgegeben Geschichte nicht zu verlaufen und kühlen Kopf und ruhige Hand in unruhigen Wirrungen und Wendungen eben jenes menschlichen Daseins zu bewahren, welches er untersuchen möchte, und dabei nicht über unauffüllbare und unbehebbare Lücken zu stolpern und zu verzweifeln – als wäre all das nicht schon ein Kunststück genug.
1 »Aussagen mit absolutem Wahrheitsanspruch können sehr verschiedener Art sein. Eine mathematische Wahrheit: ‹Die Winkel eines Dreiecks sind zwei rechten Winkeln gleich›, eine wissenschaftliche Wahrheit: ‹Die Erde bewegt sich um die Sonne›, eine philosophische Wahrheit: ‹Es ist besser Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun›, und eine Tatsachenwahrheit: ‹Im August 1914 fielen deutsche Truppen in Belgien ein›, werden auf völlig verschiedene Weise produziert und bewiesen; sind sie aber erst einmal als Wahrheit erkannt und anerkannt, so ist ihnen eines gemeinsam, daß nämlich ihr Gültigkeitsanspruch durch Übereinkunft, Diskussion oder Zustimmung weder erhärtet noch erschüttert werden kann. Die Überzeugungskraft dieser Aussagen wird durch die ‹Anzahl derer, die mit ihnen einstimmig sind›, nicht gestärkt; man kann zu ihnen weder zureden noch abreden, weil der Aussagegehalt selbst nicht überzeugender, sondern zwingender Natur ist.« (Arendt, Wahrheit und Lüge in der Politik: 59f.) Hegel schrieb einmal über den Gegensatz von Wahrheit und Meinung: »Das, was zunächst der Meinung gegenüber steht, ist die Wahrheit. Vor dieser erbleicht die Meinung.« Meinung ist ihm ein »zufälliger Gedanke«, stellt Arendt fest. »Man kann es ableiten von mein; es ist ein Begriff, der der meinige ist, also kein allgemeiner. Gegen die Partikularitäten der Meinung steht das Wahre, das allgemein ist. Daß Meinungen der Fähigkeit des Menschen zu dem perspektivischen Denken (.) entsprechen könnten und daß diese Perspektiven der natürlichen Standortgebundenheit der Menschen geschuldet und also keineswegs zufällig sind, ist Hegel nie in den Sinn gekommen.« (Ebd.: 54)
2 »Als Francis Bacon die Parole ‹Wissen ist Macht› formuliert hat, war damit nicht nur der Aufruf gemeint, sich des eigenen und gemeinsamen Wissens zu versichern, sondern auch, sich mit den Mitteln einer neuen Wissenschaft der Natur zu bemächtigen. Diese Wissenschaft will die Natur durch ihre Kenntnis dienstbar machen: ‹Menschliches Wissen und Können fallen in eins zusammen, weil Unkunde der Ursache uns um den Erfolg bringt. Denn der Natur bemächtigt man sich nur, indem man ihr nachgibt.›« (Berger: 69, Bacon zit.n. ebd.)
1. Eine Anatomie der Macht
»Es stimmt nicht, dass es in einer Gesellschaft Leute gibt, die die Macht haben, und unterhalb davon Leute, die überhaupt keine Macht haben. Die Macht ist in der Form von komplexen und beweglichen strategischen Relationen zu analysieren, in denen niemand dieselbe Position einnimmt und nicht immer dieselbe behält.«
»Macht ist überall, nicht weil sie alles umschließt, sondern weil sie sich von überall herleitet.«
– Michel Foucault
»Power perpetrates war and oppression to maintain itself until it finally topples over with the bureaucratic weight of itself and sinks into the pages of history (.), leaving lessons that need tobe learned unlearned.«
– Donald Sutherland
»Wir müssen ein für alle Mal aufhören, die Auswirkungen der Macht mit negativen Begriffen zu beschreiben (.) Tatsache ist, dass Macht ein produktives Prinzip in der Gesellschaft ist.«
– Michel Foucault7
Vorüberlegungen und Terminologie
Unter einer Gesellschaft verstehe ich die Summe aller unsichtbaren Verflechtungen einzelner Individuen untereinander.3 Für Foucault ist »eine Gesellschaft (.) kein einheitliches Gebilde, in dem nur eine einzige Macht herrscht, sondern ein nebeneinander, eine Verbindung, eine Koordination und auch eine Hierarchie verschiedener Mächte, die dennoch ihre Besonderheit behalten.«8 Wilhelm Reich stellt fest: »Jede Gesellschaftsordnung erzeugt in den Massen ihrer Mitglieder diejenigen Strukturen, die sie für ihre Hauptziele braucht«, und Erich Fromm erläutert weiter, dass »jede Gesellschaft eine bestimmte Struktur und Funktionsweise auf[weist], die durch eine Anzahl objektiver Gegebenheiten bedingt sind.
Zu diesen Gegebenheiten gehören die Produktionsmethoden, die ihrerseits von den vorhandenen Rohstoffen, von den Industrietechniken, dem Klima, der Bevölkerungszahl und von politischen und geographischen Faktoren sowie von kulturellen Traditionen und Einflüssen abhängen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. Es gibt keine Gesellschaft als solche, sondern nur besondere gesellschaftliche Strukturen, die sich auf unterschiedliche, nachweisbare Weise auswirken. Wenn sich diese gesellschaftlichen Strukturen auch im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung verändern, so sind sie doch in der jeweiligen geschichtlichen Periode relativ festgelegt.
Eine jede Gesellschaft kann nur existieren, wenn sie innerhalb des Rahmens ihrer speziellen Struktur operiert. Die Mitglieder der Gesellschaft und die verschiedenen Klassen oder Statusgruppen innerhalb derselben müssen sich so verhalten, dass sie in dem Sinn funktionieren, wie das Gesellschaftssystem es erfordert. Die Funktion des Gesellschafts-Charakters besteht darin, die Energien der Mitglieder dieser Gesellschaft so zu formen, dass ihr Verhalten nicht von ihrer bewussten Entscheidung abhängt, ob sie sich an das gesellschaftliche Modell halten wollen oder nicht, sondern dass sie sich so verhalten wollen, wie sie sich verhalten müssen und dass es ihnen zugleich eine Befriedigung gewährt, sich den Erfordernissen der Kultur entsprechend zu verhalten. Anders gesagt: Es ist die Funktion des Gesellschafts-Charakters, die menschliche Energie in einer gegebenen Gesellschaft so zu formen und zu lenken, dass diese Gesellschaft weiter funktionieren kann.«9
Ein Staat ist ein abstraktes, juristisch-fixiertes Gebilde, welches einer Gemeinschaft einzelner, sich zusammenschließender Individuen ermöglichen soll, komplexe gesellschaftliche Aufgaben und Probleme zu bewältigen. Der Einzelne stünde, wöllte er sich selbst eben dieser gemeinschaftlichen Herausforderungen annehmen, diesen machtlos gegenüber, womit der Staat seine Begründung und Notwendigkeit findet.
Für Aristoteles ist der Staat eine Universalie; Foucault widerspricht dem, ist der Staat doch zu allererst etwas von Menschengeist Erdachtes. Ein Staat wird für mein Verständnis nicht vom Volk, sondern von seiner Gesellschaft getragen. Durch die NS-Propaganda ist der Begriff »Volk« und insbesondere das zugehörige Adjektiv »völkisch« negativ besetzt worden. Das zentrale Problem hierbei ist die Frage, wer zum Volk gehört und wer nicht? »Die Ethnisierung des Volkes (.) ist vor allem für das 20. Jahrhundert charakteristisch. (.) Die nationalsozialistische ‹Volksgemeinschaft› wurde zum Inbegriff eines rassistischen und antisemitischen Konzepts des Volkes, das Exklusion und Ermordung von ‹Gemeinschaftsfremden›, ‹Fremdvölkischen› zur Konsequenz hatte.«10 Das Volk wurde »naturalisiert«, die Folge waren Segregation, ‹Säuberungen›, Vertreibungen und Massenmorde.11 Seither ist der Begriff des Volkes umstritten, nicht zuletzt deswegen, weil er von populistischen Gruppen instrumentalisiert wird.
Die Definition der Gesellschaft hingegen ist durchlässiger und dehnbarer. Sie kann sich auch über einen einzelnen Staat hinaus erstrecken. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Staaten mit verbundenen Gesellschaftsstrukturen (im religiösen, wirtschaftlichen, politischen oder ideologischen Sinne) einander stützen. Sie unterhalten diplomatische Beziehungen und treiben Handel. Neben der staatlichen Binnengesellschaft trägt die Gesellschaft im allgemeineren Sinne seine Strukturen, besonders in der Außenpolitik und in den internationalen Beziehungen, entscheidend mit.
Es heißt, der Staat sei eine Macht, Macht verübe Gewalt, Macht sei sich selbst ein Selbstzweck. Doch was lässt sich bei genauerer Betrachtung feststellen? Es geht um philosophische Überlegungen unter Berücksichtigung psychoanalytischer und historischer Grundlagen, insbesondere im sozio-ökonomischen Sinne.4
Eigentlich müsste es hierzu einen ganz neuen, eigenen Zweig der Wissenschaft geben, den der Machtanalytik.5 Dass diese Disziplin unentwickelt blieb, zunächst mit der Erfindung der Macht selbst nicht einherging, als auch danach über lange Zeit, ist ein Versäumnis und wohlmöglich Ursache dafür, dass wesentliche Lehren aus der Geschichte ungelernt und ungelehrt blieben.
»Macht ist nur unter den Bedingungen erträglich, dass sie einen beträchtlichen Teil ihrer Strukturen verdeckt. Ihr Erfolg entspricht ihrer Fähigkeit, die eigenen Mechanismen zu verbergen.«
– Michel Foucault12
Diskursgegenstand der Machtanalytik ist sowohl die sehr feinmaschigen Mikrostruktur der Macht als auch ihre rahmende Makrostruktur. Macht erweist sich dabei durch ihre fast unendliche Dichte im Kleinen als selbstverhüllender Komplex im Großen. Macht funktioniert dann am besten, wenn sie verschleiert ist. Dieses Gewebe zu durchschauen ist Ziel des machtanalytischen Diskurses. Die Intellektuellen, so Chomsky, »haben die Verantwortung, die Wahrheit zu sagen und Lügen aufzudecken«.13 Den Auftrag eines öffentlichen Intellektuellen sah auch Fromm darin, »die Wahrheit zu suchen, so gut er kann, und sie zu sagen«. In einem Rundfunkgespräch von 1974 verband er damit einen Appell, der an Aktualität nichts eingebüßt hat:
»Wenn die Intellektuellen im Dienste eines Parteiprogramms und im Dienste politischer Ziele – mögen sie auch noch so gut sein – ihre Funktion einschränken, die volle Wahrheit zu suchen und zu sagen, dann versündigen sie sich an ihrer eigensten Aufgabe und letzten Endes an der wichtigsten politischen Aufgabe, die sie haben.«14
Auch Arendt stellt fest: »Der Philosoph, der in die Öffentlichkeit eingreifen will, ist kein Philosoph mehr, sondern ein Politiker; er will nicht mehr nur Wahrheit, sondern Macht.«15
1.1 Die Erfindung der politischen Macht
»Die Geschichte der Menschheit kennt eine Fülle von Bedrohungen. Zunächst war es die rohe, ungebändigte Natur, durch die die Menschen gefährdet wurden und vor der sie Angst hatten. Mit zunehmender Naturbeherrschung hat diese Bedrohung abgenommen. (.) Parallel haben die Menschen im gesellschaftlichen Bereich zahlreiche neue Bedrohungen geschaffen: Letztere ergeben sich vor allem durch bestimmte Herrschaftssysteme sowie durch Macht, die bei Individuen ober bei sozial, ethnisch oder religiös definierten Gruppen konzentriert ist. Viele dieser Bedrohungen haben sich tatsächlich realisiert, am Ende standen Katastrophen bis hin zur Vernichtung ganzer Gesellschaften.«
– Wilhelm Heitmeyer16
Ein Staat manifestiert sich als höchste Form der Großorganisation wie jede kleinere Organisationen, nämlich juristisch fixiert durch Hierarchien und Machtverhältnisse. Der Staat ist für Foucault »eine Kristallisation von Kräfteverhältnissen«. Er ist eine »soziale Einheit in einem Netz von Beziehungen mit anderen sozialen Institutionen«; der Staat kann also nicht klar von der Gesellschaft als Instanz unterschieden werden.17 Daher sollte im Vorfeld einer tiefergehenden Staatsanalyse eine Erörterung des Machtbegriffs stattfinden. Ist Macht, da sie uns so häufig innerhalb organisationssoziologischer Diskurse begegnet, etwas Unvermeidbares? Gibt es ein Entkommen vor ihr?
Der Mensch ist »auf Gemeinschaften angewiesen, die über individuellen Geist hinausgehen«, schreibt Hastedt, »ohne Familie, Freunde und Nachbarschaften kann es wohl kaum ein gelingendes Leben geben.« Folgt man diesem Ansatz, so kann Macht (und ferner damit auch Hierarchie) als universal verstanden werden, denn »ohne Deutungsmacht gäbe es keine Welterschließung und keine Institutionen.«18 Und eben letztere bezeichnen ja eine Gemeinschaft einzelner Individuen, welche – so radikal formuliert es Hastedt und dem kann wohl auch zugestimmt werden6 – ohne Gemeinschaft nicht existieren könnten.
Vergleichbar mit von Menschen erdachten und geführten Institutionen lässt sich hier das Volk der Bienen benennen. Innerhalb eines komplexen Gebildes, welches wir Bienenstaat nennen, kommt jeder einzelnen Biene eine individuelle Teilaufgabe zu; das Bienenvolk bewältigt so komplexe gemeinschaftliche Aufgaben. Die Bienenkönigin ist die Machthaberin. Sie ist das Oberhaupt des Bienenstaates und verantwortlich für dessen Fortbestehen. Auch Ameisen folgen einem stark ähnlichen Ordnungssystem.
Spricht man hier, und darauf gilt es ausdrücklich hinzuweisen, von einem allgemeingültigen, also universalen Charakter der Macht, so darf nicht verkannt werden, dass eine Machtanalytik sich nicht allein auf die heutige, uns bekannte und empirisch beobachtbare Welt beziehen darf. Neben den angesprochenen Ameisen-, Bienen- und Menschenvölkern gibt es auch eine Reihe von Arten, welche auf hierarchische Ordnungsstrukturen verzichten, etwa die Schildkröte.
Schildkröten kommen nicht ohne jede Form von Institution aus; zur Fortpflanzung und damit dem für ihre Art unerlässlichen Arterhalt bedienen sie sich der Institution der Paarung, auch wenn dies anonym und distanziert geschehen mag. Auch Fische und Vögel bilden Institutionen, ja sogar Schwärme. Sehr wohl muss man feststellen, dass Hierarchie und Machtverhältnisse verschwimmen; man kann sie nicht leicht erkennen wie innerhalb etwa eines Bienenstaates.
Dennoch verschwinden die Kernmerkmale der Macht nicht zur Gänze. Das Wort »Macht« selbst leitet sich vom altgotischen magan ab; es bedeutet können, vermögen.19 Macht besteht also in einer besonderen Fähigkeit des Einzelnen oder eines Kollektivs in Bezug auf etwas,7 besser: Macht manifestiert sich dort, wo ein Kräfteungleichgewicht zwischen einzelnen Objekten vorherrscht. Ein starkes Wesen kann sich gegenüber einem relativ zu ihm schwächeres Wesen behaupten; es kann Macht über dieses ausüben. Es kann dem ihm inferioren Wesen durch seine ihm gegebene superiore Machtposition seinen Willen aufzwingen:8 »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eignen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht«, so Weber.20
Weiten wir das Verständnis der Macht aus, was wir angesichts ihres abstrakten Wesens grundsätzlich auch versuchen können, so kann man auch zu der zunächst weithergeholten Feststellung gelangen, dass Macht in ihrer Grundform auch unabhängig von Leben als solches vorliegen kann: Ein großer Planet hat gegenüber einem kleineren Mond, einem seiner Satelliten, eine Machtposition inne, da er aufgrund seiner größeren Masse die Umlaufbahn seines Sozius stärker beeinflusst als umgekehrt. Der Mond unterliegt den physikalischen Gesetzen der Gravitation und wird auf einer Umlaufbahn um den Planeten gehalten. Dieses interkosmische Verhältnis ist eine Analogie zu Canettis »Verhältnis zwischen Katze und Maus«.
Solange sich die Maus im erreichbaren Aktionsradius der Katze (der Mond im Gravitationsfeld des Planeten) befindet, solange hat die Katze Macht über die Maus, da sie fähig ist, sie gefangen zu nehmen (oder: es droht die Gefahr, dass der Mond von der Masse des Planeten weiter hin zum Gravitationszentrum gezogen wird). Schwarze Löcher9 können so gesehen als die mächtigsten Gebilde im Universum verstanden werden, doch während sie alles verschlingen können, unterliegen sie zugleich den Gesetzen der Physik, sodass aus dem Können ein Müssen wird. Wo Macht ist, ist auch Ohnmacht. Im Kern der Macht steckt immer ein Stück Ohnmacht, da sie sich ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten nicht widersetzen kann. Tatsächlich bleibt festzustellen, dass so etwas wie Macht im Kern tatsächlich einen universalen Charakter besitzt. Machtverhältnisse hat es in gewisser Weise also zu allen Zeiten gegeben.
Vom naturwissenschaftlichem Standpunkt aus bestehen wir und alles um uns herum aus Elementarteilchen, die nur einen Durchmesser eines Millionstel Billionstel Zentimeter haben. Derartige physikalische Theorien sind sehr wohl empirisch überprüfbar, zur Beschreibung psychologischer und soziologischer Beobachtungen und Vorgänge sind sie jedoch gänzlich ungeeignet. Nachdem wir gesehen haben, dass der Charakter der Macht etwas Universelles ist, sollen nun die Facetten der Macht selbst in gesellschaftlicher und soziologischer Dimension näher beleuchtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Gesellschaft und das Wesen des Menschen.
Interessanterweise ist festzustellen, dass sich soziologische Macht ganz anders manifestiert als die Macht als Universalie der Natur. Sozilogische oder politische Macht ist eine spezielle Form, eine Ausprägung der Macht, welche es nicht seit Menschengedenken gab. Die soziologische Macht ergibt sich aus dem Zusammenschluss von Individuen zu einer Gruppe. Eine Herde kann sich durch ihren Zusammenschluss allein schon gegenüber Bedrohungen von außen, wie sie Raubtiere darstellen, verteidigen; sie erzeugt also Macht.
Die politische Macht aber, welche auch Hierarchien, Strukturen und eigene Mechanismen kennt, ist um einiges jünger als das Leben in Gruppen und Herden. Sie entstand erst im Zuge der neolithischen Revolution etwa 3.000 v.Chr. Der Psychoanalytiker und Sozialwissenschaftler Erich Fromm schreibt in seinem epochalen Werk Anatomie der menschlichen Destruktivität: konnte und die Eigentümer dieses Kapitals es dazu benutzen konnten, andere für sich arbeiten zu lassen.21 (.)
Die prähistorischen Jäger und Ackerbauer hatten keine Gelegenheit, ein leidenschaftliches Besitzstreben oder Neid gegenüber den ‹Besitzenden› zu entwickeln, weil es einen Privatbesitz, nach dem man hätte streben können, gar nicht gab und weil die wirtschaftlichen Unterschiede so geringfügig waren, dass sie kaum Neid erregen konnten. Im Gegenteil war die damalige Lebensweise dazu angetan, die Zusammenarbeit und ein friedliches Miteinanderleben zu fördern. Es war keine Grundlage vorhanden, auf der der Wunsch, andere auszubeuten, hätte entstehen können. In einer Gesellschaft, in der wirtschaftlich und sozial keine Basis für eine solche Ausbeutung vorhanden ist, wäre der Gedanke absurd, die physischen oder psychischen Kräfte eines anderen Menschen für seine eigenen Zwecke ausnutzen zu wollen.
Auch der Impuls, andere zu beherrschen, konnte sich kaum entwickeln. Die primitiven Sippenverbände und wahrscheinlich auch die prähistorischen Jäger vor etwa 50.000 Jahren unterschieden sich eben darin grundsätzlich von der zivilisierten Gesellschaft, dass die menschlichen Beziehungen nicht von den Prinzipien der Herrschaft und der Macht bestimmt wurden. Sie beruhten auf Gegenseitigkeit. Ein Mensch mit einem leidenschaftlichen Streben nach Herrschaft und Kontrolle hätte auf sozialem Gebiet keinen Erfolg gehabt und wäre ohne Einfluss geblieben. Schließlich war auch für die Entwicklung der Habgier kaum ein Anreiz vorhanden, da Produktion und Konsum auf einem bestimmten Niveau stabilisiert waren.«22
Dies änderte sich im Zuge der neolithischen, städtischen Revolution. So schreibt Mumford:
»Aus dem Komplex des frühen Neolithikums erstand eine neue Art der gesellschaftlichen Organisation: Sie war nicht mehr in kleinen Einheiten im Land verteilt, sondern zu einer einzigen großen verbunden; sie war nicht mehr ‹demokratisch›, das heißt sie gründete sich nicht mehr auf nachbarliche Vertrautheit, hergebrachte Sitten und ein allgemeines Einverständnis, sondern sie war autoritär, zentral gelenkt und unterstand der Kontrolle einer dominierenden Minderheit; sie war nicht mehr auf ein beschränktes Territorium begrenzt, sondern sie ‹überschritt energisch die Grenzen›, um Rohmaterialien an sich zu reißen, um hilflose Menschen zu versklaven, um Herrschaft auszuüben und Tribute einzuziehen. Diese neue Kultur diente nicht der Förderung des Lebens, sondern der Ausdehnung kollektiver Macht. Durch die Vervollkommnung neuer Zwangsmittel hatten die Herrscher dieser Gesellschaft um das dritte Jahrtausend v. Chr. eine industrielle und militärische Macht in einem Ausmaß organisiert, das bis in unsere Tage nie mehr übertroffen werden sollte.«23
Wie aber haben wir uns diese Revolution, eine derartige Umwälzung der gesellschaftlichen Ordnung der damaligen Zeit vorzustellen? Hierzu Fromm:
»Innerhalb kurzer Zeit – mit historischen Maßstäben gemessen – lernte der Mensch, sich die körperliche Kraft von Ochsen und die Energie der Winde nutzbar zu machen. Er erfand den Pflug, den Räderkarren und das Segelboot, und er entdeckte die chemischen Prozesse im Zusammenhang mit dem Schmelzen von Kupfererzen (eine Kenntnis, die teilweise schon früher vorhanden war), er lernte die physikalischen Eigenschaften der Metalle kennen und begann einen Sonnenkalender auszuarbeiten. Hiermit war der Weg bereitet für die Kunst des Schreibens, für Standardmaßstäbe und Maßsysteme. ‹In keiner Periode der Geschichte bis zu den Tagen Galileis› schreibt Childe, ‹machte das Wissen so schnelle Fortschritte und waren weitreichende Entdeckungen so häufig›. Aber der soziale Wandel war nicht weniger revolutionär. Die kleinen Dörfer mit ihren unabhängigen Bauern verwandelten sich in volkreiche Städte, die sich mit weiterverarbeitender Industrie und auswärtigem Handel ernährten, und diese neuen Städte waren als Stadtstaaten organisiert. Der Mensch schuf sich buchstäblich Neuland.
Mit den neuen Produktionsformen kam es zu einer ganz entscheidenden Veränderung in der Geschichte der Menschheit. Die Erzeugnisse eines Menschen blieben nicht mehr auf das beschränkt, was er mit seiner eigenen Arbeit produzieren konnte, wie dies in Jagd-Sozietäten und beim frühen Ackerbau der Fall gewesen war. Zwar war der Mensch zu Anfang des neolithischen Ackerbaus bereits in der Lage gewesen, einen kleinen Nahrungsüberschuss zu erzeugen, doch hatte ihm dieser nur dazu gedient, seinem Leben etwas mehr Sicherheit zu geben. In dem Maße jedoch, wie dieser Überschuss wuchs, konnte er zu völlig neuen Zwecken benutzt werden. Man konnte damit Menschen ernähren, die ihre Nahrung nicht selbst erzeugten, sondern die Sümpfe entwässerten, Häuser, Städte und Pyramiden bauten oder als Krieger dienten. Natürlich war diese Verwendungsmöglichkeit erst gegeben, nachdem Technik und Arbeitsteilung einen Grad erreicht hatten, der die Möglichkeit erschloss, menschliche Arbeitskräfte so einzusetzen. Das war der Punkt, an dem der Überschuss ungeheuer anwuchs. Je mehr Felder umgepflügt wurden, je mehr Sümpfe trockengelegt wurden, umso mehr Nahrungsüberschuss konnte erzeugt werden. Diese neue Möglichkeit führte zu einer der fundamentalsten Änderungen in der Geschichte der Menschheit. Man entdeckte, dass der Mensch als ökonomisches Werkzeug zu benutzen war, dass man ihn ausbeuten und zum Sklaven machen konnte. (.)
Die erste Folge war die Entstehung unterschiedlicher Klassen. Die privilegierten Klassen, in deren Händen die Leitung und Organisation lag, beanspruchten und erhielten für sich selbst einen unverhältnismäßig großen Anteil der Produktion, das heißt, sie erlangten einen Lebensstandard, wie er der Mehrheit der Bevölkerung versagt blieb. Unter ihnen standen die unteren Klassen der Bauern und Handwerker. Unter diesen waren die Sklaven und Kriegsgefangenen. Die privilegierten Klassen organisierten ihre eigene Hierarchie, an deren Spitze ursprünglich ständige Häuptlinge – und schließlich Könige als Repräsentanten der Götter – standen, die die Titularhäupter des gesamten Systems waren. Als eine weitere Folge des neuen Produktionsmodus ist die Eroberung anzusehen, die eine wesentliche Voraussetzung für die Akkumulation von Gemeinschaftskapital war, wie man es zur Durchführung der städtischen Revolution benötigte. Aber es gab einen noch wesentlicheren Grund für die Erfindung des Krieges als Institution: den Widerspruch zwischen einem ökonomischen System, das Einigung verlangte, um optimal leistungsfähig zu sein, und der politischen und dynastischen Spaltung, die mit dieser ökonomischen Notwendigkeit im Widerspruch stand. Der Krieg als Institution war ebenso wie das Königtum und die Bürokratie eine neue Erfindung, etwa aus der Zeit um 3.000 v. Chr. (.)
Diese sozialen und politischen Veränderungen waren von einer tiefgreifenden Wandlung der Rolle der Frau in der Gesellschaft und der Mutterfigur in der Religion begleitet. Nicht länger war die Fruchtbarkeit des Bodens die Quelle allen Lebens und allen Schöpfertums, sondern es war jetzt der Verstand, der die neuen Erfindungen, die Technik, das abstrakte Denken und den Staat mit seinen Gesetzen schuf. Nicht mehr der mütterliche Schoß, sondern der Geist wurde zur schöpferischen Macht, und damit beherrschten nicht mehr die Frauen, sondern die Männer die Gesellschaft. Eines der bedeutendsten Merkmale der neuen Stadt-Gesellschaft war, dass sie sich auf das Prinzip der patriarchalischen Herrschaft gründete, zu deren Wesen das Prinzip der Kontrolle gehört: der Kontrolle über die Natur, über die Sklaven, über Frauen und Kinder. Der neue patriarchalische Mensch [schafft] die Erde im buchstäblichen Sinn. Seine Technik stellt nicht nur eine Modifikation der natürlichen Prozesse dar, sondern sie bedeutet deren Beherrschung und Kontrolle durch den Menschen, was zur Erzeugung neuer Produkte führte, die in der Natur nicht zu finden sind. Die Menschen selbst gerieten unter die Kontrolle derer, die die Arbeit in der Gemeinschaft organisierten, und von nun an mussten die Führer Macht über die haben, die sie kontrollierten.
Um die Ziele dieser neuen Gesellschaft erreichen zu können, musste alles – Natur und Mensch – kontrolliert werden, und jeder musste Macht entweder ausüben – oder fürchten. Um kontrollierbar zu werden, mussten die Menschen gehorchen und sich unterordnen lernen, und um sich unterordnen zu können, mussten sie an die überlegene Macht ihrer Herrscher glauben.«24
Fromms Ausführungen sprechen für sich selbst – sprachlich wie inhaltlich. Zusammenfassend können wir feststellen, dass ein technischer Fortschritt, Ackerbau und Viehzucht es den Menschen ermöglichte, weitaus produktiver und effizienter zu arbeiten. Es entstanden Städte, die ersten Staaten, größere Organisationen durch die Bildung von Hierarchien im Zuge aufgebauten Verwaltungsapparaten, Bürokratien. Bürokratien und Macht sind eng miteinander verwoben.
Die soziologische Form der Macht war allen Gruppen- und Herdensystemen seit jeher inhärent. Mit den Hierarchien und dem Blick auf den Menschen als Kapital wurde somit die politische Macht erdacht, oder – wenn man denn so will – erfunden. Sie schloss Gewalt aus, man musste niemanden zu etwas zwingen«, denn die Menschen »mussten an die überlegene Macht ihrer Herrscher glauben« oder glauben gemacht werden, und so befolgten sie die Regeln der Macht, ihren Mechanismen und Strukturen. Wenn wir heute über Macht sprechen, meinen wir damit in aller Regel die politische Macht. Mit ihr wurde auch die Politik geboren, die es jedoch erst nach der Macht zu analysieren gilt.
1.2 Analytik der Macht
»Es stimmt nicht, dass es in einer Gesellschaft Leute gibt, die die Macht haben und unterhalb davon Leute, die überhaupt keine Macht haben. Die Macht ist in der Form von komplexen und beweglichen strategischen Relationen zu analysieren, in denen niemand dieselbe Position einnimmt und nicht immer dieselbe behält.«
»Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren, das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kraftverhältnisse auseinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern. Nicht weil sie alles umfaßt, sondern weil sie von überall kommt, ist die Macht überall. (.) die Macht ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt.«25
»Macht tritt immer in der Form von Beziehungen auf; sie erscheint als ein strategisches Gefüge und geht auf ungleiche Kräfteverhältnisse zurück.«26
»... ich glaube nicht, dass diese Frage des ‹Wer übt Macht aus?› sich beantworten lässt, wenn nicht zugleich die Frage ‹Wie läuft das ab?› beantwortet wird. Um es deutlich zu sagen: Wenn es darum geht, die Verantwortlichen zu bestimmen, dann wissen wir, dass wir uns etwa an die Abgeordneten, Minister, Regierungsspitzen etc. halten müssen. Aber das ist nicht der wichtige Punkt. Denn wir wissen sehr wohl, dass selbst wenn es uns möglich ist, genau alle diese Leute zu bestimmen, die die Entscheidungen getroffen haben, die ‹decisions-makers›, wie die Engländer sagen, dann wissen wir immer noch nicht wirklich, wie und warum die Entscheidung so ausfiel, wie sie getroffen worden ist, wie es kommt, dass sie von allen akzeptiert wird.«27
– Michel Foucault
1.2.1 Das Wesen der Macht
»Wahre Macht kann nur bekommen, wer sie von der Gewalt zu trennen versteht.«
– Das Erste Siegel der Macht28
Das Wort »Macht« hat Fromm zufolge eine doppelte Bedeutung:
»Einmal versteht man darunter den Besitz von Macht über einen anderen Menschen, die Fähigkeit, ihn zu beherrschen; zum anderen handelt es sich darum, daß man die Macht besitzt, etwas zu tun – daß man also fähig und voll schöpferischer Potenz ist. Letztere Bedeutung hat nichts mit Herrschaft über andere zu tun. Macht in diesem Sinne bedeutet Meisterschaft als Befähigung zu etwas. Wenn wir von Ohnmacht (powerlessness) sprechen, dann haben wir diese Bedeutung des Begriffs im Sinn. Wir denken dann nicht an jemanden, der nicht fähig ist, andere zu beherrschen, sondern an jemanden, der nicht fähig ist, das zu tun, was er tun möchte. So kann ‹Macht› zweierlei bedeuten:
Beherrschung anderer (domination) oder schöpferische Potenz (potency). Weit davon, miteinander identisch zu sein, schließen sich diese beiden Eigenschaften gegenseitig aus. Impotenz (impotence) – wenn wir diesen Ausdruck einmal nicht auf die sexuelle Sphäre beschränken, sondern ihn auf alle Bereiche menschlicher Möglichkeiten ausdehnen wollen – führt zu sadistischem Streben nach Macht über andere. In dem Maße, in dem jemand potent ist, das heißt die Fähigkeit besitzt, seine Möglichkeiten auf der Grundlage der Freiheit und Integrität seines Selbst zu verwirklichen, hat er es nicht nötig, andere zu beherrschen und geht ihm die Lust an der Macht ab. Macht im Sinne von Beherrschung anderer ist die Perversion der schöpferischen Potenz, genau wie der sexuelle Sadismus die Perversion der geschlechtlichen Liebe ist.«29
Die Macht zu erfinden, ist eines; etwas anderes ist es, sie durchsetzbar zu machen und besonders: sie zu erhalten. Hierzu bedarf es Methoden oder, um mit Foucault zu sprechen: Techniken. Um Macht als Konstrukt zu verstehen, gilt es, ihre Techniken zu durchschauen und zu analysieren. Da dies ein sehr weiter Diskurs ist, möchte ich mich im Wesentlichen auf drei Kernthesen beschränken:
Erstens: Die Macht ermöglicht direkte Machttechniken per se, sie ist für sich jedoch ein fragiles Konstrukt. Zweitens: Macht erzeugt Repression, unterscheidet sich aber von Gewalt. Drittens: Macht produziert Wissen und Freiheit. Diese möchte ich genauer ausführen, jedoch zunächst einen schwammigen, oft negativ konnotierten Begriff definieren.
a) Macht: Ein perpetuum mobile?
Unter dem Begriff der Machtelite10 verstehe ich all jene Kräfte,11 Einzelpersonen wie Untergruppen und Interessenkollektive innerhalb des verhüllten Machtkomplexes, welche von denjenigen Individuen als auch Interessenuntergruppen ausgeübt werden, die von dem gemeinsamen Ziel der übergeordneten Hauptgruppe, welche Macht selbst hervorbringt, in besonderer Weise profitieren. Machteliten sind »das Ergebnis einer spezifischen Produktionsweise und Gesellschaftsorganisation«30 und haben damit ein gesteigertes Interesse, dass Gruppenziel zu erreichen; wenn es erreicht ist, es zu erhalten, und gegenüber Versuchen des Umdefinierens zu verteidigen und zu bewahren.
Da diejenigen eben die sind, welche besonders profitiert haben und profitieren, haben sie auch die Mittel dazu, dafür einzutreten und es durchzusetzen, auch in Zukunft davon profitieren zu können. Dies verstehe ich als Elitenkontinuität, welche einer Gruppe Stabilität verleiht, dadurch, dass sie das Gruppenziel stärkt und erhält.12 So schreibt auch Fromm:
»In einer jeden Gesellschaft bestimmt der Geist, der in den mächtigsten Gruppen dieser Gesellschaft herrscht, den Gesamtgeist. Das kommt zum Teil daher, daß diese Gruppen das gesamte Bildungssystem unter ihrer Kontrolle haben – die Schulen, die Kirche, die Presse und das Theater –, wodurch sie die ganze Bevölkerung mit ihren eigenen Ideen durchtränken. Außerdem genießen diese mächtigen Gruppen ein solches Ansehen, daß die unteren Schichten nur allzu bereit sind, ihre Wertbegriffe zu übernehmen, sie nachzuahmen und sich mit ihnen psychologisch zu identifizieren.«31
Diese Stabilität entsteht fast von selbst, wenn eine Ordnung einmal richtig etabliert ist. Sie folgt ihren eigenen Mechanismen und innere Psychologie. Das ist nicht unproblematisch, wenn sie sich selbst Selbstzweck wird und so wichtige oder notwendige Neuerungen und Transformationen unterdrückt. Ein System, welches sich selbst blockiert, lähmt eine ganze Gesellschaft, welche sich in der Geschichte der vergangenen Jahrhunderte oft nur noch durch blutige Revolutionen davon befreien konnte, da friedliche ausgeschlossen waren.
Dennoch werden mit dem Zugrundegehen eines Systems nicht auch dessen einzelne Teile zerstört, sodass sich aus diesen – unter den Eindrücken und Gegebenheiten des Erbes, welches sie antreten – ein neues System zusammenfügen kann. Mit dem Untergang der Macht drängt eine neue Macht in das entstandene Vakuum vor und besetzt es. Macht erscheint als eine sich selbst immer weiter erhaltende Maschine, deren Ende zugleich der Beginn einer neuen Ära ist. Damit könnte man sinnbildlich – gleichwohl diese Vorstellung sicher nicht richtig ist – Macht als ein perpetuum mobile bezeichnen.
(Eine sehr schöne und kompakte Darstellung über die Prozesse der Machtbildung (Heinrich Popitz), Die Zirkulation der Eliten (Vilfredo Pareto) und den Königsmechanismus (Norbert Elias) findet sich bei Neckel et al., Sternstunden der Soziologie: 271-318.)
b) Gehorsam und das Panpotikum
Gewalt manifestiert sich in radikaler Unterdrückung, Macht in Gehorsam. Weshalb ist der Mensch so leicht bereit zu gehorchen, und weshalb fällt ihm der Ungehorsam so schwer? – fragt Erich Fromm und erläutert:
»Solange man der Macht des Staates, der Kirche, der öffentlichen Meinung gehorcht, fühlt man sich sicher und behütet. Tatsächlich macht es kaum einen Unterschied, welcher Macht man im einzelnen gehorcht. Es handelt sich stets um Institutionen oder um Menschen, die sich auf die eine oder andere Art der Gewalt bedienen – und die arglistig Allwissenheit und Allmacht für sich in Anspruch nehmen. Mein Gehorsam gibt mir Anteil an der Macht, die ich verehre, und daher fühle ich mich stark. Ich kann gar keinen Fehler machen, denn sie trifft ja die Entscheidung für mich; ich kann auch nicht allein sein, denn sie wacht über mich; ich kann keine Sünde begehen, denn sie lässt es nicht zu, und selbst wenn ich trotzdem sündige, läuft meine Strafe doch nur auf die Rückkehr zur allmächtigen Macht hinaus. (.) Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb es so schwer ist, ungehorsam zu sein und zur Macht nein zu sagen. In der Geschichte des Menschen wurde meistens Gehorsam mit Tugend und Ungehorsam mit Sünde gleichgesetzt. Der Grund ist einfach: Bisher hat während des größten Teils der Geschichte eine Minderheit über die Mehrheit geherrscht. Diese Herrschaft war deshalb notwendig, weil von den guten Dingen des Lebens nur für die Wenigen genügend vorhanden war und für die Vielen nur die Brosamen übrigblieben. Wenn die Wenigen die guten Dinge genießen wollten und wenn sie darüber hinaus wollten, dass die Vielen ihnen dienten und für sie arbeiteten, so ging das nur unter der Voraussetzung, dass die Vielen lernten zu gehorchen.
Natürlich kann man Gehorsam mit nackter Gewalt erzwingen, doch hat diese Methode viele Nachteile, Sie bringt die ständige Gefahr mit sich, dass die Vielen eines Tages Mittel und Wege finden könnten, die Wenigen in ihre Gewalt zu bekommen; außerdem gibt es viele Arten von Arbeit, die nicht richtig ausgeführt werden können, wenn nur die nackte Angst dem Gehorsam zugrunde liegt. Daher musste der Gehorsam, der lediglich auf der Angst vor der Gewalt beruhte, in einen Gehorsam verwandelt werden, der von Herzen kam. Der Mensch muss gehorchen wollen, ja das Bedürfnis dazu spüren, anstatt nur Angst vor dem Ungehorsam zu haben. Um das zu erreichen, muss die Macht die Qualitäten des Allgütigen, Allweisen und Allwissenden annehmen. Wenn das geschieht, kann die Macht verkünden, dass Ungehorsam Sünde und Gehorsam Tugend sei. Sobald dies einmal verkündet wird, können die Vielen den Gehorsam akzeptieren, weil er etwas Gutes ist, und den Ungehorsam verabscheuen, weil er etwas Schlechtes ist – anstatt sich selbst zu verabscheuen, weil sie Feiglinge sind.«32
Dass sich durch Glaube, Rituale und Traditionen die Kontrolle über einen Menschen in diesen selbst verschieben lässt, macht es der Macht möglich, ihn zu lenken, ohne ihn gewaltsam ergreifen zu müssen, wie es etwa die Gewalt vermag. Das wesentliche Element hierbei ist die eigenständige Kontrolle – nicht durch einen äußeren Wärter, sondern in vorauseilendem Gehorsam. Dieses Prinzip, welches seit Jahrtausenden in Kulturen latent vorhanden war, wurde im Zuge der Aufklärung – im 17. bzw. 18. Jahrhundert – »entdeckt«, als der Mensch »wissenschaftlich« beschrieben wurde.
Es wurde definiert, was »Wahnsinn« ist und was als »unmoralisch« zu gelten hat. Die Aufklärung erhob damals einen universellen Anspruch. In England und Frankreich entstand mit der Analyse des »Anormalen« die Psychiatrie. Verbrecher wurden nicht mehr zur Abschreckung öffentlich enthauptet, gekreuzigt, verbrannt, gefoltert und gevierteilt, sondern auch das Strafsystem wurde mit dem Entstehen von Gefängnissen »humanisiert«. Kriminelle sollten nicht mehr sterben und die Gesellschaft von ihnen »bereinigt« werden, sondern Straftäter sollten resozialisiert werden, um wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden zu können; natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sie als Arbeitskräfte erhalten werden können.
Mit den Gefängnissen wurde auch eine unsichtbare Technik der Kontrolle und Regulierung menschlichen Verhaltens »sichtbar«.13 Das von Bentham in England konstruierte Panoptikum verlagert den Wärter in den Insassen selbst hinein. Die Gefängniszellen sind im Panoptikum im Kreis um einen Überwachungsturm angeordnet, von dem aus sie eingesehen und die Insassen beobachtet werden können. Der Wärter jedoch bleibt unsichtbar. Da der Turm unterirdisch betreten werden kann, können die Insassen zu keiner Zeit genau wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Da sie also potenziell immer beobachtet werden können, verhalten sie sich dementsprechend und passen ihr Verhalten daran an. Sie beginnen, sich selbst zu überwachen und sich selbst zu beobachten in vorauseilendem Gehorsam der Gefängnisdirektion.
Das Panipticon (Panoptikum)33
Der Erfolg dieser Regierungstechnik – wie sie etwa Religionen mit ihren dogmatisch-indoktrinierten Lehren über Jahrtausende in Ansätzen praktizierten – war eindrucksvoll und ist nach seiner »Entdeckung« und näheren Beschreibung im Laufe der Jahre auch auf andere Bereiche des öffentlichen und alltäglichen Lebens ausgeweitet worden. So wurden Bänke in Schulen frontal auf den Lehrer ausgerichtet, der so jederzeit jeden Schüler im Blick behalten kann. Auch Noten, Zensuren, Rückversetzungen und Pausengänge sind diesem Prinzip zuzuordnen.
Zygmunt Bauman greift das Panoptikum als ein Beispiel für moderne Macht auf und versucht zu zeigen, dass sich die Verhältnisse in der Postmoderne »verflüchtigen« und die Macht sich unabhängig von Territorien, zum Beispiel mit Hilfe von elektronischen Signalen (Smartphone, Internet) bewegt. Den gegenwärtigen Zustand der Postmoderne bezeichnet er auch als »post-panoptisch«, denn auch der Alltag wird zunehmend durch elektronische Signale kontrolliert: Überwachungskameras an öffentlichen Plätzen und in Geschäften, elektronische Erfassung der Arbeitszeit, Feedback-Evalutionen.
Branden Hookway führte im Jahr 2000 als Informationstheoretiker das Konzept des »Panspectrons« ein, welches eine Weiterentwicklung des Panopticons ist in dem Sinne, dass es kein Objekt der Überwachung mehr definiert, sondern alle und alles überwacht und das Objekt erst im Kontext einer konkreten Fragestellung definiert wird.
c) Drei Thesen zur Macht
These I: Die Macht an sich ermöglicht Ausübung von Macht.
»Rationale Autorität hat ihren Ursprung in Kompetenz. Der Mensch, dessen Autorität respektiert wird, handelt kompetent in dem ihm zugewiesenen Bereich, den ihm andere anvertraut haben. Er braucht weder einzuschüchtern, noch muss er durch magische Eigenschaften Bewunderung erregen. Solange und in dem Maße, in dem er kompetente Hilfe leistet, anstatt auszubeuten, beruht seine Autorität auf rationalen Grundlagen und braucht keinerlei irrationale Furcht. Rationale Autorität lässt nicht nur ständige Prüfung und Kritik seitens derer zu, die ihr unterworfen sind, sondern fordert diese geradezu heraus. Rationale Autorität ist immer zeitlich begrenzt. Ihre Anerkennung ist davonabhängig, wie die Aufgabe erfüllt wird.
Irrationale Autorität dagegen hat ihren Ursprung stets in der Macht über Menschen. Diese Macht kann eine physische oder eine psychische sein, sie kann tatsächlich vorhanden sein oder aber in der Angst und Hilflosigkeit des Menschen, der sich dieser Autorität unterwirft, ihren Grund haben. Macht auf der einen, Furcht auf der anderen Seite, das sind stets die Stützen irrationaler Autorität. Kritik an dieser Art von Autorität ist nicht nur nicht erwünscht, sondern verboten. Rationale Autorität beruht auf der Gleichheit desjenigen, der die Autorität besitzt und dessen, der sich ihr unterstellt. Beide unterscheiden sich lediglich im Grad des Wissens oder in der Befähigung auf einem bestimmten Gebiet. Irrationale Autorität beruht ihrer Natur nach auf Ungleichheit und das heißt gleichzeitig, auf einem Wertunterschied. Der Begriff ‹autoritäre Ethik› bezieht sich immer auf irrationale Autorität, gemäß dem herkömmlichen Sprachgebrauch des Wortes ‹autoritär› als einem Synonym für totalitär und antidemokratisch.«
– Erich Fromm34
Nach Foucault ist Macht kein Gebiet, welches man besitzen kann. Macht ist etwas Immaterielles, ein Bündel von Abhängigkeitsverhältnissen. Macht ist Teil eines ungleichen Verhältnisses. Ein Staat ist keine Universalie, er ist eine Manifestation von Macht. Und durch die Bürokratie und die Hierarchien, aus denen ein Staat gebaut ist, überträgt sich die Macht auf die Repräsentanten des Staates, auf die Amtsträger, welche folglich Macht haben.
»Macht« ist, wie Foucault analysierte, »sowohl juridisch – sie impliziert Gesetze, Regeln, Verbote – als auch diskursiv, d.h. sprachlich, denn die Regeln werden ausgesprochen. Macht ist zugleich eine Gewalt, die einem zu Befreienden äußerlich ist, sie unterdrückt etwas, das befreit werden könnte. Andererseits hat Foucault Macht auch als ‹wuchernden Diskurs› bezeichnet, Kräfteverhältnisse implizierend, und das kondensierte sich bei ihm zu der (seltsamen) These: ‹Die Macht kommt von unten›. Macht sei vielfältig und beweglich.«35
Wer Macht hat, besitzt diese nicht absolut. Er ist von den der Macht Unterworfenen befähigt, über diese Macht auszuüben, indem sie ihn legitimiert und anerkannt haben, ihm also Macht übertragen haben. Da diese Legitimation ihre Ursache im Glauben an die Macht des Machthabenden besteht, so werden die Machtunterworfenen schon allein deswegen der Macht des Machthabenden Folge leisten, weil sie an dessen Macht glauben oder glauben gemacht werden können – etwa durch Propaganda. Dabei ist der Gehorsam entscheidend.
Macht – einmal initiiert – ermöglicht also per se die Ausübung von Macht. Macht kann demonstriert werden. Einmal initiiert, erzeugt sie ihre Mechanismen und Strukturen fast von selbst.14
Am deutlichsten ist dies in totalitären Regimen zu beobachten. Der Führer und die Masse sind eins; der Führer handelt im Auftrag der Masse und die Masse führt seine Aufträge aus. Wer sich gegen den Führer stellt, stellt sich gegen die Masse; wer sich gegen die Masse stellt, stellt den Führer in Frage.
Milgram stellt auch fest, dass Organisationen und Hierarchien keinesfalls obsolet sind oder ausschließlich destruktives Verhalten begünstigen oder sogar hervorrufen. Ihnen kommt vielmehr sogar eine sehr wichtige Funktion zu:
»Die Vorteile sozialer Organisation wirken nicht nur nach außen, sondern genauso nach innen, denn sie stabilisieren und harmonisieren die Beziehungen der Gruppenangehörigen zueinander. Durch die deutliche Statusbestimmung jedes Angehörigen wird die Reibung auf ein Minimum reduziert. Wenn ein Wolfsrudel seine Beute erlegt hat, ist der Leitwolf der erste, der fressen darf; ihm folgt der nächste im Rang, und so fort bis zum letzten in der Rangordnung. Daß jeder Wolf seinen Platz innerhalb der Hierarchie akzeptiert, stabilisiert das Rudel. Das gleiche trifft auf menschliche Gruppes zu: Innere Harmonie ist gesichert, wenn alle Mitglieder den ihnen zugeschriebenen Status akzeptieren. Anfechtung der Hierarchie hingegen ruft oft Gewalttätigkeit hervor. Also fördert eine stabile gesellschaftliche Organisation gleichzeitig die Fähigkeit der Gruppe, mit der Umwelt fertigzuwerden, und verringert durch Regulierung der Beziehungen innerhalb der Gruppe die interne Gewalttätigkeit.
Ein Potential an Gehorsamsbereitschaft ist Voraussetzung für eine derartige gesellschaftliche Organisation, und weil Organisation für das Überleben jeder Art von solch großem Wert ist, wurde diese Eigenschaft im Verlauf der langdauernden Evolutionsprozesse im Organismus entwickelt.«36
Macht bedeutet also auch eine hohe Form der Verantwortung, da sie einem Einzelnen von einer Gruppe übertragen wird, in der Annahme, dass er alles »in seiner Macht stehende« tun wird, um die Ziele der Gruppe zu erreichen und zu verwirklichen. Das Konstrukt der Macht ist hierdurch in höchstem Maße fragil. Arendt stellt fest:
»Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein einzelner; sie ist im Besitz einer Gruppe und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält. Wenn wir von jemand sagen, er ‹habe die Macht›, heißt das in Wirklichkeit, dass er von einer bestimmten Anzahl von Menschen ermächtigt ist, in Ihrem Namen zu handeln.15 In dem Augenblick, in dem die