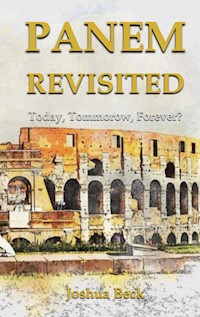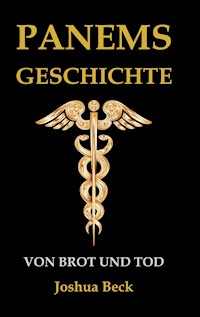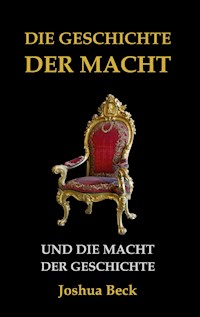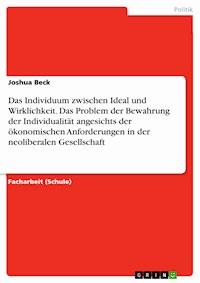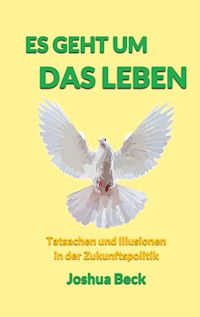
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit Scharfsinn analysierte der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm in seinem Buch Es geht um den Menschen (May Man Prevail?) im Jahr 1961 die Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten der Sowjetunion und den USA zur Zeit des Kalten Krieges. Sein Buch dokumentiert eines seiner intensiven politischen Engagements und ist zugleich das bedeutende Werk des Humanisten Fromm darüber, was Politik ist und was sie sein könnte. Heute, im Jahr 2022 - also rund sechs Jahrzehnte nach Fromms Buch - ist die Gefahr eines atomaren Holocausts nicht verschwunden und autonome Waffensysteme könnten leicht alles Leben auf der Erde auslöschen. Wir müssen diesmal befinden, dass das Ende der Geschichte kein himmlisches Reich, sondern ein tiefer Abgrund ist. Erich Fromms Buch über die Frage, ob die Menschheit siegen oder überleben wird, war, ist und bleibt hoch aktuell. Die Ereignisse in Osteuropa im Februar 2022 motivierten den politischen Denker Joshua Beck ein weiteres Buchprojekt in Angriff zu nehmen. Dieser Band versammelt einzelne Essays und schließt an Fromms Buch Es geht um den Menschen. Tatsachen und Illusionen in der Außenpolitik aus dem Jahr 1961 an: Es geht um das Leben. Tatsachen und Illusionen in der Zukunftspolitik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mit Scharfsinn analysierte der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm in seinem Buch Es geht um den Menschen (May Man Prevail?) im Jahr 1961 die Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten der Sowjetunion und den USA zur Zeit des Kalten Krieges. Sein Buch dokumentiert eines seiner intensiven politischen Engagements und ist zugleich das bedeutende Werk des Humanisten Fromm darüber, was Politik ist und was sie sein könnte.
Heute, im Jahr 2022 – also rund sechs Jahrzehnte nach Fromms Buch – ist die Gefahr eines atomaren Holocausts nicht verschwunden und autonome Waffensysteme könnten leicht alles Leben auf der Erde auslöschen. Wir müssen diesmal befinden, dass das Ende der Geschichte kein himmlisches Reich, sondern ein tiefer Abgrund ist. Erich Fromms Buch über die Frage, ob die Menschheit siegen oder überleben wird, war, ist und bleibt hoch aktuell.
Die Ereignisse in Osteuropa im Februar 2022 motivierten den politischen Denker Joshua Beck ein weiteres Buchprojekt in Angriff zu nehmen. Dieser Band versammelt einzelne Essays und schließt an Fromms Buch Es geht um den Menschen. Tatsachen und Illusionen in der Außenpolitik aus dem Jahr 1961 an: Es geht um das Leben. Tatsachen und Illusionen in der Zukunftspolitik.
Volle drei Sekunden, eine Ewigkeit, ehe die Bomben einschlugen, waren die gegnerischen Flugzeuge selber bereits wieder halb um die sichtbare Welt herum, wie Geschosse, an die ein Wilder wohl nicht glauben würde, da sie unsichtbar waren; und doch wird auf einmal das Herz zerschmettert, der Körper fällt auseinander, und das Blut ist erstaunt, ins Freie zu gelangen; das Gehirn verschleudert seine paar kostbaren Erinnerungen und stirbt, ohne zu verstehen.
Ray Bradbury (1953), Fahrenheit 451
WarGames Ending1
Der KI-Forscher Stephen Falken entwickelt in dem Film WarGames (1983) das Computersystem War Operation Plan Response, welches im Kalten Krieg Planspiele berechnet, wie ein Atomkrieg gewonnen werden könnte. WOPR probiert alle Atomkriegsstrategien durch. Nach dem Durchspielen aller möglichen Kriegsvarianten bricht das Programm ab. Professor Falken ruft das Codewort »Hallo, Joshua?«. WORP antwortet: »Ein seltsames Spiel. Der einzige Weg zu gewinnen, ist es nicht zu spielen.«2
Inhalt
Das Königreich der Frösche
Vorwort
Zu den versammelten Essays
Kapitel 1: Die Banalität des Bösen
Anhang: Eichmann als Prototyp eines entfremdeten Bürokraten
Kapitel 2: Kulturzyklen und die globale Regression
Kulturzyklen und der Kreislauf der Geschichte
Verständnisse von Geschichte und Zeit
Ray Dalio: Wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert
Psychoanalyse des Faschismus: Die globale Regression
Kapitel 3: Die Kuba-Krise und das Engagement von Erich Fromm
Die Kuba-Krise und der Kalte Krieg
Das Engagement von Erich Fromm im Kalten Krieg
Anhang: Erich Fromm und der Widerstand gegen den Menschentypus Hitler
Kapitel 4: Die Krisen des 21. Jahrhunderts
Der Klimawandel und die Hybris der kybernetischen
Zivilisation
Flucht vor Krieg und Klimakatastrophen
Bio- und Gentechnologie
Hunger und Überfluss
Arm und Reich
Stadt und Land
Kapitel 5: Die Zukunft Europas zwischen Krieg und Frieden.
Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine
Ein Alptraum wird Wirklichkeit
Die psychoanalytischer Grundannahmen meiner Erörterung
Versuch einer mathematischen Spieltheorieanalyse
Politische und historische Schlüsse und Ableitungen
Putins Panem
Anhang: Nachbemerkungen
Kapitel 6: Das wiedergekehrte Problem China
Das Kollektiv als Religion
The end of »humanity«?
Der chinesische Faschismus
Die unsichtbaren Hörner des Bösen
Xi Jinping und sein Panem
China als engster Freund Europas im 21. Jahrhundert?
Epilog
Literatur
Anmerkungen
Das Königreich der Frösche
Zahlreich sitzen die Frösche in ihrem Reich. Es ist der letzte Zufluchtsort geworden, nachdem alles Leben jenseits der Grenze ausgelöscht wurde. Doch auch das Leben innerhalb der sicheren Grenzen ist bedroht. Der König beschwichtigt, nur hier sei man sicher. Draußen sei es zu gefährlich.
Aber das Leid der Frösche nimmt zu. Einige von ihnen schreien so laut, dass weit entfernte Frösche fragen: »Warum schreien sie, wenn sie hier doch in Sicherheit sind?« Der König beschwichtigt: »Sie schreien der Freude wegen.«
Ein mutiger Frosch fragt weiter: »Warum schreien sie dann aber nicht alle?« Der König antwortet mit Gewalt auf diese provokante Frage. Er lässt den Frosch nachts töten und quält alle Frösche so sehr, dass sie lauter und lauter schreien müssen, damit er sagen kann: »Seht her, meine Frösche schreien der Freude wegen!«
Ein Frosch legt eine Atempause ein und will wissen, was aus dem namenlosen Frosch wurde. Der König erklärt, er habe die Grenze überquert und sei nie mehr zurückgekehrt. Freude sei das einzige Mittel gegen tödliche Zweifel.
Doch auch dieser Frosch ist erschöpft. Er klettert die Mauer hinauf und staunt. Als er zu den anderen zurückkehrt, hat es sich wie ein Lauffeuer verbreitet: Es ist zu gefährlich. Warum sonst hätte der Frosch, den sie die Mauern hinaufklettern sahen, umkehren sollen?
Die Frösche, die sich im engsten Kreis um den Rückkehrer versammeln, hören nicht auf zu schreien. Sie sehen ihn an und wie sich seine Lippen bewegen. Sie haben großes Mitgefühl mit ihm, denn er muss Traumatisches gesehen haben. Der König fühlt sich in seinen Warnungen bestätigt, deshalb lässt er den Heimkehrer zu den Fröschen sprechen.
Der Frosch aber berichtet von frohem Leben jenseits der Mauer und dass das Leid der Frösche in den Mauern nicht sein müsse. Der König schweigt. Die Masse brüllt los. Der Frosch sei wahnsinnig. Ein kranker Irrer. Man solle ihn einsperren, damit er nicht die Kinder erschrecke und ihnen Angst vor der Zukunft mache. Das ewige Eis war schon immer da und werde auch in Zukunft immer da sein.
»Das stimmt nicht!«, ruft ein anderer Frosch aus der Menge, die sich in zwei Richtungen trennt. Er hat dem Heimkehrer aufmerksam zugehört und erkennt, welche Gefahren im Topf und welche Chancen jenseits seiner Grenzen liegen.
Der König wird plötzlich vor die Wahl gestellt. Soll er eine Expedition anführen, um das neue Land zu erkunden? Dann aber würden sich all seine Reden als Lügen entlarven und man würde ihn verurteilen, wenn man die Leiche des Toten namenlosen Frosches findet. Soll er die Frösche ermahnen, im Topf zu bleiben? Dann aber ist die Gefahr gegeben, dass sich einige ablösen oder ihn selbst stürzen wollen. Der König fürchtet um seine eigene Stellung. Wenn die Haie um ihn erst Blut gerochen haben, werden sie zu Piranhas, und lassen nicht einmal die Knochen übrig. Deshalb erklärt er: »Wer die Worte des Königs anzweifelt, ist ein Verräter.«
Doch was waren die Worte des Königs? Die Masse war uneins darüber. Waren es die Worte des Heimkehrers, der im Namen des Königs sprechen durfte? Waren es die Warnungen, nicht den Topf zu verlassen? Im Streit zeigt sich eine große Gespaltenheit, doch nichts geschieht. Der König sieht, wie die vielen fragenden Blicke auf ihn gerichtet sind, und er erklärt weiter: »Es geht um Leben und Tod. Die Verräter müssen gehängt werden!« Dann bricht die Hölle los.
Die Frösche schlagen aufeinander ein, sie morden und vergewaltigen. Sie hängen einander auf und spalten einander die Schädel, damit der Unsinn aus den Köpfen entweichen könne.
Seltsames trägt sich zu und ein Toter ruft zu seiner Frau: »Lauf weg!« Sie nimmt die Kinder mit sich und läuft davon. Viele tun es ihr gleich. Zurück bleibt ein toter Haufen von Leibern. Der König sieht, dass er sein Volk verliert. Wo sind sie hin?
Jenseits der Grenze gibt es die Frösche. Nun muss sich der König entscheiden. Folgt er ihnen als einfacher Frosch nach, dann verliert er seine Macht. Oder kann er die Frösche zurückholen und einsperren, um König zu bleiben? Er erklärt: »Die Frösche wurden entführt von den Verrätern, deren Worte schlecht waren. Wir müssen sie heim ins Reich holen, um sie zu befreien aus der Gefahr, in der sie nun schweben.«
Der König befiehlt eine Expedition, die die entlaufenen Frösche zurückbringen soll. Doch der Erfolg bleibt aus. Die Frösche wollen nicht heimkehren. Daher befiehlt der König, alle zu töten, damit die Gefahr von außen das Leben im Topf nicht bedrohen kann. Ohne diesen Befehl wären alle Frösche entflohen. Der König will das Leben im Topf festhalten und ist bereit, alles und jeden dafür zu opfern, weil schon allein die Möglichkeit für eine Existenz einer anderen Lebensform für ihn unerträglich ist.
Vorwort
Falls Freiheit überhaupt irgendetwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen.
– George Orwell
Francis Fukuyama glaubte 1990, Das Ende der Geschichte sei erreicht. Die liberalen Demokratien hätten über die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts gesiegt und die höchste erreichbare Stufe menschlicher Zivilisation sei erlangt und verwirklicht worden. Von nun an könne es keine weitere Entwicklung mehr geben.
Fukuyama verwarf seine These sehr bald darauf, doch die Öffentlichkeit westlicher Gesellschaften hielt hartnäckig an der Illusion fest. Man sah nicht oder wollte nicht sehen, dass die Bewältigung der Herausforderungen der Vergangenheit nicht von den Herausforderungen der Zukunft befreit. Alles, was alt ist, kann in neuem Gewand wiederkehren. Doch in einer Kultur der narzisstischen Selbstüberschätzung fällt es uns unserer Tage wie Schuppen von den Augen, dass wir dem Ende der Geschichte so nahe gekommen sind wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.
Damals warnte Erich Fromm eindringlich: »Niemals war die menschliche Fähigkeit zu verstehen, die Fähigkeit zu kritischem und analytischem Denken, für das Überleben der menschlichen [Spezies] notwendiger als heute«,3 denn – wie Albert Einstein erkannte – »Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.«
Mit Scharfsinn analysierte der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm in seinem Buch Es geht um den Menschen (May Man Prevail?) im Jahr 1961 die Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten der Sowjetunion und den USA zur Zeit des Kalten Krieges. Sein Buch dokumentiert eines seiner intensiven politischen Engagements und ist zugleich das bedeutende Werk des Humanisten Fromm darüber, was Politik ist und was sie sein könnte.
Heute, im Jahr 2022 – also rund sechs Jahrzehnte nach Fromms Buch – ist die Gefahr eines atomaren Holocausts nicht verschwunden und autonome Waffensysteme könnten leicht alles Leben auf der Erde auslöschen. Wir müssen diesmal befinden, dass das Ende der Geschichte kein himmlisches Reich, sondern ein tiefer Abgrund ist. Erich Fromms Buch über die Frage, ob die Menschheit siegen oder überleben wird, war, ist und bleibt hoch aktuell.
Die Ereignisse in Osteuropa im Februar 2022 motivieren mich, ein weiteres Buchprojekt in Angriff zu nehmen, weil ich feststellen muss, dass die Art und Weise, wie und worüber debattiert wird, nicht gut ist und wir so nicht weiter machen können. Daher möchte ich gerne diesen Band herausgeben, der aus einzelnen Essays besteht und an Fromms Buch Es geht um den Menschen. Tatsachen und Illusionen in der Außenpolitik aus dem Jahr 1961 anknüpfen soll: Es geht um das Leben. Tatsachen und Illusionen in der Zukunftspolitik.
Der Band soll aus einer Sammlung von Aufsätzen, Essays und eigenständigen Kapiteln bestehen, die ich aus meiner Panem-Forschung aufgreifen möchte, in früheren Jahren bereits verfasst habe oder die ich (wie im Hinblick auf die Banalität des Bösen anlässlich des 80. Jahrestages der Wannseekonferenz) kürzlich neu verfasst habe. Die Kapitel sind in eine sinnvolle und aufbauende Reihenfolge geordnet, können aber auch unabhängig voneinander gelesen werden (sodass sich leichte Doppelungen nicht vermeiden lassen).
Das Ziel dieses Bandes ist eine Problemanalyse und Bestandsaufnahme. Es sollen Grundlagen für Probleme und Erklärungen zusammengetragen werden. Der Band lässt nur vereinzelt Lösungsansätze erkennen. Im ersten Schritt soll es nämlich darum gehen, Probleme als solche zu erkennen. Statt zu sagen: »Don´t look up!«, soll es heißen: »Just look up!«, denn wie Alexander von Humboldt einmal trefflich formulierte: »Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut haben.«
In weiterführenden Arbeiten soll es dann um das Entwickeln konkreter und zielgerichteter Lösungsstrategien gehen, um nicht in ein dystopisches Panem zu fallen, sondern ein humanistisches Eutopia begründen zu können.
J.B., 3. März 2022
Zu den versammelten Essays
Die Banalität des Bösen
Was treibt »ganz normale Männer« (Christopher Browning) dazu, die grausamsten Verbrechen zu begehen? Wie finden totalitäre Regime immer wieder Rekruten in Kriegen, die sich gegen das Leben selbst richten? Anlässlich des 80. Jahrestages der Wannseekonferenz und der »Endlösung der Judenfrage« ist dies eine aktuelle Frage, der ich mich zuwenden möchte.
Kulturzyklen und die globale Regression
Die Herausforderungen der Vergangenheit kehren in der Zukunft in gewandelter Gestalt wieder. Wie funktionieren solche Zyklen und worin zeigt sich heute die große Regression? (Beide Essays 2021)
Die Kuba-Krise und das Engagement von Erich Fromm
Ein kurzer Bericht aus dem Kalten Krieg (Essay 2014). Außerdem beleuchte ich das Engagement von Erich Fromm in Zeiten der atomaren Gefahr und seine Mahnung, wie wir zukünftige Hitler, die keine Hörner haben, erkennen können und was es bedeutet, gegen sie Widerstand zu leisten.
Die Krisen des 21. Jahrhunderts
Versammelt eine Übersicht über die großen Herausforderungen unserer Zeit (Klima, Radikalisierung, Armut, Artensterben, …) (Texte 2015 und 2021)
Ein Alptraum wird Wirklichkeit: Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine
Auf der Grundlage meines Wissens aus der Psychoanalyse habe ich in meiner Kompetenz als Mathematiker eine spieltheoretische Betrachtung der Ereignisse und Putins Strategie vorgenommen. Zunächst wollte ich mich damit nicht vordrängeln, doch da nun der Konflikt weiter eskaliert und die erste Vorhersage meiner Analyse eingetreten ist (zunehmende Angriffe auf die Zivilbevölkerung), möchte ich nun doch meine Erörterung nicht länger nur für mich behalten. Vielleicht können die Beiträge und Gedanken eines Mathematikers in unübersichtlichen Zeiten an der ein oder anderen Stelle dabei helfen, die Ereignisse besser einordnen zu können. (Dass Putin einfach verrückt sei, hilft uns nicht weiter.)
Das wiedergekehrte Problem China
In diesem Essay zeige ich, dass Erich Fromms Ausführungen aus dem Jahr 1961 im Hinblick auf den chinesischen Kommunismus und Totalitarismus (Social Credit System, totale Herrschaft, Genozid an den Uiguren) heute wieder hochaktuell sind. (Kapitel 2021)
Kapitel 1: Die Banalität des Bösen
In diesem Essay möchte ich auf das Konzept der »Banalität des Bösen« der jüdischen Denkerin Hannah Arendt eingehen, auf das ich mich dabei beziehe. Über den Bürokraten Adolf Eichmann, der einen wichtigen Anteil an der rational geplanten, logistischen Umsetzung und Organisation der Auswanderung, Deportation und Ermordung der Juden während der NS-Diktatur hatte. Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur setzte sich Eichmann nach Argentinien ab. Der israelische Geheimdienst Mossad spürte ihn auf, sodass er 1961 in Jerusalem vor Gericht gestellt wurde.
Arendt ließ sich auf eine harte Konfrontation ein, als sie über ihn das Buch Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen schrieb und ihn als »realitätsfremd«, »gedankenlos« und »Hans Wurst« bezeichnete, der gänzlich unfähig war, sich in seine Opfer hineinzuversetzen. Er hätte keinerlei persönliche Konturen erkennen lassen, wie beispielsweise der Bösewicht Jago in Shakespeares Stück Othello. Eichmann habe Juden nicht gehasst, sondern nur Befehle befolgt. Darin unterscheidet sich die Banalität des Bösen von dem radikalen Bösen. Viele enge Kontakte aus Arendts Umfeld distanzierten sich nach der Veröffentlichung ihres Buches von ihr, da es unangemessen sei, beim Holocaust von einer »Banalität« zu sprechen. Darüber hinaus schockierte Arendt mit der Frage, ob die Juden im Widerstand versagt hätten und möglicherweise eine Mitschuld am Holocaust hätten.
Jedoch müssen hier einige Missverständnisse ausgeräumt werden. Zunächst ist zu erläutern, was Arendt mit »Mitschuld« meinte. Viele Juden wanderten nach der Machtergreifung der Nazis nicht aus, weil sie ihre Heimat nicht aufgeben wollten und hofften, die staatlichen Institutionen würden sie schützen und Hitler nicht lange an der Macht bleiben – eine Fehleinschätzung, die auch von Papen und Hindenburg machten, als sie Hitler den Weg zum Reichskanzler ebneten. Arendt machte hier als Übel die Hoffnung aus, durch Aussitzen Unheil über sich ergehen zu lassen, statt dagegen kompromisslos anzukämpfen. Inge Auerbacher erzählte am 26. Januar 2022 bei Markus Lanz im ZDF, dass sie ein Visum für Hongkong hatte, das jedoch ihr Vater als rechtlicher Noch-Ehemann ihrer Mutter unterschreiben musste. Er weigerte sich und verstand nicht, was sie denn in Asien wollen. Bis heute blieb Auerbacher unklar, weshalb er das Visum nicht einfach unterschrieb.
Es ist eine historische Tatsache, schreibt Arendt in einem Brief an Karl Jaspers, dass Eichmann niemandem ein Haar gekrümmt habe. Es ist aber auch eine historische Tatsache, dass vielen Juden, eingeschüchtert und verfolgt, nicht viele Mittel blieben, in den aktiven Widerstand zu ziehen. Dagegen konnte Arendt den Nazis zweimal knapp entkommen, als sie erst nach Frankreich und dann in die USA floh. So wurde ihr oft vorgeworfen, sie könne gar nicht darüber urteilen, weshalb ihr Buch über Eichmann von vielen als »destruktiv« empfunden wurde und sie aus der jüdischen Gemeinschaft verstoßen wurde. Auch wenn Arendt vieles sprachlich mehr als nur äußerst unglücklich formulierte, so erkannte sie dennoch einige wichtige, und wie ich meine auch richtige Aspekte in der Architektur der Massenmordmaschinerie.
Ich möchte daher noch kurz darauf eingehen, dass die Juden in gewisser Weise eine Mitschuld an ihrer eigenen Ermordung hätten. Margot Friedländer zitierte einmal einen Witz über einen Juden, der einem Wachmann in einem KZ einmal die Grafe stellte: »Wer hat Schuld am Zweiten Weltkrieg? Die Radfahrer oder die Juden?« Der Wachmann fragte erstaunt zurück: »Warum die Radfahrer?« Der Jude entgegnete nur: »Warum die Juden?« Tatsächlich wäre die Frage nach den Radfahrern auch die meine gewesen, denn mit historischem Wissen dürfte es sich von selbst verstehen, weshalb für die Nationalsozialisten unstrittig war, dass die Juden die Schuld hätten, da sie ja einen weiteren Weltkrieg begonnen hätten. Demzufolge, so hat es Hitler in Mein Kampf angekündigt, sind die Juden selbst schuld, dass sie nun ermordet werden müssen.
Arendts Betrachtung ist aber eine gänzlich andere als ein unappetitliches, antisemitischen Gebräu von Ideologie. Sie meint damit, dass die Täter in der totalen Herrschaft danach streben, das Opfer selbst zum Komplizen zu machen. Dadurch werde die Tat »total«. In ihrem Buch über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft zitiert sie Albert Camus, der von einem Fall aus Griechenland berichtet. Dort wurde eine Mutter von drei Kindern »gebeten« zu sagen, welches ihrer drei Kinder getötet werden solle. Andernfalls müssten alle sterben. (Im Jahr 1982 wurde ein ganz ähnlicher fall in Sophies Entscheidung verfilmt.) Wie kann eine Mutter sagen, welches ihrer Kinder einfach erschossen werden soll? Andererseits: Wie kann eine Mutter zulassen, dass alle ihrer Kinder getötet werden, wenn sie durch eine Entscheidung zweien das Leben retten könnte? Und wie kann eine Mutter frei von Schuld leben, wenn auf ihre Wahl hin ihr eigenes Kind getötet wurde? Wie aber könnte sie ohne Schuld leben, wenn sie durch Nichtstun zugelassen hätte, dass alle sterben müssen?
Verbrechen der totalen Herrschaft unterscheiden sich darin von gewöhnlichen Verbrechen, dass sie das Opfer zum Täter machen, während der Täter unsichtbar wird oder sich selbst als Opfer stilisieren kann. Wie auch immer sich die Mutter oder der Deportierte entscheidet, an ihren Händen wird Blut haften. Das Verbrechen der totalen Herrschaft ist deshalb eine Perversion, weil es danach strebt, das Opfer zum Mittäter zu machen, oder sogar als alleinigen Täter zu präsentieren, während sich der wirkliche Täter unsichtbar macht. (So wie es in Panems Hungerspielen der Fall ist, wo die Kinder in der Arena einander niedermetzeln, während die Spielemacher in einem Kontrollraum in der Heiligkeit weißer Kleidung niemandem ein Haar krümmen müssen.)
Wenn sie sagt: »Nehmt mich statt der Kinder!«, dann können die Kinder ohne sie nicht aufwachsen und werden nach ihr ebenfalls erschossen. Es ist ein Fall überliefert, in dem der eine Wachmann die Mutter erschoss, weil sie ohne ihre Kinder nicht mehr weiterleben könne; und der andere die Kinder erschoss, weil sie ohne Mutter nicht überleben könnten. Beide Wachmänner gaben sich die Hand, etwas »Gutes« zu tun, indem sie sowohl die Mutter als auch die Kinder von ihrem Leiden »erlösten«. Der Tod war in vielerlei Hinsicht eine »legitime Behandlungsmethode«, so wie auch in der NS-Kinderpsychiatrie Kinder »erlöst« wurden, die weniger sozial und insbesondere autistisch waren.
Das gleiche Prinzip hinter Sophies Entscheidung lässt sich auf Juden anwenden, die nackt und in Viehwaggons zusammengepfercht tagelang scheinbar sinnlos in der Gegend herumgefahren wurden (was nicht sinnlos war, sondern den Zweck der Demoralisierung verfolgte) und schließlich die Lager erreichten. Dort lasen sie in großen Buchstaben »Arbeit macht frei«. Als sie entkräftet aus den Zügen ausstiegen, wurde radikal sortiert in »arbeitsfähig« und »arbeitsunfähig«. Letztere wurden direkt nach der Ankunft zu den Schießgräben geführt. Kinder, die nicht arbeiten konnten, hätte man den Müttern wegnehmen müssen. Diese hätten dann aber auch gestreikt. Die Nazis lösten dieses Problem, in dem einfach beide erschossen wurden. (Um Munition zu sparen, stellte man die Kinder vor ihre Mütter und kleine Kinder schlug man so lange mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand, bis ihnen der Schädel platzte.) Ein Mensch, der als lebendiger Leichnam bei den Lagern ankommt, kann seiner Ermordung entgehen, indem er bereit ist zu arbeiten. Damit aber macht er sich selbst zum Komplizen der Tat, weil er seiner Ermordung nicht entgehen kann, sondern diese nur aufgeschoben wird, bis er auch »arbeitsunfähig« ist.
Weil die Täter sich weigern, selbst Person zu sein und so zu Opfern werden, müssen die Opfer zu Tätern werden oder zumindest zu Komplizen. Es geht also darum, Techniken und Methoden zu entwickeln und anzuwenden, sodass sich die zu richtende Person selbst richtet, ein zu Begrabener sein eigenes Grab schaufelt, ein zu Kreuzigender sein eigenes Kreuz trägt. Weil sich die Nicht-Person des ursprünglichen Täters weigert zu denken und zu handeln, wird das eigentliche Opfer ins Denken und Handeln gezwungen, sodass es in der Verantwortung steht, als Person über etwas zu denken und entsprechend zu handeln, zu dem sich die Nicht-Person verweigert hat. Die entschieden dualistischen Begriffe von Opfer und Täter sind in der totalen Herrschaft nicht mehr zu halten, weil sie verwischt, in einander gezogen und schließlich ganz und gar vertauscht werden. Dies ist wichtig zu begreifen, um totalitärer Propaganda nicht zu erliegen. Die Nazis behaupteten immer wieder, die Juden seien selbst schuld an ihrem Schicksal – und sie taten wirklich alles dafür, sodass es in der Propaganda genauso dargestellt werden konnte. (Die Doppeldeutigkeit besteht darin, dass diese Doppeldeutigkeit in der totalen Herrschaft aufgehoben wurde.)
In der öffentlichen Diskussion im Frühjahr 2022 war dabei sehr interessant zu beobachten, dass Putin als Aggressor hinter die Präsenz des ukrainischen Präsidenten zurückfiel, dessen Land gerade von Russland angegriffen wird. Plötzlich waren es nicht mehr die Täter mit ihren mobilen Krematorien, die sich erklärten, da man keine Konzentrationslager finden könne, dürfe man hier niemanden beschuldigen; sondern die Täter wurden von anderen eben aufgrund dieser Tatsache überhaupt nicht einmal mehr als Täter verdächtigt. Wer sie dennoch als Täter benannte, wurde seinerseits diffamiert und bedroht. Dies ist für mich der deutliche Hinweis darauf, dass die Immunität in der (deutschen) Bevölkerung im Hinblick auf Propaganda und Faschismus nicht durch Bildung, Erziehung, Widerstandfähigkeit und historisches Bewusstsein entwickelt werden konnte. Es ist auch wichtig zu begreifen, dass totalitäre Verbrechen niemals ohne Mitwirkung der eigentlichen Opfer realisierbar sind. Die Lehre der Geschichte muss daher sein, sich der Tyrannei innerhalb und überall entschlossen und kompromisslos entgegenzustellen, wenn man nicht von ihr unterworfen werden will.
Mit dieser Überleitung möchte ich nach der Opfer-Perspektive nun auf die Täter-Perspektive und Arendts Konzept von der »banality of evil« zurückkommen, was im amerikanischen Englisch so viel wie »die Allgemeinheit des Bösen« bedeutet, und nicht etwa eine »Einfachheit« oder dass es »harmlos« sei. Arendt hat in Eichmanns Prozess einen Mann gesehen, der eigentlich nicht wirklich böse erschien, sondern wie ein ganz normaler Mensch wirkte. Das eigentlich Schockierende am Holocaust ist vielleicht gar nicht das Ausmaß, das eine massenindustrielle Vernichtungsmaschinerie betrieb, sondern dass es meist Ganz normale Männer waren, die diese errichteten und am Laufen hielten. Christopher Browning schrieb über diese »ganz normalen Männer« 1993 ein beeindruckendes Buch mit diesem Titel, worin er nachzeichnete, wie einfache Leute zu Massenmördern werden können, und danach unter vielen anderen scheinbar harmlos und scheinbar ohne Verbindung zu ihrer Vergangenheit weiterlebten.
Die Teilnehmer der Wannseekonferenz, von denen viele promoviert und vermeintlich »gebildet« waren, sahen in Juden keine Menschen, sondern »Dinge der anderen Seite«, als sie 1942 die »Endlösung der Judenfrag« anstrebten. Sie waren die Gelehrten mit einer herausregenden »faschistischen Intelligenz« (Jürgen Habermas), aber sie waren eben nicht gebildet. Ohne Bildung aber ist der Mensch, der aus den Abhängigkeiten der Natur herausgetreten und dessen Verhalten immer weniger durch Instinkte, sondern durch seinen Charakter geleitet wird, nicht in der Lage, andere Menschen als Artgenossen zu erkennen. Nur allzu leicht sieht er dann darin nur »ein Ding der anderen Seite«, sodass er keine Skrupel hat, es zu vernichten – ob die Bedrohung real oder eingebildet ist, oder manchmal auch gar nicht empfunden wird, sondern nur eine Langeweile und Depression durch Morden kompensiert werden soll, ohne dass Hass dabei eine entscheidende Rolle spiele. Dazu schreibt Fromm passend:
Eben deshalb, weil der Mensch, was seine Instinkte betrifft, schlechter ausgerüstet ist als irgendein anderes Lebewesen, erkennt oder identifiziert er seine Artgenossen nicht so leicht, wie Tiere das tun. Für ihn bestimmen Sprache, Sitten, Kleidung und andere Kriterien, die mehr geistig als instinktiv wahrgenommen werden, wer ein Artgenosse ist und wer nicht, und jede Gruppe, die irgendwie anders ist, wird nicht derselben Gattung Mensch zugerechnet. Hieraus folgt das Paradoxon, dass dem Menschen, eben weil es ihm an Instinkt fehlt, auch das Erlebnis der Identität mit seinen Artgenossen abgeht und dass er den Fremden so erlebt, als ob er zu einer anderen Spezies gehörte; mit anderen Worten: Es ist das Menschsein, was den Menschen so unmenschlich macht.4
Ein Teilnehmer der Konferenz zeigte sich in großer Sorge um die Menschen, was es mit ihnen machen würde, diese Grausamkeiten zu erfahren. Er sprach nicht von den Opfern, die erschossen wurden, sondern von den Tätern, die schossen. Viele junge Männer mussten sich mit Blut und Hirnmasse bedeckt übergeben. Und auch wenn die Morde von Mal zu Mal »normaler« für sie wurden, so waren sie doch seelisch gezeichnet. Viele suhlten sich in Selbstmitleid und erklärten nach dem Krieg, da sie Schreckliches erlebt hätten, seien ihre Taten im »Dritten Reich« keine Verbrechen gewesen, da sie nur Befehle befolgt hätten.
Für die Juden aber kannten die Nazis kein Mitleid und kein Mitgefühl. Im technischen und rationalen Verwaltungsakt war es noch leichter, Juden als Dinge zu behandeln. In der »Endlösung der Judenfrage« ging es darum, »Restbestände« zu beseitigen. Die ganze Sprache war technisch und erweckte den Eindruck, als handle es sich um die Verwaltung von Gegenständen. Ein Freund schrieb mir am 25. Januar 2022, noch während er den Film über die Wannseekonferenz im ZDF basierend auf dem Protokoll von Adolf Eichmann sah: »Zwischen Endlösung und Theresienstadt gibt‘s jetzt Häppchen und Schnittchen. Mir fällt das extrem schwer, das weiter zu schauen. Da kommt einem alles hoch. Es ist schrecklich. Diese Sprache. Als würde man über eine neue Produkteinführung sprechen oder über Softwareentwicklung.«
Es scheint, als müsse dieser Gedanke wiederholt werden: Die größte Sorge der Teilnehmer schien zu sein, ob für die Ermordung von elf Millionen Juden in Kriegszeiten mindestens elf Millionen Schuss Munition entbehrlich sind. Um Munition zu sparen, wurden bei Hinrichtungen schließlich Kinder vor ihre Mütter gestellt und Kleinkinder mit dem Kopf gegen Bäume gedonnert, bis ihnen der Schädel platze. Am Abend gab es ein Musikfest uns die Stimmung war ausgelassen.
Menschen aber von Angesicht zu Angesicht zu erschießen, war gleichsam schwerer. Heinrich Himmler ordnete daher solche Kulturabende und Feste als »Ausgleich« an. Neben vielen, die sich anpassten und nicht mehr und nicht weniger als die gegebenen Befehle ausführten, gab es auch solche, die richtigen Spaß am Morden fanden, das von Mal zu Mal immer normaler wurde. Am Abend prahlten sie mit ihren Taten und berichteten stolz davon, was es für ein mächtiges Gefühl ist, ein Leben auszulöschen. Detailliert erzählten sie, wie sie die Opfer zwangen, sich nackt auszuziehen, ehe sie erschossen wurden.
Aber es gab auch solche, denen das Morden zusetzte. Es war in der Hierarchie von Vorteil, wenn der Hauptmann einer Truppe sympathisch war. Er erklärte dann, er würde so einen Befehl nie erteilen, aber er habe keine andere Wahl. Es müsse schließlich getan werden. Es sei in Ordnung, wenn man nicht schießen wolle, aber man muss sich klar machen, dass dies dazu führt, dass dann jemand anderes schießen muss, wenn die einen »schwach« sind. Die Weigerung ginge zu Lasten der Kameraden. Wer also schießt, ist »solidarisch«, weil andere Kameraden unter den »eigenen Leuten« dann nicht mehr schießen müssen.
Ein besonderer Fall hat mir viele Fragen gegeben. Ein Hauptmann, der keine Skrupel kannte und Täter sein wollte, brach plötzlich zusammen und konnte nicht mehr schießen. Er wollte morden, aber sein Körper verweigerte sich. Um dies zu verstehen und weshalb so viele damals mitgemacht haben, mitmachen wollten, möchte ich eine psychoanalytische Betrachtungsweise von Erich Fromm beleuchten. Freud hatte bereits gezeigt, »dass die in der Gruppe wirksamen psychischen Erscheinungen aus den im Einzelmenschen wirksamen psychischen Mechanismen heraus zu verstehen sind und nicht etwa aus einer »Gruppenseele« als solcher«.5 Die Sozialpsychologie erhebt nicht den Anspruch, die Totalität der psychischen Struktur des Gruppenmitglieds, sondern nur die den Gruppenmitgliedern gemeinsamen psychischen Einstellungen zu verstehen. 6 Jede Gesellschaft mit ihrer spezifischen Produktionsweise bringt ihren eigenen Gesellschafts-Charakter (»social character«) mit sich.
Man muss sich vor Augen halten, dass das Morden in der damaligen Gesellschaft nichts Unanständiges war. Wahnsinn war normal. Nach Erschießungen gab es Orden für die, die damit die »Sicherheit« in einem von NS-Deutschland besetzen Gebiet herstellten. Für all die, die mit dem Hass auf Bolschewiken und Juden aufgewachsen waren, bot sich eine Gelegenheit, ihre Destruktivität auszuleben. etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung war damals antisemi-
tisch eingestellt, während Juden in Deutschland nur ein Prozent der Bevölkerung ausmachten. Auch Kinder zu morden war normal, denn es musste darum gehen, die Sicherheit der Gebiete auch in künftigen Generationen zu gewährleisten. Fromm liefert ein anschauliches Beispiel:
Der Angehörige eines Stammes, der im wesentlichen durch Krieg und Raubzüge seinen Lebensunterhalt erwirbt, muss Lust am Krieg, am Raub, an persönlicher Auszeichnung entwickeln. Das Mitglied eines Stammes, der in erster Linie intensive Agrikultur auf kooperativer Basis betreibt, muss eine gewisse Hingabe an seine Arbeit und ein gewisses Maß an Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft seinen Stammesgenossen gegenüber entwickeln. Der bürgerliche Mensch muss in seiner Charakterstruktur einen bestimmten Grad von Aggressivität entwickeln, eine bestimmte Stärke des Impulses zu erwerben, zu arbeiten, mit anderen zu konkurrieren und sie aus dem Felde schlagen zu wollen, seine Ansprüche auf eigenes Glück und Befriedigung zugunsten des Bedürfnisses nach Pflichterfüllung zu unterdrücken. Indem er aber eine Charakterstruktur entwickelt, in der solche Impulse und Haltungen vorhanden sind, wird die Praktizierung der geforderten Verhaltungsweisen wie Pflichterfüllung, Arbeit, Konkurrieren usw. zu etwas für ihn Befriedigendem.7
Um dies mit einem Beispiel zu verdeutlichen: Bei den Vorfahren der Germanen gab es im frühen Mittelalter eine geheime Gesellschaft, genannt die Berserker, was wörtlich »Bärenhemdige« heißt. Wer bei den Berserkern aufgenommen war, hatte die Aufgabe, sich in ein Raubtier, in einen Bären zu verwandeln. Dies galt als die höchste spirituelle Errungenschaft. Man war heilig, wenn man sich zum Tier zurückbegeben konnte, zum Tier wurde. Und wer zum Tier wurde, war zu einer unbändigen, verrückten Wut fähig. Doch dies alles war ganz bewusst, denn bei dieser verrückten Wut fühlte er, dass er alles Menschliche zurückgelassen hatte und zum Tier geworden war und dass dies sein ursprüngliches Leben war. (Es mutet seltsam an, dass zwischen den Bärenhemden und den Braunhemden nur knapp zweitausend Jahre liegen. Doch zeichnete einen Menschen wie Hitler genau diese besondere Art von Verrücktheit aus, und die verrückten Wutausbrüche waren für ihn etwas ganz Charakteristisches.)
Das Beispiel mit den Berserkern ist nur eines von tausend anderen. Wenn ich einen Menschen mit einer verrückten Wut verstehen will, dann hilft die Kenntnis der Berserker in der Tat sehr viel. ... diese Wut ist eine Antwort auf das Leben. Sie ist seine Religion, seine zufällig geheime und private Religion. Je mehr wir deshalb über andere Erlebensformen außerhalb unseres eigenen kulturellen Bezugsrahmens wissen, desto mehr sind wir fähig, uns selbst und andere zu verstehen und das zu erleben, was in unserer Gesellschaft zufällig vom Bewusstsein ausgeschlossen bleiben muss, weil es nicht in diese Gesellschaft passt.8
Es stimmt zwar, dass der Mensch sich an beinahe alle Lebensbedingungen gewöhnen kann, trotzdem ist er kein leeres Blatt Papier, auf welches die Kultur ihren Text schreibt. Die seiner Natur eingeborenen Bedürfnisse wie das Streben nach Glück, Harmonie, Liebe und Freiheit, sind dynamische Faktoren im Geschichtsprozess, die psychische Reaktionen hervorrufen, wenn sie auf Versagung stoßen. Mit der Zeit suchen diese Reaktionen neue Bedingungen zu schaffen, die den menschlichen Grundbedürfnissen besser entsprechen.9
Dies war auch bei vielen Tätern zu erkennen, die sich gegen ihre psychischen Leiden wehrten, sie weiter unterdrückten und weiter mordeten. Der Fall des Hauptmanns ist in dieser Hinsicht sehr interessant. Er wollte morden, so wie wir in unserer Kultur arbeiten wollen, früh aufstehen wollen, fleißig sein wollen – aber irgendwann, wenn wir die Anzeichen der Symptome unterdrücken, versagt schließlich unser Körper.
Dann fühlen wir uns wie Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt, aber manchmal bedeutet das, was eine den einzelnen Menschen umgebende Kultur als »schwach«, »feige«, »unsolidarisch«, »krank« oder »minderwertig«, eben als »Ungeziefer« bezeichnet, nichts anderes als das Ungeheuer, ein Mensch zu sein, wie Eugen Drewermann einmal formulierte – eben ein Mensch mit einer Seele, einem Gewissen, einem Sinn für Gerechtigkeit und Humanität, mit genuinen Bedürfnissen, Leidenschaften, inneren Strebungen, einer Identität, einem Charakter und Individualität, der Moral und Ethik kennt und der ebenso verzeihen wie vergeben kann, aber doch eigentlich immer damit kämpft, einfach nur vergessen zu wollen. Hannah Arendt schrieb über die Konzentrationslager:
Die Tötung der Individualität, der Einmaligkeit der menschlichen Person, die, zu gleichen Teilen von Natur, Willen und Schicksal gebildet, uns in ihrer unendlichen Verschiedenheit so selbstverständliche Voraussetzung aller menschlichen Beziehungen geworden ist, daß uns identische Zwillinge bereits ein gewisses Unbehagen verursachen, erzeugt ein Grauen, das über die Empörung der rechtlichpolitischen und die Verzweiflung der moralischen Person weit hinausgeht. Hier setzen die nihilistischen Verallgemeinerungen des Konzentrationslagererlebnisses an, die, plausibel genug, behaupten, daß im Grunde alle Menschen die gleichen Bestien seien. In Wahrheit demonstrieren die Erfahrungen der Konzentrationslager, daß es in der Tat möglich ist, Menschen in Exemplare der menschlichen Tierart zu verwandeln, und daß die Natur nur insofern menschlich ist, als sie es dem Menschen freistellt, etwas höchst Unnatürliches, nämlich ein Mensch zu werden.10
Es sind Fälle berichtet, die erkennen lassen, dass auch einige der Täter selbst zu Opfer des Regimes wurden. So hat mich der Fall eines deutschen Soldaten sehr bewegt, dessen Frau Halbjüdin war. Um seine Frau, seine Kinder, seine Familie zu schützen, zig er an die Ostfront, um sich den Orden des Eisernen Kreuzes zu verdienen, wodurch automatisch seine ganze Familie als »arisch« vor den Rassegesetzen anerkennt würde. Wenn er einen Russen töten muss, um seine Familie zu beschützen, sagte er sich, dann tue er es. Es war für ihn die Hoffnung, einen Ausweg zu finden, und er war bereit, alles dafür zu tun, was auch immer nötig war, auch wenn es bedeutet, dass er zum Mörder werden würde.
Die totale Herrschaft des NS-Regimes erfasste Opfer und Täter in unterschiedlicher Art und Weise, aber doch vollumfänglich. Die einen waren Opfer, die von den Tätern in die Täterschaft mit hineingezogen werden sollten; die Täter, die das System selbst am Laufen hielten und glaubten, es dadurch nur am Laufen zu lassen, wurden zu Opfern, weil sie ihr Mensch-Sein aufgaben für das trügerische Gefühl der Sicherheit im Konformismus und so an einer höheren Macht Teilhabe zu finden, nachdem ihr ganzes Leben lang eine Teilnahme ungelebt geblieben ist. Nicht nur Arendt sah Gedankenlosigkeit als Wesensmerkmal totalitärer Verbrechen; auch Aldous Huxley erklärte:
Ein Mensch kann auf zweierlei Weise mit der Gesellschaft in unmittelbare Berührung kommen: Als Angehörige einer Familie, einer religiösen Gruppe, eines Berufs oder aber als Angehöriger einer Menschenmenge. Gruppen können so moralisch und intelligent sein wie die Individuen, aus denen sie bestehen; eine Menschenmenge ist chaotisch, hat kein eigenes Ziel und ist zu allem fähig, ausgenommen zu intelligentem Handeln und realistischem Denken. Zu einer Menge versammelt, verlieren Menschen die Fähigkeit, vernünftig zu denken und eine moralische Entscheidung zu treffen. Ihre Beeinflussbarkeit wird bis zu dem Punkt gesteigert, wo sie aufhören, irgendein eigenes Urteil oder einen eigenen Willen zu haben. Sie werden sehr erregbar, sie verlieren jedes Gefühl individueller oder kollektiver Verantwortlichkeit, sie sind plötzlichen Anfällen von Wut, Begeisterung und Panik unterworfen. Mit einem Wort, ein Mensch in einer Menge benimmt sich, als hätte er eine große Dosis eines starken Rauschmittels geschluckt. … Das massenberauschte Individuum entweicht seiner Verantwortlichkeit, Intelligenz und Sittlichkeit in eine Art rasender, animalischer Geistlosigkeit.11
Schätzungsweise waren zweihundertfünfzigtausend Täter und viele Millionen Mittäter am Holocaust beteiligt oder wissentlich informiert. Edith Sheffer schätzt, dass mehrere Millionen Menschen von den Kindereuthanasieprogrammen wussten und zumindest indirekt daran beteiligt waren. Viele Millionen Deutsche in der Allgemeinbevölkerung schwiegen und schauten weg. »Raul Hilberg, Pionier der Holocaust-Forschung, hat in den Neunzigern noch relativ statisch zwischen Tätern, Opfern und Zuschauern (bystanders) unterschieden. Mittlerweile sind die Übergänge fließender:
Man spricht von Beteiligten, Helfern, Nutznießern, Profiteuren, auch indifferente und gleichgültige Menschen kommen verstärkt ins Blickfeld. Ohne sie wäre die soziale Ausgrenzung der Juden aus der Gesellschaft nicht möglich gewesen. Dies gilt nicht allein für die deutsche, sondern in der Tendenz für die meisten europäischen Gesellschaften, deren jüdische Minderheiten verfolgt und ermordet wurden. Überall fanden die Deutschen willige Helfer, und nicht wenige der deutschen Verbündeten, wie die Rumänen, brachten eigenständig Hunderttausende Juden um.«12
Es ist eine historische Tatsache, dass Hitler weder einen Befehl zur »Endlösung der Judenfrage« gegeben hat, noch dass er an der Wannsee-Konferenz zugegen war. Hitler habe, so beschrieb es Joseph Goebbels in seinem Tagebuch, die Rolle eines »Kommunikators« erfüllt. Hitler sei »der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung«, notierte er am 27. März 1942.