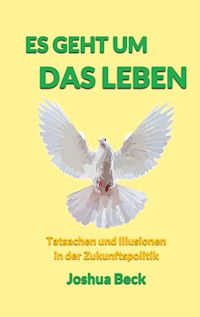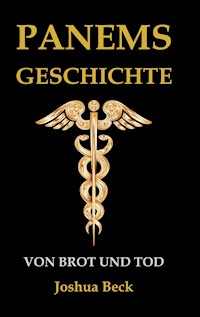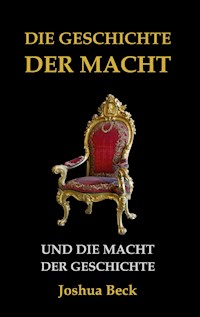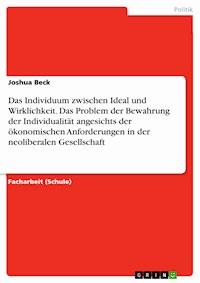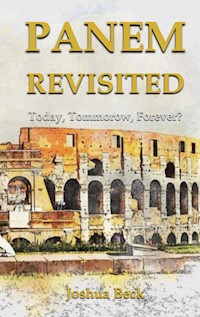
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In diesem dritten Band habe ich mit intensiv mit einer zeitgenössischen Einordnung der Trilogie der Tribute von Panem in Form von Essays befasst. Für mich bieten die Bücher und Filme eine sehr gut Arbeitsfläche, um so etwa im Deutschunterricht die Felder Geschichte, Macht, Staat, Politik, Propaganda, Revolution und Krieg zu bearbeiten. Im Rahmen meiner Panem-Forschung, welche ich nun schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt betreibe, habe ich aber auch Beunruhigendes gefunden, da die Dystopie eines untergegangenen Amerikas und einer infantilen, sadistischen und totalitären Gesellschaft keinesfalls mehr als absolut unerreichbar erscheint. Daher ist der Band auch außerhalb des Schulunterrichtes durchaus sehr lesenswert. Die Kapitel sind so geschrieben, dass sie aneinander anknüpfen, aber dennoch weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden können, was nur geringfügig zu Doppelungen führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.«
– Mephistopheles, Faust I
»Das Tao ist das, was zuerst das Licht und dann die Dunkelheit einlässt. Was die Wechselwirkung der beiden Urkräfte bewirkt und damit stete Neuerung. Das, was dem allgemeinen Verschleiß entgegenwirkt. Das Universum wird niemals ausgelöscht werden, denn immer dann, wenn es den Anschein hat, als habe die Dunkelheit alles erstickt und transzendiert, wird in seinen Tiefen die Saat des Lichts wiedergeboren. Dies ist der Weg. Wenn die Saat fällt, fällt sie in die Erde, den Boden. Und dort im Verborgenen erwacht sie zum Leben.«
– Philip K. Dick: The Man In The High Castle1
Inhalt
Danksagung
Vorrede
Vorwort zum dritten Band
Mensch und Medien
1.1 Medienkritik
1.2 Langeweile und Sadismus
1.3 Die Welt als »Verkaufs«-Bühne
1.4 Mediensatire auf unsere Populärkultur
Fröhliche Hungerspiele
2.1 Das Wesen der Hungerspiele
2.2 Kindereuthanasie
2.2.1 Das Dritte Reich
2.2.2 Panem
2.3
Jugend ohne Gott?
Über das Ende des Menschen
3.1 Unser Verhältnis zum Leben
3.1.1 Ein unsichtbarer Holocaust?
3.1.2 Die Liebe zum Toten
3.2 Das psychische Verschwinden des Menschen
3.2.1 Vom Körper zur Seele
3.2.2 Das Panoptikum
3.2.3 Wahnsinn als Diagnoseregime
3.2.4 Brot und Spiele
3.2.5 Der Kompass der Macht
3.2.6 Das Verschwinden des Individuums
3.2.7 Die Rückkehr des Individuums
3.3 Das biologische Verschwinden des Menschen
3.3.1 Automat oder Mensch?
3.3.2 Das »tote« Leben
3.3.3 Das »lebendige« Tote
Über Kriege und Revolutionen
4.1 Über die Psychologie der Massen
4.2 Die Psychologie der Revolution
4.2.1 Der Königsmord
4.2.2 Revolution und Krieg
4.2.3 Eine neue Ordnung
4.2.4 Braune Augen
4.3 Über die Kunst des Krieges
4.3.1 Wie man Krieger rekrutiert
4.3.2 Wie Kriege geführt werden
4.3.3 Asymmetrische und hybride Kriege im 21. Jahrhundert
4.3.4 Kindersoldaten
4.4 Über Kriegsverbrechen
4.4.1 Die Atombombe
4.4.2 Held oder Kriegsverbrecher?
4.4.3 Faschismus als Wechselwirkung
Über Zyklen und Wendungen
5.1 Kulturzyklen und der Kreislauf der Verfassungen
5.1.1 Verständnisse von Geschichte und Zeit
5.1.2 Der Kreislauf der Verfassungen
5.2 Ray Dalio: Wie die Wirtschaftsmaschine funktioniert
5.3 Howe and Strauss:
The Fourth Turning
5.3.1 Die Vier Wendungen
5.3.2 Zeitpunkt der Generationen und Wendungen
5.3.3 Wie Panem um die Ecke blickt
Panem
today
?
6.1 Die Krisen des 21. Jahrhunderts
6.1.1 Flucht vor Krieg und Klimakatastrophen
6.1.2 Bio- und Gentechnologie
6.1.3 Hunger und Überfluss
6.1.4 Arm und Reich
6.1.5 Stadt und Land
6.1.6 Ein »Suigenozid«?
6.2 Fanatismus, Populismus und Radikalismus
6.2.1 Das Sichtbare
6.2.2 Das Unsichtbare
6.2.3 Fake News und der Wandel der Demokratie
6.3 Regression und Revolution
6.3.1 Die globale Regression
6.3.2 Unser Staat, unsere Zukunft, unsere Verantwortung
6.3.3 Eine Revolution
China: Panem
tomorrow
?
7.1 Das Kollektiv als Religion
7.2 The end of »humanity«?
7.3 Der chinesische Faschismus
7.4 Die unsichtbaren Hörner des Bösen
7.5 Xi Jinping und sein Panem
Panem
forever
?
Literatur
Anmerkungen
Danksagung
Aus einem Brief an meinen früheren Englischlehrer, dem ich danken möchte dafür, dass er mein Interesse an Collins Werk geweckt hat:
Betreff: »Grüße aus Panem« und ein kleiner »Brief aus dem Rosengarten«
Lieber Herr E.,
[.] Die aktuellen Entwicklungen in politischer Dimension sind leider wenig erfreulich. Vieles erinnert mich an die Tribute von Panem und in diesem Kontext habe ich mich auch unserer gemeinsamen Englischstunden erinnert. Die Filme haben mich seit über fünf Jahren nicht mehr losgelassen und nun habe ich motiviert durch Collins Viertes Buch begonnen – da es weder Freizeitgestaltung mit Freunden oder ein freudiges, erfolgreiches Studieren gibt – aus der Not eine Tugend zu machen und also ein Buch darüber zu schreiben. Es ist aktueller denn je, mit Blick auf die totalitäre Trump-Bewegung in den USA als auch katalysiert durch die Corona-Schrecken global.
Sutherland schreibt in seinen/seinem (?) Letters from Rose Garden:
Power. That’s what this is about? Yes? Power and the forces that are manipulated by the powerful men and bureaucracies trying to maintain control and possession of that power? Power perpetrates war and oppression to maintain itself until it finally topples over with the bureaucratic weight of itself and sinks into the pages of history (except in Texas), leaving lessons that need tobe learned unlearned.
Seine Analyse, so schlicht und kompakt sie auch daherkommen mag, ist vortrefflich zutreffend. Die Mechanismen der Macht, ihre Manifestierung in Machtverhältnissen und also auch in den daraus gebildeten Machtstrukturen zu entschlüsseln, ist eine fast unmögliche Aufgabe, aber ich habe das Gefühl, nach vielen Jahren des Nachdenkens, Sortierens und Analysierens langsam einen Durchblick zu erhalten, Collins Werk also dechiffrieren zu können.
Auch wenn es eine Banalität sein mag, ohne Ihr Eigeninteresse, das Verhalten der Charaktere verstehen zu wollen und uns Schülerinnen und Schüler nach einer Erklärung für viele Absurditäten zu fragen, das Werk also zum Gegenstand des literarischen Diskurses im Unterricht zu machen, hätte es dieses meine Interesse vermutlich so nie gegeben. [.]
*****
Einen besonderen Dank möchte ich auch meinem Freund Steven Schwarz widmen, der mich als Historiker und Politikwissenschaftler in vielerlei Fragen beraten hat, sowie Iris Pilling, mit der ich vor der Veröffentlichung des Manuskriptes intensive Gespräche über die aufgegriffenen Inhalte und erarbeiteten Thesen und ihre Form führen konnte.
Für Fragen der Psychologie und Psychoanalyse danke ich Christine Preißmann, Meike Miller und Julia Klimek sowie für zeitgenössische Erfahrungsberichte, die mir Stefan Sauerwein und Marcel Dehmer zugetragen haben. Aber auch meiner Tante Renate Beck danke ich für den Austausch über kulturgeschichtliche Begebenheiten.
Besonders danken muss und möchte ich aber sechs bedeutenden Denkern, ohne die dieses Buch in dieser Form niemals hätte entstehen können: Hannah Arendt, Elias Canetti, Erich Fromm, Michel Foucault sowie Noam Chomsky und Stephen Hawking, deren Werke mich stark im Denken beeinflusst haben, auch wenn letztere beiden an dieser Stelle nicht direkt Eingang hierin finden.
Der hauptsächliche Dank aber gebührt Suzanne Collins sowie all denen, die an der Verfilmung dieses großartigen Gesamtkunstwerkes mitgearbeitet haben. Dieses Werk hat das Potential, die Welt zu verändern. Für viele Panem-Fans hat das Werk längst ihr Leben ein Stück weit verändert.
J.B., Mai 2021
Vorrede
Wie oft ich die die Filme der Tributen von Panem-Reihe mittlerweile schon gesehen habe, weiß ich gar nicht so genau. Jedes Mal habe ich erneut das Gefühl, wieder ein völlig neues, bisher mir entgangenes Detail zu entdecken. Und mit dem Verständnis des Geschehens der ganzen Filmreihe sowie den Büchern als Beiwerk konnte ich so langsam einen roten Faden entdecken.
Es ist wie eine unendliche Aufgabe, eine unendliche Geschichte in allerlei möglichen Dimensionen nachzuschreiben. Die Tribute von Panem erzählen von einem Staat, dem Leben und Überleben, von Politik, Unterdrückung, Revolution, aber auch Liebe, menschlichem Verhalten und unseren Urbedürfnissen.
Die Deutungen können staatsphilosophischer, psychoanalytischer, religiöser, literarisch-metaphorischer, kulturwissenschaftlicher, ökonomischer, historischer und gegenwärtiger Natur sein. All dies zu ordnen ist eine Aufgabe Vieler. Und mit diesem Buch möchte ich den ersten grundlegenden Anfang machen. Viele der Thematiken sind nicht zuletzt im Rahmen der Corona-Pandemie aktueller denn je geworden.
Die Zielsetzung meiner vorliegenden Arbeit ist mir zu Beginn nicht wirklich klar gewesen, es war mehr der Weg das eigentliche Ziel. Erst mit dem Schreiben und Denken habe ich so langsam eine Idee davon bekommen, was die Quintessenz sein könnte. (Hätte ich das aber schon vorher gewusst, hätte ich ja nicht zu schreiben brauchen.)
Das Werk habe ich aufgrund der Fülle an Themen und vielfältigen Gedanken in vier Bände aufgeteilt und in einem erweiternden Band – Die Geschichte der Macht und die Macht der Geschichte – wichtige »Grundlagen« für die bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesamttextes von der Geschichte Panems in Fragestellungen der Macht, das Wesen des Faschismus und der Entstehung von Staaten ausgelagert. Der Schreibstil ist ein mehr philosophischer und die Gedanken darin sind durchaus wichtig, um Panem als Phänomen richtig begreifen zu können. Jedoch könnte es für interessierte, neugierige, aber etwas ungeduldige Leser den Lesefluss hemmen. Dennoch möchte ich den Band, in den ich auch neuere und aktuelle politische Entwicklungen unserer Zeit eingearbeitet habe, sehr empfehlen.
In der eigentlichen Hauptarbeit setzte ich mich im ersten und zweiten Buch mit der (fiktiven) Geschichte Panems und der Mockingjay Revolution in einer ausführlichen Szenenanalyse auseinander. Zu Beginn des ersten Bandes leiste ich aber noch etwas Vorarbeit, sodass es gelingen kann, Panems Vorgeschichte und die mythologischen Hintergründe von Collins Werk zu verstehen.
Im dritten Teil bemühe ich mich um eine zeitgenössische Einordnung in Form von Essays, in der ich auch gezielt Themen und Menschheitsfragen unserer Zeit beleuchte.
Abschließend setze ich mich im vierten Band intensiv mit dem biographischen Charakter von Präsident Coriolanus Snow auseinander.
Der Leser hat einen Anspruch an mich als Autor, dass ich ihm ein gelungenes Werk anbiete. Aber ebenso habe ich auch als Autor einen Anspruch an den Leser, sich auf eben dieses Werk offen einlassen zu können. Um diese Bereitschaft möchte ich bitten.
Ich wünsche viel Freude und Erkenntnisgewinn beim Lesen,
Joshua Beck, April 2021
Vorwort zum dritten Band
In diesem dritten Band habe ich mit intensiv mit einer zeitgenössischen Einordnung der Trilogie der Tribute von Panem in Form von Essays befasst. Für mich bieten die Bücher und Filme eine sehr gut Arbeitsfläche, um so etwa im Deutschunterricht die Felder Geschichte, Macht, Staat, Politik, Propaganda, Revolution und Krieg zu bearbeiten. Im Rahmen meiner Panem-Forschung, welche ich nun schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt betreibe, habe ich aber auch Beunruhigendes gefunden, da die Dystopie eines untergegangenen Amerikas und einer infantilen, sadistischen und totalitären Gesellschaft keinesfalls mehr als absolut unerreichbar erscheint. Daher ist der Band auch außerhalb des Schulunterrichtes durchaus sehr lesenswert.
Die Kapitel sind so geschrieben, dass sie aneinander anknüpfen, aber dennoch weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden können, was nur geringfügig zu Doppelungen führt.
Im ersten Kapitel beleuchte ich die Mediensatire auf unsere Populärkultur, die Collins entworfen hat.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wesen der Hungerspiele und zieht die wenig erheiternden historischen Vergleiche zu den Kindereuthanasieprogrammen im »Dritten Reich«. Aber ich möchte auch die Frage stellen, wie wir heute mit unseren Kindern umgehen.
Die Hungerspiele haben zum Ziel das Verschwinden des Menschen, sowohl psychisch als auch physisch. Sie sind der Werkzeugkasten totaler Herrschaft. In Kapitel 3 möchte ich daran anknüpfen und fragen, wie es um den Menschen heute bestellt ist, oder ob er im Begriff ist, zu verschwinden.
Kapitel 4 ist ein Rückblick auf die Psychologie der Massen, den Geist der Revolution, den Krieg und die Propaganda, die in Panem in allerlei Gestalten daherkommen, und doch in unserer Welt bloß alltäglich sind.
Im fünften Kapitel erörtere ich, ob sich autoritäre Tendenzen, Populismus und Totalitarismus überall in der Welt durch Kulturzyklen und Wirtschaftstheorien erklären lassen.
In Kapitel 6 gehe ich schließlich der Frage nach, was die großen Probleme unseres Jahrhunderts sind und ob Panem heute schon erkennbar ist.
Auch wenn es noch ein Stück weit entfernt ist, zeige ich abschließend, dass China im Begriff ist, das Panem von morgen zu werden – und mit ihm die ganze Welt?
Panem today, Panem tomorrow, Panem forever?
1. Mensch und Medien
1.1 Medienkritik
»Den Indianern gab man Feuerwasser,1 um sie einzulullen; uns gibt man das Fernsehen.«
– Hans-Joachim Kulenkampff1
»Das Fernsehen macht mich zu einer Art Gott. Ich schaffe die Realität, die mich tatsächlich umgibt, ab, und stattdessen schaffe ich mir eine neue Realität, die kommt, wenn ich auf den Knopf drücke. Ich bin beinahe Gott, der Schöpfer. Das ist meine Welt. Da fällt mir eine kleine Geschichte ein, die den Vorzug hat, wahr zu sein, und die das sehr genau ausdrückt. Erzählt wurde sie mir von einem Vater, der mit seinem sechsjährigen Sohn an einem sehr regnerischen und stürmischen Tag im Auto fuhr. Auf der Landstraße ging ein Reifen kaputt. Sie mussten also das Rad abnehmen und es auswechseln. Das war natürlich sehr unangenehm. Da sagte der kleine Junge zu seinem Vater: ‹Papi, können wir nicht einen anderen Kanal einstellen?› So war für das Kind die Welt. Passt mir die eine nicht, wähle ich eine andere.«
– Erich Fromm2
Vor einigen Wochen – als ich diese Zeilen schreibe – sah ich im Fernsehen einen Bericht über zwei Freunde, die sich nach vielen Jahren wiedergetroffen haben. Der eine war amerikanischer Soldat und im Nachkriegsdeutschland stationiert. Er lernte einen kleinen Jungen kennen, der ihm einen Abschiedsbrief schrieb, als er nach Amerika zurückkehrte. Der Soldat wurde Schriftsteller und schließlich Professor für Literatur. Als er im Jahr 2020 einen Raum mit alten Sachen aufräumte, fand er den Brief des Jungen und begann ihn zu suchen. Schließlich fand er ihn auch und die beiden sprachen einige Zeit über ihr Leben und alle Dinge, die sie seitdem erlebt haben. Die Moderatorin, die den Kontakt zu beiden herstellte, sagte: »Das war eine Geschichte, wirklich wie im Film.«
Man scheint dabei vergessen zu haben, dass Filme auf Drehbüchern basieren, die von Menschen verfasst wurden und demzufolge ein Spiegelbild von persönlichen, historischen und kulturellen Hintergründen der realen Welt sind. Filme sind das Abbild der Wirklichkeit – vielleicht geschönt, dramatisiert, mystifiziert – aber niemals sind reale Geschichten Abbilder von Filmen. Die Selbstverständlichkeit, wie wir heute geneigt sind über etwas zu sagen, es sei »wie im Film«, ist ein Symptom der Entfremdung von uns und unserer eigenen Realität. Liebesgeschichten, Alltags-Soaps, Naturkatastrophen – wir erfahren sie meistens auf einem großen Bildschirm, während unser eigenes Leben nicht mehr stattfindet, weil wir eben unentwegt vor einem Bildschirm sitzen. Mit der Frage, was es mit einer Gesellschaft macht, die sich derart gehen lässt und sich vom Leben entfremdet, haben sich bereits einige Autoren beschäftigt, deren Werke zu den wichtigsten der jüngeren Literaturgeschichte gerechnet werden können.
Das Propoteam, in dem Katniss Propaganda-Spots im Kapitol dreht, hat die Nummer 451, was eine Anspielung auf den Roman Fahrenheit 451 ist. Der Roman ist vor gesellschaftskritischem Hintergrund zu lesen. Die politische Führung agiert autoritär. Menschliche Bedürfnisse werden zur Herrschaftssicherung unterdrückt. Das Ziel staatlichen Handelns ist es, die Bevölkerung fortlaufend mit einfachen Mitteln zu beschäftigen, um Individuation und damit eine Bedrohungen für das System als Ganzes zu verhindern.
Ein zentrales Element stellen dabei Fernsehshows dar, die über Videoleinwände in den Wohnzimmern der Menschen zu sehen sind und an denen sich die Zuschauer beteiligen können. Viele Menschen sind aufgrund der ununterbrochenen Medienbeschallung durch Radio und Fernsehen dazu gezwungen, Schlafpillen einzunehmen, um schlafen zu können.
Zudem ist die Gesellschaft sehr aggressiv. Soziale Zwänge bringen vor allem junge Menschen dazu, Mord als Spaß anzusehen. Hetzjagden auf andere Bürger im Straßenverkehr stellen ein alltägliches Vergnügen dar, die auch im Fernsehen übertragen werden. Die Jugend ist auch durch die Schule unausgelastet und so sind die »Vergnügungsparks« mehr im Sinne der Regelung von Aggressionen gedacht.
Selbständiges Denken ist in dieser Gesellschaft als unanständig stigmatisiert. Der allgemeinen Ansicht nach führt es nur dazu, dass die Menschen sich unsozial verhalten und die ganze Gesellschaft aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Der permanente Medienkonsum soll der Versuchung des eigenständigen Denkens Abhilfe schaffen.
Bücher, Romane, Biografien und Gedichte werden als »Hauptfeinde« angesehen, da sie Gefühle im Menschen hervorrufen und ihn in einen traurigen Zustand versetzen können. Bücher werden daher von der »Feuerwehr« aufgespürt und verbrannt. Die Feuerwehr in dieser Dystopie ist nicht dazu da, Feuer zu löschen, sondern Feuer zu legen. Menschen, die Bücher besitzen und lesen, werden als Staatsfeinde verfolgt, ihre Häuser und Bibliotheken werden von »Firemen« (Feuermänner, Brandstifter) angezündet. Auch Tote werden in Kauf genommen.
Diese Verfassung der Gesellschaft wurde allerdings nicht durch die herrschende, totalitäre Regierung etabliert, sondern die Menschen haben durch ihren steigenden Medienkonsum, insbesondere durch das Fernsehen, selbst eine antiliberale, totalitäre Regierung herbeigeführt. Der Roman warnt also keineswegs vor einem totalitären Staat, der seine Macht durch Repression und Zensur erhält. Bradbury sagte in einem Interview, dass seine »ursprüngliche Absicht die Warnung vor der Zerstörung des Interesses an Büchern durch das Fernsehen war. Es gibt in der Gesellschaft des Romans nach wie vor – anscheinend freie – Wahlen (bei denen hauptsächlich die Attraktivität der Kandidaten ausschlaggebend ist), und das Bücherverbot ist von der Regierung nicht erfunden, sondern auf Wunsch des Volkes erlassen worden.«3
Auch Günther Anders kritisierte die Massenmedien dafür, dass sie »uns das Sprechen abnehmen« und uns in »Unmündige und Hörige«4 verwandeln: »Da uns die Geräte das Sprechen abnehmen, nehmen sie uns auch die Sprache fort; berauben sie uns unserer Ausdrucksfähigkeit, unserer Sprachgelegenheit, ja unserer Sprachlust.«5 So werden Individuen zu »infantilen, eben unmündigen, nicht sprechenden Wesen«. Der »Endeffekt, in den [diese Entwicklung] mündet, muß überall der gleiche sein: Nämlich in einem Typ von Menschen bestehen, der, da er selbst nicht mehr spricht, nichts mehr zu sagen hat; und der, weil er nur hört, und zwar immerfort, ein ‹Höriger› ist.
Die erste Wirkung dieser Beschränkung aufs Nur-hören ist jetzt schon deutlich. Er besteht in einer, in allen Kultursprachen stattfindenden, Sprachvergröberung, -verarmung und -unlust. Aber nicht nur in dieser, sondern auch in Vergröberung und Verarmung des Erlebens, also des Menschen selbst; und zwar deshalb, weil das ‹Innere› des Menschen: dessen Reichtum und Subtilität, ohne Reichtum und Subtilität der Rede keinen Bestand hat; weil nicht nur gilt, daß die Sprache der Ausdruck des Menschen ist, sondern auch, daß der Mensch das Produkt seines Sprechens ist; kurz: weil der Mensch so artikuliert ist, wie er selbst artikuliert; und so unartikuliert wird, wie er nicht artikuliert.6 (.)
Wenn die Welt zu uns kommt, statt wir zu ihr, so sind wir nicht mehr ‹in der Welt›, sondern ausschließlich deren schlaraffenlandartige Konsumenten. Wenn sie zu uns kommt, aber doch nur als Bild, ist sie halb an- und halb abwesend, also phantomhaft. (.) Wenn die Welt uns anspricht, ohne daß wir sie ansprechen können, sind wir dazu verurteilt, mundtot, also unfrei zu sein. (.) der Unterschied zwischen Sein und Schein, zwischen Wirklichkeit und Bild [ist] aufgehoben.«7
In diesem Kapitel möchte ich weiterhin untersuchen, wie die Hungerspiele in einer Gesellschaft als Unterhaltungswert hochgehalten, statt als barbarische Sitte abgelehnt werden; welche gesellschaftliche Funktion die Spiele erfüllen und was sich über eine Gesellschaft aussagen lässt, die sich an solch sadistischen Spielen ergötzt. Alles trägt dazu bei, eine Mediensatire zu erzeugen, die von unserer Realität nicht allzu weit abweicht.
1.2 Langeweile und Sadismus
Die allgemeine Langeweile des Lebens versuchen Menschen mit zahlreichen »Aktivitäten« zu kompensieren; während der Arbeit wird eifrig der Lebensunterhalt verdient, nach der Arbeit wird Langeweile mit »Trinken, Fernsehen, Autofahren, Parties besuchen, sexueller Betätigung oder dem Einnehmen von Drogen« unterdrückt, beobachtet Fromm, ehe sie ein »natürliches Schlafbedürfnis« überkomme: »Man kann sagen, daß heutzutage eines der Hauptziele der Menschen darin besteht, ‹ihrer Langeweile zu entfliehen.›«8
Es fällt auf, dass die Unterhaltungsindustrie besonders mit destruktiven, apokalyptischen Filmen wie The Day After Tomorrow, Avatar oder The Hunger Games auf ein großes Publikum trifft. Welche charakterlichen Merkmale lassen sich an der Zuschauerschaft feststellen? »Wer will schon dabei zusehen, wie Kinder sich gegenseitig umbringen? Höchstens fiese Perverslinge.«9
Andererseits ist die Zerstörung und das Sterben von Menschen en masse in The Day After Tomorrow sehr anonym. Man sieht, wie Hurrikans eine Stadt verwüsten, eine Flutwelle Wolkenkrater mit sich reißt, aber eigentlich weiß man nur, dass Menschen sterben. Wer sie sind, weiß man nicht. Es existiert keinerlei emotionale Bindung zu ihnen. Anders verhält es sich mit den Protagonisten in solchen Filmen, die jedoch meistens überleben und als Helden gefeiert werden. Über den destruktiven oder sadistischen Charakter eines Zuschauers oder eines ganzen Publikums, welches sich leidenschaftlich und in großer Faszination an solchen Filmdramen ergötzt, kann dies jedoch nicht hinwegtäuschen. Fromm erklärt:
»Individuelle Faktoren, die dem Sadismus Vorschub leisten, sind all jene Bedingungen, die dem Kind oder dem Erwachsenen ein Gefühl der Leere und Ohnmacht geben (ein nicht-sadistisches Kind kann zu einem sadistischen Jugendlichen oder Erwachsenen werden, wenn neue Umstände eintreten). Zu jenen Bedingungen gehören solche, die Angst hervorrufen, wie zum Beispiel ‹diktatorische› Bestrafung. Hiermit meine ich eine Art der Bestrafung, deren Intensität nicht streng begrenzt ist, die nicht in einem angemessenen Verhältnis zu einem speziellen Verhalten steht, sondern die willkürlich vom Sadismus des Bestrafenden genährt und von einer Angst erregenden Intensität ist. Je nach dem Temperament des Kindes kann die Angst vor Strafe zu einem beherrschenden Motiv in seinem Leben werden, sein Integritätsgefühl kann langsam zusammenbrechen, seine Selbstachtung kann abnehmen, und es kann sich so oft verraten fühlen, dass es sein Identitätsgefühl verliert und nicht mehr ‹es selbst› ist.
Die andere Bedingung, die zu einem Gefühl vitaler Ohnmacht führt, ist eine Situation psychischer Verarmung. Wenn keine Stimulation vorhanden ist, nichts, was die Fähigkeiten des Kindes weckt, wenn es in einer Atmosphäre der Stumpfheit und Freudlosigkeit lebt, dann erfriert ein Kind innerlich. Es gibt dann nichts, worin es einen Eindruck hinterlassen könnte, niemand, der ihm antwortet oder ihm auch nur zuhört, und es wird von einem Gefühl der Ohnmacht und Impotenz erfasst. Ein solches Gefühl der Ohnmacht muss nicht unbedingt zur Bildung eines sadistischen Charakters führen; ob es dazu kommt oder nicht, hängt von vielen anderen Faktoren ab. Es ist jedoch eine der Hauptursachen, die zur Entwicklung des Sadismus sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene beitragen,«10 und weiter:
»Nur wenn man die Intensität und Häufigkeit der destruktiven sadistischen Gewalttätigkeit bei Einzelpersonen und Volksmassen erlebt hat, kann man verstehen, dass die kompensatorische Gewalttätigkeit nichts Oberflächliches und nicht die Folge schlechter Einflüsse, übler Gewohnheiten oder dergleichen ist. Sie ist eine Macht im Menschen, die ebenso intensiv und stark ist wie sein Wille zu leben. Sie ist eben deshalb so stark, weil sie das Aufbegehren des Lebens gegen seine Verkrüppelung ist; der Mensch besitzt ein Potenzial zur zerstörerischen und sadistischen Gewalttätigkeit, weil er ein Mensch und kein Ding ist und weil er versuchen muss, Leben zu zerstören, wenn er es nicht erschaffen kann. Das Kolosseum in Rom, in dem Tausende von impotenten Menschen mit größtem Vergnügen zusahen, wie andere Menschen von wilden Tieren zerrissen wurden oder wie sie sich gegenseitig umbrachten, ist das große Monument des Sadismus.
Aus diesen Erwägungen folgt noch etwas anderes. Die kompensatorische Gewalttätigkeit ist das Ergebnis eines ungelebten und verkrüppelten Lebens, und zwar sein notwendiges Ergebnis. Sie lässt sich durch Angst vor Strafe unterdrücken oder durch Schauspiele und Vergnügungen aller Art sogar ablenken. Sie bleibt jedoch als Potenzial in voller Stärke bestehen und wird manifest, sowie die sie unterdrückenden Kräfte nachlassen.
Das einzige Heilmittel dagegen ist die Entwicklung des schöpferischen Potenzials im Menschen, die Entwicklung seiner Fähigkeit, produktiven Gebrauch von seinen menschlichen Kräften zu machen. Nur wenn der Mensch aufhört, ein Krüppel zu sein, wird er auch aufhören, ein Sadist zu sein und zu zerstören, und nur Verhältnisse, die so beschaffen sind, dass der Mensch Interesse am Leben gewinnt, können jene Impulse zum Verschwinden bringen, welche die Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag so schmachvoll gemacht haben.«11
Die Langeweile ist eine der furchtbarsten Plagen, die es gibt. Schmerzen sind oft weniger bedrückend als Langeweile. »Die Langeweile kommt daher, daß der Mensch zum reinen Instrument geworden ist, daß er keine Initiative entwickelt, keine Verantwortung besitzt, daß er sich nur als Rädchen in einer Maschine fühlt, das man jederzeit durch ein anderes ersetzen kann. (.)
Der Mensch, der an Langeweile leidet, kann dies kaum ertragen. Er versucht sie zu kompensieren – durch Konsum. Er fährt mit dem Auto herum, er trinkt, und er unternimmt dieses und jenes, damit er die zwei, drei Stunden, in denen er nicht angespannt im Betrieb arbeitet, irgendwie ‹verbringt›. Er spart zwar Zeit mit seinen Maschinen, aber wenn er die Zeit eingespart hat, dann weiß er nicht, was er mit ihr anfangen soll. Dann ist er verlegen und sucht, diese gewonnene Zeit auf anständige Weise zu töten. Unsere Vergnügungsindustrie, unsere Parties und Freizeitgestaltungen sind zum großen Teil nichts anderes als ein Versuch, auf anständige Weise die Langeweile des Wartens zu beseitigen.
Aber die Langeweile wird damit kaum aus der Welt geschafft. Der gelangweilte Mensch, der nichts Positives erleben kann, hat noch eine andere Möglichkeit, Intensität zu erleben – die Zerstörung. Wenn ich Leben zerstöre, dann erlebe ich eine Sensation der Überlegenheit über das Leben, ich räche mich an ihm, weil es mir nicht geglückt ist, dieses Leben mit Sinn zu erfüllen. Indem ich nämlich räche und zerstöre, beweise ich mir, daß das Leben mich doch nicht betrogen hat. Ich kann es nicht ertragen, daß andere Menschen das Leben genießen und daß sie es besser haben, weil sie lebendig sind, während ich dem Leben kalt und tot gegenüberstehe.«12
Eine Gesellschaft, die sich an Gladiatorenkämpfen oder den Hungerspielen ergötzt, ist für unser Verständnis zweifellos sadistisch und destruktiv. Eine wichtige Frage ist nun, worin der Unterschied zwischen Sadismus und dem nekrophilen Charakter liegen. Anders als der Nekrophile will der Sadist sein Objekt der Begierde erhalten. Beiden Charakteren liegen jedoch viele gemeinsame Ursachen zugrunde. Soweit es die Gesellschaft in Panem betrifft, besser gesagt die Gesellschaft der Kapitolisten – zu denen ich auch Distrikt 1 und besonders Distrikt 2 zähle –, lassen sich Sadismus und Nekrophilie nicht sauber voneinander trennen.
Einerseits ist das Maß der Destruktivität durch eine allgemeine Langeweile – wie auch in Fahrenheit 451 – ungeheuer groß; zugleich wird diese jedoch auch überdeckt von zahnlosen Reaktionsbildungen und dem betriebenen Konsum. Die endlosen Festlichkeiten erscheinen als lebendig, doch sind sie nichts weiter als Festspiele des Leidens und des Todes. Die allgemeine Langeweile ist die vielleicht bedeutendste Ursache dafür, weshalb nachfolgende Generationen, für die die Hungerspiele schon immer da waren, diese barbarische Sitte nur allzu bereitwillig annahmen und fortführten, mehr noch: sie immer weiter kultivierten und intensivierten. Die Spiele mussten, um weiter aufregend zu sein und zu stimulieren, drastischer, brutaler und grausamer werden:
»Wenn wir [reale Ereignisse] jedoch vom Bildschirm erfahren, werden wir gerne von der Logik des Spektakels in Bann gezogen. Wenn wir von einem Skandal erfahren, regt das unseren Appetit auf den nächsten an. Sobald wir unterschwellig akzeptieren, dass wir eine Reality-Show anschauen statt über das wirkliche Leben nachzudenken, kann im Grunde kein Bild dem Präsidenten politisch schaden. Reality TV muss mit jeder Folge drastischer werden.«13
Das Gleiche gilt aber auch für alle anderen Lebensbereiche, die Eingang in eine große TV-Show gefunden haben. Die Dimension geht dabei weit über Unterhaltungssendungen hinaus und betrifft auch politische Nachrichten und Wahlkämpfe, die dadurch immer weiter polarisieren und Demokratie verballhornen.
1.3 Die Welt als »Verkaufs«-Bühne
»Die ganze Welt ist eine Bühne und Fraun wie Männer nichts als Spieler.« – Jaques in Shakespeares Wie es euch gefällt (est. 1599), Akt 2, Szene 7.
War die Welt 1599 noch eine Bühne, so ist sie heute eine Verkaufsbühne und »Fraun wie Männer nichts als Verkäufer ihrer Selbst.« Das Marketing ist aber der Mitte des 20. Jahrhunderts neues Strukturprinzip geworden. Während in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben noch vom Anspruch auf »Herrschaft« (durch Kapital, Wissen, Standes- oder Klassenzugehörigkeit, Macht, Wahrheitsbesitz, Sachkompetenz) bestimmt war und – wie Fromm in den 1930er Jahren mit dem Konzept der »autoritären Orientierung« zeigte – alle Bereiche menschlichen Lebens dominierte und strukturierte, so wurde durch den Protest gegen diese autoritäre Orientierung – was gemeinhin mit den ‹68er Jahren› assoziiert wird – die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die »Marketing-Orientierung« dominant werden konnte.
In keiner uns bekannten Epoche der Menschheit »hat das Marketing eine so umfassende und alle Lebensbereiche bestimmende Bedeutung gehabt wie im ausgehenden 20. Jahrhundert. Das Marketing (im Sinne von ‹Vermarktung›) ist zur Philosophie der Wirtschaft, ja für viele heute zum Sinn des Lebens geworden. Alles orientiert sich daran, ob sich etwas ‹vermarkten› lässt (.) Persönlichkeit gilt es zur Darstellung zu bringen (.); Not, Bedürfnisse, Wünsche sind interessant, so lange man mit ihnen Geschäfte machen kann. (.)
Konformismus, Flexibilität, Mobilität, Leistungswille, Individualisierung, Egoismus, Sentimentalisierung, ‹Coolness› sind deshalb Leitwerte des gegenwärtigen Menschen, weil sie unerläßliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Marketing sind und weil das Marketing zum wichtigsten strukturierenden Prinzip in den meisten Lebensbereichen geworden ist.«14
Nicht mehr das eigene Sein eines Menschen – seine Fähigkeiten, Eigenheiten, Bedürfnisse, Gefühle, Gedanken – ist bedeutend, »sondern das, was sich verkaufen läßt, was ankommt, was vielversprechend verpackt ist. Es kommt nicht auf das eigene Sein und den tatsächlichen Inhalt an, sondern auf die Vorspiegelung und die Inszenierung, (.) So führt die Marketing-Orientierung faktisch zu einer Entwertung des Seins und des authentischen Selbsterlebens des Menschen.«15
Diesen Mangel an (Selbst-)Sein versucht der Mensch zu kompensieren. Fromm hat viele der praktizierten Kompensationsversuche herausgearbeitet und damit der Gesellschaft den »Spiegel« vorgehalten: »Erfolg hängt weitgehend davon ab, wie gut sich jemand auf dem Markt verkauft, wie gut er seine Persönlichkeit einbringt, sich in netter ‹Aufmachung› präsentiert: ob er freundlich, tüchtig, aggressiv, zuverlässig, ehrgeizig ist, welche Familie hinter ihm steht, welchen Clubs er angehört und ob er mit den richtigen Leuten bekannt ist.«16
Die immer währende Orientierung ist, sich gut rüberzubringen, gut drauf zu sein, in jene Rolle schlüpfen zu können, die in ist. Durch diese Inszenierung der Wirklichkeit ist – durch die Illusion, der man sich hingibt – der Mensch »jeder menschlichen Aktivität und Anstrengung enthoben (.), um seine eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu üben und zur Entfaltung zu bringen.«17 Nicht der Mensch selbst ist wertvoll, sondern die Produkte, welche er konsumiert. Nicht der Mensch ist aktiv, »sondern der Kaffee, das Erlebnisbad, der Action-Film, die Möbel, der links- oder rechtsgedrehte Joghurt« sind aktivierend.
Vor allem lässt sich in der »illusionären Wirklichkeit« das »Versagen«, das eigene Scheitern, die Begrenztheit des eigenen Besitzes oder die Endlichkeit des Lebens ausblenden. Man muss weder warten, noch kommt man zu kurz.18 Nicht nur verschwindet so zunehmend langfristiges Denken und damit folgerichtig auch umsichtiges und nachhaltiges Handeln aus unserer Gesellschaft, auch der Mensch selbst wird, wie Kinnert richtig feststellt, zu einem Konsumgut, welches seine eigenen Gefühle negiert und seine eigene Einsamkeit verdrängt:
»Jungen Männern, die sagen, mit wie vielen Frauen sie geschlafen haben, geht es ja nicht um ernste Beziehungen, sondern ums Trophäensammeln. Wenn die heterosexuelle Frau den gut aussehenden Bachelor mit Fitnesskörper hat, dann geht es um das Ausstellen von Begehrlichkeit. Wir sind in unserer Gesellschaft durchdrungen von Attraktion, Attraktivität, Begehrlichkeit, auch von Anti-Aging.
Mit Jungsein und Vitalität assoziieren wir Leben und Gewinnersein. Das, was Einsamkeit assoziiert, ist genau das Gegenteil: Ich bin es nicht wert, dass Menschen mit mir befreundet sind, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich bin sozial inkompatibel, keiner will was von mir. Unsere ganze Gesellschaft lebt von Attraktivität und so etwas wie einem sozialen Wert. Und der, der zugibt, dass er einsam ist, deklariert sich als das komplette Gegenteil.
Einsamkeit ist eines der schamvollsten Themen in unserer Gesellschaft überhaupt. Das, was unsere Gesellschaft am meisten ersehnt, sind Sozialhelden. Es ist hundertmal salonfähiger zu sagen: ‹Ich bin pleite, aber ich bin cool und ein Rockstar›, als zu sagen: ‹Ich habe Geld, aber keiner will mit mir spielen.› Es gibt sehr viele Gründe für Einsamkeit. Aber in der Mitte der Gesellschaft wird Einsamkeit sehr schamvoll behandelt, weil es mit sozialem Versagertum assoziiert wird.«19
Um zu verstehen, inwieweit sich diese persönlichen Strebungen zur Selbstdarstellung auf die Gesellschaft als Ganzes auswirken, ist der Ansatz von Erich Fromm nützlich:
»Gesellschaft und Individuum stehen sich nicht ‹gegenüber›. Die Gesellschaft ist nichts als die lebendigen, konkreten Individuen, und das Individuum kann nur als vergesellschaftetes Individuum leben. Seine individuelle Lebenspraxis ist notwendigerweise die seiner Gesellschaft beziehungsweise Klasse und letzten Endes durch die Produktionsweise der betreffenden Gesellschaft bedingt, das heißt dadurch, wie diese Gesellschaft produziert und wie sie organisiert ist, um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen.
Die Verschiedenheit der Produktions- und Lebensweise der verschiedenen Gesellschaften beziehungsweise Klassen führt zur Herausbildung verschiedener, für diese Gesellschaft typischen Charakterstrukturen. Die einzelnen Gesellschaften unterscheiden sich nicht nur durch die Verschiedenheit in der Produktionsweise und ihrer sozialen und politischen Organisation, sondern auch dadurch, daß ihre Menschen bei allen individuellen Unterschieden eine typische Charakterstruktur aufweisen. Wir wollen diese den ‹sozial typischen Charakter› nennen.«20
Der Gesellschafts-Charakter (social character) ist das Resultat von grundlegenden Orientierungen, »und zwar solchen, die ihrer Dynamik und ihrem Gewicht nach von entscheidender Bedeutung für alle Individuen dieser Gesellschaft sind.«21 Der »individuelle Charakter« ist die »Gesamtheit der Wesensmerkmale eines Menschen«, die seine Persönlichkeitsstruktur ausmachen. Der Gesellschafts-Charakter umfasst »den wesentlichen Kern der Charakterstruktur der meisten Mitglieder einer Gruppe«, während individuelle Charaktere »Variationen dieses Kerns« sind. Dabei sind zufällige Faktoren wie Geburt, Lebenserfahrung, Beruf, Religion, Vermögensverhältnisse der Eltern oder Erkrankungen der Grund, weshalb sich Menschen charakterlich voneinander unterscheiden, obwohl sie alle der gemeinsamen Gesellschafts-Charakterstruktur unterliegen.
»Menschen können sich immer gut präsentierten wollen: zum Beispiel durch kluge Reden oder durch sicheres Auftreten, durch anstößige Witze, durch Hilfsbereitschaft, mit Hilfe ihrer Ellenbogen, durch modisches Outfit, durch Potenzgehabe oder durch Bescheidenheit. So unterschiedlich die Verhaltensweisen und Charakterzüge sind – was dennoch alle Menschen verbindet und worauf es ankommt, ist um am Beispiel zu bleiben – die Grundstrebung, sich immer gut präsentieren zu wollen. Diese strukturiert das Verhalten und gibt den Charakterzügen ihre spezifische Orientierung.«22
Die Bedingungen und Erfordernisse des Wirtschaftssystems und des Zusammenlebens »spiegeln sich in mächtigen leidenschaftlichen ‹Grundstrebungen› oder Charakterorientierungen, vieler Menschen wider, die diese ähnlich denken, fühlen und handeln lassen und sich in den verschiedensten Charakterzügen und Verhaltensweisen in direkter oder in abgewehrter Form manifestieren. Um zu begreifen, warum Menschen sich so und nicht anders verhalten, gilt es, solche Charakterorientierungen aufzuspüren, weil sie die mächtigsten Antriebskräfte nicht nur für gesellschaftliches, sondern auch für individuelles Verhalten sind. Psychoanalyse der Gesellschaft hat also Orientierungen des Gesellschafts-Charakters von Individuen zum Erkenntnisgegenstand, die unter gleichen sozio-ökonomischen Bedingungen leben und deshalb die Leitwerte und Erfordernisse des Wirtschaftens und des Zusammenlebens als Charakterorientierungen so verinnerlichen, daß sie sich mit Lust und Leidenschaft so verhalten, wie sie sich auf Grund der sozioökonomischen Erfordernissen verhalten sollen und müssen.«23
1.4 Mediensatire auf unsere Populärkultur
Die 2017 erschiene Serie Game2: Winter folgt Teilnehmern auf ihrem Survival Trip durch Sibirien. Der Sieger erhält ein stattliches Preisgeld. Das Bemerkenswerte ist nun, dass in den Vorbereitungen die Wettbewerber eine Vertragsklausel unterzeichnen mussten, dass sie keine rechtlichen Ansprüche geltend machen, wenn sie getötet oder vergewaltigt werden. Wer die geltenden Gesetze der Russischen Föderation breche, würde jedoch der Polizei übergeben.24Dennoch stellt diese Regel eine Aufweichung zivilisatorischer Grundprinzipien dar.
Das Publikum, welches sich an solchen Spielen ergötzt und die Zerstörung von Menschen im BigBrother-TV als selbstverständliche Unterhaltung betrachtet, leistet wie in Panem Beihilfe zu solchen Grausamkeiten. Man könnte sogar sagen, die Zuschauer werden ihrerseits zerstört oder sind es bereits, sodass sie selbst Opfer ihrer eigenen Unterhaltungsunkultur2 geworden sind.
Das wirft die Frage auf, weshalb Menschen sich zu solchen Spektakeln hinreißen lassen und dabei alle Moral und Wertvorstellungen fallen lassen. Das inflationäre Morden und Töten in den Populärmedien ist insoweit bedenklich, als dass die Mordrate in den öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Programmen die Zahl der realen Morde in Deutschland mittlerweile übersteigen dürfte. Es liegt hier also keine individuelle, sondern eine gesellschaftliche Problematik vor.
Der einzige Unterschied zu den Zuschauern des Kolosseums in Rom vor 2000 Jahren besteht in der televisuellen Distanz. Die Annahme, etwas geschehe also »nur im Fernsehen«, aber nicht in Wirklichkeit, erreicht in Panem ein fatales Ausmaß. Anders als die Kapitolzuschauer erfahren die Bewohner der Distrikte einen direkten Bezug. Es sind ihre Kinder, die geopfert werden, weil es der Hochverratsvertrag so vorsieht.
»Bei seinem Versuch, die Trivialität seines Lebens zu transzendieren, fühlt sich der Mensch getrieben, das Abenteuer zu suchen, über die Schranken menschlicher Existenz hinauszublicken und sie sogar zu überschreiten. Das macht die großen Tugenden und die großen Laster, die schöpferische Tätigkeit wie die Zerstörung so erregend und anziehend. Ein Held ist, wer den Mut hat, Grenzen zu überschreiten, ohne dabei der Angst und dem Zweifel anheimzufallen. Der Durchschnittsmensch ist selbst noch in seinem vergeblichen Versuch, ein Held zu sein, ein Held. Er fühlt sich getrieben von dem Wunsch, seinem Leben einen Sinn zu geben, und von der Leidenschaft, so weit wie er es kann, bis an die Grenzen vorzudringen.
Dieses Bild bedarf noch einer wichtigen Qualifizierung. Der Einzelne lebt in einer Gesellschaft, die ihn mit fertigen Modellen beliefert, die vorgeben, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. So sagt man ihm in unserer Gesellschaft zum Beispiel, dass, wenn er »sein Brot verdiene«, eine Familie ernähre, ein guter Bürger sei und Waren und Vergnügungen konsumiere, sein Leben sinnvoll sei. Aber obgleich solche Suggestionen bei den meisten Menschen im Bewusstsein wirksam sind, so gewinnen sie doch keine echte Bedeutung für sie; und sie können nicht die fehlende innere Mitte ersetzen. Die suggerierten Modelle nützen sich ab und versagen immer häufiger. Dass dies heute in weitem Umfang der Fall ist, zeigt sich an der Zunahme des Drogenmissbrauchs, dem Mangel an echtem Interesse für irgendetwas und am Niedergang der intellektuellen und künstlerischen Kreativität sowie an der Zunahme von Gewalttätigkeiten und Destruktivität.«25
Fromms Überlegungen sind auch heute noch hoch aktuell. In Bezug auf die Verwischung von illusionärer und realer Wirklichkeit sprach er von einer »leichten chronischen Schizophrenie«,26 was die vielleicht beste Beschreibung der Gesellschaft in Panem und besonders im Kapitol ist. Collins Hungerspiele und der Kult um diese in Panem sind jedoch eine Mediensatire auf unsere eigene Medienunkultur aus Horrorfilmen wie Jigsaw – bei denen gefesselten Menschen sich selbst Gliedmaße abschneiden müssen, um nicht von Maschinen zerfetzt zu werden –, Reality und BigBrother TV – wobei Prominente in Trailern sogar ganz explizit als fließbandfertige Produkte dargestellt werden und von einem Greifarm im »Promihaus« platziert werden – aber auch die Regenbogenpresse und die sehr späten »Pöbeltalkshows«, die Schwanitz zu den Dingen zählte, »die man nicht wissen sollte«.27
Dass Meinungsmache am Abend intensiviert betrieben wird, ist keinesfalls Zufall, sondern propagandistisches Kalkül. Schon Hitler wusste in Mein Kampf: »Der beste Zeitpunkt für die öffentliche Versammlung ist der Abend, wenn die Menschen müde und daher am leichtesten zu beeinflussen sind.«28 Seit dem konnte diese Beobachtung durch zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien belegt werden: Müde Menschen denken nicht mehr kritisch, sondern nur noch mit. Die Techniken der Propaganda hingegen haben sich seit dem im Wesentlichen nicht verändert; sie blieben dieselben.
Nachrichten sind Business und kein Dienst an der Allgemeinheit. Die oberste Regel im Konzept des Infotainment lautet: Gib dem Publikum, was es sehen will. Auch Postman schrieb: »Eine Nachrichtensendung ist ein Rahmen für Entertainment und nicht für Bildung.«29 Berichterstattungen einzelner Sender orientieren sich also nicht an »Wahrheit«, sondern an der politischen oder sozialen Einstellung ihres Zielpublikums.
Die Selbstvermarktung der Tribute bei der Parade oder den Interviews ist eine gelungene Zuspitzung des Marketing-Charakters, wie ihn Erich Fromm beschrieben hat. Die eigene Identität der Tribute wird von diesen aufgegeben, um in ein bestimmtes Rollenmodell zu schlüpfen, von dem sie sich Erfolg versprechen. Sie haben so eine Identität, aber sie sind nicht sie selbst. Nichts anderes liegt Shows wie Das Supertalent, Deutschland sucht den Superstar, Das Dschungelcamp, Germany´s Next Topmodel oder dem alltäglichen Wahn- und Irrsinn der sozialen Medien von Instagram über Facebook zu YouTube zugrunde.
Collins Mahnung ist ihrerseits inspiriert von den Gladiatorenkämpfen des Alten Roms, die wir ebenso bewundern wie die faschistische Kultur im heutigen China für ihren wirtschaftlichen Aufstieg und ihre eindrucksvollen Bauten ihrer Megastädte. Aber Collins ließ sich auch von dem japanischen Spielfilm Battle Royal aus dem Jahr 2000 beeinflussen, dessen Grundlage ein gleichnamiger, früher erschienener Roman bildet.
Der Film spielt in einem dystopischen Japan der Zukunft, in dem nach einer Bildungsreform jährlich Schulklassen ausgewählt werden, um sich in einem staatlich arrangierten Todesspiel gegenseitig zu töten. Die Halsbänder der Teilnehmer ermöglichen es, den Aufenthaltsort der Schüler zu bestimmen, und können vom Kontrollzentrum aus zur Explosion gebracht werden. Steht nach drei Tagen noch kein Gewinner fest, detonieren alle Halsbänder. Der Anreiz, einander zu töten, ist so gegeben. Kurz nach Beginn des Spiels begehen einige Schüler Selbstmord, andere töten ihre Kameraden aus Rache wegen früherer Auseinandersetzungen, einige weitere schließen sich zusammen oder machen einander Liebesgeständnisse.30
Eine neue, aktuellere Version der Hungerspiele stellt aber auch die südkoreanische Serie Squid Game dar, die im September 2021 bei Netflix erschienen ist und auf die ich daher noch eingehen möchte.
Arme, hoch verschuldete oder ausgebeutete Menschen erhalten eine Einladung zu einer Spielshow, die auf einer geheimen Insel ausgetragen wird. Ermöglicht wird dies von einem kleinen Kreis sehr reicher und mächtiger Personen, die aus sicherer Entfernung den Spielen beiwohnen. Das Personal auf der Insel ist maskiert und bewaffnet. Wer den Wettbewerb am Ende gewinnt, erhält ein sehr hohes Preisgeld. Wer jedoch eine Spielrunde verliert, wird getötet, was in der Serie auch sehr explizit dargestellt wird. Bemerkenswert ist jedoch, dass alle Spielteilnehmer »freiwillig« an den Spielen teilnehmen. Sie sind lieber tot als hungrig, denn außerhalb der Insel wartet auf sie ein sozial unerträgliches und perspektivloses Leben.
Zu Beginn des Spiels kommt es zu einer Massenpanik, bei der zahlreiche Teilnehmer beim Versuch, das Spielfeld vorzeitig zu verlassen, disqualifiziert und damit erschossen werden. Der Wettbewerb umfasst sechs Spiele, die an koreanische Kinderspiele angelehnt sind. Beim Tauziehen etwa stehen zwei Teams auf sehr hohen Plattformen und versuchen, das gegnerische Team mithilfe des Taus, an das alle Spieler gekettet sind, in den Abgrund zwischen den Plattformen zu ziehen. Sobald ein Team das geschafft hat, wird das Seil durchtrennt und das unterlegene Team stirbt durch den Sturz aus großer Höhe. Für die verstorbenen Teilnehmer gibt es ein Krematorium mit mehreren Öfen, was in gewisser Weise an die schrecklichen Bilder der NS-Konzentrationslager mit ihren Verbrennungsöfen erinnert. Das Bild ist eindeutig: Der soziale Abschaum der Gesellschaft wird verheizt.31
In Südkorea hat die Serie vor allem wegen ihrer offenen Gesellschaftskritik den Zeitgeist getroffen: Wachsende Ungleichheit, Diskriminierung sozialer Minderheiten, extremer Leistungsdruck – fast alle großen Probleme des Landes werden in der Serie aufgegriffen.32
Nur kurze Zeit nach dem Erscheinen der Serie – die offenbar trotz Altersbeschränkung auch Grundschüler gesehen haben – kam es auf Pausenhöfen nicht nur vermehrt zu Ohrfeigen und Prügeleien, sondern »eine britische Grundschule schrieb zum Beispiel einen Brief an die Eltern und warnte davor, dass manche Kinder auf dem Spielplatz so getan hätten, als würden sie sich gegenseitig erschießen«.33
Das Erschreckende ist hierbei für meine Begriffe nicht, dass Kinder im Grundschulalter durch blutige und brutale Serien moralisch und sozial »verdorben« werden, sondern dass sie für Gewalt, Mord und Bluttaten »empfänglich« sind – wie es im Grunde unsere ganze Gesellschaft ist, führt man sich die erfolgreichsten Serien und Filme in der Populärkultur vor Augen. Offenbar ist die empfundene Langeweile und die erfolglose Sinnsuche im Leben vieler Menschen so groß, dass sie als billigste Ausflucht, um ihren Durst nach Drama zu stillen, die Destruktivität wählen. Es ist die Gesellschaft, in die Kinder hineingeboren werden, die ihnen vermittelt, Gewalt sei etwas »Normales« und »Natürliches«.
Die Mahnung dieser Mediensatiren sind gegeben: Langeweile und der Mangel an Fähigkeit zur freien Persönlichkeitsentwicklung begünstigen Sadismus und Destruktivität. Die Dystopien in Fahrenheit 451, Battle Royal oder Squid Game bringen dies ebenso zum Ausdruck wie Collins panemesische Hungerspiele. Die Warnung der Geschichte Panems aber ist noch eine viel explizitere:
»Orwell warnt vor der Unterdrückung durch eine äußere Macht. In Huxleys Vision dagegen bedarf es keines Großen Bruders, um den Menschen ihre Autonomie, ihre Einsichten und ihre Geschichte zu rauben. Er rechnete mit der Möglichkeit, daß die Menschen anfangen, ihre Unterdrückung zu lieben und die Technologien anzubeten, die ihre Denkfähigkeit zunichtemachen.
Orwell fürchtete diejenigen, die Bücher verbieten. Huxley befürchtete, daß es eines Tages keinen Grund mehr geben könnte, Bücher zu verbieten, weil keiner mehr da ist, der Bücher lesen will. Orwell fürchtete jene, die uns Informationen vorenthalten. Huxley fürchtete jene, die uns mit Informationen so sehr überhäufen, daß wir uns vor ihnen nur in Passivität und Selbstbespiegelung retten können. Orwell befürchtete, daß die Wahrheit vor uns verheimlicht werden könnte. Huxley befürchtete, daß die Wahrheit in einem Meer von Belanglosigkeiten untergehen könnte.
Orwell fürchtete die Entstehung einer Trivialkultur, in deren Mittelpunkt Fühlfilme, Rutschiputschi, Zentrifugalbrummball und dergleichen stehen. Wie Huxley in Dreißig Jahre danach oder Wiedersehen mit der Schönen neuen Welt (Brave New World Revisited) schreibt, haben die Verfechter der bürgerlichen Freiheiten und die Rationalisten, die stets auf dem Posten sind, wenn es gilt, sich der Tyrannei zu widersetzen, ‹nicht berücksichtigt, daß das Verlangen des Menschen nach Zerstreuungen fast grenzenlos ist›. In 1984, so fügt Huxley hinzu, werden die Menschen kontrolliert, indem man ihnen Schmerz zufügt. In Schöne neue Welt werden sie dadurch kontrolliert, daß man ihnen Vergnügen zufügt.
Kurz, Orwell befürchtete, das, was uns verhaßt sei, werde uns zugrunde richten. Huxley befürchtete, das, was wir lieben, werde uns zugrunde richten.34 (.) Huxley hat gezeigt, daß im technischen Zeitalter die kulturelle Verwüstung weit häufiger die Maske grinsender Betulichkeit trägt als die des Argwohns oder des Hasses.
In Huxleys Prophezeiung ist der Große Bruder gar nicht erpicht darauf, uns zu sehen. Wir sind darauf erpicht, ıhn zu sehen. Wächter, Gefängnistore oder Wahrheitsministerien sind unnötig. Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken läßt, wenn das kulturelle Leben neu bestimmt wird als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb, wenn der öffentliche Diskurs zum unterschiedslosen Geplapper wird, kurz, wenn aus Bürgern Zuschauer werden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zur Varieté-Nummer herunterkommen, dann ist die Nation in Gefahr – das Absterben der Kultur wird zur realen Bedrohung. (.)
Kein kompaktes Programm, kein Mein Kampf und kein Kommunistisches Manifest haben die Entwicklung, die sich jetzt abzeichnet, angekündigt.«35
Im gouvernementalen Zeitalter kommt Medien eine sehr bedeutende Rolle zu, wie ich im erweiternden Band – Die Geschichte der macht und die Macht der Geschichte – erarbeitet habe. Medien erzeugen Bilder, gewiss damit auch eine Form von Propaganda. In Panem misslang das Transportieren essentieller Bilder offenbar, sodass die Distrikte sich gegen das Kapitol erhoben, und erneut propagierten die Machteliten eine Ideologie, an die sie selbst nicht mehr recht glaubten.
»Könnte diese – durch fehlende Bilder bedingte – Handlungsunfähigkeit der Eliten zu dem Befund führen, dass soziale Stabilität zukünftig durch einen autoritären Überwachungs- und Kontrollstaat garantiert werden muss, in dem die Bevölkerung durch eine dauernde Angstmache manipulativ an die jeweilige Führung gebunden wird?«36
Das gouvernementale Zeitalter wurde in Panem von einem totalitären post-gouvernementalen Zeitalter abgelöst. Postmann schrieb in Wir amüsieren uns zu Tode darüber, dass Huxley mit seiner Dystopie einer Schönen neuen Welt richtig lag, und Orwell mit 1984 nicht. Orwell schrieb 1948, Huxley 1932. Orwell schrieb darüber, dass das, was wir hassen, uns vernichtet; Huxley darüber, dass das, was wir lieben, uns vernichtet, weil wir in aller Zerstreuung gar nicht mehr wissen, was Liebe eigentlich bedeutet. Snow wusste darum sehr genau, als er sagte, es sind die Dinge »we love most, that destroy us.« Es ist denkbar, dass sowohl Huxley als auch Orwell beide richtig liegen werden– in chronologischer Folge ihrer Werke.
1 Alkoholische Getränke, besonders Branntwein
2 Im amerikanischen Fernsehen zeigte der Sender NBC zwischen 1989 und 1996 einen Sportwettbewerb mit dem reißerischen Titel American Gladiators.
2. Fröhliche Hungerspiele
2.1 Das Wesen der Hungerspiele
Als Suzanne Collins vor mehr als zehn Jahren die »Hunger Games« für die Welt der Literatur erdachte, hatte sie einerseits eine radikale Mediensatire vor Augen, zum anderen wollte sie kritisieren, wie wir die Zukunft junger Menschen und nachfolgender Generationen zerstören: Kriege, die Klimakatastrophe, der »Endkampf« um die letzten Ressourcen, der die Menschheit an den Rand der Ausrottung getrieben hat. Dann erhob sich Panem wie Phoenix aus der Asche – und mit ihm die Hungerspiele.
Was ist das Wesen dieser Spiele? Ich würde sagen: Man nehme Menschen, am besten Kinder, konfrontiert sie mit der höchstmöglichen Form der Angst, der Todesangst. Dann sorgt man dafür, dass es kein Entkommen vor dieser Angst gibt. Was macht es mit Menschen, einer Angst hilflos ausgesetzt zu sein und ihr nicht entkommen zu können? Sie müssen lernen, ihr Schicksal zu akzeptieren.
Dann, wenn man die Menschen in der Angst gefangen hat – und im Besonderen das Märtyrertum ausgeschlossen ist –, zeigt man ihnen einen Hoffnungsschimmer am Horizont auf. Sie werden im festen Glauben daran, dass sie für sich und ihr Überleben »das einzig Richtige« tun und für »das Gute« handeln, alles tun, was auch immer nötig erscheint, um diesen Horizont zu erreichen. Insbesondere sind sie bereit, alles und jeden zu töten, und das mit todesverachtender Gleichgültigkeit. Sie denken nicht mehr über ihr Handeln und Tun nach. Blind vor Angst flüchten sie in die Destruktivität, sie werden zu Mutanten, zu mutts, zu »Trotteln« oder gedankenlosen »Schafsköpfen«.
Wenn die Identitäten der Tribute zersetzt und die »moralischen Personen« ermordet sind, bildet man sie zwei Wochen zum Kampf aus, steckt sie in eine Arena und dort bringen sie einander um. Niemand gewinnt die Spiele, es gibt nur Überlebende. Der Körper mag die Spiele überlebt haben, aber er ist nichts weiter als eine leere Hülle. Seelisch ist man als Sieger tot, und ein Mensch stirbt den Tod seiner Seele ebenso wenig ruhig, wie er den Tod seines Körpers nicht ruhig stirbt. Nebenbei wird ein Berg von Leichen »fabriziert«.
Nach den schrecklichen Bildern von Auschwitz und den Nürnberger Prozessen haben es sich die Architekten der Hungerspiele offenbar zum Ziel gesetzt, die Geschichte des 20. Jahrhunderts allein aus der Perspektive des Täters zu reflektieren. Aus Sicht des Täters ist die Lehre der Geschichte des Dritten Reiches, dass es unschön ist, als Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen zu werden. Für seine Tat nicht verurteilt zu werden, ist für den Täter das angestrebte Ziel. Er versucht daher, die Bindung zwischen ihm und seiner Tat vollständig aufzulösen. Die Architektur der Hungerspiele halte ich für weitaus perfider als die Architektur des Holocausts der nationalsozialistischen Faschisten an den Juden.
Das Verhalten der Tribute in der Arena kann durch die Spielemacher im Kontrollzentrum sehr genau gesteuert werden, währenddessen die Spielemacher unsichtbar bleiben. Das zeigt sich zum Beispiel in Katniss Flucht vor dem Waldbrand, als nach Belieben Schüsse auf sie abgegeben werden oder einzelne Bäume in bestimmten Winkeln umgestürzt werden können. Ihr Fluchtverhalten kann gelenkt werden wie eine Kugel in einem Flipperautomaten. Zugleich wird das Verhalten der Tribute und das Geschehen sehr genau analysiert und darüber Statistiken geführt (etwa, wie viele an Infektionen sterben usw.) Die Tribute selbst werden auf simple Zahlen reduziert: Die ihres Distriktes und ihre Bewertungszahl nach dem Trainingscenter. Aber die totale Herrschaft des Regimes der Hungerspiele endet nicht mit dem Verlassen der Arena, sondern – wie wir erahnen konnten – kontrolliert auch danach noch immer das Verhalten der Sieger unentwegt fort, ohne, dass es jedoch einen sichtbaren Manipulator oder Täter gebe.
Was ich den Architekten der Hungerspiele nun unterstelle, ist ungeheuerlich. Offenbar hat man sich den Holocaust näher betrachtet und sich gefragt, ob es möglich ist, der Verantwortung für das Verbrechen als Täter dadurch zu entkommen, dass man das Opfer nicht ermordet, sondern es in den Selbstmord treibt. In aller Schärfe formuliert muss die offenkundige Fragestellung also die gewesen sein: Gibt es eine Möglichkeit, die Menschen in den Lagern dazu zu bringen, sich gegenseitig umzubringen? Ja sogar dazu zu treiben, dass sie nur allzu bereitwillig die Lager selbst als den Ort ihres eigenen Endes wählen?
Die Antwort auf diese Frage ist: Ja. Man kann Menschen seelisch von innen heraus derart zersetzen, dass sie den Selbstmord freiwillig als letzte »Behandlungsmethode« wählen oder aber diesen zumindest widerstandslos hinnehmen. So schreibt auch Arendt: