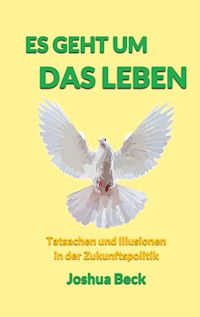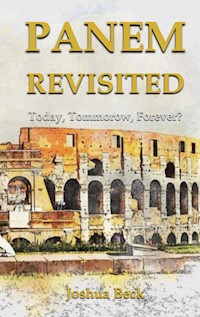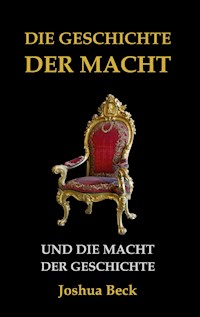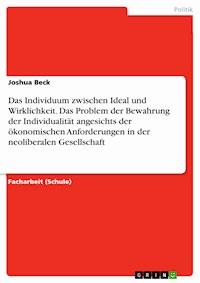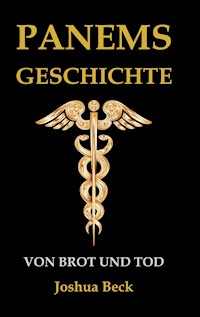
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Snowfall
- Sprache: Deutsch
Der fünfbändige »Snowfall-Zyklus« ist das Ergebnis eines mehr als sechs Jahre andauernden und intensiven Auseinandersetzungsprozesses des Autors Joshua Beck mit dem fiktiven Staat »Panem«, welcher in Suzanne Collins Dystopie eines in Krisen, Kriegen, Naturkatastrophen und Pandemien untergegangenen Nordamerikas zum Spiegelbild unserer eigenen Welt geworden ist. Der hier vorliegende Band versammelt die einzelnen Bände der Film- und Szenenanalyse sowie die Biographie von Präsident Coriolanus Snow erstmals zusammen in einem gut lesbaren Hardcover Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 914
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Danksagung
Vorrede zum Snowfall-Zyklus
Teil 1
Vorwort zum ersten Band
Vorbemerkungen
1. Methodik
2. Formen des Diskurses
3. »Mit offenen Karten«
1. Einleitung
1.1 Der Autor und seine Leser
1.2 Über das Böse, Monster und Despoten
1.3 Der Mythos
1.3.1 Kulturelle Funktionen
1.3.2 Theseus und Minotaurus
1.3.3 Spartacus
1.4 Coriolanus als historische und literarische Gestalt
1.4.1 Die antike Legende
1.4.2 Shakespeares Coriolanus
1.4.3 Der Staat als Körper mit
Bauch
und
Gliedern
2. Mit offenen Karten: Panem
2.1 Präludium einer Utopie
2.2 Überlegungen zur Vorgeschichte
2.2.1 Systemtheorie
2.2.2 Panems »Gesellschafts-Charakter«
2.3 Der Staat Panem
2.3.1 Zentralwirtschaft und Stabilität statt Fortschritt
2.3.2 Der Ständekonflikt zwischen Patriziern und Plebejern
2.4 Die Dunklen Tage und der Hochverratsvertrag
2.4.1 Krieg und Rebellion
2.4.2 Die »Revolution« der Revolution
2.4.3 Die Französische Revolution
2.4.4 Frieden durch das Totalitäre?
2.5 Prequel: Das Lied von Vogel und Schlange
2.5.1 Vogel und Schlange in der Mythologie
2.5.2
Snowfall
. Vorspiel einer Tragödie
2.5.3 Mentor und Spielemacher
2.5.4 Die
Bedeutung
der Hungerspiele
2.5.5 Die Hungerspiele als Medienereignis
2.5.6 Die kulturelle Funktion der Hungerspiele als Medienereignis
2.5.7 Der Staatsmann Snow
2.5.8 Sekundäre Quellen
3. Tödliche Spiele – THE HUNGER GAMES
3.1 Die Ernte
3.1.1 Distrikt 12
3.1.2 Die Maske und das Glück
3.1.3
divide et impera
3.1.4 Die Spotttölpelbrosche
3.1.5 Kinder und die Losungsregeln
3.1.6 Staatspropaganda
3.2 Die Macht des Determinismus
3.2.1 Der Zug
3.2.2 Über das Böse
3.2.3 Die Kunst, Menschen zu zerstören
3.3 Das Kapitol
3.3.1 Tradition und Moderne
3.3.2 Eine Biopolitik der Normen und der Tod der Werte
3.3.3 Geschlechterrollen, Mode und Singularitäten
3.3.4 Das Feuer
3.3.5 Die Parade
3.4 Die Hungerspiele
3.4.1 Das Trainingscenter und Humankapitalismus
3.4.2 Die Arena: Gefängnis und Laboratorium
3.4.2.1 Totale Überwachung des Selbst durch das Selbst
3.4.2.2 Experimente am Menschen und die Konzentrationslager
3.4.2.3 Die Täter als Opfer der Wissenschaft
3.4.3 Das Rating
3.4.4 Die Außenseiter
3.5 Die TV-Show
3.5.1 Peeta und die Medien
3.5.2 Die Angst, nicht man selbst zu sein
3.5.3 Die Arena als Panoptikum
3.6 Die 74. alljährlichen Hungerspiele
3.6.1 Das Wesen der Spiele
3.6.2 »Lang lebe der Tod«
3.6.3 Johanna von Orleans
3.6.4 Die Mutationen
3.6.5 Die giftigen Beeren und eine kleine Revolte
Teil 2
Vorwort zum zweiten Band
4. Gefährliche Liebe – CATCHING FIRE
4.1 Die Tour der Sieger
4.1.1 Freund und Feind
4.1.2 There is no buisness like show business
4.1.3 Distrikt 11 und die Deindividuation
4.1.4 The show must go on
4.1.5 Die Party des Jahres und das Mahagoni
4.1.6 Ein unerklärter Propaganda-Krieg
4.1.7 Das Swan House
4.2 Die Idee der Revolution
4.2.1 Das Ablenkungsmanöver
4.2.2 Das Ende der Hoffnung
4.2.3 What ever it takes
4.2.4 Die Spezies der Sieger
4.3 Das Dritte Jubel-Jubiläum
4.3.1 Regeländerung im Spiel als
Kniff
4.3.2 Die Große Parade
4.3.3 Sabotage und die Mayflower
4.3.4 »Sie sollen alle sterben!«
4.4 Die 75. Hungerspiele
4.4.1 Die Uhr
4.4.2
Der Schrei
4.4.3 Die Grenzen der Macht
4.4.4 Das große Finale
4.4.5 Der Zusammenbruch des Systems
4.4.6 Zweimal kleine
Hexenküche
5. Flammender Zorn – MOCKINGJAY I
5.1 Wie man Feuer entfacht
5.1.1 Distrikt 13
5.1.2 Vergeltung
5.1.3 Helfershelfer
5.1.4 Das Märchen und der Bock
5.1.5 Waffenruhe?
5.1.6 Der Spotttölpel
5.1.7 Die Epidemie und erwachsene Kinder
5.2 Revolution und Propaganda
5.2.1 Neue Herren, alte Abhängigkeiten
5.2.2 Demokratie ist wieder »in«
5.2.3 Individualismus
5.2.4 Das Gute und das Böse
5.2.5 Mythologie: Errate den Verräter
5.3 Die Banalität des Bösen
5.3.1
Ein
Kriegsverbrechen
5.3.2 Das erste Propo
5.3.3 Verbrechen und Illusion im Totalitarismus
5.3.4 Das Ende der »humanity«?
5.3.5 Ein kleines Vietnam
5.3.6 Das Lied vom Henkersbaum
5.4 Die Rettungsmission
5.4.1 Landung in Distrikt 5
5.4.2 Züge und Gegenzüge
5.4.3 In Schach
5.4.4 Wenn Liebe tötet
5.4.5 Bis in den Tod
6. Flammender Zorn – MOCKINGJAY II
6.1 Eine harte Nuss
6.1.1 Machtanalytik
6.1.2 Gegen das System
6.1.3 Die Nuss und die Wolfshöhle
6.1.4 Das Ende einer glorreichen Ära
6.2 Der Krieg: Glück und Zufall?
6.2.1 Befehlsverweigerung
6.2.2 Eine neue Ära?
6.2.3 Clausewitz und der Krieg
6.3 Die 76. Hungerspiele
6.3.1 Das Spiel mit dem Tod
6.3.2 Feind oder Freund?
6.3.3 Propaganda
6.3.4 Im Untergrund
6.4 Endspiel
6.4.1 Lebendig begraben
6.4.2 Die große Hexenküche
6.4.3 Die Deutung
6.5 Es lebe die Revolution!
6.5.1 Das Nachspiel
6.5.2 Coriolanus letzter Sieg
6.5.3 Eine schöne neue Welt?
6.5.4 Die Revolution der Hoffnung
Die Mockingjay Revolution
Teil 3
7. Präsident Coriolanus Snow
Präludium: Weiße Rosen
Macht und Ohnmacht
Kreativität und Destruktivität
Sadismus und Masochismus
Sein und Schein
Leben und Töten
Triumph und Versagen
Held und Antiheld
Der seltsame Fall des Coriolanus Snow
Postludium
Epilog
Anhang
Donald Sutherlands Brief aus dem Rosengarten
Johann Wolfgang von Goethe
Diktatur und Widerstand
Zwei Einleitungen. Zwei Mahnungen.
a) Niccolo Machiavelli: Unsere Erziehung und die Bedrohung der Republiken
b) Eugen Drewermann: Kapitän Ahab und die Verfrühung der Angst
1. Wie Diktaturen entstehen und fortbestehen
a) Wie du eine Diktatur errichtest und diese erhältst.
b) Wie »man« eine Diktatur errichtet und diese erhält.
2. Wie Demokratien zu verteidigen sind
a) Wie »man« eine Demokratie verteidigt und erhält.
b) Wie du eine Demokratie verteidigst und erhältst.
Literatur
Anmerkungen
Prolog
Meinen ersten Kontakt mit dem ersten Film der Die Tribute von Panem-Trilogie hatte ich während meines Abiturs im Englischunterricht gegen Ende des Jahres 2015 – also vor nun schon fast sieben Jahren. »Was für ein Irrsinn«, war mein erster Gedanke, so einen »Fantasy-Wahnsinn« wie Die Chroniken von Narnia oder Der Herr der Ringe konnte ich zu dieser Zeit überhaupt nicht mögen. Damit möchte ich Fans dieser Filme und Bücher nicht zu nahe treten; es entsprach nun mal aber meiner damaligen Einstellung.
Doch bereits nach wenigen Minuten schlug mein Desinteresse in Interesse um. Ich war in gewisser Weise nicht nur fasziniert, sondern geradezu gefesselt. Und je mehr ich von dem ersten Film sah, desto mehr dachte ich mir: »Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn.« Später sah ich den zweiten Film und geriet als logisch denkender Mensch besonders an dessen Ende fast an den Rand eines Nervenzusammenbruches. Daher habe ich mir abgewöhnt, Panem wörtlich zu verstehen zu versuchen.
Die Filme hatten etwas Tieferes und es gab viele Faktoren, die mir das Gefühl gaben, hier ein ganz besonderes Werk vorgefunden zu haben, das die Mühe zum Verstehen wert ist. Schließlich ist Goethes faustische Hexenküche nicht weniger wirr und in sich verdreht. Es ist die Herausforderung der Dechiffrierung. Seither habe ich Tag ein, Tag aus eigentlich kaum etwas anderes gemacht, als mir den Kopf über Brot zu zerbrechen, und an manchen Tagen war ich damit fast vollkommen überfordert. Es hat viel Mut erfordert, sich einer Aufgabe zu stellen, die ohne offenkundigen Nutzen ist. Aber wie die Zahlentheorie lange sich selbst ein Selbstzweck war und erst durch die RSA-Verschlüsselungstechniken einen Mehrwert gewann, so sollte sich auch meine Panem-Forschung schließlich auszahlen.
Seit Goethes Faust hat die Welt der Kunst ein kaum so monumentales, geradezu allumfassendes Werk mehr gesehen wie es die Tribute von Panem darstellen. Da beziehe ich selbstbewusst Position. Und eben dieses Werk zu verstehen, ist entsprechend nicht leicht. Es ist eine Herausforderung. Dieser stelle ich mich in dieser fünfbändigen Buchreihe, welche über weite Teile innerhalb weniger Monate im Jahr 2021 entstanden ist. Doch die Gedanken dahinter sind jahrelanger Auseinandersetzung zu verdanken. Und bei vielen Dingen habe ich das Gefühl, noch mehr lesen zu müssen, um Collins Werk und das der Regisseure vollumfänglich und noch genauer verstehen zu können. Es geht darum, das Wesen der Macht begreifbar zu machen und seine feinen Maschen zu durchdringen. Collins Werk eignet sich als literarischer Zugang zu dieser Gedankenwelt sehr gut.
Die Tribute von Panem einem Genre zuzuordnen, ist bisher nicht einheitlich gelungen. Vielmehr ist »Panem« selbst zu einem Genre geworden. Vergleichbare Bücher in der Kinder- und Jugendliteratur werden beschrieben als »Bücher wie Panem«. Panem ist viel mehr als nur ein Land, das den Kinderhass zum Staatskult erhoben hat. Daher möchte ich versuchen, eine Definition vorzuschlagen. Dabei spielt die Beobachtung eine zentrale Rolle, dass sowohl Lebensmacht als auch die Todesmacht in den Tributen von Panem zusammenfallen. Nicht nur ihr Tod wird durch ihr Los besiegelt, sondern auch ihr Leben wird bis zu ihrem Tod »gemacht«, sodass es ihnen unmöglich ist, sich der Staatsmacht durch Selbstmord zu entziehen. Ihr Leben gehört dem Staat, genau wir ihr Tod.
Ein »Panem« ist also ein Land, in dem die totale Herrschaft allumfassend ist, sodass Lebens- als auch Todesmacht zusammenfallen. Leben wird nicht gemacht trotz des unausweichlichen Todes – so wie wir alle mit dieser Gewissheit leben müssen –, sondern während das genaue Datum des Todes und seine näheren Gründe feststehen. Das Leben selbst wird nicht »gemacht« als ein Selbstzweck, sondern es ist ein zu überwindender Abstand zum allerlösenden Tod, auf den es sich unentwegt hinzubewegen gilt, weil man diesen für den Beginn der Unsterblichkeit hält.
Noch nie zuvor ist Vergleichbares in der Weltgeschichte so allumfassend und so gründlich durchgeführt worden, wie wir es in Panem beobachten mussten. In Huxleys Schöner neuen Welt konnten wir erahnen, dass das Leben durch den Staat für den Staat gemacht wird, und der Tod ab einem bestimmten Alter vorgesehen ist, den elternlose Erwachsene freudig und in höchstem Pflichtgefühl erwarten, sodass der Gottesstaat zum Staatsgott wird, der Leben gibt und nimmt. Das Leben des Einzelnen gehört dem Staat, genau wie sein Tod. Die Differenz zwischen dem Leben gebenden und nehmenden Gott und dem Staat wird vollends aufgehoben, da der Staat selbst auch die Geburten kontrolliert, nicht nur die Sterbefälle. Der Staat wird zum Gott, Gott ist der Staat. Der Staatsgott ist ein Gottesstaat.
Es ist denkbar, dass nach einer Katastrophe wie einer verheerenden Pandemie, welche die Menschheit an den Rand des Abgrundes führt, der Staat auch das Geben von Leben an sich zieht, um den Fortbestand der Zivilisation zu sichern, und das in globaler Dimension. Das Ergebnis dürfte einerseits zu einem Weltstaat, andererseits zu einer aktiven Geburtenkontrolle führen, die über die passive – in Form von Verhütungsmitteln und Medikamente oder Kastrationen – hinausgeht.
Was macht das mit einer Gesellschaft, die sozialen Hunger leidet und sich machtlos fühlt? Mit einer Gesellschaft, die beherrscht wird von Mechanismen, welche sie selbst in Gang setzte und die nach ihren eignen Regeln deterministisch abrollen? Ist das Leben nicht mehr lebenswert, so stellt sich die Frage, ob das Überleben überlebenswert ist. Sagt sich eine solche Gesellschaft los von der Liebe zum Leben los und begeistert sich immer mehr für das Tote, welches einen Ausweg aus der Wertlosigkeit des Lebens verheißt?
Diese Fragestellungen bilden den Ausgang meiner Panem-Forschung.
Danksagung
Aus einem Brief an meinen früheren Englischlehrer, dem ich danken möchte dafür, dass er mein Interesse an Collins Werk geweckt hat:
Betreff: »Grüße aus Panem« und ein kleiner »Brief aus dem Rosengarten«
Lieber Herr E.,
[.] Die aktuellen Entwicklungen in politischer Dimension sind leider wenig erfreulich. Vieles erinnert mich an die Tribute von Panem und in diesem Kontext habe ich mich auch unserer gemeinsamen Englischstunden erinnert. Die Filme haben mich seit über fünf Jahren nicht mehr losgelassen und nun habe ich motiviert durch Collins Viertes Buch begonnen – da es weder Freizeitgestaltung mit Freunden oder ein freudiges, erfolgreiches Studieren gibt – aus der Not eine Tugend zu machen und also ein Buch darüber zu schreiben. Es ist aktueller denn je, mit Blick auf die totalitäre Trump-Bewegung in den USA als auch katalysiert durch die Corona-Schrecken global.
Sutherland schreibt in seinen/seinem (?) Letters from Rose Garden:
Power. That’s what this is about? Yes? Power and the forces that are manipulated by the powerful men and bureaucracies trying to maintain control and possession of that power? Power perpetrates war and oppression to maintain itself until it finally topples over with the bureaucratic weight of itself and sinks into the pages of history (except in Texas), leaving lessons that need tobe learned unlearned.
Seine Analyse, so schlicht und kompakt sie auch daherkommen mag, ist vortrefflich zutreffend. Die Mechanismen der Macht, ihre Manifestierung in Machtverhältnissen und also auch in den daraus gebildeten Machtstrukturen zu entschlüsseln, ist eine fast unmögliche Aufgabe, aber ich habe das Gefühl, nach vielen Jahren des Nachdenkens, Sortierens und Analysierens langsam einen Durchblick zu erhalten, Collins Werk also dechiffrieren zu können.
Auch wenn es eine Banalität sein mag, ohne Ihr Eigeninteresse, das Verhalten der Charaktere verstehen zu wollen und uns Schülerinnen und Schüler nach einer Erklärung für viele Absurditäten zu fragen, das Werk also zum Gegenstand des literarischen Diskurses im Unterricht zu machen, hätte es dieses meine Interesse vermutlich so nie gegeben. [.]
*****
Einen besonderen Dank möchte ich auch meinem Freund Steven Schwarz widmen, der mich als Historiker und Politikwissenschaftler in vielerlei Fragen beraten hat, sowie Iris Pilling, mit der ich vor der Veröffentlichung des Manuskriptes intensive Gespräche über die aufgegriffenen Inhalte und erarbeiteten Thesen und ihre Form führen konnte.
Für Fragen der Psychologie und Psychoanalyse danke ich Christine Preißmann, Meike Miller und Julia Klimek sowie für zeitgenössische Erfahrungsberichte, die mir Stefan Sauerwein und Marcel Dehmer zugetragen haben. Aber auch meiner Tante Renate Beck danke ich für den Austausch über kulturgeschichtliche Begebenheiten.
Besonders danken muss und möchte ich aber sechs bedeutenden Denkern, ohne die dieses Buch in dieser Form niemals hätte entstehen können: Hannah Arendt, Elias Canetti, Erich Fromm, Michel Foucault sowie Noam Chomsky und Stephen Hawking, deren Werke mich stark im Denken beeinflusst haben, auch wenn letztere beiden an dieser Stelle nicht direkt Eingang hierin finden.
Der hauptsächliche Dank aber gebührt Suzanne Collins sowie all denen, die an der Verfilmung dieses großartigen Gesamtkunstwerkes mitgearbeitet haben. Dieses Werk hat das Potential, die Welt zu verändern. Für viele Panem-Fans hat das Werk längst ihr Leben ein Stück weit verändert.
J.B., Mai 2021
Vorrede zum Snowfall-Zyklus
Wie oft ich die die Filme der Tributen von Panem-Reihe mittlerweile schon gesehen habe, weiß ich gar nicht so genau. Jedes Mal habe ich erneut das Gefühl, wieder ein völlig neues, bisher mir entgangenes Detail zu entdecken. Und mit dem Verständnis des Geschehens der ganzen Filmreihe sowie den Büchern als Beiwerk konnte ich so langsam einen roten Faden entdecken.
Es ist wie eine unendliche Aufgabe, eine unendliche Geschichte in allerlei möglichen Dimensionen nachzuschreiben. Die Tribute von Panem erzählen von einem Staat, dem Leben und Überleben, von Politik, Unterdrückung, Revolution, aber auch Liebe, menschlichem Verhalten und unseren Urbedürfnissen.
Die Deutungen können staatsphilosophischer, psychoanalytischer, religiöser, literarisch-metaphorischer, kulturwissenschaftlicher, ökonomischer, historischer und gegenwärtiger Natur sein. All dies zu ordnen ist eine Aufgabe Vieler. Und mit diesem Buch möchte ich den ersten grundlegenden Anfang machen. Viele der Thematiken sind nicht zuletzt im Rahmen der Corona-Pandemie aktueller denn je geworden.
Die Zielsetzung meiner vorliegenden Arbeit ist mir zu Beginn nicht wirklich klar gewesen, es war mehr der Weg das eigentliche Ziel. Erst mit dem Schreiben und Denken habe ich so langsam eine Idee davon bekommen, was die Quintessenz sein könnte. (Hätte ich das aber schon vorher gewusst, hätte ich ja nicht zu schreiben brauchen.)
Das Werk habe ich aufgrund der Fülle an Themen und vielfältigen Gedanken in vier Bände aufgeteilt und in einem erweiternden Band – Die Geschichte der Macht und die Macht der Geschichte – wichtige »Grundlagen« für die bessere Verständlichkeit und Lesbarkeit des Gesamttextes von der Geschichte Panems in Fragestellungen der Macht, das Wesen des Faschismus und der Entstehung von Staaten ausgelagert. Der Schreibstil ist ein mehr philosophischer und die Gedanken darin sind durchaus wichtig, um Panem als Phänomen richtig begreifen zu können. Jedoch könnte es für interessierte, neugierige, aber etwas ungeduldige Leser den Lesefluss hemmen. Dennoch möchte ich den Band, in den ich auch neuere und aktuelle politische Entwicklungen unserer Zeit eingearbeitet habe, sehr empfehlen.
In der eigentlichen Hauptarbeit setzte ich mich im ersten und zweiten Buch mit der (fiktiven) Geschichte Panems und der Mockingjay Revolution in einer ausführlichen Szenenanalyse auseinander. Zu Beginn des ersten Bandes leiste ich aber noch etwas Vorarbeit, sodass es gelingen kann, Panems Vorgeschichte und die mythologischen Hintergründe von Collins Werk zu verstehen.
Im dritten Teil bemühe ich mich um eine zeitgenössische Einordnung in Form von Essays, in der ich auch gezielt Themen und Menschheitsfragen unserer Zeit beleuchte.
Abschließend setze ich mich im vierten Band intensiv mit dem biographischen Charakter von Präsident Coriolanus Snow auseinander.
Der Leser hat einen Anspruch an mich als Autor, dass ich ihm ein gelungenes Werk anbiete. Aber ebenso habe ich auch als Autor einen Anspruch an den Leser, sich auf eben dieses Werk offen einlassen zu können. Um diese Bereitschaft möchte ich bitten.
Ich wünsche viel Freude und Erkenntnisgewinn beim Lesen,
Joshua Beck, April 2021
Der Mensch erschuf die Macht, ohne sie zu verstehen, woraufhin sie sich gegen ihn wandte.
Ein Mensch kann und darf niemals für sich allein betrachtet werden, er ist stets eng verwoben mit seiner Zeit. Die Motive unseres Handelns sind nicht selten vielfältiger, ja ambivalenter Natur. Es gibt solche, die wir bewusst verfolgen, und solche, die wir unbewusst verfolgen; und dann gibt es noch solche Motive, die selbst unserem Unterbewussten unbewusst sind, denn sie gehen weit zurück auf die Geschichte unserer Ahnen, welche als unsichtbare Masse weiterhin ein Teil unserer eigenen Massenseele sind.
Die Geschichte lässt sich nicht planen; sie ergibt sich aus einem Zusammenspiel des Zufälligen und des Unvorhersehbaren, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Kräfte gibt, die den Zufall nicht dem reinen Zufall zu überlassen gewillt sind. Wie genau die Dinge zu einander lagen, das kann abschließend wohl nie mit letzter Sicherheit geklärt werden. Ein Historiker ist also vielmehr ein Archäologe, der nach den verschütteten Resten der Wahrheit sucht. Eben dieser Wahrheit, die niemals jemand im Kern zu erkennen vermag, kann er sich nur möglichst dicht annähern.
Doch schlussendlich bleibt die Erkenntnis, dass sich die Dinge wohl niemals in ihrer reinsten Form der Wahrheit als solche erkennen lassen werden und dass Historizität mitunter etwas höchst Subjektiviertes und Mediatisiertes ist.
Vorwort zum ersten Band
In diesem ersten Band habe ich mich intensiv mit der Trilogie der Tribute von Panem von der Vorgeschichte bis zum 74. Jahr der Hungerspiele auseinandergesetzt. Für mich bieten die Bücher und Filme eine sehr gute Arbeitsfläche, um so etwa im Deutschunterricht die Felder Geschichte, Macht, Staat, Politik, Propaganda, Revolution und Krieg zu bearbeiten. Im Rahmen meiner Panem-Forschung, welche ich nun schon seit mehr als einem halben Jahrzehnt betreibe, habe ich aber auch Beunruhigendes gefunden, da die Dystopie eines untergegangenen Amerikas und einer infantilen, sadistischen und totalitären Gesellschaft keinesfalls mehr als absolut unerreichbar erscheint. Daher ist der Band auch außerhalb des Schulunterrichtes durchaus sehr lesenswert.
Vorbemerkungen
1. Methodik
»Drei große Ausschließungssysteme treffen den Diskurs: das verbotene Wort; die Ausgrenzung des Wahnsinns; der Wille zur Wahrheit.«
– Michel Foucault1
Ganz unproblematisch ist die immense Dichte an thematischen Gegenständen der Panem-Trilogie nicht. Und auch nach sechs Jahren weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll. (Ich befinde mich also nun schon in meinem sechsten Jahr der Panem-Forschung, was bedeutet, dass ich Tag ein, Tag aus im Grunde nichts anderes mache, als mir den Kopf über Brot zu zerbrechen, und bin dabei oft heillos überfordert.) Aber Collins 2020 erschienener neuer Band, eine Vorgeschichte der Hungerspiele, hat mich motiviert, nun tatsächlich die Aufgabe anzunehmen. Es ist die Aufgabe, als Leser eine individuelle Interpretation zu gewinnen, zugleich aber als eigenständiger Autor eine Deutungshoheit über Collins Werk in Anspruch zu nehmen. Letzteres ist nicht unproblematisch.
Franz Kafka gilt heute als einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Sprache, ja vielleicht sogar als der meistgelesene deutschsprachige Autor. Seine Werke erscheinen meist rätselhaft, ins Absurde abschweifend. Bei näherer Betrachtung jedoch offenbaren sich dem Leser tiefgründige Gedankengebäude, welche eingebettet in ein atmosphärisches Klima zeitlos, ja geradezu universell erscheinen.
Collins schien sich mit ihrer Panem-Trilogie auf die Spuren Kafkas und Goethes begeben zu wollen. Sie schafft es, Bilder zu erschaffen, sodass man meinen könnte, sie habe es sich zu eigen gemacht, die großen und komplexen Themen des 21. Jahrhunderts vorwegzunehmen. Gewiss, Collins die Fähigkeit zuzuschreiben, sie hätte die Zukunft vorhersehen können, ist zu weit gegriffen.
Vielmehr liegt die These nahe, dass der Leser selbst, welcher geprägt ist von seiner Epoche, ihr Werk subjektiviert und so zu einer individuellen, eigenen Deutung gelangt. Es darf also zu Recht die Frage gestellt werden, ob eine absolut oder teilweise individuell erschlossene, subjektive Panem-Deutung überhaupt vertretbar ist. Diese Schwierigkeit möchte ich kurz näher am Beispiel der umfangreichen Kafka-Forschung erläutern.
Bereits 2003 gab es über 11.000 Kafka-Deutungen.2 Für Kafka-Texte bedeutet dies, so Koch, ein Abschiednehmen von der Vorstellung, man könne eine Text-Deutung gleichsetzen mit der Entschlüsselung eines tieferen Sinns.3 Für die hermeneutische Kafka-Forschung ist dies eine wahre Tragödie: Die Kafka-Philologie ist eine unerschöpfliche Aufgabe, und dies sogar in zweifacher Hinsicht, so Kilcher:
»Unerschöpflich ist sie einerseits durch die Eigenheit von Kafkas Texten, die in ihrer fragmentarischen und parabolischen Gestalt zwischen Vieldeutigkeit und Undeutbarkeit changieren. Unerschöpflich ist sie andererseits durch die Vielzahl der Ansätze, Perspektiven und Kontexte, die die wissenschaftliche Analyse dieser Texte je leiten. Die Kafkaforschung ist deshalb lange schon Anlass weniger zu Euphorie als vielmehr zu Entmutigung angesichts der unüberschaubaren Zahl von Promotionen, Tagungen etc.«4
Hinsichtlich einer »Rechtfertigung« auch nur einer einzigen weiteren denkbaren Kafka-Deutung scheint es dem Interpreten wohl schwer gemacht zu werden, diese in die Kafka-Forschung einzubringen. Dennoch: Umreist man den Kerngegenstand der literaturwissenschaftlichen Forschung, das Schreiben an sich, so wird ersichtlich, dass es für einen Leser und potentiellen Deuter Kafkas, oder allgemein irgendeines Autors, keinen echten Grund gibt, sich von der schier unermesslichen Menge bisheriger Deutungen abschrecken zu lassen.
Ein Autor schreibt mitunter aus den unterschiedlichsten Motiven und Beweggründen, ein Leser liest der Unterhaltungslust, literarischem Interesse oder aus Erkenntnisdrang wegen. Würde sich der Leser dahingehend beeinflussen lassen, wie unterhaltsam, literarisch bedeutsam oder zu Erkenntnis gereichend andere Leser irgendein oder ein spezielles Werk finden, so wäre der Leser in seiner Rolle innerhalb der Wirkungsentfaltung und Wirkungsgeschichte von Literatur nicht frei.
Dies wäre vergleichbar mit dem Umstand, dass ein Autor nur über ein bestimmtes Thema schreiben darf oder den immer gleichen Stil gebrauchen muss. Dann gebe es keine Geschichten mehr darüber, wie sich jemand das Leid von der Seele schrieb, in kluger Weise über sich und die Welt reflektiert hat oder einfach nur unterhalten wollte; mit anderen Worten: Literatur wäre langweilig, da vorhersehbar, berechenbar.
Um nicht langweilig, »outdated« zu sein und auch nicht zu werden, bedarf es nicht notwendigerweise elementarer Grunderneuerungen. Der Literatur genügt es, wenn sie Neues, und damit eben auch Überraschendes in dosierter Weise hervorbringt. Dies ist ihr möglich, wenn sie ihren Diskursteilnehmern innerhalb eines zwar begrenzten Rahmens einen Raum bietet, innerhalb dem der Literaturdiskurs jedoch völlig frei von äußeren Kräften, aber sehr wohl beeinflusst von allen inneren Kräften geführt werden kann. Foucault zu Folge muss das Wahnsinnige aus dem Diskurs ausgeschlossen werden:
»Seit dem Mittelalter ist der Wahnsinnige derjenige, dessen Diskurs nicht ebenso zirkulieren kann wie der der anderen: sein Wort gilt für null und nichtig, es hat weder Wahrheit noch Bedeutung. (.) Andererseits kann es aber auch geschehen, dass man dem Wort des Wahnsinnigen im Gegensatz zu jedem anderen eigenartige Kräfte zutraut; die Macht, eine verborgene Wahrheit zu sagen oder die Zukunft vorauszukünden oder in aller Naivität das zu sehen, was die Weisheit der anderen nicht wahrzunehmen vermag.«5
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies: Es bedarf eines Forums, welches undenkbare, ja unmögliche Deutungen nicht prinzipiell ausschließt, diesen jedoch nicht unmäßig Raum bietet. Eine Deutung muss auf einer erkennbaren Grundlage fußen, will sie ernst genommen werden. Solange eine Deutung im denkbar Möglichen liegt, muss diese auch zugelassen und anerkannt werden. Ob eine Deutung dabei denkbar möglich ist, orientiert sich hierbei daran, inwieweit sie bisherige Deutungen und Forschungserkenntnisse berücksichtigt, diese miteinbindet oder zumindest Raum für diese lässt. Eine neue Deutung, die andere, etablierte Deutungen zu verdrängen versucht, hat es schwer, anerkannt zu werden. Sehr wohl muss sie deshalb nicht »falsch« und die anderen »richtig« sein.
Ein Leser kann also nur zu einer subjektiven Deutung gelangen. Weicht diese unter Umständen von bisherigen Deutungen ab, so soll dies den Interpreten nicht abschrecken; vielmehr erweist sich seine neue Deutung als Richtigstellung, zumindest als Ergänzung und als weitergedachte Interpretation der bisherigen Forschung.
Was bedeutet das für meine Panem-Forschung? Sehr bemühe ich mich, eine Grundlage zu schaffen, auf der ich eine fundierte Deutung aufbauen kann. Das bedeutet, sich zunächst einen Überblick über bisherige Deutungsversuche zu verschaffen. Anders als bei Kafka ist die Panem-Forschung glücklicherweise noch nicht allzu weit fortgeschritten, was jedoch ganz eigene Probleme mit sich bringt.
Es bedeutet für mich nämlich, zunächst eine Basis zu schaffen, die es mir ermöglicht, über Panem qualifiziert sprechen zu können. Daher möchte ich mit literarischen, historischen und politikwissenschaftlichen »Basics« beginnen, bevor ich mich dem eigentlichen Gegenstand zuwende.
Schließlich muss ich erklären, dass ich die Literatur und die Filme nicht getrennt voneinander deuten möchte. Ich verstehe das »Phänomen Panem« als Synthese beider Medien. Das ist wichtig zu verstehen. Es geht mir um das Verstehen von etwas, was durch seinen Gesamtkontext erzeugt wird.
Jedoch ist Panem kein reales, sondern ein fiktives Phänomen. Strebe ich danach, darüber zu schreiben, ist die Quellenwahl nicht seriös bestimmt. Nur Collins Bücher aus den Jahren 2008/09/10 und 2020 können als echte Primärquellen verstanden werden, bekommen jedoch schon allein durch den Vorgang der Übersetzung in die deutsche Sprache einen sekundären Charakter. Ein Übersetzer schreibt das Werk im Grunde neu. Die Filme sind allein schon der schauspielerischen Eigeninterpretationen der Rollen subjektiviert und können daher nur sekundärer Natur sein. Jedoch möchte ich der Einfachheit der Analysestruktur versuchen, beides symbiotisch einzuordnen.
Spreche ich von Collins&Co, so verstehe ich hierunter die Urheber, welche Buch und Film erschaffen haben: Collins als Autorin sowie freundliche Helfende, Verlagsmitarbeitende in der Beratung bei Formulierungen, Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler selbst, die als professionelle und erfahrene Koryphäen ihres Handwerks in der Lage sind, das Drehbuch auf eigene Weise zu interpretieren und ihrem Charakter eigene Facetten zu verleihen. Weitere Sekundärquellen sind Fan-Foren, in denen etwa über Charaktere diskutiert wird. Jede Quelle ist konsequenterweise auf Glaubwürdigkeit hin zu prüfen, was in der Geschichtsforschung eine Selbstverständlichkeit ist, im fiktiven Rahmen aber etwas ironisch erscheint. Unter Glaubwürdigkeit verstehe ich also notwendigerweise eine hinreichende Plausibilität, wobei es meine Aufgabe ist, eben diese zu begründen.
Für den Aufbau der Analyse habe ich mich entschieden, zu Beginn eines Filmes einen pointierten Abriss über den Inhalt zu geben und mich inspiriert von der Filmvorlage an Szenen entlang zu hangeln. Übergreifende Themen, die mir besonders wichtig erscheinen, werde ich im dritten Band Panem Revisited nach den Szenenanalysen der ersten beiden Bände aufgreifen.
2. Formen des Diskurses
Zur Methode meines Schreibstiles habe ich mich für zwei wesentliche Diskursformen entschieden, die ich kurz erläutern möchte: den kreiselnd zirkulierenden Diskurs und den strukturiert konstruierten Diskurs.
Unter dem kreiselnd zirkulierenden Diskurs, dem Ammonit– oder Schneckenhausdiskurs, verstehe ich eine philosophische Herangehensweise an einen Gegenstand, welcher im Zentrum liegt, derart, sodass der Diskurs im Kreis um diesen zirkulieren kann. Dabei wird der Radius immer kleiner, sodass sich die Kreislinien immer näher an das Zentrum annähern, ohne es jedoch erreichen zu können. Die Natur dieses Diskurses ist eine philosophische.
Sie ist oft schwammig und »redet um den heißen Brei herum«. Daher ist sie nicht für jeden Diskurs geeignet, sondern besonders für die solchen, welche eigenständige Überlegungen neu einführen möchten. Durch das Kreiseln kommt man immer wieder nahe an alten, bekannten Stellen vorbei, sodass dieser Diskurs ein sich selbst korrigierender ist, da Fehler und falsche Annahmen erkannt und überarbeitet werden können.
Das Schneckenhaus
Der strukturiert konstruierte Diskurs, der Pyramidendiskurs, ist eine mehr wissenschaftliche Herangehensweise. Der Gegenstand wird hoch oben aufgehängt und muss durch die Konstruktion eines Gerüstes angenähert werden; er ist dabei aber nie ganz erreichbar. Die Vorgehensweise ist ein abwechselndes oder kombiniertes Aufbauen von Säulen, welche aus Voraussetzungen gemacht sind, und darauf liegenden Stufen, welche die sich daraus ergebenden Folgerungen sind. Der Diskurs ist klar zielorientiert.
Der Nachteil dieses Diskurses ist jedoch, dass wenn nur eine einzige Voraussetzung falsch ist, das ganze Gedankengebäude in sich zusammenzufallen droht. Dies muss nicht notwendigerweise geschehen; man kann oft auch durch handwerkliches Geschick Nachbesserungen anstellen.
Als Mathematiker ist mir diese Form des Diskurses sehr vertraut. Viele wunderschöne Beweise erweisen sich als vollkommen unnütz, weil sich kleine Ungenauigkeiten in den aller ersten Voraussetzungen einfach nicht beheben lassen wollen. Dies erfordert eine hohe Frustrationstoleranz und als Mathematiker muss man daran gewöhnt sein, oftmals zu neun Zehnteln »für den Papiermülleimer« zu schreiben.
Dieser Diskurs eignet sich daher besonders für das Zusammentragen bereits gut durchdachter und erarbeiteter Thesen.
Die Pyramide
Zwischen diesen beiden Diskursformen wechsle ich also je nachdem, ob es um das Einführen neuer Gedanken geht, oder um das Zusammentragen plausibler Thesen.
Beide Formen lassen sich auch kombinieren zu einem Wendeltreppendiskurs. Er vereint beide Vorteile auf sich, ist jedoch nicht zuletzt deswegen aber auch sehr herausfordernd, für den Autor wie für den Leser.
Die Wendeltreppe
3. »Mit offenen Karten«
Jean-Christophe Victor, das Gesicht der geopolitischen Arte-Sendereihe Mit offenen Karten, nahm sich einmal vor, eine politikwissenschaftliche Betrachtung eines fiktiven Staates anzufertigen, als Art Lehrbuch für methodische Herangehensweisen. Das ist durchaus sinnvoll, auch wenn der ein oder andere vom Fach her keinen Sinn darin sieht, sich mit einem fiktiven Staat zu befassen.
In unserer Herangehensweise sind wir an sich in doppelter Hinsicht durch unsere kulturellen und medialen Meme vorgeprägt. Meme sind wie Filter, durch die wir unsere Umwelt wahrnehmen und nach denen wir Eindrücke von außen einordnen und deuten; zum einen, wie wir Dinge selbst wahrnehmen, zum anderen, wie wir Dinge betrachten, von denen wir wissen, wie sie allgemeinhin wahrgenommen werden.
Eine fiktive Staatsanalyse ermöglicht es zumindest, die zweite Beeinflussung unseres Denkens durch Meme aus dem Diskurs herauszunehmen. Es ist also eine gute Idee, die Victor vor seinem Tod leider nicht mehr umsetzen konnte. Collins Panem als dystopischer Ort in der Literatur eignet sich jedoch hervorragend für ein solches Vorhaben.
Durch den großen Erfolg in der Populärkultur existieren zwar Vorprägungen dadurch, dass man um die allgemeine Wahrnehmung von Panem weiß, jedoch erschließt sich Literatur einem Leser eben in individueller Weise und dämpft die Voreingenommenheit durch Meme ab.
Meine Grundmotivation war die Frage, wie man das Land Panem und seine Geschichte verstehen kann: Was ist passiert, dass es ein solches Land mit dieser Verfassung und Gesellschaft gibt? Die Erkenntnis ist: Auch aus dieser Geschichte kann man etwas lernen.
Das wird so etwa interessant, wenn man sich klar macht, dass Kriege, Naturkatastrophen und Pandemien den amerikanischen Kontinent schwer gezeichnet haben und entsprechend eine Verfassung entstanden ist wie in Panem. Diese hatte schwere Konstruktionsfehler und führte zu einer unerbittlichen Diktatur.
Warum wird das interessant und wichtig für uns? Es gibt derzeit – im frühen Sommer 2020 – viele Ideen, wie unsere Bundesdeutsche Verfassung »pandemie- und krisentauglich« gemacht werden könne. Das steht in Verbindung mit Grundrechtseinschränkungen und wirft die Frage der Legitimation auf. Da Panems Verfassung aufgrund dieser Umstände entstanden ist, können wir etwas daraus lernen.
1. Einleitung
Mythen und Legenden.
Es gibt die verschiedensten unter ihnen, glaubwürdige und unglaubwürdige, wahre und unwahre, sie erzählen von Helden und von Monstern, von Wohltat und Untat, von Sieg und Niederlage.
Allen gemein ist eine tiefere Botschaft, eine metaphorische Art und Weise, eine Lebensweisheit zu überliefern.
Manche Mythen kreieren sich von selbst. Legenden sind nicht zuletzt deswegen legendär, weil sie sich selbst zu Legenden gemacht haben.
Wieder andere Mythen werden erschaffen, von Menschen erdacht. Ihnen entbehrt dennoch nicht jede historische Grundlage.
Der erschaffene Mythos mag eine fiktive Erzählung zum Gegenstand haben. Doch das, was Menschen denken, kann und darf niemals außerhalb des Zeitgeistes betrachtet werden.
Ein Mensch ist nämlich niemals ein Individuum allein, wie Sartre einmal schrieb. Man sollte ihn besser ein einzelnes Allgemeines nennen. Er ist kulturell, wie auch seine Gedanken, vom gemeinschaftlichen Geist, vom vorherrschenden kollektiven Bewusstsein vorgeprägt.
Wenn also nun ein Mensch einen Mythos propagiert, so mag dieser nicht historisch sein. Doch können wir viel über den Menschen und seine Zeit lernen, in der er lebte.
Durch den Mythos öffnet sich ein Fenster in die Vergangenheit. Der Mythos ist, als solcher richtig betrachtet und nicht als historischer Tatsachenbericht missverstanden, etwas Wahres.
Der Mythos, oder vielmehr die intensive, kritische Auseinandersetzung mit diesem, tradiert eine tiefere Wahrheit. Er tradiert ihn, seine Übermittlung wird Tradition, einer Religion gleichsam.
Aus diesem Grunde sah ich mich dazu veranlasst, mich meinen Parallelbiographien zuzuwenden. Sie erzählen nicht das historische Leben der einzelnen Allgemeinheiten in korrekter Weise; sie überliefern eine Wahrheit über die Verhältnisse und das Denken aus der Zeit, aus der sie berichten.
Einem Mythos, dem ich mich hier zuwenden möchte, ist der des Lebens des Coriolanus. Einige frühe Quellen berichten von ihm als historische Persönlichkeit, erst spätere stellen dies in Frage.
Für mich soll es aber gleich sein, ob historisch oder erschaffen – Coriolanus Mythos ist eine wahre Geschichte über Brot und Tod.
1.1 Der Autor und seine Leser
»Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden Sprache der Fiktion ihre Einheit, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt.«
– Michel Foucault6
Der Sinn und Gehalt von Literatur erschließt sich einem jedem Leser in individueller Weise, er wird zum Interpreten der gelesenen Schrift. Literatur ist somit etwas höchst Subjektiviertes. Der Autor codiert seine Botschaften und Einsichten in die Welt, welche wiederum auf seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung beruhen, in Metaphern und Parabeln. Der Leser kann – muss aber nicht – diese dechiffrieren, über sich und seine Stellung in der Welt reflektieren und sich nach einer kritischen Auseinandersetzung mit literarischen Charakteren identifizieren.
Der Leser, dessen Lebensweise im Haben wurzelt, wird alles sehr genau lesen, so wie der Autor alles ganz genau aufgeschrieben hat, aus der Angst, seine Gedanken aus dem Gedächtnis zu verlieren und dann nicht mehr zu haben. Der Leser, der das Sein lebt, ist nicht daran interessiert, ein Buch nur zu lesen, sondern es zu verstehen. Er begreift die Gedanken, Zusammenhänge und Ideen eines Textes dann sogar besser, als der Autor, der nur darauf konzentriert ist, einen Text zu haben.7
Ein Autor ist die personalisierte Form, vornehmlich seiner eigenen Gedanken. »Es gibt nach dem Text kaum eine andere Größe im Gebiet der Literatur, die uns wichtiger wäre als der Autor.«8 Er gibt dem Geisteswesen etwas Sichtbares, das Abstrakte manifestiert sich in ihm durch ihn für ihn und den Lesenden. Der Autor ist der Souverän der Gedanken. »Bekanntlich jedoch wird der Mensch (.) häufig unbewußt von völlig anderen Motiven bestimmt, als er selber glaubt. (.) Unsere Beschäftigung mit dem Unbewußten hat uns mißtrauisch gemacht gegen die scheinbar offen zutage liegende Bedeutung der Worte.«9
Das Schreiben ist aber nicht das eigentliche Werk des Autors. Es ist für sich durchaus eine lobenswerte Arbeit, jedoch nur ein Teil eines größeren Denk- und Schaffensprozesses. Dieser Prozess, der seinen Ursprung in dem Motiv zur Selbstbildung findet, ist niemals abgeschlossen, er ist dynamisch. Das Schreiben repräsentiert einen Teil dessen, einen Ausschnitt, eine Momentaufnahme der auktorialen Gedankenwelt.
Der Autor, so Foucault, »ist genaugenommen weder der Eigentümer seiner Texte, noch ist er verantwortlich dafür; er ist weder Produzent noch ihr Erfinder. (.) Der Autor ist sicherlich derjenige, dem man das Geschriebene oder Gesagte zuschreiben kann. Aber die Zuschreibung (.) ist das Ergebnis komplizierter kritischer Operationen.«10
Erreichte Standpunkte, aufgestellte Thesen und gefundene Überzeugungen können überdacht, erweitert oder verworfen werden. Ob sie nun vom einem selbst stammen oder durch äußere Einflüsse auf ihn entstanden sind, wie etwa durch Gespräche oder das eigenständige Lesen anderer Texte, ist dabei unerheblich – nach Foucault geht alles im Autor auf, er ist wie ein Werkzeug seiner Zeit, die ihren Ausdruck zu finden sucht.
Dennoch ist das Schreiben als Prozess, solange noch nicht abgeschlossen, ein ebenso dynamischer wie das ganzheitliche Denken an sich. Foucault sagte einmal sinngemäß, wenn er schon vorher wüsste, wohin ihn das Schreiben führe, würde (oder vielmehr bräuchte) er es gar nicht erst tun. Besonders Foucault war dafür bekannt, in einem späteren Werk es sich quasi zum Ziel zu setzen, gegen sich selbst in früheren Werken anzuschreiben. Er widerlegte seine Thesen konsequent selbst, wenn es einen neuen Erkenntnisgewinn für ihn gab und dies erforderlich wurde. Für ihn wurde das Ringen um Thesen und die besten Theorien zu einem lebenslangen, nie abgeschlossenen Prozess.
Das Schreiben ist ein Hilfsmittel des Subjektes, seine Gedanken zu manifestieren, zu formen und schließlich reflektieren und überprüfen zu können. Erst, wenn die Gedanken des Inneren an der Scheibe zum Außen kondensieren, gelingt es dem Schreibenden einen distanzierteren Blick von außen einnehmen zu können.
Das Medium, welchem wir uns beim Vorgang des Schreibens bedienen, ist die Sprache, genauer: die Sprache der Schrift. Sprache selbst ist ein Medium, welches uns als Hilfsmittel zum Ausdruck nicht nur der Schrift, sondern auch unserer nicht-manifesten Gedanken dient. Wir verwenden verbale und non-verbale Sprache.
Verbal sind die Worte, sie sind die innere Form der Sprache. Zur non-verbalen Sprache gehört das Paralinguistische, die Betonung und Aussprache der Worte. Es ist die äußere Form der Sprache, zu der auch Gestik und Mimik sowie Körpersprache im Allgemeinen gehören. Das Wort Person leitet sich ab vom lateinischen per sonare, »durch Klingen«. Der Klang der Stimme prägt das Erscheinungsbild und das Wahrnehmen eines Menschen ebenso maßgeblich wie sein Phänotyp.
Aber auch die Sprache der Zeichen ist ein wichtiges Medium. Zum einen gibt es – wie erwähnt – die Körpersprache, die, da sie doch zu weiten Teilen von unserem Unterbewusstsein kontrolliert, ausgestrahlt und aufgenommen wird, weit mehr wesentliche Informationen übermittelt als die Worte an sich. Neben der Sprache durch den Körper gibt es auch noch eine andere Sprache, die noch mehr auf Zeichen basiert als eben die körperliche.
Es ist die Mathematik. Da diese Sprache allein in schriftlicher Form existiert, wird die Bedeutung und der Kern des Schreibens in ihr besonders hervorgehoben. Der denkende Mathematiker betreibt Mathematik: Er manifestiert abstrakte Gedanken, um ein Problem lösen oder eine These überprüfen zu können. Er kann seine Arbeit reflektieren und überdenken, schließlich erweitern oder verwerfen. Der Mathematiker ist vornehmlich ein Autor, Mathematik ist etwas Visuelles. Wer Mathematik anderweitig und nur als Medium betreibt, sei es als Physiker, Chemiker oder Finanzverwalter, der schreibt.
Betreibt jemand Mathematik gedanklich, so muss unterschieden werden. Einfache oder auch hoch komplizierte Kopfrechenaufgaben vermitteln keine Erkenntnis, sie sind nicht Teil eines komplexeren Denkprozesses. Ist ein Kopf so klug, ganze Abhandlungen im Kopf zu fassen, und dies gilt sehr wohl auch für die Sprache als Medium der Gedanken grundsätzlich, so ist er kein Autor. Er manifestiert seine Gedanken nicht. Wohl aber ist er ein Denker. Er sieht das, was er zu sehen braucht, um seinem Denkprozess zu folgen, vor sich, vor seinem eigenen geistigen Auge.
Es lässt sich also passend zum Diskursgegenstand abschließend ein weiteres Merkmal des Autors feststellen: Er ist bestrebt, seine Gedanken nicht zwangsläufig anderen zur Verfügung zu stellen, jedoch anderen potentiell – wenn auch nicht gesichert stets freiwillig – den Zugang zu ermöglichen. Kafka wünschte sich, dass seine Schriften vernichtet würden, wenn er tot sei. Glücklicherweise für uns folgte sein Freund Max Brod diesem Wunsch nicht.
Der Autor, mit sich selbst im Reinen, will etwas Schaffen, was – etwas luftig gesprochen – die Ewigkeit zu überdauern vermag.1 Der Autor ist eine zeithistorische Persönlichkeit. »Eines der Hauptmotive des künstlerischen Schaffens ist gewiß das Bedürfnis, uns gegenüber der Welt wesentlich zu fühlen«, stellt Sartre fest.11
Seine individuelle Handschrift kann er ausdrücken auf zweierlei Weise: Die äußere Form ist die der Schrift. Sein Schriftbild ist etwas Individuelles. Im Zuge der Digitalisierung, Standardisierung und »elektronischer Briefe« geht ihm diese Möglichkeit zusehends verloren. Was ihm bleibt ist die innere Form, die Wahl der Worte. Hier kann der Autor seine ganz eigene Note einfließen lassen. Dies ist die Möglichkeit für ihn, als Persönlichkeit eng verwoben mit seinem Text, wie oben beschrieben, die Ewigkeit zu überdauern. Oder, um mit Heinrich Heine zu sprechen: »Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt auch am Ende Menschen.«
Es zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen der Sprache des Wortes und der Sprache des Zeichens. Das Zeichen als solches ist, innerhalb einer soziokulturell homogenen Gesellschaft, bereits einheitlich standardisiert. Durch Digitalisierung wird es in zweifacher Weise einer Standardisierung unterzogen. Die dem Autor individuell zur Verfügung stehende Handschrift wird hier vollends eliminiert. Alles, was den Autor nun noch mit seinem Text verbindet, ist sein Name am Anfang auf der Titelseite. Und Titeln, wie auch Namen, kommen als Worten in der Sprache der Zeichen bestenfalls eine untergeordnete Rolle zu.2 Die auf Konsum ausgerichteten Massenmedien versuchen die Namen bekannter Autoren möglichst groß auf das Cover abzudrucken – größer als den Titel des Buches –, der Text selbst ist aber auf Auslage angelegt und inhaltlich oft von nur kurzweiliger Aktualität und damit nicht von Beständigkeit.
Man erinnert sich nicht an jede Art von Denker. Lesen wir Foucault, Fromm, Chomsky, Arendt, Platon, Aristoteles, Cicero, Weber oder Luhmann, so sind sie stets stille Begleiter. Das Lesen hält hiermit eine ganz eigene Form der Gesellschaft für den Lesenden bereit. Er ist nicht einsam, er steht im Dialog mit Philosophen, Forschern und Intellektuellen oder fiktiven Charakteren eines Romans, mit denen er sich ein Stück weit auch selbst identifizieren kann.
Einem Leser der Zeichen wird dieses Vergnügen weniger zuteil. Es hätte jeder, oder im Zeitalter autonomer Computersysteme auch niemand sein können, welcher den Text verfasste. Der Text spricht nicht, er steht in keiner Verbindung zu einer Person. Gesellschaft kann der Lesende nur durch Konzentration auf das Immaterielle und Inhaltliche finden. Findet der Lesende der Zeichen aus welchen Gründen auch immer hier keine Gesellschaft, fühlt er sich einsam, ist er einsam, bleibt er einsam.
Der tiefere Sinn von Literatur erschließt sich jedem Leser in individueller, eben einer solchen subjektiven Weise. Es ist daher zu bedenken, dass bei jeder Interpretation der Interpret nur eine persönliche, eigene Deutung erschließen kann. Der Leser eben dieser Interpretation wiederum, welcher somit selbst zum Interpreten wird, betrachtet eine solche selbst aus einer eigenen, subjektiven Perspektive. Analog gilt dies für den Zuschauer eines Filmes.
Mathematiker, betreiben sie untereinander Konversation verbal wie non-verbal in Kombination, reden über Zahlen, Formeln und Körper. Dinge, die nur in der Gedankenwelt existieren. Ein Staat, weiter Staats- und Gesellschaftsphilosophie, ist ebenso ein gedankliches Konstrukt, die dahinterstehende Theorie beschreibt in gewisser Weise die Bewegung von Gegenständen, nämlich das Verhalten einzelner Individuen innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung, die schließlich auch juristisch fixiert werden kann. Sie alle gründen im Glauben der Menschen an diese Systeme selbst. Ohne diesen Glauben würden sie verschwinden und könnten nur als Mythos unsterblich werden.
(est. Sommer 2017, überarbeitet und um Zitate erweitert)
1.2 Über das Böse, Monster und Despoten
»Die Feinde der Menschheit haben rapid an Macht gewonnen, sie sind dem Endziel der Zerstörung der Erde sehr nahe gekommen, es ist unmöglich, von ihnen abzusehen und sich auf die Betrachtung geistiger Vorbilder allein zurückzuziehen, die uns noch etwas zu bedeuten haben.«
– Elias Canetti, Das Gewissen der Worte
»In Zeiten des Umbruchs, wenn das Alte schon fault und das Neue noch hinter dem Horizont liegt, schlägt die Stunde der Monster.«12 Monster sind wie Spiegelbilder, die dem ambivalenten und wandelbaren Wesen des Menschen historisch und kulturell variierende Entwürfe des Seins aufzeigen von dem Lebensbejahenden, das wir das Gute nennen, bis zum Lebensverneinenden, was wir als das Böse verstehen. Losgelöst von einer entschieden dualistisch geprägten Vorstellung ist das Böse kein Prinzip an sich, vielmehr sinkt es geradezu zu einer Unterfunktion des Guten herab, von diesem lizensiert, um sich selbst zu erneuern. Manchmal ist die Destruktivität die konstruktivste Form der Kreativität, denn erst durch das restlose Zerschlagen der alten Ordnung ergibt sich die Chance auf den Neuaufbau einer besseren Ordnung.
Die alte Ordnung jedoch konsequent hinter sich zu lassen, bedeutet keineswegs, die Dinge an sich zu vernichten. Vielmehr geht es darum, wie eben diese Dinge zu einander stehen oder gestanden haben. Ist eine Wasserleitung kaputt, so muss das entsprechende Stück des Rohres ausgetauscht werden. Dazu muss möglicherweise eine Wand eingerissen werden, um das Wasserrohr freizulegen. Jedoch gleich eine ganze Stadt in Schutt und Asche zu legen und so dem Erdboden gleichzumachen, ist ein Akt, welcher in seiner Destruktivität derart nicht erforderlich ist. Es gilt also, den Kräften der Destruktivität klug und kanalisiert Wirkung zu verschaffen.
Mit Revolutionen verhält es sich so, dass die primären Haupteffekte unseres Handelns nicht selten nur billigend in Kauf genommen werden; vielmehr interessieren uns die vermeintlichen Nebeneffekte, besonders gewisse von diesen, an denen wir weiter anzuknüpfen vermögen. Die Motive unseres Handelns sind nicht selten vielfältiger, ja ambivalenter Natur. Es gibt solche, die wir bewusst beabsichtigen; solche, die wir unbewusst verfolgen; und dann gibt es noch solche Motive, die selbst unserem Unterbewussten unbewusst sind, denn sie gehen weit zurück auf die Geschichte unserer Ahnen, welche als unsichtbare Masse weiterhin ein Teil unserer eigenen Massenseele sind.
Die Geschichte lässt sich nicht planen; sie ergibt sich aus einem Zusammenspiel des Zufälligen und des Unvorhersehbaren, doch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Kräfte gibt, die den Zufall nicht dem »reinen Zufall« zu überlassen gewillt sind. Die Geschichte vom Leben ist eine vom Entstehen und Vergehen. Und in Zeiten, wo das Alte zu modern beginnt, das Neue aber noch hinter den Bergen liegt, schlägt die Stunde der Monster. Warum erfreut sich das Motiv des Monsters in Medien so großer Aufmerksamkeit? Was ist das Abstoßende an Monstern und Tyrannen, was zugleich faszinierend wirkt?
Schmitz-Emans zufolge habe sich dies bis heute erhalten: Monster der Imagination, die das Seltsame verkörpern, und körperlich identifizierbare Monster, Individuen, die die Grenzen zwischen Mensch und Tier oder Mensch und Maschine verschwimmen lassen. Das Monster als eine Gestalt, welche ihre ursprüngliche Herkunft negiert. Monster stehen also für Abweichungen, Abweichungen von der Norm oder stellen eine gesellschaftliche Norm in Frage. Idealbilder existieren allein in Vorstellungen, und monströse Gestalten erinnern an ihre Realitätsferne.
Imaginierte und empirische Monster gehen aber auch allerlei Verbindungen ein. Als Beleg für diese These führt Schmitz-Emans antike Reiseberichte oder Erzählungen über exotische Völker wie auch sagenumwobene Wesen an. Hierbei handle es sich um Zwischenwesen, um »Hybride«. Schmitz-Emans erkennt also richtig, dass die Variationen des Monster-Seins sich unterscheiden können, jedoch sein eigentlich prägnantestes Merkmal das Aufheben von Grenzen zwischen diesen ist. Dies ist es, was das Monster als solches kennzeichnet.
Dabei können Monster wunderlich sein und einen Unterhaltungswert darstellen, so etwa der mittelalterliche Hofnarr, aber auch mahnen, etwa vor der Bedrohung für das soziale Leben durch Verbrecher. Psyche und Physis gehen im Hinblick auf die Merkmale des Monsters auch hier Verbindungen ein. Für Michel Foucault wurde das Monster der Körperlichkeit in der Moderne vom monstre morale, dem moralischen Monster abgelöst. Darunter versteht Foucault etwa den Kannibalen oder den Inzestuösen. Zwar verschwinden physische Monster nicht, doch moralischen Monstern wird bei weitem mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Monster sind Spiegelbilder »des Menschen durch den Menschen für den Menschen«. Das Motiv des Monsters unterhält, warnt oder beides zugleich. Der Mensch sucht sich selbst und bedient sich hierbei einer Abgrenzung durch das Monster-Motiv. Diese Abgrenzung scheitert Schmitz-Emans zufolge jedoch, vielmehr erkenne der Mensch im Motiv des Monsters seine eigene Vielgestalt und Wandelbarkeit. Der Mensch ist somit selbst eine zumindest in ihren Grundzügen monsterhafte Gestalt. Schmitz-Emans hat versucht eine Definition für das Motiv des Monsters zu finden, seine zugrundeliegendes Aussageabsicht und seine Wirkungsgeschichte zu umreißen. Doch weshalb können sich Monster in Literatur und Medien solch immenser Popularität erfreuen?
Dass dies so ist, zeigen nicht zuletzt Filme und Serien wie Der Herr der Ringe, Game of Thrones oder Harry Potter. Monströsen Gestalten kommt hier die Funktion von Bedrohung und Gefahr zu, sie sollen den Zuschauer ekeln und faszinieren zugleich. Es handelt sich hierbei um imaginative Monster. ALF hat zum Gegenstand, wie es sein könnte, wenn ein sympathischer, tollpatschiger Außerirdischer bei einer amerikanischen Durchschnittsfamilie eine Weile zur Niederlassung käme. Alf ist hierbei eben humoristisch akzentuiert, seine Gestalt soll unterhalten, den Zuschauer zum Lachen bringen. Auch Puppen, wie die des Bauchredners Sascha Grammel, sollen dies: Sie sind niedlich und symphytisch.
Im Film E.T. hingegen verbindet sich Sympathie aber auch ein gewisses Ekelempfinden. Dieser Ekel besteht hierbei in dem Fremdartigen, dem Ungewohnten. E.T. sieht Alf in keiner Weise ähnlich; es handelt sich bei beiden um imaginative Gestalten.
Wir nehmen heute an, und das mit verhältnismäßig hoher Wahrscheinlichkeit, dass es in unserem Universum auch auf anderen Planeten, nicht nur auf der Erde Leben, also extraterrestrisches Leben gibt, jedoch müssen wir uns trotz unseres in vielerlei Hinsicht enormen Wissens über die Evolution ein-gestehen, dass wir nicht wissen, wie diese Lebensformen aussehen könnten. Vielmehr stellt sich die Frage, ob wir außerirdisches Leben überhaupt als solches erkennen können. Man kann sich so etwa vorstellen, das eine klebrige Schleimschicht auf einem Felsen zäh herabfließt. Diese Lebensformen, welche sich von verklebten Fliegen ernährt und durch einen Luftaustausch atmungsaktiv ist, würden wir als etwas Ekelhaftes verstehen, nicht jedoch als Lebensform.
Monster wie Fabelwesen, also Elfen, Trolle, Einhörner oder Drachen, sind Hybride, wenngleich auch nicht solche wie Spiderman, Superman, X-Man oder Wolverine. Es sind keine Hybride, welche Mensch mit Natur oder Maschine verbinden, sondern solche, die zwar imaginiert sind, zugleich aber auch einer fundierten Erfahrungsgrundlage entspringen: ein Einhorn etwa soll wohl Ähnlichkeiten mit einem Pferd haben, nur muss es noch »irgendwie« ein Horn mit sich tragen. Pegasus kann darüber hinaus auch noch fliegen. Hier wird die Fantasie angeregt. Man stelle sich vor, ein Mitteleuropäer käme von einer Reise durch Afrika zurück, wo er zum allerersten Mal ein Nashorn sah. Jemand, der diese Reise nicht machen konnte, hat das Nashorn niemals in natura sehen können; seine Vorstellungen basieren also ausschließlich auf einem Reisebericht. Das Ergebnis war Albrecht Dürers Gemälde Rhinocerus.
Albrecht Dürer: Rhinocerus, 151514
Und auch in der Paläontologie kehrt dieses Motiv wieder: Wie sahen sie aus? Wie waren sie, diese Global Player des Erdmittelalters, die wir »Dinosaurier« nennen? Ein Iguanodon oder ein Triceratops sind merkwürdig anmutende Gestalten. Riesenfaultiere oder Terrorvögel ebenfalls. Was uns an diesem prähistorischen Leben neben dem fasziniert, ist die uns nicht mit heute Beobachtbarem vergleichbare Größe dieser Kreaturen. King Kong, der mit drei Tyrannosaurus-Rex kämpft, hat etwas Erschreckendes, Gewaltiges, der Kampf etwas Episches.
Denkt man an Jurassic Park oder Jurassic World, so kommt dem Monster-Motiv nicht nur ein Unterhaltungswert zu, sondern auch eine mahnende Funktion. Der Hybrid, ein Geschöpf von Super-T-Rex, ist das Mahnzeichen schlechthin. Wer oder was das Monster ist liegt auch im Auge des Betrachters, so ist für eine Maus bereits eine Katze ein Monster.
Die Menschen, konstatiert der Schöpfer dieses Design-Monstrums, sind es eben nur gewohnt, die Katze zu sein. Im ersten Teil der Filmreihe heißt es sinngemäß: »Gott erschuf die Dinosaurier. Um Adam und Eva zu schaffen, tötete er die Dinosaurier. Der Mensch tötete Gott, und erweckte die Dinosaurier wieder zum Leben...«
Es wird gewarnt vor dem Menschen. Der Mensch, welcher »Gott« spielt und seiner Dinge nicht mehr Herr wird, ist das Motiv. Egal, ob es um Genetik, Atomphysik oder die Globalisierung geht: der Mensch, das Monster der Moderne, das sich selbst und die Welt zerstört, das ist das zentrale Motiv. Schon Friedrich Nietzsches Zarathustra lehrte diesen Übermenschen, seinen Willen zur Macht. Goethes Faust zeigt den Menschen, der nach der Allerkenntnis strebt, aber auch sich der Kontrolle über die Natur bemächtigen will. Hermann Melvilles Moby Dick ist ein Motiv für die Unbeherrschbarkeit der Natur, und Kapitän Ahab für den Gescheiterten; er ist gescheitert an seinem eigenen Streben und Machtverlangen.
Franz Kafkas eigentümliche und unverwechselbare Weise des Schreibens, wie das Surreale in den Alltag einbricht, ist auch in gewisser Weise monsterhaft. In Die Verwandlung verpesten, so der Kafka-Biograph Reiner Stach, vorkapitalistische Arbeitsverhältnisse die Atmosphäre. Gregor Samsa findet sich zu einem Käfer verwandelt in seinem Bett wieder. Er ist ein Hybrid, er verbindet den Menschen mit der Natur, dem Animalischen. Zugleich ist Gregors Käfergestalt aber auch vielmehr eine Warnung vor einer ausbeuterischen, ja unmenschlichen Arbeitswelt. Seine Wandlung kann gelesen werden als Flucht in die Krankheit als letzter Ausweg.
Und hier ist es wieder, das »Unmoralische«. Wir leben in der Moderne, in einer Zeit, in der technisch alles möglich scheint, in der der Mensch von Informationen erdrückt wird, in der alles global und immer schneller und schneller geschehen muss – die soziale, moralische Entwicklung, die Individualität, ja Integrität des prinzipiell freien Individuums bleibt auf der Strecke.
Monster-Motive sollen unterhalten, faszinieren, unsere Fantasie anregen, aber eben auch warnen. Foucault hat zurecht erkannt, dass besonders das monstre morale, das in eben dieser Moderne entsteht, eine warnende Funktion einnimmt.
Das monstre morale ist das Monster-Motiv der Moderne schlechthin – gewiss liegt auch hier ein Mitgrund für den Erfolg etwa Patrick Süskinds Roman Das Parfum. Ein Mensch, ein Individuum, eigentümlich auf seine Weise, ja autistoid, doch genial zugleich, erfährt zeitlebens die Gesellschaft als kalt, als unmenschlich. Sein Streben gründet sich auf Rache, Vergeltung, Hass und Ideologie. Er will herrschen. Grenouille ist der Messias, das kranke psychotischschizoide Monstrum, und doch ein gescheitertes Genie. Die Vernunft versagt angesichts dunkler Kräfte; diese machen aus einem Menschen ein Monstrum.
Schon in der Romantik faszinierte dies. E.T.A. Hoffmanns Werk, nach Schopenhauer eine Sammlung an Schauergeschichten, ist ein Sammelsurium an Begegnungen mit solchen dunklen Mächten und dunklen Geistern.
Die Faszination besteht in dem Schock, dem Schrecken, doch zugleich hat man das Bedürfnis nach Verständnis. Und so warnen soziale Dystopien vor einem nur allzu mächtigen, ja omnipräsenten monstre morale. Der Mensch sieht sich gewarnt, in dem er mit dem Spiegelbild all seiner ihm innewohnenden, unmoralischen Persönlichkeitselemente konfrontiert wird, und ist davon fasziniert zugleich.
Der Mensch, ein Wesen, das nach Macht und Kontrolle strebt, so Zarathustra bei Nietzsche – mit Blick auf die politische Dimension der Tage, auf Trump, Bolsonaro, Erdogan, Xi oder Putin, so erscheint vor allem das monströse Motiv eines Individuums, welches seine »einfache« Herkunft negiert und nach der Alleinherrschaft, der Allmacht strebt, real geworden zu sein.
Schon Shakespeares Coriolanus fasziniert als unmoralisches Monster. Zu antiken Zeiten, so will es der Mythos, ein römischer Feldherr, der sich gegen sein Volk stemmte, seither immer wieder als Verräter interpretativ aufgegriffen wird, diente nicht nur einem gleichnamigen Film als Grundlage, sondern er herrscht auch in Suzanne Collins Dystopie eines zukünftigen Nordamerikas repressiv und unnachgiebig als Präsident von Panem.
Für ihn sind die Hungerspiele das kulturelle Herz Panems, und diese sind die Verkörperung des Unmoralischen, vereinen sie doch Gladiatorenkämpfe mit Big-Brother-TV und dienen lediglich der Unterdrückung des Volkes durch eine Oligarchie der Privilegierten. Das Kapitol, ein wahres Monster, verkörpert einen willkürlichen Staat. Mit Blick auf Nordkorea, Syrien oder andere diktatorische Regime der Geschichte, so darf zurecht gefragt werden, weshalb Menschen immer wieder derart machtbegierig sind oder werden (können).
Es ist die vielschichtige, teilweise sich in sich selbst mit sich selbst ausschließende Funktion des Monster-Motivs, welches geistigen Tiefgang, aber auch simple Faszination miteinander verbindet und so eines der ausdrucksstärksten und eindringlichsten Motive ist, die medial hervorgebracht werden können. Daher ist das Monster-Motiv so populär.
Auch ich bin fasziniert und verspürte einen inneren Drang, mich besonders mit Collins Dystopie näher zu beschäftigen. Seit dem Erscheinen des ersten Buches im Jahre 2008 zog Panem auch viele andere Millionen Leser und Kinozuschauer in seinen Bann. Wann immer ich eine Seite lese oder einen der Filme schaue, so habe ich das Gefühl, immer wieder neue Facetten zu entdecken, die mir bisher entgangen sind. Facetten, die für etwas stehen, die etwas aussagen, die »den Spielen Bedeutung verleihen«.
April 2017, überarbeitet
1.3 Der Mythos
»Die Mythologie des Infantilen wurde in unserem Jahrhundert durch eine neue und frappante Schöpfung bereichert: die Gestalt des Peter Pan. In Barries Buch wird der Infantilismus sich seiner selbst bewusst und dabei grauenvoll schelmisch und kokett. Das Beunruhigende daran ist, dass Peter Pan ganz unzweifelhaft einem populären Bedürfnis entsprach. Die Leute wollen sich im Kindischen suhlen. (.) Zumal in Amerika hat die Idolatrie des Kindischen ein solches Ausmaß erreicht, dass die erwachsene Existenz weitgehend der kindlichen untergeordnet wird. Im Familienkreis sind es die Kinder, die den Ton angeben: Die Älteren müssen brav folgen. Von jeder Generation wird erwartet, dass sie ihr Erwachsensein auf dem Altar der nächsten Generation opfert. Wie töricht das alles ist, verrät uns die einfachste Mathematik: Wir sind zwanzig Jahre lang Kinder, vierzig oder fünfzig Jahre erwachsen. Der Kult des Kindischen hindert die Menschen daran, während der letzten zwei Drittel ihrer natürlichen Existenz sinnvoll zu leben. Die Kindheit hat ohne Frage ihre Rechte: doch die Reife nicht minder. Diese Erwachsenenrechte verlangen zumindest ebenso viel Achtung wie die des Kindes.«
– Aldous Huxley15
1.3.1 Kulturelle Funktionen
Eine Sage ist eine »volkstümliche Geschichte, die oft aus dem Volk selbst entsteht und (zunächst) mündlich überliefert wird. Im Unterschied zum frei erfundenen Märchen geht die Sage von bestimmten Orten und Personen oder von wahren Begebenheiten aus, die ausgeschmückt werden.
Eine Legende ist eine lehrhafte, volkstümliche Erzählung aus dem Leben eines Heiligen, bei der meist ein wahrer Kern fantasievoll ausgeschmückt wird. Sie ist von gebildeten Leuten geschrieben und zum Lesen oder Vorlesen bestimmt.«16 Was jedoch ist ein Mythos? Was macht ihn so besonders und mächtig? »Mythen erfreuen sich einer immer noch ungebrochenen Konjunktur. Das postmoderne Klima erweist sich als mythophil.17 Erzählt werden bestimmte wiederholbare Ereignisse, die außerhalb von Raum und Zeit liegen und ansetzen an bestimmte Knotenpunkte der menschlichen Existenz.«18
Mythen haben besonders psychoanalytisch eine sehr machtvolle Wirkung, denn »der Mythos (.) ist keine bloß erzählte Geschichte, sondern eine gelebte Realität. Er ist (.) lebendige Wirklichkeit, von der geglaubt wird, sie sei in Uhrzeiten geschehen, und sie beeinflusse die Welt und die Schicksale der Menschen seitdem fortwährend.«19 Man darf den Mythos jedoch keinesfalls als Tatsachenbericht oder als historische Evidenz missverstehen. »Der Mythos [ist] keine Erklärung zur Befriedigung einer wissenschaftlichen Neugier, sondern das Wiedererstehen einer urzeitlichen Wirklichkeit in erzählender Form. Mythen erklären nie, in keinem Sinne, sie statuieren immer einen Präzedenzfall als Ideal und Gewehr für die Fortsetzung.«20
Der Historiker, welcher ein Wissenschaftler ist, muss Aufwand betreiben, um die verschlossenen Fenster der Zeit zu öffnen. »Mythologie begründet dadurch, dass sich der Mythensager mit seiner erlebenden Erzählung in Uhrzeiten zurückfindet. Ja er befindet sich plötzlich, ohne Umschweife und Herumsuchen, ohne Nachforschen und Sichanstrengen in jener Uhrzeit, die ihn angeht (.), von [der] er berichtet.«21
Der Mythos ist also etwas sehr Eindringliches und er macht es bequem, zu einem früheren, anderen Zeithorizont Zugang zu finden. Canetti zu Folge kann die Bedeutung der unsichtbaren Massen, darunter die der Toten, der Ahnen, aber auch die Masse der Zukünftigen, nur schwer überschätzt werden.22 Um zu dieser vergangenen, unsichtbaren Masse Zugang zu finden, sind Mythen wie geschaffen. Der Mythos, so Jung und Kerényi, ist für das Teilwerden und das Erfahren der Vergangenheit und der vergangenen Massen also ein sehr wirksames Instrument:
»Die Seele der Völker ist das gemeinsam in jedem Einzelnen. Der Einzelne [kann] nun mit dem Bewusstsein einer Erweiterung beschenkt werden, die die Grenze des Persönlichen durchbrechen [darf], in der Richtung der gemeinsamen Vergangenheit des Menschengeschlechts. Warum sollte die Möglichkeit einer seelischen Erbschaft ausgeschlossen werden, während doch die einer körperlichen Erbschaft [feststeht]?«23
Durch das Fesselnde ist der Mythos nicht nur ein einfaches Instrument. Er ist auch ein Instrument, welches sich besonders effizient im Rahmen von Propaganda einsetzen lässt, besonders in totalitären Staaten. »Mythen überzeugen die Bevölkerung, beispielsweise gesellschaftliche Hierarchien anzuerkennen, indem sie diese Hierarchien als schon immer etabliert und in diesem Sinne als angemessen darstellen.«24
Die Legitimierung eines Regimes durch die Überzeugung der Masse durch Mythen ist eine Säule, welche von historischer Bedeutung ist. Der Mythos ermöglicht die Machtergreifung und Machtlegitimation. Der Mythos dient schließlich aber auch dem Machterhalt durch seine Wirkung, Machttechniken durchsetzbar und allgegenwärtige Kontrolle ausübbar zu machen. Der Mythos manifes