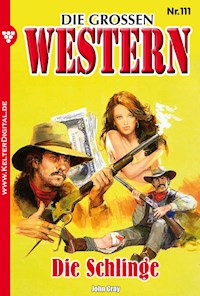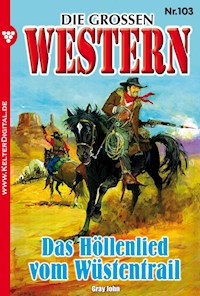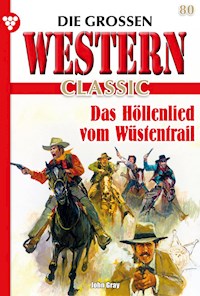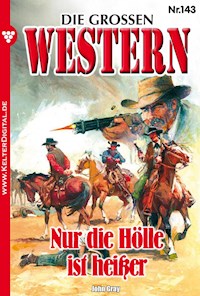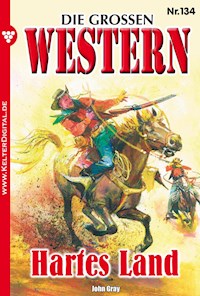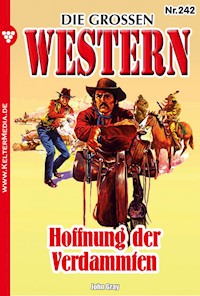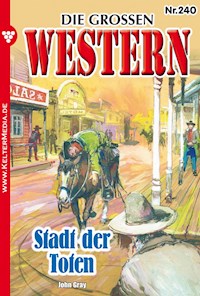Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Er ritt über die spärlich mit Gras bewachsenen Hügel und sah die sandigen Ufer des Aravaipa-Flusses vor sich. Er war ein großer, breitschultriger Mann in groben Baumwollhosen und einem weichgegerbten Lederhemd mit Fransen an den Nähten. Seine Füße steckten in Mokassins, um den Hals hatte er sich ein verwaschenes rotes Tuch gebunden.Unter dem breitrandigen, zerbeulten Sombrero, den er auf dem Kopf trug, quoll langes schwarzes Haar hervor. Das und seine Augen, die von lichtem Blau waren, kontrastierten scharf mit seinem dunklen, bronzehäutigen Indianergesicht.Er saß geschmeidig im Sattel eines riesigen Appaloosa-Hengstes, locker und kraftvoll zugleich. Wer ihn ansah, spürte die Wildheit, die von ihm ausging.Die Sonne hatte den Zenit erreicht, ein paar Wolken kreuzten den brennenden Horizont. Von Südwesten strich ein schwüler Windhauch über den Fluß.Er sah auf dem anderen Ufer die langgestreckte, von Hügeln gesäumte Ebene, an deren Westende Wagen und Pferde zu sehen waren. Menschen bewegten sich hin und her.Der Reiter trieb den Appaloosa an und ritt auf eine Furt des Aravaipa zu. Der Fluß war flach, das Wasser reichte nicht einmal bis zu den Steigbügeln. Der Hengst durchquerte ohne größere Anstrengung den Fluß und trabte am anderen Ufer die Böschung hoch.Plötzlich stand wie aus dem Boden gewachsen ein Soldat vor ihm. Er hielt ein langläufiges Springfield-Gewehr in den Fäusten, blickte zu dem Reiter hoch und registrierte seine dunkle Haut und den indianischen Schnitt seines Gesichts.»Sie dürfen hier nicht durch.Der Reiter beugte sich vor. »Warum?»Das Gelände ist heute gesperrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 251 –
Die Nacht des großen Mondes
John Gray
Er ritt über die spärlich mit Gras bewachsenen Hügel und sah die sandigen Ufer des Aravaipa-Flusses vor sich. Er war ein großer, breitschultriger Mann in groben Baumwollhosen und einem weichgegerbten Lederhemd mit Fransen an den Nähten. Seine Füße steckten in Mokassins, um den Hals hatte er sich ein verwaschenes rotes Tuch gebunden.
Unter dem breitrandigen, zerbeulten Sombrero, den er auf dem Kopf trug, quoll langes schwarzes Haar hervor. Das und seine Augen, die von lichtem Blau waren, kontrastierten scharf mit seinem dunklen, bronzehäutigen Indianergesicht.
Er saß geschmeidig im Sattel eines riesigen Appaloosa-Hengstes, locker und kraftvoll zugleich. Wer ihn ansah, spürte die Wildheit, die von ihm ausging.
Die Sonne hatte den Zenit erreicht, ein paar Wolken kreuzten den brennenden Horizont. Von Südwesten strich ein schwüler Windhauch über den Fluß.
Er sah auf dem anderen Ufer die langgestreckte, von Hügeln gesäumte Ebene, an deren Westende Wagen und Pferde zu sehen waren. Menschen bewegten sich hin und her.
Der Reiter trieb den Appaloosa an und ritt auf eine Furt des Aravaipa zu. Der Fluß war flach, das Wasser reichte nicht einmal bis zu den Steigbügeln. Der Hengst durchquerte ohne größere Anstrengung den Fluß und trabte am anderen Ufer die Böschung hoch.
Plötzlich stand wie aus dem Boden gewachsen ein Soldat vor ihm. Er hielt ein langläufiges Springfield-Gewehr in den Fäusten, blickte zu dem Reiter hoch und registrierte seine dunkle Haut und den indianischen Schnitt seines Gesichts.
»Sie dürfen hier nicht durch.«
Der Reiter beugte sich vor. »Warum?«
»Das Gelände ist heute gesperrt.«
Der Reiter blickte über den Soldaten in der staubigen, durchgeschwitzten Uniformbluse der US-Infanterie hinweg. Er sah hier und da Zeltstangen und zerfetzte Decken im Gras liegen, auch Reste von Wickiup-Gerüsten. Alles trug Spuren der Witterung. Weite Teile des Graslandes waren verbrannt, die dunklen Flecke waren unübersehbar. Unweit des Flußufers bemerkte der Reiter neben einem Sagebusch Skelettknochen, die von der Sonne gebleicht waren.
»Ist der General da?« fragte der Reiter.
Der Soldat runzelte die Stirn.
»General Howard?«
»Ja«, sagte der Soldat. »Aber…«
»Ich bin Jim Levine«, sagte der Reiter. »Der General erwartet mich.«
»Ach, Sie sind der…« Der Soldat stockte und lief rot an.
»Was bin ich, Trooper?«
»Der – der Mann, von dem der General gesprochen hat.« Der Soldat trat hastig zur Seite. »Reiten Sie dorthin, wo die Wagen stehen.«
Levine ritt an dem Posten vorbei. Er war es gewöhnt, daß seine Erscheinung Überraschung auslöste und seine Hautfarbe meistens Unwillen erregte. Er hatte sich so sehr daran gewöhnt, daß er es kaum noch beachtete.
Der Wind frischte etwas auf, als er über das von Brandflecken und Zerstörung gezeichnete Land ritt. Noch vor einem Jahr hatten hier Menschen gelebt. Mescalero-Apachen, die gewillt gewesen waren, in Frieden zu leben, die sich freiwillig hier angesiedelt und versucht hatten, sich mit den weißen Siedlern der Gegend und der Armee zu arrangieren. Bis zu jenem Tag im Frühjahr, als das alles vorbei gewesen war.
Levine bemerkte Grabhügel dicht am Fluß. Überall sah er jetzt bleichende Knochen im Gras, zerbrochene Werkzeuge, verrostete Messer, zerborstene Töpfe und Kochgeräte, Kleidungsfetzen und zerrissenes Sattelzeug.
Die Umrisse des einstigen Mescalero-Lagers waren noch gut zu erkennen. Auf den Hügeln ringsum waren Armeeposten aufgestellt. Levine ritt an den alten Feuerstellen vorüber. Die Feldsteine, aus denen sie errichtet worden waren, waren noch rußgeschwärzt.
Unweit der Wagen zügelte Levine den Hengst und glitt aus dem Sattel. Er rückte die Halfter rechts mit dem langläufigen Peacemaker-Colt ein wenig vor und bewegte sich auf die Gefährte zu. Sie trugen den Armeestempel an den Seitenbracken. In einiger Entfernung lagerten Soldaten.
Ein paar Apachen standen in der Nähe herum, kleinwüchsige, breitschultrige aber ausgemergelt wirkende Männer, trotz der Hitze in grobe Kaliko-Decken gehüllt. Sie wirkten apathisch und starrten über den Fluß, als sähen sie etwas, was gar nicht mehr da war.
Zwischen den drei großen Wagen stand ein hochgewachsener, weißbärtiger Mann mit zerfurchtem Gesicht. Sein rechter Ärmel war an der Uniform festgesteckt, er war leer. Die breite Krempe des Armeehutes beschattete seine hohe Stirn.
Neben ihm stand ein schlanker Offizier in Lieutenantsuniform und redete, während er gleichzeitig mit beiden Armen gestikulierte.
Levine blieb hinter ihnen stehen. Er schob sich den Sombrero ein Stück in den Nacken.
»General Howard?«
Der Einarmige wandte sich um. Er blickte Levine prüfend an. Dann streckte er die linke Hand aus. »Sie müssen Jim Levine sein.«
Levine ergriff die Hand und war überrascht, wie fest sein Händedruck erwidert wurde.
»Ich bin froh, daß Sie da sind«, sagte Howard.
»Ihr Telegramm hat mich in Prescott erreicht«, erwiderte Levine. »Ich wollte einen Tag später nach Norden aufbrechen.«
»Ich habe in drei verschiedene Städte telegraphiert«, sagte Howard. »Ich hätte wahrscheinlich überall hin telegraphiert, um Sie zu erreichen.« Er zeigte auf den Lieutenant neben sich.
»Das ist Lieutenant Royal Whitman.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Levine«, sagte Whitman.
Levine blickte Whitman in die Augen. Er hatte schon viel von ihm gehört. Whitman hatte sich sehr für die Apachen eingesetzt und damit seine Karriere ruiniert. Er war seit Jahren nicht mehr befördert worden und hatte schon einige Male vor Militärgerichten gestanden.
»Sie wissen, was hier an dieser Stelle geschehen ist«, sagte Howard.
»Ungefähr«, erwiderte Levine. »Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre: Voriges Jahr im Frühling gab es in der Nähe von Tucson einige Apachenüberfälle. Die Bürger von Tucson behaupteten, es handle sich bei den Kriegern um die Leute Eskiminzins, die hier angesiedelt waren. Etwa um die gleiche Zeit wie jetzt, also Ende April, ritt die Miliz von Tucson hierher und griff das Camp an.«
»Es waren präzise sechs Amerikaner«, sagte Lieutenant Whitman, »zweiundvierzig Mexikaner und über neunzig von den christianisierten Papagos aus der Nähe von San Xavier. Sie wurden dafür bezahlt.«
»Von den Hügeln über dem Fluß eröffneten sie das Feuer«, sagte Levine. »Das Lager schlief noch. Es dauerte nicht sehr lange, dann waren alle Mescaleros, die nicht davonlaufen konnten, tot. Meistens Squaws und Kinder, über einhundertvierzig Menschen.«
»So ist es«, sagte Whitman. »Sie haben gewütet wie die Wilden.«
»Sie brauchen keine Einzelheiten zu erzählen, Lieutenant«, unterbrach ihn Levine. »Ich kenne mich aus.«
»Eskiminzin ist mit dem Rest seiner Krieger in die Berge geflüchtet und hat sich seitdem nicht mehr sehen lassen«, sagte Whitman. »Viele meinen, daß er auf den Kriegspfad gehen wird, aber ich glaube, er ist ein besonnener Mann, mit dem trotz allem noch zu reden ist. Er weiß auch, daß die Armee nicht schuld an dem Unglück ist.«
»Die Mörder wurden freigesprochen, nicht wahr?«
»Es gab einen Prozeß gegen die Führer der Miliz von Tucson, der mit Freisprüchen endete«, sagte Whitman. In seiner Stimme schwang ein bitterer Ton mit.
»Präsident Grant ist anderer Meinung«, sagte Howard. »Er hat die Unterlagen der Ereignisse gesehen und mir gegenüber erklärt, daß für ihn diese Aktion blanker Mord war. Aber nicht einmal der Präsident kann Gerichte beeinflussen.«
Howard blickte an Levine vorbei über das Schlachtfeld. Seine Augen waren schmal und grau wie die eines alten Falken. Seine scharfgeschnittenen Züge wirkten noch düsterer als vorher.
Die Apachen, die Levine gesehen hatte, setzten sich nun in Bewegung und gingen langsam zum Fluß hinunter. Sie wanderten am Ufer des Aravaipa entlang und verschwanden aus dem Blickfeld der Männer.
»Hat die Sache voriges Jahr etwas damit zu tun, daß Sie mich gesucht haben?« fragte Levine.
»Ja«, sagte Howard. »Ich habe viel von Ihnen gehört. Sie haben für Crook gearbeitet.«
»Ein paarmal«, sagte Levine. »Ich würde am liebsten nichts mehr mit ihm und der Armee zu tun haben. Ich habe lange gezögert, nachdem ich Ihr Telegramm erhalten habe, ob ich überhaupt hierherreiten sollte.«
»Ich hörte schon, daß es Differenzen zwischen Ihnen und Crook gegeben hat«, sagte Howard.
»Keine Differenzen«, sagte Levine. »Wir haben zu verschiedene Ziele. Ich habe für Crook gearbeitet und mir eingebildet, dabei etwas für die Indianer tun zu können. Aber manchmal hatte ich danach den Eindruck, daß Crook nur jedesmal von mir noch etwas dazugelernt hatte, um die Indianer noch ein bißchen besser zu begreifen und ihnen noch mehr schaden zu können.«
»Sie werden vielleicht mit Crook in Berührung geraten«, sagte Howard. »Er ist der Departmentskommandant. Ich bin nur im Sonderauftrag des Präsidenten aus Washington hier. Aber Crook ist gegen mich, unter Umständen wird er auch gegen Sie sein, nämlich dann, wenn Sie mir helfen.«
»Um was geht es?«
»Ein paar Mescaleros sind übriggeblieben«, sagte Howard. »Sie wurden gleich nach dem Kampf gefangen.«
Levine runzelte die Stirn. »Ich habe von Kindern gehört.«
»Kinder, richtig«, schaltete Whitman sich ein. »Es haben siebenundzwanzig Kinder überlebt. In der weiteren Umgebung sind dann noch einmal sieben Kinder eingefangen worden. Insgesamt vierunddreißig Kinder. Sie sind seit einem Jahr Kriegsgefangene der Miliz von Tucson.«
»Kinder? Machen Sie keine Witze, Lieutenant.«
»Leider ist das kein Witz«, sagte Howard. »Die Miliz sieht die Mescalero-Kinder als ihre Beute an. Solange der Prozeß gegen die Führer der Miliz lief, saßen die Kinder nur in Gefangenschaft. Jetzt wollen die Leute aus Tucson sie als Sklaven nach Mexiko verkaufen. Mit dem Erlös wollen sie sich für die angeblich erlittenen Schäden durch Apachenüberfälle entschädigen.«
»Crook ist dafür«, sagte Whitman. »Er hatte mich meines Postens enthoben, weil ich dagegen war.«
»Eskiminzin hat sich inzwischen bemerkbar gemacht«, sagte Howard. »Er verlangt die Herausgabe der Kinder, weil sie zu seinem Stamm gehören. Ich halte die Forderung für richtig, aber ich will erst mit den Beteiligten sprechen.«
»Sie können uns helfen«, sagte Whitman.
»Kann ich das?«
»Vielleicht«, sagte Howard. »Es hängt davon ab, wie die Gespräche mit der Miliz von Tucson, mit Crook und mit Eskiminzin verlaufen. Crook steht unter Dampf, weil ich hier bin, weil ich Sondervollmachten habe und ihm übergeordnet bin. Die Fronten sind sehr verhärtet. Ich glaube nicht, daß es zu einer gütlichen Einigung kommen wird. Ich will Sie für alle Fälle in meiner Nähe haben, um die Möglichkeit offenzuhalten, die Kinder inoffiziell freizukriegen. Es gibt dafür keinen besseren Mann als Sie.«
»Was haben Sie vor?«
»Das kann ich Ihnen genau erst sagen, wenn ich weiß, ob Ihr Einsatz nötig ist.«
»Wo sind die Kinder jetzt?«
»In Camp Grant, meinem früheren Posten«, sagte Whitman.
»In Camp Grant sollen die Verhandlungen stattfinden«, sagte Howard. »Ich wollte vorher die Örtlichkeiten kennenlernen. Deshalb bin ich hier. Noch heute breche ich nach Camp Date Creek im Nordwesten auf. Aber in einem Monat bin ich in Camp Grant. Wenn Sie nichts Unaufschiebbares vorhaben, sollten Sie auch da sein. Ich weiß, für was Sie kämpfen und auf welche Weise. Die Sache ist für Sie wichtig. Glauben Sie mir.«
Levine schwieg.
»Ich will den Kindern unter allen Umständen ersparen, verkauft zu werden«, sagte Howard. »Sie haben ihre Eltern verloren und dabei zusehen müssen, wie sie umgebracht wurden. Das ist schlimm genug.«
»Sie wollen sagen, daß Sie zunächst versuchen wollen, ohne mich eine Lösung zu finden. Sie brauchen mich nur, wenn es gar nicht anders geht.«
»Ja.«
»Sie sind wenigstens ehrlich«, sagte Levine. »Unter Umständen heißt das, daß ich vier Wochen lang umsonst herumsitze.«
»Ich kann Ihnen jetzt keinen festen Auftrag geben«, sagte Howard. »Aber ich bin ziemlich sicher, daß ich Sie brauchen werde.«
»Wir hätten uns nicht um Sie bemüht, wenn wir nicht damit rechnen würden, Ihre Hilfe zu brauchen«, sagte Whitman.
Levine schwieg. Er schaute über das Schlachtfeld. Der schwüle Wind von Südwesten umfächelte sein hart geschnittenes Gesicht.
Unwillkürlich meinte Levine, den Geruch des Todes noch wahrnehmen zu können, der sich im vorigen Jahr über diese Ebene gelegt hatte.
Was Howard gesagt hatte, klang nicht unbedingt zuverlässig. Aber General Oliver Otis Howard war als ehrlicher Mann bekannt.
Er hatte im Bürgerkrieg in der Schlacht von Fair Oaks seinen rechten Arm verloren, als er sein Regiment in die vorderste Frontlinie geführt hatte. Schon lange davor war er wegen seiner tiefen Religiosität als der »Bibel-Howard« bekannt geworden.
Levine dachte, daß er im Grunde keine Zeit zu verlieren hatte. Die Sache der Indianer stand überall schlecht, nicht nur hier unten im Südwesten, obwohl die Kämpfe hier schon zu geradezu tierischen Gemetzeln ausgeartet waren.
Aber dann dachte er an die vierunddreißig Apachenkinder, denen ein Leben in Sklaverei drohte.
Es gab Dinge, die getan werden mußten. Levine blickte Howard an. Er sagte: »Ich bin in spätestens vier Wochen in Camp Grant.«
Er drückte erst Howard die Hand, danach Whitman. Langsam drehte er sich um und ging zu dem Appaloosa zurück.
Als er sich in den Sattel schwang, meinte er, den Lärm des Massakers zu hören, das hier stattgefunden hatte. Er schloß die Augen und sah für Sekunden Frauen und Kinder verzweifelt umherhetzen und getroffen stürzen. Er hörte sie schreien, sah Krieger flüchten und Männer mit Gewehren über die Hügel laufen, die auf alles schossen, was sich bewegte.
Es dauerte nicht lange. Levine packte die Zügel fester. Er hatte viel gesehen und erlebt. Dinge, wie sie hier geschehen waren, kannte er nur zu gut. Es hatte keinen Sinn, sich lange damit aufzuhalten. Das, was geschehen war, ließ sich nicht mehr rückgängig machen.
Levine ritt über das Schlachtfeld, auf dem über hundertvierzig nahezu waffenlose Mescalero-Squaws und -Kinder gestorben waren, auf die Furt des Aravaipa zu.
*
Die Hütte war aus luftgetrockneten Lehmziegeln erbaut. Sie hatte ein flaches Strohdach und zwei winzige quadratische Fenster. Es war heiß und stickig im einzigen Raum der Hütte, die Luft war wie ein Brei und stank nach Schweiß und Urin. Durch die engen Fenster drang wenig Licht, und die Luft konnte nicht zirkulieren, denn es ging nur ein schwacher Wind. Dagegen brannte die Sonne gnadenlos auf die Hütte herunter.
Auf dem Fußboden aus gestampftem Lehm lagen Strohsäcke und fleckige Decken. Darauf saßen, hockten oder lagen die Kinder.
Levine sah die schmalen, eingefallenen braunen Gesichter mit den tiefliegenden Augen. Sie starrten ihm ohne Interesse entgegen. Sie wirkten lethargisch und abgestumpft. Levine war betroffen.
In einer Ecke saß ein Mädchen von höchstens vierzehn Jahren und hielt einen vielleicht zweijährigen Jungen in den Armen. Der Junge wimmerte leise. Das Mädchen wiegte ihn schweigend hin und her. Aber das Wimmern erfüllte die Hütte mit nervtötender Monotonie, ohne daß eines der anderen Kinder es überhaupt zu bemerken schien.
»Sie sind seit gut einem halben Jahr hier«, sagte Whitman. Er stand neben Levine auf der Türschwelle der Hütte. »Die Miliz wollte sie sofort verkaufen und hatte sich schon mit einigen mexikanischen Familien geeinigt. Dann haben wir die Kinder rausgeholt, damit eine höhere Instanz diesen Fall behandeln kann.«
»Das ist ein Rattenloch«, sagte Levine. »Ich würde mein Pferd nicht einmal in einen Stall stellen, der so aussieht. Wenn die Kinder noch lange hier bleiben, werden sie eingehen wie krankes Vieh.«
»Ja«, sagte Whitman. »Deshalb ist die Sache eilig.«
Er drehte sich um. Vor der Tür stand ein Mann mit einer Winchester in der Armbeuge. In seinem linken Mundwinkel hing eine Zigarette. Er blickte an Whitman vorbei und taxierte Levine.
»Bringen Sie das Halbblut weg, Lieutenant«, sagte er. »Er hat genug gesehen.«
»Das geht Sie gar nichts an«, erwiderte Whitman.
»Ganz ruhig, Lieutenant. Die kleinen Rothäute gehören uns, der Miliz von Tucson.«
»Sie sind hier in Camp Grant«, sagte Whitman. »Und hier befehle ich.«
»Nicht uns«, sagte der Mann. »Wir wissen, wie es um Sie steht. Sie werden hier nicht alt. Also spielen Sie sich nicht so auf. Sowie der Zauber hier vorbei ist, werden Sie sowieso wieder ihre Koffer packen müssen. General Crook hat es in Tucson selber erzählt.«
Der Mann grinste. Whitman lief rot an, blieb aber ruhig. Ein zweiter Mann stellte sich neben den ersten. Er trug ein fleckiges grünes Hemd, das ihm offen über den Gürtel hing. Er hatte die Daumen hinter den breiten Patronengurt gehakt und blickte Whitman und Levine herausfordernd an.
Levine musterte die beiden kühl. Er sagte: »Wahrscheinlich hausen sie selbst in solchen Löchern. Deswegen wissen sie nicht, wie Menschen wohnen.«
»Was willst du damit sagen, Bastard?« Der erste hob die Winchester ein wenig an. Er tat einen Schritt auf Levine zu.
»Nimm das Gewehr weg«, sagte Levine. Er blickte den Mann starr an. Der andere konnte dem Blick nicht standhalten. Er senkte den Kopf und nahm das Gewehr herunter.
Whitman setzte sich in Bewegung und ging an den Milizposten vorbei. Levine folgte ihm.
Der zweite Mann schob sich plötzlich vor. Levine bemerkte es aus den Augenwinkeln. Als der Mann ihm ein Bein stellen wollte und gleichzeitig mit der rechten Faust ausholte, wich Levine aus, duckte sich und schnellte herum.
Er unterlief den Hieb des anderen und rammte ihm beide Fäuste gegen die Brust.
Der Posten stieß einen gurgelnden Laut aus und kippte rücklings zu Boden.