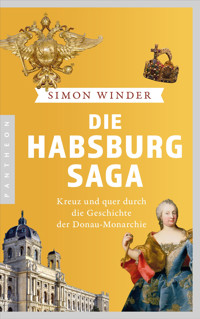
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die unglaubliche Geschichte der Habsburger: mit Witz und Charme erzählt
Keine andere Herrscherfamilie in Europa war über einen derart langen Zeitraum so mächtig wie die Habsburger. Simon Winder erzählt die Geschichte dieser legendären Dynastie und die ihrer eigenwilligen Untertanen. Er führt uns an die Schauplätze der versunkenen Donaumonarchie, mit feinem Sinn auch für Abseitiges und Bizarres. Uns begegnen Hexenmeister und Teufelspuppen, Juwelen und Skelette, Bergvölker und Piratennester, unglückliche Ehen – und ein Meerschweinchendorf. Ohne nostalgische Verklärung macht Winder die Vielfalt der k. u. k. Monarchie lebendig und zeigt uns, wie ihr Erbe die mitteleuropäische Gegenwart prägt.
Dieses Buch ist erstmals 2014 unter dem Titel »Kaisers Rumpelkammer« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 946
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Keine andere Herrscherfamilie in Europa war über einen derart langen Zeitraum so mächtig wie die Habsburger. Simon Winder erzählt die Geschichte dieser legendären Dynastie und die ihrer eigenwilligen Untertanen. Er führt uns an die Schauplätze der versunkenen Donaumonarchie, mit feinem Sinn auch für Abseitiges und Bizarres. Uns begegnen Hexenmeister und Teufelspuppen, Juwelen und Skelette, Bergvölker und Piratennester, unglückliche Ehen – und ein Meerschweinchendorf. Ohne nostalgische Verklärung macht Winder die Vielfalt der k. u. k. Monarchie lebendig und zeigt uns, wie ihr Erbe die mitteleuropäische Gegenwart prägt.
Autor
Simon Winder, geboren 1963 in London, ist Cheflektor des englischen Verlags Penguin Books. Dort betreut er unter anderem die Bücher vieler bedeutender Historiker. 2010 erschien sein Bestseller »Germany, oh Germany: Ein eigensinniges Geschichtsbuch«, 2014 »Kaisers Rumpelkammer: Unterwegs in der Habsburger Geschichte« (Neuausgabe 2023 unter dem Titel »Die Habsburg-Saga«), 2019 folgte als Abschluss dieser Mitteleuropa-Trilogie »Herzland. Eine Reise durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich und Deutschland«.
Simon Winder
Die Habsburg-Saga
Kreuz und quer durch die Geschichte der Donaumonarchie
Aus dem Englischen von Klaus Binder, Bernd Leineweber und Nele Quegwer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Danubia – A Personal History of Habsburg Europe« bei Picador, London.
Diese Übersetzung ist erstmals 2014 unter dem Titel »Kaisers Rumpelkammer« erschienen.
Das Titelblatt zeigt ein Detail aus der bilderreichen wundervollen Holzschnittfolge Der Triumphzug Kaiser Maximilians I. Dieses Blatt hat Hans Burgkmair der Ältere 1515 geschaffen. (BPK, Berlin)
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Pantheon Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
»Danubia« © 2013 by Simon Winder
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Coverabbildungen: © Attila Jandi / Dreamstime (Doppeladler); © Lestertairpolling / Dreamstime (Krone); © Shutterstock / S.Tatiana (Naturhistorisches Museum Wien); © Christie’s Images / Bridgeman Images (Maria Theresia)
ISBN 978-3-641-29635-3V002
www.pantheon-verlag.de
Für Martha Frances
Wie viel davon ist in den freien Ländern des Westens bekannt? Die Informationen sind in den Tageszeitungen zu finden. Wir sind über alles informiert. Wir wissen nichts.
Saul Bellow, Nach Jerusalem und zurück
Der dicke Einjährigfreiwillige wälzte sich auf die andere Seite und fuhr fort: «Das steht fest, dass das alles einmal explodieren muss und nicht ewig dauern kann. Versuchen Sie es, in ein Schwein Rum zu pumpen, es wird Ihnen zum Schluss doch explodieren.»
Jaroslav Hašek, Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk
Kaiser von Österreich
Apostolischer König von Ungarn
König von Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, Illyrien
König von Jerusalem etc.
Erzherzog von Österreich
Großherzog von Toskana und Krakau
Herzog von Lothringen, Salzburg, Steier, Kärnten, Krain und der Bukowina
Großfürst von Siebenbürgen
Markgraf von Mähren
Herzog von Ober- und Niederschlesien, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Auschwitz, Zator, Teschen, Friaul, Ragusa, Zara
Gefürsteter Graf von Habsburg, Tirol, Kyburg, Görz, Gradisca
Fürst von Trient und Brixen
Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien
Graf von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc.
Herr von Triest, von Cattaro und auf der Windischen Mark
Großwojwode der Wojwodschaft Serbien etc. etc.
Die Titel Franz-Josephs I. nach 1867, von denen einige eher kühne Behauptungen sind als Hinweise auf tatsächliche Besitzverhältnisse
Inhalt
Einleitung
Ortsnamen · Das Haus Habsburg
I
Gräber, Bäume und ein Sumpf · Völkerwanderungen · Die Habichtsburg«Sieh dich um!» · Kultstätten · Gewählte Cäsaren
II
Der Erbe Hektors · Der große Hexenmeister · Gnome zu Pferde · Johannas Kinder · Mit dem Geld der Fugger · Die Katastrophe
III
«Mille regretz» · «Die merkwürdigste Sache, die je passiert ist» · Der Heldenharnisch · Europa unter Belagerung · Das Piratennest · Ein wirklicher Bärengraben
IV
Das andere Europa · Bezoare und Nachtclub-Hostessen · Jagd mit Geparden · Die sieben Burgen
V
Überraschende Landung einer fliegenden Hütte · «Sein göttlicher Name wird in die Sterne gemeißelt werden» · Tod in Eger · Beerdigungsrituale und Fuchsjagd mit Knüppeln · Die Teufelspuppe · Wie man den Turm zu Babel baut
VI
Genetische Schrecken · Kampf um die Herrschaft in Europa · Eine neue Grenze · Zeremonialprotokoll · Schlechte Nachrichten für Basilisken · Private Vergnügen
VII
Jesus vs. Neptun · Das erste Testament · Andachtsräume · Das zweite Testament · Zipser und Piasten
VIII
Die große Krise · «Jetzt hat Österreich Hosen an» · Die Gloriette · Krieg um Weihnachtskrippen · Erlauchte Leichen · Wenn man die Welt teilt
IX
«Sonnenaufgang» · Ein Zwischenspiel rationaler Besonnenheit · Niederlage durch Napoleon, Teil eins · Niederlage durch Napoleon, Teil zwei · Irgendwie wird alles noch schlimmer · Eine Hochzeit im engsten Kreis · Zurück zur Natur
X
Eine Warnung an Legitimisten · Probleme mit loyalen Untertanen · Un vero quarantotto · Bergvolk
XI
Tempel der glorreichen Katastrophen · Neue Habsburger Reiche · Der dumme Riese · Spaßzeit der Nationen · Der Ausgleich · Ein teurer Schluck Wasser
XII
Kartierung der Zukunft · Verlockung des Orients · Verweigerungen · Dorf der Verdammten · Alles in Bewegung · Der Führer
XIII
Die Schafe und die Melonen · Elfen, Karyatiden, viele allegorische Mädels · Denkmale einer entschwundenen Vergangenheit · Junges Polen
XIV
«Der dicke Fromme» · Nachtmusik · Siebenbürgische Raketentechnik · Psychopathologien des Alltagslebens · Der Anfang vom Ende
XV
Der Fluch des militärischen Ernstfalls · Sarajevo · Die Katastrophe von Przemyśl · Letzter Zug nach Wilsonville · Wie Pastetenteig · Der Preis der Niederlage · Triumphe der Gleichgültigkeit
Schluss
Karten
Bibliographie
Dank
Register
Einleitung
Ortsnamen
Das Haus Habsburg
Die Habsburg-Saga ist eine Geschichte der riesigen Territorien auf dem europäischen Kontinent, die die Habsburger nach und nach unter ihre Herrschaft brachten. Sie beginnt im ausgehenden Mittelalter und schließt am Ende des Ersten Weltkriegs, nach dem das Reich zerfiel und die Habsburger aus Österreich flohen.
Mit List und Tücke, mit Glück und viel Geschick konnten sich die Habsburger ungewöhnlich lange halten. In gewissem Grad verdanken sich alle großen Reiche dem Zufall, aber für das ihre gilt das in besonderem Maß, denn den Habsburgern fielen ganze Königreiche, Herzogtümer, Marken und Grafschaften zuhauf in den Schoß, weil anderswo Nachkommen ausblieben, Landesherren dem Wahnsinn verfielen oder auf dem Schlachtfeld starben. Sie herrschten über Gebiete zwischen Nordsee und Adria, zwischen den Karpaten und Peru. Ihre vielen Herrschaftssitze waren über ganz Europa verstreut, ihr Kernland aber lag an der Donau, dem großen Fluss, der durch das heutige Ober- und Niederösterreich und ihre einstige Residenzstadt Wien fließt, durch Bratislava, das Pressburg hieß, als sie dort zu Regenten des Königlichen Ungarns gekrönt wurden, und weiter durch Budapest, das später zu einer ihrer großen Hauptstädte wurde.
Über vier Jahrhunderte lang nahm die europäische Geschichte kaum eine Wendung, an der die Dynastie nicht beteiligt war. Habsburger, deren Namen heute kaum noch jemand kennt, haben mit ihren Händeln, Launen und Hintergedanken Einfluss darauf genommen, welche Sprachen Millionen heutiger Europäer sprechen, welche Religionen sie praktizieren, wie ihre Städte aussehen und wo die Grenzen ihrer Länder verlaufen – eine durchaus verwirrende Angelegenheit. Ein ums andere Mal haben sie Mitteleuropa gegen immer neue Angriffswellen der Osmanen verteidigt. Entschlossen sind sie dem Protestantismus entgegengetreten. Und im 19. Jahrhundert, als ganz Europa in nationalistische Raserei verfiel, wurden sie – wenn auch nicht ganz freiwillig – zu Verfechtern der Toleranz. Durch Eheschließungen oder militärische Allianzen haben sie mit so ziemlich jedem Teil Europas, der ihnen noch nicht gehörte, Beziehungen geknüpft. Aus der Perspektive der meisten europäischen Staaten wechselte die Familie der Habsburger so häufig Kostüm und Farben, dass sie in allen Rollen auftreten konnte, als felsenfeste Verbündete ebenso wie als der Leibhaftige selbst. Tatsächlich war der Einfluss der Habsburger so vielfältig und komplex, dass er sich einer moralischen Beurteilung nahezu entzieht, nichts Menschliches war ihnen fremd.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts – als sich die Erbschaften aberwitzig häuften und die Wappenzeichner kaum nachkamen – beherrschte die Familie fast ganz Europa. Eine «chinesische» Zukunft schien sich abzuzeichnen: der Kontinent als ein einziger und einheitlicher Staat. Dazu kam es nicht, denn unter einer Flut unzähliger Faktoren konnte Karl V. seine Vormachtstellung nicht mehr behaupten; nun rächte sich, dass sein Reich aus so vielen Zufällen entstanden war, denn nun wurde er von widersprüchlichen Interessen und Forderungen nahezu überschwemmt. Im Jahr 1555 sah sich Karl, ganz gegen seinen Willen, gezwungen, sein riesiges Erbe aufzuteilen: Die eine Hälfte ging an seinen Sohn Philipp in dessen neuer Hauptstadt Madrid, die andere an seinen Bruder Ferdinand in Wien. Von diesem Umbruch an verfolge ich die Geschichte von Ferdinands Nachkommen, allerdings machten sich die Verwandten in Madrid dann und wann störend bemerkbar, bis sie nach 1700 mit den Wirren des Spanischen Erbfolgekriegs von der Bildfläche verschwanden.
Als ich Germany, oh Germany, mein letztes Buch, schrieb, suchten mich manchmal Angstträume heim, weil ich wusste, dass es auf Taschenspielerei beruhte. Abgesehen von einigen schwelgerischen Exkursen beschränkte ich meinen geographischen Fokus auf die Grenzen der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Das war nötig, damit eine zusammenhängende Erzählung entstehen konnte, historisch gesehen aber war es lächerlich. Was da entstanden war, sprach dem, was eigentlich mein Hauptanliegen war, auf beschämende Weise Hohn: Wollte ich doch zeigen, dass «Deutschland» eine sehr junge Schöpfung ist, gewaltsam herausgetrennt aus einem Durcheinander kleiner und mittelgroßer Feudalstaaten, die große Teile Europas eingenommen hatten. Hunderte Hoheiten und Hoheitsgebiete, in unablässigem Streit miteinander, existierten innerhalb des schützenden Rahmens des Heiligen Römischen Reichs mit seinen Kaisern, die ein Jahrtausend lang herrschten, allerdings mit mäßigem Erfolg. In den letzten dreihundertfünfzig Jahren, in denen dieses Reich bestand, wurde fast immer das Oberhaupt des Hauses Habsburg zum Kaiser gewählt. Den Habsburgern fiel diese Rolle zu, weil sie über immense Territorien geboten, immerhin gehörten ihnen, zu verschiedenen Zeiten, Teile von neunzehn Ländern des heutigen Europa.1 Nur ein Habsburger also verfügte über finanzielle und militärische Ressourcen, die groß genug waren, seinen Anspruch auf die Kaiserwürde durchsetzen zu können. Das bedeutete aber auch, dass er sich oft verzettelte, hatte er sich nicht nur um große zusammenhängende Territorien innerhalb des Heiligen Römischen Reichs zu kümmern wie das heutige Österreich und die Tschechische Republik, sondern auch um damit ganz unverbundene Gebiete wie Kroatien oder Mexiko. Diese Verzettelung war, so kann man sagen, die Hauptantriebskraft für die politische Geschichte Europas.
Die Geschichte der Habsburger, der dauerhaftesten und mächtigsten Dynastie, die die Welt in Germany, oh Germany von Stammsitzen aus beherrschte, die sich ziemlich weit außerhalb der heutigen deutschen Staatsgrenzen befanden, ist so komplex, dass ich mich in meinem früheren Buch mit gelegentlichen Hinweisen begnügen musste. Der Einfluss Habsburgs war quer durch Europa überwältigend, doch die «großen Ereignisse» in der Geschichte des Kontinents wurden ebenso oft durch Unfähigkeit oder offenkundige Erschöpfung des Herrscherhauses hervorgerufen wie durch dessen tatsächliche Initiative. Erstaunlich viele Kaiser waren ratlos oder fehl am Platz, ihre Rivalen, die sie am liebsten mit Haut und Haaren verschlungen hätten, zahllos, und doch landeten diese auf der Müllhalde der Geschichte, während die Habsburger einfach weitertrotteten. Mit unverdientem Glück, durch kurze Ausbrüche von Stärke und infolge von Ereignissen, zu denen sie selbst am wenigsten beitrugen, hielten sie durch – bis zu ihrer Niederlage gegen Napoleon. Rasch und geistesgegenwärtig änderten sie den Titel ihres Kaisertums, der sich nun auf das bezog, was heute das «Habsburgerreich» genannt werden kann, auf das Stammland der Familie also, das, nach Russland, immerhin den zweitgrößten europäischen Staat bildete. So hielten sie ein weiteres – schon ziemlich ramponiertes – Jahrhundert durch bis zum endgültigen Untergang der Habsburgerreichs als eine der im Ersten Weltkrieg besiegten Mittelmächte. Die Nachbeben des in mancher Hinsicht zufälligen Endes dieses zufälligen Reichs sind bis heute spürbar. Auf einige werde ich zu sprechen kommen, faktisch aber endet die Geschichte 1918, als die verschiedenen Teile des Reichs eigene Wege einschlugen.
Dies Buch ist weniger heiter als Germany, oh Germany. Besucht man beispielsweise Städte im Rheinland, so ist klar, dass sie trotz der physischen wie moralischen Zerstörungen, die sie im 20. Jahrhundert erlitten, große historische urbane Räume geblieben sind, in denen weiterhin Deutsche leben. Sie können ihre Mitschuld an den Schrecken der Jahre 1933 bis 1945 durchaus anerkennen und zugleich eine Linie ziehen zwischen sich und großen Teilen der früheren Geschichte. In ihrer Mehrheit sind die Deutschen auch den Folgen der sowjetischen Besatzung entgangen, wodurch die Zeitspanne der Traumatisierung für sie erheblich kürzer war. Die Erinnerung an den Wohlstand und die Stabilität im Sommer 1914 war für viele Westdeutsche noch lebendig, als sie Ende der 1940er Jahre wieder ein normales Leben aufnehmen konnten. Eine solche Atempause gab es für die Menschen in großen Teilen des einstigen Habsburgerreichs nicht, immer wieder im Laufe des Jahrhunderts mussten sie Massaker, Vertreibungen, Invasionen, Terror und nahezu babylonische Manöver der Staatenbildung und -umbildung über sich ergehen lassen.
Die Nachkommen der Menschen, die in diesen verbrannten Zonen überlebt haben, hatten in den 1990er Jahren kaum noch Verbindungen zum Habsburgerreich, gleichwohl waren sie von dessen architektonischen Relikten umgeben. Nur mit Mühe konnte 2011 das Vorhaben verhindert werden, die Reste der Goldenen Rosen Synagoge in Lwiw (Lemberg) abzureißen, um für ein Hotel Platz zu schaffen – das wohl drastischste Beispiel für die Teilnahmslosigkeit, die in vielen Regionen des ehemaligen Reichs im Umgang mit der Vergangenheit herrscht. Vom Westen Tschechiens bis jenseits der Karpaten finden sich Städte, deren gesamte Bevölkerung dort erst nach 1945 angesiedelt worden ist. Welche Bedeutung sollte es für Rumänen haben, verlassene deutsche Dörfer als Teil ihres kulturellen Erbes anzusehen, welche Bedeutung für Ukrainer, ehemals polnische Sakralbauten zu erhalten? Was Besuchern malerisch erscheinen mag, kann ein Einheimischer abscheulich finden oder – ein erheblicher Fortschritt – gleichgültig behandeln. Diese Spannungen und Brüche sind in diesem Buch spürbar.
Die Frage, ob es sich leichten Herzens durch Orte spazieren lässt, die solche Schicksale erlitten haben, stellt sich unausweichlich. In den vier Jahren jedoch, in denen ich immer wieder durch Gebiete des alten Habsburgerreichs gereist bin, blieb mir meine Aufgabe stets bewusst: meinen Lesern aus dem angelsächsischen Raum zu zeigen, dass diese vielen kleineren und größeren Städte, die ihnen auch lange nach Ende des Kalten Kriegs noch immer Terra incognita sind, im Herzen Europas und, im Guten wie im Bösen, im Zentrum der geschichtlichen Erfahrungen des Kontinents liegen und ebendarum noch immer interessant sind. Wenn wir etwas von ihrer Geschichte vor 1918 verstehen, können wir auch etwas von dem zurückgewinnen, was die späteren totalitären Regimes für immer auslöschen wollten: das plurale, anarchische, das vielsprachige Europa, über das einst, in einer verwirrenden Mischung aus Unfähigkeit, Bösartigkeit und gelegentlicher Güte, das Haus Habsburg wachte.
Im Oktober 2008, im Rahmen der UEFA Champions League, traten die Mannschaften des FC Chelsea und des CFR Cluj gegeneinander an. Schlachtenbummler aus Chelsea, die zu dem Spiel nach Transsilvanien flogen, fanden es lustig, sich mit Umhängen und Plastikreißzähnen auszurüsten, und so verkleidet verließen sie das Flugzeug. Torkelnd und die Arme schwingend brüllten sie in einem Phantasieakzent: «Ach, die Kiinder derr Nacht – ich heere sie rrufen!» und so weiter. Am nächsten Tag, in einem Interview mit einem britischen Radiosender, war ein denkbar erboster DJ aus Cluj zu hören, der sich mit überschlagender Stimme in perfektem Englisch, gleichwohl – Fair Play – mit leicht komischem Akzent, über die Demütigung, die Beleidigung seines Volkes empörte: Dracula sei nichts weiter als die Erfindung «irgendeines irischen Romanschreibers» und Vampirismus völlig unbekannt in Transsilvanien.
Recht hatte er, und das Interview ging mir seitdem nicht mehr aus dem Sinn: Musste ich nicht fürchten, selbst wie ein Chelsea-Fan mit Plastikgebiss und Cape aus dem Flugzeug zu stolpern? Gerade in den ehemals habsburgischen Ländern wurden um die Deutung von Geschichte viele Schlachten geschlagen. Ihr Studium wurde befeuert von Anfeindungen und Phantasien über ethnische, religiöse und Klassenprivilegien. Ich musste ein Narr sein, mich in diese hochaufgeladene Arena zu begeben. Wie leicht ist es doch, den Nationalismus anderer zu verachten und den eigenen nicht zu bemerken. Die Beschäftigung mit Sprachen, Archäologie, Ethnographie, Siegelkunde, Numismatik, Kartographie und so weiter, der man sich im Habsburgerreich obsessiv hingab, ist ein toxisches Erbe; und in meinen etwas düsteren Momenten beschleicht mich das Gefühl, dass die Verbreitung dieser Themen und der Gebrauch, der von ihnen gemacht wurde, eine Katastrophe für Mitteleuropa waren; im Grunde waren jene Gelehrten sowie die Geistlichen, die sie unterstützten, die größten Schufte. Verglichen mit ihnen waren Politiker und Militärs bloße Puppen; selbst Hitler war nur ein abscheuliches Nebenprodukt von verschiedenen giftigen nationalistischen und wissenschaftlichen Lehren aus Wien.
Das Interesse war groß, wie besessen durchsiebte jede Sprachgruppe ihre Historie und suchte nach Geschichten über ihre Vorfahren: nicht nur zur schwärmerischen Unterhaltung, sondern um diese Geschichten zu Narrativen, zu ihren Waffen zu machen, mit denen sich die Vorherrschaft der eigenen Gruppe über alle anderen untermauern ließ. Was setzten die Ungarn nicht alles daran, um ihre grandiose Herkunft aus den Weiten der asiatischen Steppe zu belegen und 1896 den tausendsten Jahrestag ihrer Ankunft in Europa zu feiern! Gleichzeitig versuchten rumänische Wissenschaftler durch Ausgrabungen zu beweisen, dass sie die wahren Eigentümer des Territoriums waren, Nachkommen nämlich von Soldaten und Siedlern des römischen Heeres – den Namen ihres Landes erfanden sie, um diesem Argument Nachdruck zu verleihen. Was eine harmlose, spleenige Liebhaberei hätte sein können, wurde zur treibenden Kraft hinter furchtbaren Ereignissen; am harmlosesten noch war die Parole der Rumänen, die in den letzten Jahren des Habsburgerreichs auf antiungarischen Kundgebungen zu hören war: «Ungarn zurück nach Asien!» Worauf solche Rhetorik zielte, ist offensichtlich: Nach dieser Logik ließen sich all die Gruppen ausdeuten, die – wie Juden, Sinti und Roma – keine «Heimat» hatten. Und kaum war das Habsburgerreich nach 1918 in Kleinstaaten zerfallen, blühte der Nationalismus und schuf eine hochgefährliche Situation für all jene, die innerhalb der künstlich gezogenen Grenzen nunmehr zu «Fremden» geworden waren.
Teile dieses Buchs beschäftigen sich mit den erschütternden Folgen dieser Nationalismen, was jedoch nicht heißen soll, dass ich irgendeinen nostalgischen Wunsch nach Rückkehr in die Zeit des Habsburgerreiches hege. Das wäre sinnlos. Diesen widerwärtigen Zug der Moderne gilt es zu akzeptieren, ohne von der Rückkehr in eine aristokratische Welt ohne Zeitungen, ohne allgemeine Schulbildung zu träumen. Schließlich gediehen viele dieser grauenhaften Vorstellungen innerhalb des Habsburgerreichs, das somit sein Teil dazu beigetragen hat, gleichwohl entwickelten sich ebendort auch Strömungen und Ideen gegen dumpfe Nationalismen: vom Zionismus über den Anarchismus bis hin zur Entdeckung des Unbewussten.
Damit hängt eine weitere Absicht zusammen, der ich beim Schreiben dieses Buches gefolgt bin: die Auswirkungen der extremen, zügellosen Gewalt darzustellen, die in früheren Epochen das Leben in Mitteleuropa beherrschte, bis zur nahezu vollständigen Entvölkerung ganzer Landstriche führte und nicht unbeteiligt war an den Schrecken des 20. Jahrhunderts. Solche Grausamkeit war Westeuropäern in ihren Heimatländern in der Regel fremd, obgleich sie auf anderen Kontinenten bedenkenlos nicht weniger grausam verfuhren. Eine Betrachtung Europas als Schauplatz von Sklaverei, Bestrafungsfeldzügen, gewaltsamer Vertreibung und Neuansiedlung, Piraterie und öffentlicher Verstümmelung sowie Hinrichtung im Namen des Glaubens bringt allerhand zum Vorschein. Ich hoffe, ich habe darüber mit so viel Verständnis geschrieben, dass ich niemanden beleidige, aber doch klarmache, wie zentral solche Schicksale für Europas Geschichte sind: Sie haben ihre Wurzeln nicht in irgendeiner fremdartigen «östlichen» Barbarei.
Im Sommer 1463 wurde der bosnische König Stjepan Tomašević von der Armee des osmanischen Herrschers Mehmet II Festung Ključ belagert. Der König ergab sich, als ihm freies Geleit zugesichert wurde. Doch kaum waren er und sein Gefolge in Mehmets Gewalt, wurden sie getötet und die überlebenden bosnischen Adligen zu Galeerensklaven gemacht. Die Osmanen waren der Ansicht, die herrschende Klasse Bosniens habe ihre Funktion verloren und müsse liquidiert werden – Bosniens neuer Status als ein kleines Eyalet, als Provinz des Osmanischen Reichs, sollte dauerhaft sein und endgültig. Das freie Geleit war einem König zugesichert worden, aber der war nun einfacher Untertan, und mit dem konnte man machen, was man wollte. Für mehr als fünfhundert Jahre hat Bosnien, ein respektables mittelalterliches Königreich, damals seine Unabhängigkeit verloren. Ein anderes berühmtes Beispiel bietet Polen. Als Habsburger, Preußen und Russen Ende des 18. Jahrhunderts nach einer Reihe von Verhandlungen mit atemberaubender Kälte beschlossen, das Königreich Polen unter sich aufzuteilen, sollte auch dies für immer sein und der Name Polens hinter den von Bürokraten erfundenen Bezeichnungen «Westpreußen», «Westrussland» sowie «Galizien und Lodomerien» verschwinden. Polens neue Herren kooperierten, um alle, die eine Gefahr für die neue Ordnung darstellten, zu fassen, zu töten oder einzukerkern.
Diese latente Unsicherheit und Bedrohung, dass eine ganze Elite einfach ausgelöscht werden konnte, ist in der mitteleuropäischen Geschichte ein immer wiederkehrendes Thema. Westeuropäer oder Angelsachsen haben solche Erfahrungen kaum gemacht. Frankreich zum Beispiel hat, fast solange es existiert, keine erfolgreiche Invasion erleben müssen und wurde fast immer von Franzosen regiert. Die politischen Entscheidungen angelsächsischer Länder sind durchweg aus Positionen einer bemerkenswerten Sicherheit getroffen worden. Die habsburgischen Länder dagegen waren stets und an nahezu jeder Grenze verwundbar, Dutzende von leicht zu bewältigenden und günstig gelegenen Invasionsrouten führten dorthin. Da konnten Verbündete zu Feinden werden, verschlafene Grenzgebiete über Nacht zu Krisenherden. Die Hauptaufgabe der Habsburger war daher militärischer Natur: Von seinen Ursprüngen bis zu seinem Zusammenbruch war ihr Reich eine Maschinerie, die robusten Nachbarn widerstehen und aufsässige Untertanen kontrollieren musste. Schlug das habsburgische Heer keine Schlacht, bereitete es sich auf einen Krieg vor. Vornehmlich in der Zeit vor 1914 ging die Mär, das Reich der Habsburger sei rückständig und ineffektiv, habe man dort nichts als Mehlspeisen und Walzer im Sinn. Eine Fehleinschätzung: Die Dynastie war immer auf engstirnige Weise rücksichtslos und brutal, wenn es galt, sich gegen Eindringlinge zu behaupten. Der so leutselig wirkende, bärtige alte Kaiser Franz Joseph war besessen von der Idee des Reichs als eines riesigen militärischen Organismus: Sein Leben war eine Folge von Paraden, Manövern, Ordensverleihungen und Streitigkeiten über die gewaltigen Geldmittel, die seine Armee verschlang. All das wäre seinen Vorgängern zwei- und auch vierhundert Jahre zuvor bekannt vorgekommen. Immer in der Geschichte der Habsburger tauchten neue Unwägbarkeiten auf, unablässig waren sie damit beschäftigt, die militärische Bereitschaft, Stimmungsschwankungen und diplomatische Neuorientierungen ihrer Nachbarn zu beobachten. Gab es doch genügend Beispiele dafür, dass Herrscher verwandter Staaten unüberlegt gehandelt hatten und darum von der Bildfläche verschwunden waren. Immer wieder zeigten sich die Habsburger als wahre Meister der Kunst, Rückschläge anderer zum eigenen Vorteil auszunutzen, bis sie schließlich selbst Entscheidungen trafen, die 1918 zu ihrem Verschwinden und zur Aufteilung des Reichs führten.
Wir dürfen nicht vergessen, wie schwach die politische Herrschaft in großen Teilen Europas war, bis allgemeine Schulbildung, Telegraphen und Eisenbahnen das Band zwischen Regionen und Ländern enger knüpften. Die Habsburger liebten es, Landkarten, Stammbäume und Wappen zu studieren und mit ausladenden Gesten auf diese symbolischen Stenogramme ihrer Eigentümerschaft zu verweisen, aber man sollte nicht glauben, dass solche Gesten viel Substanz hatten. Niemand, von einigen Gemeinden in Bergregionen oder Waldgebieten abgesehen, wurde ganz sich selbst überlassen, gleichwohl: Wien war weit weg und das Gefühl, dem Hof dort in irgendeiner Weise verpflichtet zu sein, eher vage. Es gab unzählige Privilegien, verliehen an Regionen, an lokale Grundherren, Adel oder Kirche, die allen modernen Träumen von staatlicher Einheit und Effizienz hohnsprachen. Viele Geschichtswerke zeigen die Tendenz, das Geschehen aus dem Blickwinkel der Herrschenden darzustellen. Besonders deutlich wird dies im Begriff «Rebellion», einem Wort, dem das Scheitern schon immanent ist, insofern als – laut Definition – eine gelungene Rebellion einen Wechsel der Dynastie zur Folge hat. Es ist nicht schwer, Geschichte so zu erzählen, dass eine Rebellion als Ärgernis, als Vergeudung dringend benötigter Ressourcen oder als verzweifelter Ausdruck von Rückständigkeit erscheint. Das aber hieße, einen Mann, der in Wien eine Krone trägt, viel zu ernst zu nehmen, und ich hoffe, zeigen zu können, wie viele vollkommen vernünftige Gründe es gegen die Herrschaft der Habsburger gab. Früher oder später – und vor allem in Ungarn – vollzog nahezu jeder eine Wendung in die «Illoyalität», und das sagt einiges. Joseph II. hat seine Ziele im Russisch-Österreichischen Türkenkrieg auch darum nicht erreicht, weil die ungarischen Adligen dem Heer keine Lebensmittel lieferten, denn sie hassten den Kaiser und hielten ihn für einen lästigen Widerling. Als seine riesige Armee scheiterte und er in ohnmächtiger Wut tobte, ist es, aus weltgeschichtlicher Perspektive betrachtet, kaum möglich, nicht doch etwas Mitleid mit ihm zu haben, aber überall in Europa gab und gibt es alle möglichen Menschen, die sich weigern zu tun, was von ihnen verlangt wird, und es sollte ihnen doch ein bisschen mehr Anerkennung zuteilwerden.
Eine beliebte Figur in vielen Anekdoten und Romanen ist der kleine ungarische Adlige, der nur für den Wein und die Jagd lebt und sich weigert, an ihn gerichtete Briefe oder Telegramme zu öffnen; sie seien, so lässt er wissen, nichts als unverschämte Eingriffe in das Leben eines Edelmannes. Mit solchen Figuren in allen Varianten hatten die Habsburger ständig zu tun: mit Verteidigern feudaler Rechte, sturen Gemeinden, exzentrischen religiösen Gruppierungen, aufsässigen Zunftgenossen. Selbst hohe Adlige konnten sich für die hochriskanten Vorteile verräterischer Beziehungen zu den Osmanen entschließen. Generationen von Wiener Beamten rauften sich an ihren Kirschholzschreibtischen die Haare: Warum tun diese Leute nicht einfach das, was man ihnen sagt? Doch Beamte, Minister, Hofräte, Militärs, sie alle waren benebelt von viel zu vielen Landkarten, Tabellen und Haushaltsprognosen. Das Neue an diesem Buch könnte sein, dass es versucht, in Wien nicht die Schaltstelle politischer, religiöser, sozialer oder strategischer Vernunft zu sehen. Ein steirischer Bauer, ein Leibeigener in Siebenbürgen oder ein Pirat an der Adria sahen Wien auf ganz andere Weise, und ihre Sicht war nicht unbedingt falsch.
*
Dieses Buch ist so konzipiert, dass es ganz unabhängig von Germany, oh Germany gelesen werden kann. Natürlich beschäftigen sich beide zum Teil mit demselben Territorium, sodass es zu Überschneidungen kommt, dem begegne ich durch veränderte Blickwinkel und Beispiele; einige grundlegende Erläuterungen, wie sich Europa unter dem Einfluss des Heiligen Römischen Reichs und seiner Kaiser entwickelte, werde ich wiederholen müssen.
Drei Dinge möchte ich ausdrücklich sagen. Dieses Buch ist keine Geschichte einer Dynastie. Meine Leser müssen sich nicht mit endlosen Eheverträgen befassen, auch nicht mit fadem Klatsch über das, was ein Erzherzog zu einem anderen Erzherzog sagte, oder darüber, wie irgendwer mit seiner Schwägerin zurechtkam. Das Buch behandelt einige interessante, folgenreiche Dinge, die bestimmte Herrscher unternahmen, und dabei spielen dann auch Eheverträge eine Rolle – in denen es verwirrend oft um Personen geht, die entweder Maria oder Karl hießen –, aber ich bemühe mich, die Art von Gerüchten und Gezirpe, von royalem Klatsch und Tratsch zu vermeiden, unter denen viele Darstellungen der Habsburger leiden. Ich habe das ewige «Küss die Hand», die Schönheitsflecken, das Hackenschlagen, die diskreten Blicke auf schmeichelnde Verehrer («Oh, so stürmisch, Herr Graf») einfach weggelassen und hoffe, meine Leser werden es mir danken.
Dies ist auch kein Buch, das versucht, bestimmte ethnische Gruppen durch einen Haufen imaginierter Eigenschaften zu definieren. Leser werden keine Sätze finden, die mit der Feststellung beginnen: «Wie dieses feurige, doch edle Gewürz, das sie so liebevoll pflegen und das auf der ganzen Welt unter dem Namen ‹Paprika› bekannt ist, so sind die Ungarn …» Von keinem Volk wird es heißen, dass es sein letztes Hemd herschenken würde, keines wird als naturgegeben melancholisch oder musikalisch auftreten, weder sind Sprachgruppen einander unversöhnlich feind noch immer schon freund, absolut niemand wird sich opfern, weil seinem Volk der Fatalismus angeboren ist. Solchen Unfug konnte man jahrhundertelang hören – Erzherzog Franz Ferdinand hatte sogar, als Gedächtnisstütze, eine Liste mit nationalen Attributen auf seinem Schreibtisch liegen. Mit alldem sollte endlich Schluss sein. Das Leben in Europa könnte schlagartig besser werden, würden wir Eigenschaften wie «stets zum Lachen aufgelegt», «mürrisch» oder «wie geschaffen für die Liebe» nur Individuen zuschreiben statt ganzen Völkern und solche albernen ethnischen Behauptungen vermeiden, denen zufolge es ganze Städte voller musikalisch Begabter gibt oder abgelegene Täler voller Menschen, die zu Wutausbrüchen neigen. Während meiner Arbeit an Germany, oh Germany hat mich dergleichen allzu oft aufgeregt. Für viele britische und amerikanische Freunde, mit denen ich über mein Thema sprach, stand unumstößlich fest, dass Deutsche humorlos seien, während ich gerade einen Bierkeller besucht hatte, in dem die meisten Gäste so lachten, dass sie rotviolett anliefen und es sie schier zerriss – was natürlich auch nicht heißt, dass alle Deutschen Sinn für Humor hätten.
Und schließlich will dieses Buch kein erschöpfender Führer durch Mitteleuropa sein. Die Idee, es zu schreiben, kam mir bei einem Besuch im Kaiserlichen Hofmobiliendepot, einem mit allem möglichen Plunder vollgestopften Museum in Wien – ein Durcheinander aus spindeldürren alten Stühlen, Hutständern, Tafelschmuck und seltsamen Gemälden, die aus den Palästen der Habsburger stammen und nach 1918 verwaisten, als es keine Verwendung mehr für sie gab. Dem ist dieses Buch, im Guten wie im Schlechten, ein bisschen ähnlich – auch es eine Art Kaisers Rumpelkammer, ein Sammelsurium von Dingen, die ich ausgegraben, ans Licht gebracht habe und persönlich faszinierend finde – aber es kann gut sein, dass manche Leser mir darin nicht folgen mögen oder können, dass sie sich bei bestimmten Abschnitten langweilen oder ärgern, vielleicht sogar bei ganzen Kapiteln.
Ich habe mich auf Stoffe konzentriert, die mich selbst interessieren, und einen einigermaßen klaren erzählerischen Leitfaden verfolgt, doch unvermeidlich gibt es auch eine Menge Themen, die ich kaum berühre. So wird man, zum Beispiel, zur Musik einiges finden, doch lässt der Text eher meine Vorliebe für Joseph Haydn und Hugo Wolf erkennen als meine nur ferne, wenig sachkundige Bewunderung für Ludwig van Beethoven oder Anton Bruckner. Das könnte manche Leser verärgern, und ich bitte um Vergebung. Aber warum sollte ich bestimmte Dinge pflichtschuldig behandeln oder aufblasen und dafür den knappen Raum vergeben, sodass interessanteres Material wegfallen müsste? Ebenso sind manche Kaiser einfach reizvoller als andere, und mir war es lieber, die Zeit auf eine Handvoll der Spannenderen unter ihnen zu verwenden, als auch alle Langweiler auftreten zu lassen.
Ich bin noch ganz benommen von meinem Glück, dieses Buch schreiben zu können. Den größten Teil meines Erwachsenenlebens waren die Kulturen Mitteleuropas meine Obsession, aber eine legitime Entschuldigung zu haben, überall umherzureisen, von Böhmen bis in die Ukraine, so lange Zeit über so viele Gegenstände lesen, nachdenken, reden und schreiben zu dürfen, das war schon ein unschätzbares Privileg. Ich hoffe sehr, dass es mir gelungen ist, zu vermitteln, was ich empfand, wenn ich wieder einmal im wunderbar restaurierten Selbstbedienungsrestaurant des Budapester Ostbahnhofs saß, an einem McChickwich kaute und mich fragte, welches Abenteuer mir wohl als Nächstes bevorstehen würde.
1 In alphabetischer Reihenfolge: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn, Ukraine, für kurze Zeit auch das ganze spanische Reich in Übersee. Die Familie kam durch Philipp, den Sohn Karls V., in den Besitz Portugals und seiner Kolonien sowie, für einen noch längeren Zeitraum, Spaniens und seines Reichs.
Ortsnamen
Immer schon hatte, wer Städten Namen geben konnte, eine wichtige Waffe in der Hand, um seine Herrschaft über ein Gebiet zu etablieren. Welchen Namen man einer Stadt gibt, kann einen bestimmten ethnischen Hintergrund, einen aggressiven oder nostalgischen politischen Standpunkt zum Ausdruck bringen. Ein passendes aktuelles Beispiel ist die transsilvanische Stadt Cluj-Napoca. Cluj ist die rumänische Bezeichnung. Cluj-Napoca ist eine Schöpfung der 1970er Jahre, denn Napoca hieß die römische Stadt, die es an dieser Stelle mal gegeben hatte. Klausenburg war der deutsche Name, Klazin der jiddische, Kolozsvár der ungarische. Immer ging es um dieselbe Stadt, alle Namen haben verwandte Wurzeln, alle aber haben auch ein sehr unterschiedliches politisches Gewicht. Ein Ungar würde sagen, von Kolozsvár zu sprechen, heiße einfach nur, dass man den ungarischen Namen verwendet – einem Rumänen dagegen erschiene dies als eine irredentistische Provokation, als Ablehnung der rumänischen Verwaltung der Stadt und als sentimentaler Wunsch nach Rückkehr zur guten alten Zeit, als Cluj eine größere ungarische Stadt war. Der Rumäne mag Gründe haben für seine Empörung, dass er damit recht hat, steht nicht fest. Ähnlich verhält es sich mit der alten Stadt Pozsony, in der die ungarischen Könige gekrönt wurden, Pressburg auf Deutsch. 1919 nutzten Tschechen und Slowaken die Gelegenheit und erfanden für Pozsony den Namen Bratislava, und der war weder deutsch noch ungarisch. Für die Tschechen wiederum muss äußerst unbefriedigend sein, dass sie ihren Staat Tschechische Republik nennen müssen, weil die naheliegende Alternative Böhmen und Mähren durch den Gebrauch, den die Nationalsozialisten während des «Protektorats» von diesen Namen gemacht haben, besudelt wurde.
Aus solchen Minenfeldern gibt es keinen Ausweg: Was heute Lwiw ist, kann Lemberg, Lemberik, Lwów oder Lvov sein, das heutige Ivano-Frankivsk kann Stanislau, Stanisławów, Stanislavov sein – jede dieser Varianten ist auf diese oder jene Weise schmerzlich für die jeweils ausgegrenzte Gruppe. Deshalb werde ich die aktuellen offiziellen Namen benutzen und möchte dies neutral verstanden wissen, ohne Gefühle der Zu- oder Abneigung anzudeuten.1
Man wird in diesem Buch auf viel unbekannte historische Geographie stoßen. Einheiten wie Kärnten oder die Oberlausitz bestanden jahrhundertelang, und man muss sich im Klaren darüber sein, dass sie eine erstaunlich belastbare Stärke, eigene Traditionen, Wappen, Adelsfamilien und Dienstpflichten gegenüber ihren Herrschern hatten. Ein anderes berühmtes Beispiel ist das Königreich Galizien und Lodomerien, das die Polen und viele andere als koloniales Unglück, als gänzlich illegitim betrachteten, das gleichwohl hundertfünfzig Jahre existierte – länger als das vereinte Deutschland. Zur Kenntnis zu nehmen, dass Galizien keine dem Untergang geweihte, sonderbare Eintagsfliege, sondern für seine Bewohner eine viele Generationen andauernde Realität war, bedeutet ein Umdenken, das eine wichtige Vorbedingung für das Verständnis der europäischen Geschichte darstellt.
Viele ältere politische Gebilde erscheinen uns heute als klein, doch bis zum 19. Jahrhundert bestand Mitteleuropa überwiegend aus solchen Einheiten. Bis zur Vereinigung Deutschlands und Italiens schien ein Land wie die Schweiz groß. Hätten Europäer um 1900 einen Blick auf die kartographische Darstellung des Kontinents im Jahr 2000 werfen können, sie hätten gestaunt; nicht nur darüber, dass ehemals unabhängige Staaten wie Polen und Irland, die sich damals vermeintlich unwiderruflich unter dem Stiefel von Großmächten befanden, wiedererstehen konnten, sondern auch über so phantastische Neuschöpfungen wie die Slowakei und Mazedonien. Beide waren um 1900 schlicht bedeutungslos, die Slowakei nichts weiter als eine Bergregion im nördlichen Ungarn, Mazedonien versteckt in einer Falte des Osmanischen Reichs. Ebenso erstaunlich wäre ihnen erschienen, dass treue Kronländer wie die Grafschaft Görz oder das Herzogtum Teschen, die seit dem Mittelalter existiert hatten, verschwanden und heute, unter den neuen Grenzen, fast unauffindbar sind. Nicht jedem wird dies gefallen, aber dieses Buch will seine Leser ermuntern, Europa als ein Gebiet zu betrachten, in dem es mancherlei und merkwürdige Grenzen gibt, mannigfaltige Entwicklungen möglich sind und dessen Geographie und Besitzverhältnisse immer wieder zum Zugriff einluden. Die Karten ab hier sollen eine Hilfe sein. Eine wirklich verwirrende Vorstellung davon, wie Mitteleuropa im 20. Jahrhundert hätte neugeordnet werden können, gibt es hier.
1 Die Übersetzung folgt in der Regel dieser Maxime, in manchen Fällen allerdings, dem deutschen Sprachgebrauch oder dem historischen Kontext folgend, erlauben wir uns Ausnahmen oder setzen deutsche Namen in Klammern dazu (Anmerkung der Übersetzer).
Das Haus Habsburg
Um die Leser nicht mit einem Stammbaum abzuschrecken, den man für eine Zeichnung des menschlichen Körpers mit seinen Venen und Arterien halten könnte, angefertigt von einem ahnungslosen Wahnsinnigen, hielt ich es für besser, mich für den Anfang auf einen Überblick über die Familienoberhäupter zu beschränken, damit die Reihenfolge ihrer Regentschaft deutlich wird. Das alles erscheint ziemlich geradlinig und natürlich, denn all die Heimtücke, die rücksichtslosen Unterteilungen, den Hass, die vorgetäuschte Pietät und das generelle Versagen lässt die Liste natürlich nicht erkennen, das bleibt dem Text überlassen.
Um die Leser nicht über Gebühr zu strapazieren, habe ich alle Titel vereinfacht; ein Vorgehen, das womöglich für Irritation sorgen wird, aber ich werde mich, soweit möglich, für jede auftretende Person an einen einzigen Titel halten. Einen Eindruck der andernfalls drohenden Verwirrung gibt folgendes Beispiel: der reizlose Philipp der Schöne war Philipp I. von Kastilien, Philipp II. Burgund, Philipp V. von Namur, Philip VI. von Artois sowie der I., II., III. und so weiter für andere Territorien. Die Leser also können dankbar sein, wenn ich von Philipp dem Schönen spreche, und sich kurz vor Augen führen, welch ein Grauen an Pedanterie ihnen erspart bleibt. Gerade in kritischen Situationen mögen solche Auslassungen Bedeutsames betreffen, wenn nämlich einige Wiener Kaiser als Könige von Ungarn und Könige von Böhmen verschiedene Zahlen hatten – so war Rudolf II. in Ungarn Rudolf I. und Karl VI. war Karl III. oder III. Károly – doch ich halte mich an die Kaisernamen, entweder an den des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches (bis 1806) oder an den des Kaisers von Österreich (von 1804 bis 1918).
Bis 1806 ist mit «dem Reich» das Heilige Römische Reich gemeint, als dessen Kaiser fast immer das Oberhaupt des Hauses Habsburg gewählt wurde. Persönlich und weitgehend unabhängig von dieser Funktion war er Regent der Habsburger Länder oder Habsburger Erblande. Doch auch diese Länder bildeten niemals ein zusammenhängendes Ganzes und standen zudem häufig noch unter der Herrschaft verschiedener Aristokraten und kirchlicher Körperschaften, manchmal waren es auch ziemlich kleine Territorien im «Besitz» der Familie. Herrschen oder regieren hieß insofern, sich durch ein Dickicht von Sonderrechten, Vergünstigungen, Exemtionen und verknöcherten feudalen Privilegien hindurchzulavieren. Bedeutende Teile der Habsburger Erblande lagen innerhalb des Heiligen Römischen Reichs, andere wiederum nicht, beispielsweise Ungarn. Darum waren «Kaiserliche Truppen» durch das Votum des Heiligen Römischen Reichs sanktionierte Streitkräfte und nicht identisch mit den eigenen Armeen der Habsburger. Leser, die unter fünfzig sind, werden Begriffe wie «Empire» [Reich] oder «imperial» sofort mit dem hoch organisierten Bösen à la Star Wars assoziieren. Vielleicht ist das wiederauflebende Interesse an der Geschichte des Heiligen Römischen Reichs tatsächlich auf diese unbewusste Assoziation zurückzuführen. Allerdings sollten wir bedenken, dass dieses irdische «Reich» hinsichtlich seiner Effizienz, Motivation und Boshaftigkeit einige Stufen unter seinem Rivalen im Weltraum stand; vielleicht aber könnten die beiden Imperien Noten darüber austauschen, wie ärgerlich anfällig sie für nutzlose Niederlagen zu sein scheinen.
Nachfolger Friedrichs III. (1452–1493)1 wurde, nachdem sie sich die Regentschaft eine Zeitlang geteilt hatten, sein Sohn Maximilian I. (1493–1519). Auf ihn folgte sein Enkel Karl V. (1519–1558). Er teilte sein unregierbar gewordenes Erbe: Der spanische Zweig der Familie unter seinem Sohn Philipp II. ging eigene Wege, während die östlichen Länder an Karls Bruder Ferdinand I. (1558–1564) fielen. Dessen Nachfolger wurde der Sohn Maximilian II. (1564–1576), auf den wiederum dessen Sohn Rudolf II. (1576–1612) folgte. Nach einem Staatsstreich trat Rudolfs Bruder Matthias (1612–1619) für die Regentschaft an. Sowohl Rudolf als auch Matthias blieben kinderlos, daher wurde ihr Vetter Ferdinand II. (1619–1637) zum Familienoberhaupt, auf ihn folgten, zumeist in direkter Generationenfolge, die jeweils ältesten lebenden Söhne: Ferdinand III. (1637–1657), Leopold I. (1657–1705) und Joseph I. (1705–1711). Nach dessen unerwartet frühem Tod kam sein Bruder Karl VI. (1711–1740) auf den Thron. Weil er keine überlebenden männlichen Nachkommen hatte, musste seine Tochter Maria Theresia (Herrscherin über die Habsburger Länder 1740–1780), konfrontiert mit aller erdenklichen Treulosigkeit, unter Blutvergießen um das Erbe ihrer Titel kämpfen, während ihr Mann Franz I. (1745–1765) nach einem peinlichen Interim zum Kaiser gewählt wurde. Damit war die Dynastie als Haus Habsburg-Lothringen neu gegründet. Mit Joseph II. (1765–1790) trat wieder ein Sohn die dynastische Nachfolge an, ihm folgten sein Bruder Leopold II. (1790–1792) und dessen Sohn Franz II. (1792–1806). Dieser musste die Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs niederlegen und machte sich zum Kaiser von Österreich, konnte mit der Zählung neu beginnen und nannte sich Franz (1804–1835). Mit Ferdinand (1835–1848) folgte wiederum der Sohn, der jedoch 1848 durch einen Staatsstreich abgesetzt wurde. Dies brachte seinen Neffen Franz Joseph (1848–1916) an die Macht. Nach den vielschichtigen und bekannten dynastischen Rückschlägen folgte auf ihn sein Großneffe Karl (1916–1918). Obwohl Ungarn bis 1944 eine Monarchie blieb, die ihre Regentschaft im Namen der Habsburger beanspruchte, ist es nicht falsch zu sagen, dass die Dynastie mit Karls Abdankung 1918 von der Bühne der Geschichte abtrat.
1 Jahreszahlen in Klammern beziehen sich hier auf die jeweilige Regentschaft; im Folgenden, wenn nicht anders vermerkt, auf die Lebensdaten der genannten Person (Anmerkung der Übersetzer).
I
Gräber, Bäume und ein SumpfVölkerwanderungenDie Habichtsburg«Sieh dich um!»KultstättenGewählte Cäsaren
Auch dies ist ein Burgkmair – ein eindrucksvoller, 1507 entstandener Holzschnitt des Kaiseradlers. Voller Allegorien und Anspielungen zeigt er Maximilian über einer Art. Vogeltränke thronend, in der die neun Musen baden (Scala, Florenz/BPK, Berlin).
Gräber, Bäume und ein Sumpf
Als Ausgangspunkt einer Geschichte des vom Haus Habsburg geprägten Europa eignet sich die Stadt Pécs im südlichen Ungarn ebenso gut wie jeder andere Ort. Allerdings ist kaum vorstellbar, dass sie jemals etwas anderes war als eine freundliche Provinzstadt – die unglückliche Zielscheibe größerer internationaler Ereignisse, aber kein Ort, um irgendetwas in Gang zu setzen. Weiter nach Süden wird die Landschaft staubig und trist und ist nur dünn besiedelt, daher mutet die Stadt an wie eine Oase oder ein Grenzposten. Es macht den Eindruck, als seien die Cappuccinos hier ziemlich hart erkämpft. Die wenigen über die Stadt verstreuten großen Gebäude mussten nach den diversen Katastrophen immer wieder notdürftig zusammengeflickt werden; zum Charme des zentralen Platzes etwa trägt die raue Masse einer ehemaligen Moschee bei, an der endlos und wenig überzeugend herumgeschustert wurde, um eine Kirche daraus zu machen, nachdem 1686 die osmanischen Machthaber die rauchenden Trümmer der Stadt aufgegeben hatten.
Ein ungewöhnliches Relikt gibt es allerdings: frühchristliche Grabbauten aus der Zeit, als Pécs ein Weinanbaugebiet namens Sopianiae und Hauptstadt der römischen Provinz Pannonia Valeria war. Das berühmteste dieser Gräber, erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt, enthält eine Reihe von Fresken mit biblischen Szenen. Sie sind mit dem Farbsinn und dem Einfühlungsvermögen eines mäßig begabten neunjährigen Kindes gemalt, nur wegen ihres Alters und ihrer traurigen Fleckigkeit wirken sie nicht trivial. Adam und Eva sind zu sehen, Noah und seine Arche, die Heiligen Petrus und Paulus. Vierzehnhundert Jahre haben die Fresken unter der Erde verbracht, wohl nur darum haben sie überlebt; hier und da ist Farbe abgebröckelt.
Angelegt wurde die Nekropole im 4. Jahrhundert, und Sopianiae muss damals, an der unruhigen Grenze des Römischen Reichs gelegen, ein ziemlich unsicherer Ort gewesen sein. Jedenfalls war die Stadt keine wirkliche Festung, und wenn eines der Kastelle an der Donau überrannt worden war, dann werden dem verängstigten Kurier, der die Nachricht nach Sopianiae brachte, die gefürchteten Reiterhorden bereits auf den Fersen gewesen sein. Die Menschen, die hier lebten, waren germanische Untertanen Roms, latinisiert und christlich, das Territorium gehörte damals seit rund vierhundert Jahren zum Römischen Reich. Weinanbaugebiet klingt irgendwie fröhlich, und tatsächlich gab es Bäder, ein Aquädukt, eine Basilika, was eben eine römische Stadt so hatte, und vielleicht ging es dort so munter zu wie im Dorf von Asterix.
Noch etwas an der Nekropole von Pécs ist bemerkenswert, aber das ist kein Fresko, kein ausgefallenes Dekor, sondern der Umstand, dass etwas fehlt. Ein Grabbau, wohl zutreffend auf die Zeit um 400 datiert, war für den Verputz vorbereitet worden, doch der Putz wurde niemals aufgetragen. Jemand hatte viel Geld ausgegeben, um das Totenhaus für einen reichen Verwandten errichten zu lassen, ließ es dann aber unvollendet. Wir können nur spekulieren, aber wie es aussieht, blieb der Bau in diesem Zustand, weil Sopianiae im Jahr seiner Errichtung aus den Annalen verschwindet. Auftraggeber und Bauleute waren entweder geflohen oder wurden von hunnischen Reitern wenn nicht getötet, dann zumindest versklavt. Bis die Stadt wieder in einem Dokument auftaucht, vergeht Gräber, Bäume und ein sumpf 41 etwa ein halbes Jahrtausend; buchstäblich kein einziger Ziegelstein lässt sich auf die Zeit nach 400 datieren. Jahrhundertelang haben Regenfälle Schlamm und Erde auf den Gräbern abgelagert.
Die Vernichtung dieses Teils des römischen Europa bildet den Hintergrund für alles Folgende. Was sehr viel später die südliche Zone des Habsburgerreichs werden sollte, war jahrhundertelang eine Welt ohne Schrift, ohne Städte, ohne Christentum, nur lokale Handelsbeziehungen gab es. Einige Menschen werden immer in den Ruinen der Städte gelebt haben, denn die Mauern boten Unterschlupf und etwas Sicherheit, aber die Wassersysteme und Märkte, die ihnen eine Existenz ermöglicht hatten, verfielen. Und wenn es niemanden mehr gab, der ein schadhaftes Aquädukt reparieren konnte, dann füllten sich eines Tages die Zisternen nicht mehr. Hier und da wird irgendein Stammesfürst das, was von einem größeren Gebäude geblieben war, zur Kulisse eines halb ausgebauten Palastes gemacht haben, da aber niemand wusste, wie man Steine behaut, konnte nichts Neues gebaut werden, zumindest nicht aus Stein. Für Jahrhunderte gab es nur von Palisaden und Wassergräben geschützte Orte – das war die Welt, in welche die legendären Vorfahren der modernen mitteleuropäischen Völker von Osten her einwanderten, wahrscheinlich in nicht besonders wohlriechenden kriegerischen Karawanen.
Einige Hinweise auf das Schicksal der Gebiete, aus denen die Römer abzogen, lassen sich auch in Bautzen im südöstlichen Sachsen entdecken. Es liegt auf einem Felsen über einer düsteren Schlucht, dort, wo das Oberlausitzer Bergland in flaches Heidegebiet übergeht. Auch die Stadt wirkt düster, als saugte die Schlucht jede Farbe auf: Selbst ein so bunt schillernder Vogel wie ein Eichelhäher scheint einfarbig, sobald er in die Schlucht hineinfliegt. Diese hat sich die Spree gegraben, die hier freilich noch einen weiten Weg nach Berlin vor sich hat, wo sie eine prominentere Rolle spielt. Selbst auf einer Landkarte sieht Bautzen nicht besonders glücklich aus – mit gewundenen Gebirgsstraßen und Pässen im Süden, über die Heere an die Stadt herangeführt werden konnten, die mal nach Westen, mal nach Osten zogen. In dieser umkämpften Gegend kann Bautzen wohl zu Recht für sich in Anspruch nehmen, am häufigsten, ob gezielt oder zufällig, niedergebrannt worden zu sein.
Interessant ist Bautzen in vielerlei Hinsicht. Es liegt in einer Region, die einst vom habsburgischen Kaiser regiert wurde – es blieb ein einnehmendes Bildnis von Rudolf II. erhalten, das einen Wachtturm schmückt –, bis sie 1635, während des Dreißigjährigen Kriegs, der Herrscher von Sachsen als Dankeschön erhielt. Seit dieser Zeit befindet sich die Oberlausitz, die teils deutsches, teils slawisches Territorium war und eine sprachlich unübersichtliche Ecke Mitteleuropas, innerhalb deutscher Grenzen. Deshalb blieben die meisten ihrer Einwohner von den massiven ethnischen Säuberungen verschont, die 1945 die Nachbarländer Tschechoslowakei und Polen einsprachig machten, und das alte, in der Region verbreitete Muster von Deutsch sprechenden Städtern und Slawisch sprechenden Landbewohnern findet man in der Oberlausitz noch immer, nämlich bei der kleinen Gruppe der Sorben. Daher heißt Bautzen auch Budyšin und die Spree Sprjewja.
Was die Stadt so einmalig macht, sind ihre Ursprünge – und das, was sie uns über die Ursprünge ganz Mitteleuropas zu erkennen gibt. Das ist ein Eisen, das heißer nicht sein könnte. Denn jede Nationalität in Mitteleuropa definiert sich selbst dadurch, dass sie echter1 ist als alle anderen: dass sie den alleinigen Anspruch auf den Besitz eines Territoriums hat, weil sie ein überlegenes kriegerisches Talent oder eine mächtigere Kultur besitzt oder, in diesem Zusammenhang wohl am wichtigsten, weil sie in diesem oder jenem Tal vor allen anderen angekommen ist. Heute ließe sich das erste Auftreten einer jeden Sprachgruppe in Europa mit der Radiocarbonmethode datieren, doch wäre das, objektiv betrachtet, nur für eine Handvoll schrulliger Altertumsforscher interessant. Gleichwohl wurden solche Datierungen, gerade durch die Mühen jener verstaubten Gestalten, zum Anliegen von jedermann – und zu einem Anliegen, das den gewaltsamen Tod zahlloser Menschen herbeigeführt hat. Die Jagd nach nationalen Ursprüngen wurde im 19. Jahrhundert zur Obsession, als nämlich ein gelehrter und aggressiver Sprachennationalismus Mitteleuropa zu beherrschen begann. Auf immer mehr Stadtplätzen tauchten Standbilder heroischer, zotteliger Vorfahren auf, Rathäuser wurden mit beklemmenden Wandmalereien ausstaffiert, auf denen ebenjene Vorfahren zu sehen waren, wie sie entweder bedrohlich von einem erklommenen Hügel auf das gelobte Land hinunterblicken, mit Fahne oder Schwert einer Stadtgründungszeremonie beiwohnen oder alle umbringen, die schon vor ihnen da waren. Schulen hallten wider vom Singsang der Kinder, die Heldensagen deklamierten. Diese Epoche war eine Blütezeit der europäischen Kultur und eine Katastrophe zugleich, als sich das 20. Jahrhundert daranmachte, diese frühmittelalterlichen Phantasien mit modernen Waffen zu verwirklichen.
Das Gebiet um Bautzen ist so außergewöhnlich, weil es zeigt, um was es ging im dunklen Zeitalter der Völkerwanderungen, in dem alle diese Nationalitäten ihre Wurzeln finden könnten. Archäologische Untersuchungen in der Lausitz zeigen, dass hier von etwa 400 v. Chr. bis 200 n. Chr. germanische Stämme lebten, sicher und außer Reichweite des Römischen Reichs, danach aber, für etwa sechs Jahrhunderte, anscheinend überhaupt niemand. Es könnte natürlich sein, dass es Menschen gab, die so einfach lebten, dass sie weder Gräber noch Schwerter, Keramik, Fundamente von Befestigungsanlagen oder dergleichen zurückließen – aber plausibel scheint das nicht. Aus welchen Gründen auch immer, es hat dort nur wenige oder gar keine Menschen gegeben. Die dichten Wälder, die sich von jeher über Europa zogen, deckten auch verlassene Siedlungsplätze wieder zu, und es streiften nur noch Wölfe, Wisente und Auerochsen durch den malerischen Nebel. Die Situation in der Lausitz ist außergewöhnlich, aber wie es aussieht, ist die Bevölkerung großer Teile des europäischen Binnenlands wohl untergegangen. Barbarische Reiterhorden, Hunnen und andere, die römische Städte wie Pécs auslöschten, scheinen auch die Menschen getötet oder vertrieben zu haben, die in den kleinen Siedlungen nördlich der alten Römergrenze lebten.
Heute sind Bäume in weiten Teilen Mitteleuropas nicht mehr als ein gefälliges Zubehör menschlicher Ansiedlungen, nur in Böhmen und in der Slowakei gibt es noch ausgedehnte dichte Waldgebiete. Früher dagegen bedeckten die Bäume, von kahlen Höhen abgesehen, gewöhnlich fast alles. Wurden sie nicht mehr gefällt und zurückgedrängt, eroberten sie gerodetes Land rasch zurück. Eine kleine, durch eine Missernte oder ein Massaker vernichtete Siedlung verschwand einfach, ihre Äcker und Behausungen wurden von Millionen Wurzeln durchwuchert. Bis weit ins Mittelalter hinein blieb das Roden, das Freihalten des Bodens von Bewuchs, eine notwendige Aufgabe, Grundherren boten Bauern einen günstigeren Pachtzins an, wenn sie Rodehacken gebrauchten, mit denen die Baumwurzeln ausgerissen werden konnten. Sobald das Land schließlich gepflügt werden konnte, erhöhten sie die Pacht. Selbst solche bekanntermaßen trostlosen und menschenleeren Gebiete wie die ungarische Große Ebene waren einst völlig überwuchert von Bäumen.
Die germanischen Stämme, die auf einem breiten Streifen lebten, der sich von der Nordsee bis zum Balkan zog, haben anscheinend aufgegeben, dezimiert zogen sie sich vielleicht in andere Regionen zurück, womöglich auf die Britischen Inseln: wegen der ständigen Angriffe asiatischer Nomaden und weil auch sie den Zusammenbruch des Römischen Reichs zu spüren bekamen, in dessen Folge im 5. Jahrhundert ein ganzes Wirtschaftsnetz in die Brüche ging. Der größte Schrecken ereilte die Menschen Mitte des 6. Jahrhunderts mit der Pest. Wir haben Zeugnisse ihrer verheerenden Auswirkungen auf die großen Städte im östlichen Mittelmeerraum, aber sie wird sich von dort aus weiterverbreitet haben, entlang Schriftkultur gab und die Opfer ihren eigenen Untergang nicht dokumentieren konnten. In dieser Hinsicht besteht eine Parallele zu Nordamerika, wo viele Stammesgruppen an europäischen Krankheiten starben, Jahre bevor sie in direkten Kontakt mit Europäern kamen. Ich erinnere mich an eine kleine traurige Ausstellung in einem westkanadischen Museum, in der Mokassins und Perlen der einst dort siedelnden Athabasken zu sehen waren, die alle gestorben zu sein schienen, unbemerkt und weit verstreut in entlegenen Tälern. So ähnlich könnte man sich das auch im Innern Europas vorstellen, als die Pest den spärlichen Handelswegen durch den Balkan folgte, Siedlungen entvölkerte und schließlich die unaufhaltsam wuchernden Bäume alle Spuren auslöschten. Dass kleine Gruppen von Slawen, Magyaren, Walachen und anderen so leicht in Mitteleuropa eindringen konnten, hängt mit der schieren Leere dieser Räume zusammen.
Beeindruckende Reste dieses ungezähmten Europa finden sich noch im Gemencer Wald in Südungarn. Als die Donau im 19. Jahrhundert auf langen Etappen begradigt, schiffbar und berechenbar gemacht wurde, blieben in der Gegend von Gemenc die Altwasserarme bestehen. Das Land war nicht urbar zu machen und wurde zum erzherzoglichen Jagdgebiet. Als ich an einem heißen Sommertag dorthin kam, wirkte alles ganz friedlich. Auf einer Orientierungstafel am Waldrand waren farbige Wanderwege verzeichnet; die Karte war illustriert mit Zeichnungen, die die Fauna des Waldes zeigten, darunter majestätische Adler und ein wie ein Zirkuspudel auf den Hinterbeinen tanzendes Wildschwein. Diese übersichtliche schematische Darstellung verschwand jedoch unter Dutzenden zappelnder summender Käfer, die bezaubernd ultramarin und kupfern schimmernd über die Beschriftung jagten. Das Sonnenlicht, in dem die Käfer leuchteten, ließ das Ganze noch bedrohlicher erscheinen. Aber das war nichts im Vergleich zu dem, was mich im Wald erwartete. Nach wenigen Schritten schon waren die auf der Karte sauber markierten Pfade im Nirgendwo verschwunden, war die von Menschen gemachte Ordnung einer außer Rand und Band geratenen Natur gewichen, einem modrig riechenden Gewucher vegetabilen Lebens, ein vielstimmiges Heulen, Quieken und Grunzen lag in der Luft, im stickigen Halbdunkel unter den alten Bäumen. Nach wenigen Minuten stand ich an einem riesigen, verwilderten Teich, dessen Wasserfläche stumpf war, weil Millionen von Samen darauf schwammen, Frösche hockten träge auf treibendem Holz. Der nächste Teich überschwemmte den Pfad, und nach nur wenigen hundert Metern musste ich umkehren. Das war ein wilder, sommergrüner Dschungel, wie ich ihn in Brasilien erwartet hätte, aber nicht in Ungarn. Mit einem Mal wurde mir klar, warum Jahrhunderte der Bemühungen um Entwässerungssysteme und Wehre, des Einsatzes von Hacken, Rodeisen und grasendem Vieh sowie unaufhörlicher, ermüdender Kontrollgänge nötig und viel bedeutsamer gewesen waren, um unsere Gesellschaften zu schaffen, als flüchtige politische Ereignisse. Schließlich lief ich am Waldrand entlang, mehrere Kilometer weit auf einem aus Erde aufgeschütteten Deich – eine beeindruckende Antwort auf das aus den Altwasserarmen periodisch aufsteigende Hochwasser – und wurde belohnt mit Adlern, einer messingfarbenen Hirschkuh von beachtlicher Größe, einem Fuchsskelett und einem Hirten mit Rindern und Hütehund – nur einem Wildschwein bin ich nicht begegnet. Doch dass sich diese prächtigen Tiere nicht zeigten, konnte der außergewöhnlichen Natur des Gemencer Waldes, ihrer Schönheit keinen Abbruch tun. Hier ließ sich erahnen, wie die meisten Flusstäler in einer Zeit mit nur wenigen Menschen ausgesehen haben. Wie das Tal des Ganges, heute eine braun verbrannte, baumlose Ebene, einmal eine von Tigern bevölkerte Wildnis aus überfluteten, unpassierbaren Wäldern war, so war auch das europäische Tiefland für Menschen bedrohlich und nicht zu nutzen. Die meisten europäischen Großtiere entwickelten sich für dieses Habitat und verschwanden mit ihm. Aber es war diese sumpfige, von undurchdringlichen Wäldern verschlossene, sich selbst überlassene Welt, in die ab dem 8. Jahrhundert n. Chr. kleine Gruppen von Kriegern mit ihren Familien eindrangen.
Im Westböhmischen Museum von Plzeň (Pilsen) ist ein fast hysterisch anmutender Fries zu betrachten, auf dem die alten Tschechen dargestellt sind, wie sie in einem Wald ankommen, ihre Feinde foltern und töten, sie an Bäume fesseln und erwürgen. Im Jahr 1900 in der bekannten Manier des frühen Jugendstils geschaffen, folgte der Bildhauer Vojtech Saff der ethnographischen Vermutung, dass überraschend viele weibliche Stammesangehörige unter zwanzig waren und nackt. Das Relief ist von merkwürdig unbekümmertem Sadismus und zeugt von der nationalistischen Manie des Zeitalters, indem es die Tschechen auffordert, nicht länger untätig herumzusitzen, Zeitung zu lesen und Kräuterschnäpse zu kippen, sondern den Tugenden ihrer strammen Vorfahren nachzueifern. Natürlich wissen wir überhaupt nichts darüber, wie diese alten Tschechen waren, und was ihre Wildheit anbetrifft, muss Saff noch nicht einmal falschliegen: Dennoch, die Gelegenheiten, bei denen Frauen mit eindrucksvollen Brüsten abgeschnittene Köpfe an den Haaren herumschwenkten, werden wohl eher selten gewesen sein.
Rumänische Nationalisten übertrumpften geschickt alle anderen Volksgruppen, indem sie behaupteten, von den Römern abzustammen, den Bewohnern der alten Provinz Dacia (Dakien). Das machte allen slawischen Gruppen und auch den Ungarn einen Strich durch die Rechnung, die sich auf einen Ankunftszeitraum zwischen 660 und 900 n. Chr. geeinigt hatten. Eine Eigenheit vieler rumänischer Städte sind die Kopien der römischen Plastik von Romulus und Remus, die von ihrer Wolfsmutter gesäugt werden – ein absonderliches Geschenk, das Mussolini den Rumänen Anfang der 1920er Jahre machte, um, wenig feinsinnig, anzudeuten, dass sein eigenes neues Reich einen ethnisch beglaubigten Verbündeten hatte, ein weiteres Kind Roms. Derartiges wird in diesem Buch noch öfter auftauchen, doch jedem Leser dürfte schon jetzt aufgegangen sein, für welch eigenartige und befremdliche Zwecke Geschichte in dieser Region eingesetzt wurde.
Dabei unterschieden sich die Rumänen gar nicht so sehr von den anderen Volksgruppen, denn tatsächlich sind sie aus stärker latinisierten Gebieten südlich der Donau gekommen, vermutlich aus dem heutigen Serbien oder Kroatien, womit sich die Frage erledigt hat, warum ein so raues und marginales Gebiet des alten Römerreichs wie Dacia sich trotz des sonst so drastischen Wandels ein römisches Flair bewahrt haben sollte: Das hat es gar nicht. Dieses unwillkommene Resultat sollte all die rivalisierenden nationalistischen Historiker dazu bringen, in spaßigem Erschrecken die Hände hochzuwerfen, «Schluss jetzt!» zu rufen und einen ethnisch neutralen Schnaps miteinander zu trinken: «Wenn die Rumänen ein mystisches Kernland haben, das, wie sich herausgestellt hat, in Wirklichkeit einem anderen Land gehört, dann können wir auch einfach alle nach Hause gehen.»
Wer sich zu sehr für solche Themen interessiert, begibt sich auf dem schnellstmöglichen Weg ins Delirium. Die extreme Mobilität all dieser Stämme ist verwirrend genug, und dass über Jahrhunderte hinweg schriftliche Zeugnisse fehlen, macht die Sache nicht besser. Insgesamt lässt sich wohl festhalten, dass die Germanen sich nach Westen zurückzogen und Slawen von irgendwo im heutigen Ostpolen nachdrängten, wohl auch vermischt mit weiteren Nomadenstämmen aus den asiatischen Steppen wie Awaren und Magyaren, die nach den Hunnen kamen. Immerhin könnten die Eliten der ursprünglichen Kroaten und Serben auch eine iranische Sprache gesprochen haben, womit ein Punkt erreicht sein dürfte, an dem jeder halbwegs vernünftige Mensch die Sache seinlässt.
Die Bevölkerungsbewegungen haben Spuren hinterlassen: Bruchstücke von Keramiken, Überreste von Pfahlbauten und gelegentliche, womöglich leichtfertig verfasste Kommentare von wenig informierten Mönchen, die Jahrhunderte später und ganz woanders lebten. Rekonstruiert man die Wanderungsbewegungen anhand dieser Zeugnisse mit Pfeilen auf Landkarten, ergibt sich ein erstaunlicher Spaghettisalat. Das Endergebnis dieser Migrationen lässt sich heute deutlich erkennen. Die Vorfahren der Tschechen siedelten in einer geschützten Gegend, in der die sichelförmigen Gebirgszüge Böhmerwald und Erzgebirge sie vor germanischen und fränkischen Raubzügen bewahrten. Ihre slawischen Verwandten im Norden und im Süden, die Sachsen und die Kärntner, wurden von einfallenden Germanen vernichtet oder zu deutsch sprechenden Christen gemacht, die nichts als die Namen Sachsen und Kärnten behielten. Noch weiter im Osten und Süden verbreiteten sich – in der Regel unter awarischer Oberherrschaft – die frühen Mährer, Slowaken, Russen, Ukrainer, Bulgaren, Polen, Ruthenen, Kroaten und Serben, die selbst zahlreiche weitere Untergruppen hatten, die längst ausgelöscht sind.
Über die Awaren, ziemlich bewegliche asiatische Nomaden von einer Art, die allen sattsam bekannt war, die sich in Mitteleuropa niederlassen und einem ehrlichen Broterwerb nachgehen wollten, wissen wir so gut wie gar nichts. Ihre Sternstunde hatten sie, als sie vor Konstantinopel standen, doch im Jahr 626 scheiterte die Belagerung, und die Byzantiner trieben sie ins Pannonische Becken zwischen den Karpaten und den Balkangebirgen, das zu ihrem Siedlungsgebiet wurde. Am Khaganat der Awaren zeigt sich in vielerlei Hinsicht, was das finstere Mittelalter so verwirrend macht: Wir wissen kaum etwas, haben nur knappe Hinweise aus Chroniken und wenige erhaltene Ziergegenstände, über deren Kontext nichts bekannt ist; gleichwohl hatten sie zweihundert Jahre lang die Oberherrschaft und lenkten die slawische Besiedelung in Mitteleuropa; ihr Einflussbereich erstreckte sich bis an die Ostsee und zur Wolga. Eine awarische Gesandtschaft kam 790 an den Hof Karls des Großen in Worms, um über die Grenze zwischen Frankenreich und Khaganat zu verhandeln, doch war das nur eine Waffenruhe. Schließlich aber siegten die Franken über die Awaren. Bekannt wurde die verheerende Schlacht wegen des riesigen Awarenschatzes, der nach Aachen gebracht und von Karl an seine Getreuen verteilt wurde. Damit gelangte eine ungeheure Menge Gold in den Westen, der mit derlei Reichtümern bislang nicht gesegnet war. Ein letztes Mal werden die Awaren in einer Chronik von 822 erwähnt, dann verschwinden sie aus den Aufzeichnungen. Ich wüsste zu gerne, wie diese awarischen Gesandten, die mit Karl dem Großen verhandelten, aussahen – aber wir wissen nicht einmal, wie Awaren sich kleideten oder wie sie sprachen: Dieses Volk hätte geradeso gut vom Mars sein können. Irgendwann verschwand es und ging in den slawischen Volksgruppen auf.
Im 9. Jahrhundert hatte sich Mitteleuropa in seinen Grundelementen etabliert. Das flüchtige Gebilde Großmähren oder Großmährisches Reich war eine slawische Konföderation, die zwar von großer Bedeutung war, über die wir aber enttäuschend wenig wissen, noch nicht einmal, welche Völker ihr tatsächlich angehörten. Einigermaßen sicher ist nur, dass das heutige Mähren und die Slowakei und wahrscheinlich ein Kreis von Ländern um diesen Kern dazugehörten. Tschechische und slowakische Nationalisten haben endlos darüber gestritten. Doch auch wenn dieses Reich nur einige Jahrzehnte bestand, so war es kulturell sehr bedeutsam: zum einen als Ursprung der schönen und fremdartigen glagolitischen Schrift, in der Simon etwa so aussehen würde:
(das M ist in seiner Vergänglichkeit besonders hübsch in seiner Fülle); zum anderen als Ursprung der ersten slawischen Schrift, was den unermüdlichen byzantinischen Missionaren Kyrill und Method zu verdanken ist, die das Mährerreich vom Einfluss Roms befreien wollten, indem sie mit der Schrift eine eigene slawische Liturgie entwickelten – eine Entscheidung, die sich in einer weiteren, bis heute wirksamen Grenze niederschlug, nämlich der zwischen dem römischen und dem orthodoxen Christentum.





























