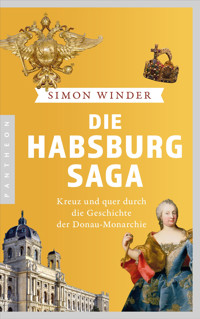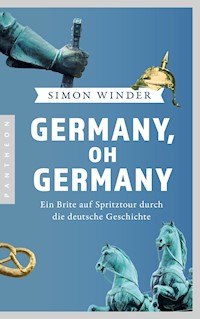8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein ebenso unterhaltsamer wie lehrreicher Trip durch Europas Herzland
Zwischen Amsterdam und Zürich, entlang des Rheins, erstreckt sich Europas Herzland – von Kaisern begehrt, von Armeen umkämpft, von Dichtern gepriesen. Wer Europa verstehen will, muss die Geschichte dieser Region kennen: den ständigen Zwist zwischen großen und kleinen Mächten, den Kampf zwischen Vereinheitlichung und trotziger Selbstbehauptung. Nicht zufällig befinden sich alle Institutionen der EU in der Region, die das Schicksal des Kontinents wie kaum eine andere widerspiegelt. Wunderbar leicht und höchst eigenwillig erzählt Simon Winder von diesem Herzland, mit all seinen Sonderbarkeiten voller Kultur, Schönheit und Schrecken: von Waterloo bis Verdun, von Asterix bis zu den Nibelungen, von Rubens bis Karl Marx, von Gouda bis zum Edelzwicker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 908
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Zeichnung Die Imker von Pieter Brueghel d. Ä., 1565. Siehe »Das Leben im Garten«, Kapitel sieben (bpk/Kupferstichkabinett, SMB/Jörg P. Anders).
Zum Buch
Zwischen Amsterdam und Zürich, entlang des Rheins, erstreckt sich Europas Herzland – von Kaisern begehrt, von Armeen umkämpft, von Dichtern gepriesen. Wer Europa verstehen will, muss die Geschichte dieser Region kennen: den ständigen Zwist zwischen großen und kleinen Mächten, den Kampf zwischen Vereinheitlichung und trotziger Selbstbehauptung. Nicht zufällig befinden sich alle Institutionen der EU in der Region, die das Schicksal des Kontinents wie kaum eine andere widerspiegelt. Wunderbar leicht und höchst eigenwillig erzählt Simon Winder von diesem Herzland mit all seinen Sonderbarkeiten voller Kultur, Schönheit und Schrecken: von Waterloo bis Verdun, von Asterix bis zu den Nibelungen, von Rubens bis Karl Marx, von Gouda bis zum Burgunder.
Zum Autor
Simon Winder, geboren 1963 in London, ist Cheflektor des englischen Verlags Penguin Books. Dort betreut er unter anderem die Bücher vieler bedeutender Historiker. 2010 erschien sein Bestseller »Germany, oh Germany: Ein eigensinniges Geschichtsbuch«, 2016 »Kaisers Rumpelkammer: Unterwegs in der Habsburger Geschichte«.
SIMON WINDER
HERZLAND
Eine Reise durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich und Deutschland
Aus dem Englischen vonNathalie Lemmens
Siedler
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Lotharingia. A Personal History of France, Germany and the Countries in Between« bei Picador.Die Abbildung auf der Titelseite zeigt einen Ausschnitt aus dem Leichenzug von Erzherzog Albrecht, Kupferstich von Cornelis Galle nach Jacques Franckaert, 1623 (Rijksmuseum, Amsterdam). Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © Simon Winder 2019Copyright © 2020 für die deutsche Ausgabeby Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt
Covermotiv: © picture-alliance/akg-images/Erich Lessing; © picture alliance/dpa/Paul Zinken; © picture alliance/Heritage Images/CM Dixon; © picture alliance/Zoonar/Cipariss
Lektorat und Satz: Peter Palm, Berlin
Karten: Peter Palm, Berlin
Reproduktionen: Aigner, Berlin
ISBN 978-3-641-18821-4V002www.siedler-verlag.de
Für CMJ
Am Tag des Jüngsten Gerichts wird man uns nicht fragen, was wir gelesen, sondern was wir getan haben …
THOMAS VON KEMPEN
INHALT
EINLEITUNG
Ein paar Worte zu mir und meinem Verhältnis zu Frankreich
Ein paar Worte zu den Ortsnamen
KAPITEL EINS
Von Eisschilden zu Asterix
Der Kriegsherr
Childerichs kostbare Bienen
Die Herrschaft der Heiligen
Rheingold
Der Ruf des Olifants
KAPITEL ZWEI
Karls geteiltes Erbe
Adlige Herrschaften und städtischer Handel
Glanz und Elend der Kaiser
Der Aufstieg des Jungen aus Boulogne
Die Zisterzienser
KAPITEL DREI
Die rheinische Sibylle
Ein paar Fakten
Geschichten vom Wolf Isegrim
Straßenszenen
Die Kathedrale von Amiens
Hunger, Pest und Überschwemmung
Der Kühne und der Wahnsinnige
KAPITEL VIER
Der Furchtlose und der Gute
Betnüsse
Ein Rat von Mehmet dem Eroberer
Eine Stadt trifft die falschen Entscheidungen
Der Kühne und die Schweizer
KAPITEL FÜNF
Das große Erbe
Maria die Reiche und die Zukunft der Welt
Frischer Wind auf der Habichtsburg
»Hüte dich, hüte dich, Gott sieht!«
Viele Verwendungsmöglichkeiten für Papier
KAPITEL SECHS
Die neue Welt
Margarete von Österreich
Leben und Abenteuer Kaiser Karls V.
Die Oranier
Der Aufstand der niederländischen Provinzen
Das katholische Anliegen
KAPITEL SIEBEN
Die Leiden der »Lady Belge«
Das Leben im »Garten«
Vögel, Tiere und Blumen
Krisen-Croissants
Weiße Wände und farbloses Glas
KAPITEL ACHT
»Eine solch freudvolle Ernte«
Schwertfechter und Seifensieder
Elisabeth und ihre Kinder
Onkel Tobys Steckenpferd
»Zu spät ist es schon, noch ehrgeizig zu sein«
KAPITEL NEUN
Nancy und Lothringen
Der Wiederaufbau des Rheinlands
Sperma bei Kerzenschein
Blattgold und Vogelmist
Abenteuer in Mikrostaaten
In der Perückenzeit
KAPITEL ZEHN
Eine »heroische, ahndungsvolle Tat«
»Die alten Zeiten sind dahin«
Der große französische Lebkuchenbäcker
Die Küstenarmee
Die neue europäische Ordnung
»Viel lieber Tod als ein schimpfliches Leben!«
KAPITEL ELF
Seltsame Vorgänge unter Tage
Der neue Rhein
Das Amt für die Übersetzung Barbarischer Bücher
Aufruhr in Baden
Ein Neufundländer in Luzern
Von Großherzögen, Kaisern und Königen
KAPITEL ZWÖLF
Kilometerschweine
Das Exil der französischen Herrscher
Metz und die nationalistische Front
Ein Meer aus grünem Tuch
Gewehrkugeln, Elfenbein und Kautschuk
Rochen und Masken
KAPITEL DREIZEHN
»Kasernen, Kasernen, Kasernen«
Kriegspläne
Die Grenzschlachten
Kilometer Null
Rot, Gelb und Blau
Die Schmach am Rhein
KAPITEL VIERZEHN
Träume von Korfu
Mauern und Brücken
Das Königreich der Matratzen
Der Weg nach Straßburg
Armageddon
Karl der Große kommt nach Hause
NACHWORT
ANHANG
Dank
Karten
Bibliografie
Personenregister
Eine mittelalterliche Miniatur aus den Chroniques des rois de France mit einer leicht schematischen Darstellung von Ludwig dem Frommen (rechts), der postum der Aufteilung des Reichs in Westfranken (Karl der Kahle), Lotharingien (Lothar I.) und Ostfranken (Ludwig der Deutsche) seinen Segen erteilt (Alamy).
EINLEITUNG
Eines Tages war ich in den Ardennen unterwegs von Stavelot nach Spa. Ich saß in einem Bus voller Schüler jeglichen Alters und war, abgesehen von dem unerschütterlichen Busfahrer mit seinem bewundernswert steinernen Gesichtsausdruck, der einzige Erwachsene an Bord. Es herrschte tiefster Winter. Der Nebel war so dicht, dass ich das Gefühl hatte, man müsse sich die Nebelfäden aus dem Haar kämmen und vom Mantel bürsten, kaum dass man ausgestiegen war. Der Bus glich einem Tollhaus auf Rädern. Eines der Kinder kokelte mit einem Feuerzeug einen Plastikgriff an, ein anderes hatte eine App auf seinem Handy, mit der es die Fotos seiner Freunde in Dämonenfratzen verwandelte. Immer wieder flog unter lautem Gejohle ein aufgeblasenes Kondom über unsere Köpfe hinweg. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, und ich stellte mir vor, dass der Bus wie in einem fröhlichen Cartoon beim Fahren hin und her schwankte. Plötzlich sehnte ich mich nach den längst vergangenen Zeiten zurück, als ich selbst auf verschiedenen Schulhöfen darauf gewartet hatte, dass meine Kinder herauskamen. Ich hatte vergessen, wie unbeständig die Stimmung in Kindergruppen sein kann, dass sie wie durch Zauberhand von einer Sekunde zur nächsten niedergeschlagen, aufgeregt, erschöpft oder völlig überdreht sein können.
Jeder Halt des in Nebel gehüllten Busses war für mich eine Überraschung. Sobald die Türen zischend aufglitten, stürmten ein paar Kinder hinaus in die weißliche Watte, aus der hier und da ein kahler Ast hervorragte. Nur die gerade noch erkennbare Ecke eines Dachs ließ erahnen, dass dort auch Häuser sein mussten. Wir befanden uns buchstäblich mitten im Nirgendwo – in einer rauen Gegend mit dünn besiedelten Tälern, die zu bereisen den meisten Europäern nie im Leben in den Sinn käme. Aus der Luft betrachtet hätte man sehen können, dass sie bis zum Rand mit Nebel gefüllt waren.
Wie so viele Orte, über die ich in diesem Buch schreiben werde, waren diese einsamen Täler für kurze Zeit der Mittelpunkt der Welt. Hier fand die Ardennenoffensive statt – der letzte umfassende Versuch der Deutschen, die westlichen Alliierten zu besiegen. In der kleinen Stadt Stavelot, von der ich zuvor noch nie gehört hatte, erreichte die Schlacht im Dezember 1944 ihren Höhepunkt. Amerikanische Truppen hatten zahllose Brücken zerstört und Tausende Bäume gefällt, mit denen sie die schmalen Straßen blockierten, während die Deutschen hastig Pontons bauten und die Hindernisse in die Luft sprengten. Bei ihrem Vormarsch drangen sie nach Stavelot ein, brachten Dutzende Einwohner um, schafften es aber nicht, sich einen Weg durch den Ort freizukämpfen. Auch der Versuch, die Stadt zu umgehen, misslang. So machten sie schließlich kehrt und läuteten damit jenen Rückzug ein, der mit ihrer Kapitulation im Mai 1945 endete. Ein kleiner Gedenkstein in der Stadt verkündet: HIER WURDE DER VORMARSCH DER INVASOREN GESTOPPT.
Ich war von dem gleichen Nebel umgeben, der den Vorstoß der Deutschen durch die Ardennen zunächst so erfolgreich gemacht hatte, aber diese Offensive war nur eine der Episoden, die die Region im 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt des Weltgeschehens rückte. Vier Jahre zuvor, im Frühjahr 1940, hatten Tausende deutscher Panzer und Mannschaftswagen hier den Grundstein für die nahezu umgehende vernichtende Niederlage der britischen und französischen Armeen gelegt, indem sie unbemerkt über ebendiese gewundenen Sträßchen nach Frankreich vorrückten.
Nicht weit von Stavelot entfernt liegt der Kurort Spa. Dort befand sich in der Spätphase des Ersten Weltkriegs das große Hauptquartier der deutschen Streitkräfte. Fotos aus dem Jahr 1918 zeigen Kaiser Wilhelm II., den Kronprinzen und mehrere Generäle in makellosen Uniformen, wie sie während der letzten Wochen der kaiserlichen und aristokratischen Herrschaft in einem der beschlagnahmten Kursäle plaudernd beieinanderstehen. Hier bat der Kaiser, nachdem er vom Ausbruch der Revolution in Berlin erfahren hatte, seine Generäle um Unterstützung und musste von ihnen hören, dass sie ihren Truppen nicht mehr trauten und befürchteten, der Kaiser könne von seinen eigenen Soldaten angegriffen werden. Wilhelm floh daraufhin in Panik in die Niederlande und ließ sogar seinen Hofzug zurück aus Angst, er könne beschossen werden. Das war das Ende von mehr als acht Jahrhunderten Hohenzollernherrschaft.
1944 nutzte die US Army Spa als Hauptquartier, evakuierte dieses jedoch, als nach der im Schutz des Nebels erfolgten deutschen Überraschungsoffensive vorübergehend Panik ausbrach.
Der ursprüngliche Grund für meinen Besuch in Stavelot waren mein schlechtes Gewissen und mein Ärger darüber, dass ich den Namen dieses Ortes noch nie zuvor gehört hatte. Dabei war das Kloster Stablo im 12. Jahrhundert einer der wichtigsten Anziehungspunkte der Region, wie man noch heute in dem sensationellen Museum sehen kann, das in der imposanten ehemaligen Abtei untergebracht ist. In Stavelot erkannte ich allerdings auch, dass mit dem ständigen Umherreisen für dieses Buch unbedingt Schluss sein musste. Denn diese Region, gleichermaßen verschlafenes Ende der Welt wie Schauplatz von Ereignissen, die das weitere Schicksal der Menschheit bestimmt haben, barg eine schier endlose Fülle von historischen Details und Ereignissen. Hier saß ich nun in einem Bus mit den Urenkeln und Ururenkeln von Menschen, die »historische« Ereignisse unterschiedlichster und fürchterlichster Art miterlebt hatten, doch diese unbeschwerten Kinder mit ihren bunten Rucksäcken und ihrer nimmermüden Bereitschaft, unvermittelt in Lachkrämpfe auszubrechen, sobald eines von ihnen furzte, hatten von all dem nicht die geringste Ahnung. Meine eigenen Kinder waren inzwischen erwachsen, und ich erkannte in diesem Augenblick mit Bestürzung, wie viel Zeit ich fern von ihnen verbracht hatte, während ich durch Dutzende von Orten wie Stavelot streifte und dort immer wieder vor derselben Frage stand: Warum waren die Ideen und Ereignisse Europas über all diese Orte hinweggefegt, die doch eigentlich nur in Ruhe gelassen werden wollten?
Schon lange träume ich davon, einmal schreiben zu können: Dieses Buch ist der Abschluss einer Trilogie. Und jetzt ist es so weit! In Germany, oh Germany habe ich die Geschichte von Menschen deutscher Sprache erzählt, mehr oder weniger beschränkt auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Obwohl ich mich bemüht habe, das Buch geografisch ausgewogen zu gestalten, verlagerten sich seine Schauplätze immer wieder Richtung Osten, wo ich hemmungslos in der Vergangenheit der beschaulichen Städtchen Thüringens und Sachsen-Anhalts schwelgte. Danach schrieb ich Kaisers Rumpelkammer, um auch auf die Deutschen in Österreich und anderen Regionen im Osten einzugehen, die ich in Germany, oh Germany ausgeklammert hatte. Da die deutsche Kultur sich bis ins 20. Jahrhundert über ganz Mitteleuropa verbreitet hatte, kam ich bei meinen Recherchen auf diesem Gebiet mit vielen anderen Themen in Berührung, für die ich mich ebenfalls interessiere – rivalisierende Nationalgefühle, die Familie der Habsburger mit ihren skurrilen Eigenheiten oder die Auseinandersetzungen zwischen Christen und Osmanen, die diese Region über Jahrhunderte hinweg geprägt haben.
Als jemand, der in Zeiten des Kalten Krieges aufgewachsen ist, war ich wie viele in meiner Generation fasziniert von der Entdeckung dieser »neuen«, zuvor so gut wie unerreichbaren ehemaligen kommunistischen Gebiete hinter dem Eisernen Vorhang und neigte dazu, die vertrauteren westlichen Teile Europas als selbstverständlich hinzunehmen. Doch schon beim Verfassen von Germany, oh Germany beschlich mich das vage Gefühl, ein wenig zu mogeln und mich nicht angemessen mit dem vielleicht wichtigsten Motor europäischer Entwicklungen zu beschäftigen: den Ländern im Westen. Weil sie wie Großbritannien Teil der Europäischen Union waren und für mich nicht Geschichte, sondern Gegenwart und banale Alltäglichkeit verkörperten, hatte ich sie bis dahin gar nicht richtig wahrgenommen. Dabei hätte ich mit einigem Nachdenken längst darauf kommen können, dass die Gebiete westlich des Rheins und die Beziehungen zwischen den Menschen deutscher und französischer Sprache, die dort leben, das wohl unbanalste Thema darstellen, das man sich nur vorstellen kann.
Das Leitmotiv dieses Buches beruht auf einer der wichtigsten, wenn auch eher ungeplanten Entwicklungen der europäischen Geschichte. Karl I., der »Große«, widmete seine lange und überaus erfolgreiche Karriere der Schaffung eines gewaltigen Reichs, das einen großen Teil des nordwestlichen Kontinentaleuropas umfasste. Diese Leistung war jedoch in hohem Maße sein ganz persönliches Verdienst, weshalb es nach seinem Tod im Jahr 814 nicht mehr lange Bestand hatte. Der Charakter seiner Nachfolger, neue Feinde und die schier unbeherrschbare Ausdehnung des Gebietes ließen das Karolingische Reich in einen Bürgerkrieg taumeln.
843 kamen seine Enkel in dem kleinen Ort Verdun zusammen und einigten sich darauf, das Reich in drei Teile aufzuspalten. Es war bei den Franken nicht unüblich, Territorien unter Geschwistern aufzuteilen, und sie kannten auch von jeher die Unterscheidung zwischen dem älteren Austrien (dem »östlichen Land«) am Rhein und dem jüngeren Block Neustrien (dem »neuen westlichen Land«) an der Seine. Nun aber kam es zu einer Dreiteilung: Karl II., der Kahle, erhielt den Westen, das künftige Frankreich. Ludwig II., der Deutsche, bekam den Osten, das künftige Deutschland. Und der lange Streifen in der Mitte, zu dem auch die Kaiserstadt Aachen gehörte, fiel an den beinamenlosen Lothar I. Dessen kaum überschaubares Erbteil erstreckte sich von der Nordseeküste bis nach Mittelitalien und wurde nach seinem Tod abermals aufgeteilt. Von seinen drei Söhnen erhielt der ältere Norditalien, der jüngere die Provence und der mittlere, Lothar II., das Gebiet nördlich davon, das von nun an seinen Namen tragen sollte: Lotharingien, »das Reich Lothars«.
Dieses Reich zwischen Nordsee und Elsass ist über die Jahrhunderte zu einem kleinen Rest zusammengeschmolzen – im Französischen »Lorraine«, auf Deutsch immer noch »Lothringen«. Die Frage, was dieses »Lotharingien« eigentlich ausmacht, hat seit 843 unzählige Wandlungen erfahren, aber sie stellt sich bis heute. In jedem Jahrhundert haben sich an Lotharingien Kriege entzündet, und es war Schauplatz zahlreicher Ereignisse, die die europäische Zivilisation prägten. Manchmal wurde die Lücke zwischen Ost- und Westreich beinahe vollständig geschlossen – schon unmittelbar nach dem Tod Lothars II. war Lotharingien vom endgültigen Verschwinden bedroht –, und doch hat sich die Region ihren intermediären Status über mehr als tausend Jahre bewahrt. 2017 liegen auf dem Gebiet von Lothars ehemaligem Reich die Königreiche Belgien und Niederlande, das Großherzogtum Luxemburg sowie der nördliche Teil der Schweizerischen Eidgenossenschaft, und der Rest verteilt sich auf die Republik Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland. All diese Länder sind hervorgegangen aus dem geradezu irrwitzigen Flickenteppich, den ihre unterschiedlichen Vorgängerstaaten einst bildeten. In diesem Buch möchte ich nicht nur einen Überblick zu deren Historie geben, sondern vor allem aufzeigen, in welcher Weise die Region eine entscheidende Triebfeder für wesentliche Entwicklungen der europäischen Geschichte gewesen ist.
Aus praktischen Gründen habe ich beschlossen, Lotharingien dort beginnen zu lassen, wo der Rhein aus dem Bodensee austritt, und beziehe zunächst beide Ufer des Hochrheins inklusive der nördlichen Kantone der Schweiz mit ein. Sobald wir die Schweiz hinter uns gelassen haben, bildet der Rhein die östliche Grenze Lotharingiens, während es westlich des Rheins jene heute französischen Territorien umfasst, die über viele Jahrhunderte zum Heiligen Römischen Reich gehörten. Bei dieser Abgrenzung war ich zu einigen schmerzlichen Einschränkungen gezwungen. Die erste davon betrifft Genf. Der Bogen des Genfersees bildet zwar eindeutig das südliche Ende des behandelten Bereichs, doch Genf selbst musste ich ausklammern, da die Stadt lange Zeit zu Savoyen gehörte, sich nach Süden orientierte und eng mit den Geschicken Turins und des restlichen Italien verbunden war. Hätte ich Italien auch noch aufgenommen, wäre dieses Buch zwangsläufig zum Scheitern verurteilt gewesen. Was die Rheinufer betrifft, bin ich ziemlich konsequent – es gibt also viele Ausführungen zu den Gebieten westlich des Rheins, aber jenseits des Flusses bewege ich mich kaum weiter nach Osten, um nicht von Städten wie Frankfurt ins eigentliche Deutschland hineingelockt zu werden. Die einzige Ausnahme in dieser Hinsicht ist Heidelberg, da große Teile seines Herrschaftsbereichs – der Kurpfalz1 – links des Rheins lagen. Sobald sich das Gewirr der Rheinarme in den Niederlanden ausbreitet, bin ich wiederum recht großzügig in Bezug auf das, was ich aufnehme, und mache erst kurz vor Nordholland Halt. Südlich davon schließe ich jene nordfranzösischen Gebiete mit ein, die in der Vergangenheit ebenfalls umstritten waren – bis hin zu den alten Territorien der Grafen von Flandern nördlich der Somme, die seit Menschengedenken immer wieder Soldaten mit frischem Sold und stetem Kummer versorgten.
Alles in allem umfasst Lotharingien also ein riesiges Gebiet, aber es gibt dort erstaunlich wenig große Städte oder gar Metropolen. Dennoch hat diese Region es immer wieder verstanden, fremde Staaten mit sehr viel größeren Ressourcen und viel weiteren Horizonten ins Chaos zu stürzen. Die Herrscher in Paris, London, Amsterdam, Berlin, Wien, Rom und Mailand, die ihre begehrlichen Blicke auf Lotharingien richteten, sahen dort entweder Chancen oder Probleme, die ihnen Kopfzerbrechen bereiteten – und ebendieses Kopfzerbrechen prägte ganze Epochen, was nicht selten dazu führte, dass große Dynastien wutschnaubend und frustriert in die Knie gingen.
Um meinem Entschluss, mich nicht mit Städten außerhalb des lotharingischen Gebietes zu beschäftigen, treu zu bleiben, habe ich Bern ebenso unerwähnt gelassen (zumindest weitestgehend – ein, zwei Dinge musste ich einfach ansprechen) wie Dijon (eindeutig Kernbestandteil Frankreichs, aber gleichzeitig auch ein wichtiges Zentrum der Herzöge von Burgund während jener magischen hundertzwanzig Jahre, in denen sie den lotharingischen Flöz ausbeuteten). Auf Dijon habe ich nur unter Tränen verzichtet, entgingen mir doch dadurch unzählige Flaschen Nuits-Saint-Georges und Platten voller Schinken-Petersilien-Sülze, die ich aus Recherchegründen hätte probieren müssen. Amsterdam ist sicher die diskussionswürdigste Auslassung, aber so wie Genf den Leser im Süden zu weit in ferne Regionen führt, verlagert Amsterdam die Geschichte zu sehr nordwärts in die Ostseegebiete, nach Friesland und hin zu einer Reihe weiterer Verlockungen, die seine Einbeziehung problematisch machen. Außerdem galt Amsterdams Interesse, historisch betrachtet, ähnlich wie das von London oder Madrid meist entfernteren Regionen und weniger den Gebieten in seinem unmittelbaren Süden. Amsterdam hatte stets Wichtigeres im Sinn und lag zudem so weit im Norden, dass es selbst so gut wie nie in die Schusslinie der verheerenden Ereignisse weiter südlich geriet – allerdings hat es diese oft genug angestachelt und finanziert, was denjenigen, die darunter zu leiden hatten, bittere Kommentare entlockte.
Wie schon meine beiden früheren Bücher erfordert auch dieses die Bereitschaft zu einer Art Gedankenspiel, wenngleich keinem sehr mühsamen. Viele der politischen Gebilde, die hier beschrieben werden, existierten jahrhundertelang mit einer Robustheit und langfristigen Selbstverständlichkeit, die ihnen eine unhinterfragte Akzeptanz verliehen. Wir mögen heute über das Herzogtum Bar lachen, das auf der Karte aussieht, als hätte jemand eine Handvoll Frühstücksflocken verschüttet, doch es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass den vielen Generationen, die dort einst lebten, die offenkundige Lebensunfähigkeit ihres Ministaates peinlich gewesen sei – zumindest nicht bis zum 18. Jahrhundert. Die alte Reichsabtei Prüm, deren einziger nennenswerter Schatz die – ziemlich abgelatschten – Sandalen Christi waren, die sie von Pippin, dem Vater Karls des Großen, erhalten hatte, bewahrte über Jahrhunderte hinweg ihre Eigenständigkeit, lockte mit erstaunlichem Erfolg einen schier endlosen Strom von Pilgern an und büßte ihren Status erst ein, als die Region von Napoleon überrannt wurde.
In jeder Epoche gehen die Menschen davon aus, dass sie selbst in einer vernünftigen Ordnung leben, und blicken voller Mitleid auf die politische Dummheit früherer, weniger zivilisierter Zeitalter. Wir wachsen unter bestimmten Umständen auf und halten diese für naturgegeben. Doch auch im 21. Jahrhundert strotzt »Lotharingien« noch von auf den ersten Blick höchst unsinnigen geografischen Gegebenheiten. Bei einer Reise vom südlichen Ende der heutigen Region gen Norden trifft man auf Kuriositäten wie die Konstanzer Stadtteile Paradies und Altstadt, die als einzige am südlichen – also Schweizer – Rheinufer liegen, den seltsamen Grenzverlauf des dreiteiligen Kantons Schaffhausen, die sinnfreien Verästelungen und Exklaven des Kantons Solothurn und das winzige französische Département Belfort (erhalten geblieben in Anerkennung der erfolgreichen Verteidigung der Stadt im Deutsch-Französischen Krieg – ein seltener Lichtblick). Ferner auf das absurd kleine deutsche Bundesland Saarland (ein Nebenprodukt der Pariser Bemühungen, nach beiden Weltkriegen das Gebiet für Frankreich zu annektieren), das Großherzogtum Luxemburg (das nur deshalb noch existiert, weil Frankreich und Preußen in den 1860er Jahren keine Lust hatten, sich darum zu streiten), die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (1919 als Kriegsbeute in das Staatsgebiet eingegliedert, obwohl dies damals wie heute nicht den geringsten Sinn ergab), den sonderbaren niederländischen Wurmfortsatz um Maastricht, die 22 winzigen Flecken von Baarle-Hertog (in den Niederlanden gelegen, aber aufgrund übellaunigen Gezänks in den 1840er Jahren noch heute belgisches Hoheitsgebiet) und als krönenden Abschluss jenes niederländische Territorium mit dem hübschen Namen Seeländisch-Flandern, einen breiten Streifen eingedeichten Ackerlands, der von den restlichen Niederlanden aus lediglich per Schiff oder durch einen neuen Autotunnel zu erreichen ist – ein Relikt der langen Blockade der Scheldemündung, durch die der rivalisierende Antwerpener Hafen abgeriegelt werden sollte.
Es gibt sicher noch mehr solcher Beispiele (man denke nur an die beiden kleinen kanadischen Hoheitsgebiete in Nordfrankreich, die dem Land als Standorte für Weltkriegsgedenkstätten überlassen wurden). Alle diese kleineren und größeren »Geröllstücke« sind typisch für Lotharingien. Als Belege für die eigentümliche Vergangenheit der Region verkörpern sie eine beinahe geologische Kontinuität, die die Landstriche von weiten Teilen des restlichen Europa unterscheidet. Indem diese fragmentierten politischen Einheiten sogar die erbitterten Bemühungen der französischen Nachrevolutionszeit und des Zweiten Weltkriegs überstanden, als ganz Europa in ein einziges rationales Ganzes gepresst werden sollte, sprechen sie solchen Bestrebungen geradezu Hohn.
Ein paar Worte zu mir und meinem Verhältnis zu Frankreich
Mit vierzehn Jahren bin ich zum ersten Mal in meinem Leben geflogen. Meine Eltern setzten mich ins Flugzeug und schickten mich mutterseelenallein auf einen Bauernhof nordöstlich von Meaux, wo ich Französisch lernen sollte. Mein Gemütszustand entsprach in etwa dem jener unbeachteten kleinen Säugetiere, die im Zoo in der hintersten Ecke ihres Käfigs auf schmutzigem Stroh kauern, die Ohren flach an den Kopf angelegt und den Blick von grenzenloser Panik erfüllt.
Mit unseren eigenen Kindern haben wir jahrelang Varianten des Themas Frankreichaustausch durchgespielt: »Entweder du machst jetzt deine Hausaufgaben, oder du fährst für sechs Wochen nach Clermont-Ferrand und isst Lammhirn!« Aber im Gegensatz zu uns meinten meine Eltern es ernst. Meine Mutter war mit achtzehn, neunzehn als Au-pair-Mädchen zu einer französischen Familie gekommen, die wir einmal besuchten, als meine Schwestern und ich noch ziemlich klein waren. Wir kamen aus einem fröhlichen Mittelschichtshaushalt im näheren Umland von London und fanden diese französische Familie mit ihren Gewehren und Hunden und tartes, den Wendeltreppen und Monsieur in seinem langen Mantel umwerfend exotisch. Das Haus war eine ehemalige Priorei mit einer verfallenen Kapelle, in der es ein mit menschlichen Schädeln gefülltes Taufbecken gab – wir haben nie herausgefunden, ob das als Ausdruck laizistischer Verachtung gedacht war oder sie einfach bloß aufgeräumt hatten. In der Familie lebte auch ein deutscher Student, der gerade seinen Militärdienst abgeleistet hatte und uns Gewehrgriffe zeigte, indem er meine vierjährige Schwester als Waffe benutzte und sie anwies, sich ganz starr zu machen. Es waren seltsame Tage.
Den allerpeinlichsten Moment dieses Frankreichaufenthalts erlebte ich während eines förmlichen Mittagessens, zu dem sich neben der Familie noch eine schier endlose Zahl merkwürdiger französischer Erwachsener eingefunden hatte. Die Vorspeise bestand aus sehr eigentümlichen Rindfleischstreifen, und schon beim allerersten Bissen sprangen meine Kiefer regelrecht auseinander. Während alle anderen ungezwungen plauderten, wurde ich von qualvoller Hilflosigkeit erfasst und erstickte beinahe bei dem vergeblichen Versuch, diesen ledrigen Happen hinunterzuschlucken. Rettung nahte in Gestalt eines großen, streng riechenden Schnauzers namens Clovis. In dem verwegenen Bemühen, mein Fleischproblem zu lösen, begann ich ihn unter dem Tisch mit kleinen Stückchen zu füttern. Das funktionierte ausgesprochen gut, und schon bald war mein Teller leer. Ich weiß nicht mehr genau, was mich dann bewog, Clovis unter dem Tisch noch ein Stückchen geröstetes Baguette zu reichen. Vermutlich war es Dankbarkeit für seine Hilfsbereitschaft. Ganz gewiss aber war es ein katastrophaler Fehler, denn die lauten Knurpsgeräusche brachten das Tischgespräch abrupt zum Verstummen, bevor unversehens ein Tumult losbrach. In meiner abgrundtiefen Verlegenheit fiel ich in eine Art Trance und habe keinerlei Erinnerung mehr an die weiteren Ereignisse, abgesehen von dem, was meine Eltern mir später erzählten (offenbar rührte die allgemeine Aufregung daher, dass Clovis, der Stolz des gesamten Haushalts und langjährige Freund aller Familienmitglieder, inzwischen zahnlos und gebrechlich und daher auf spezielle Flüssignahrung angewiesen war). Allerdings ist bei ihren Schilderungen einige Vorsicht geboten, da meine Eltern stets eine große Vorliebe für jenes Ineinanderfließen wahren und aufgesetzten Entsetzens hegten, an dem die Franzosen eine solche Freude haben.
Ich erwähne dies, weil meine Schwestern und ich über das scheinbar unendliche von dieser Priorei ausgehende Netz familiärer Verbindungen in den darauffolgenden Jahren mit zahllosen Frankreichaufenthalten versorgt wurden. Diese Kontakte sollten einen nachhaltigen Einfluss auf uns ausüben: Eine meiner Schwestern machte einen Abschluss in modernen Sprachen, arbeitete eine Weile in Paris und verbrachte überhaupt viel Zeit in Frankreich. Die andere heiratete einen Franzosen und lebt seit Jahren in der Bretagne. Ihre beiden Kinder sind so außerordentlich französisch, dass man meinen könnte, sie hätten dieses unnachahmliche Lippenschürzen und Schulterzucken in einem Intensivkurs an einer gallischen Schauspielschule gelernt.
Meine eigenen Erfahrungen waren weniger erfreulich – was vor allem auf meine mangelnde Begabung für (und meine daraus resultierende Abneigung gegen) Fremdsprachen zurückzuführen ist. Es erschien mir einfach unvorstellbar, dass ich zwei Wochen Schulferien dafür opfern sollte, Französisch zu sprechen – oder vielmehr nicht zu sprechen. Verschlimmert wurde das Ganze (falls eine Steigerung überhaupt möglich war) durch den »Austausch«-Aspekt, denn das bedeutete, dass ein Junge anschließend bei mir zu Hause auftauchen, noch mehr Ferienwochen blockieren und genauso wenig Englisch lernen würde wie ich Französisch. Nicht von ungefähr war mein erster Versuch auf dem Gebiet belletristischer Prosa der Entwurf zu einem Roman, in dem ein französischer Junge, dessen Familie einen englischen Austauschschüler aufgenommen hat, diesen umzubringen versucht, indem er ihn von einer Klippe stößt. Durch reines Glück landet der englische Junge auf einem Felsvorsprung, von dem er sich mühsam in Sicherheit bringen kann. Die zweite Hälfte sollte von dem französischen Jungen handeln, der nach dem Scheitern seines Plans nach England geschickt wird, wo er langsam, aber sicher dem Wahnsinn verfällt, weil er einer unglaublichen Vielfalt an Fallen (Fußangeln, glitschigen Öllachen, Giften, außer Kontrolle geratenen Autos usw.) ausweichen muss, die der stilvolle, einfallsreiche englische Junge für ihn arrangiert. Ich weiß noch, wie viele Momente der geistigen Leere dieses fiktive Romanprojekt mit dem Titel Schüleraustausch während der sterbenslangweiligen Stunden ausfüllte, in denen ich Schach spielte oder den Tower besichtigte mit französischen Jungen, die ebenso wenig daran interessiert waren, Englisch zu lernen, wie ich Französisch.
Doch genug davon, schließlich erzähle ich das alles nicht, um diese Seiten mit Anekdoten aus meiner Teenagerzeit zu füllen, sondern weil ich eine Vorstellung davon vermitteln möchte, wie nervös mich der Gedanke macht, über französische Geschichte zu schreiben. Im Rückblick ist mir klar, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich damals noch keine Bücher aus jener reichen englischen Tradition gelesen hatte, die Frankreich als den Schauplatz sexueller Initiation jugendlicher Briten präsentiert. Hätte ich das seinerzeit schon gewusst, wäre jeder Moment, den ich durch das gesellschaftliche Dickicht der Franzosen manövrierte, von einem erwartungsvollen Rausch begleitet gewesen, während diese sich ihrerseits ihrer alten Verpflichtungen gegenüber jungen englischen Hausgästen schmerzlich bewusst waren. Es fällt mir schwer, nicht noch im Nachhinein leisen Groll darüber zu empfinden, wie viele Söhne und Töchter, Väter und Mütter mich taxiert haben und zu dem Schluss gekommen sein müssen: »Nein, wohl eher nicht.« Vielleicht stritten sie, nachdem ich den Raum verlassen hatte.
Meine Beziehung zur französischen Sprache lässt sich mit einem kleinen Hund vergleichen, der das Futter auf dem Tisch riecht, es aber nicht erreichen kann und keine Ahnung hat, wie es aussieht. So viele Aufenthalte in Frankreich – das Geldwechseln, das Abholen am Flughafen, die höflichen Unterhaltungen bei den Mahlzeiten –, und dennoch habe ich die Abschlussprüfung der letzten Klasse nur mit knapper Not bestanden. Zweimal besuchte ich die Familie auf dem Bauernhof nordöstlich von Meaux. Es war eine bemerkenswerte Erfahrung. Die Eltern waren beeindruckend, energisch und freundlich. Wir gingen zum Tontaubenschießen, fuhren in Monsieurs altem Jeep, der vom D-Day übrig gebliebenen war (auf der Motorhaube prangte noch der weiße Stern der Amerikaner), durch die Gegend, fütterten Hühner, suchten im Wald Pilze und aßen Gehirn auf Toast.
Auf diese Weise verbrachte ich viele Stunden damit, kein Wort Französisch zu sprechen. Einmal saßen wir im Wagen, und einer der jüngeren Brüder meines Austauschpartners sagte über mich: »Der ist doof wie Vieh«, was ich zwar verstand, worauf ich jedoch nichts erwidern konnte. Und so unternahmen wir weiterhin Spaziergänge, spielten Tischtennis, sammelten noch mehr Pilze, sahen fern – taten einfach alles, was uns davor bewahrte, miteinander reden zu müssen. Ich hatte die geniale Idee gehabt, André Gides Symphonie Pastorale mitzunehmen, weil die englische Übersetzung den gleichen Titel hatte wie das französische Original. Ich hoffte, ich könnte diese lesen, ohne dass jemand es merkte. Noch heute erinnere ich mich daran, wie Madame, das Buch in der Hand, mir mit trauriger, vorwurfsvoller Miene entgegensah, als ich vom Pingpong-Spielen hereinkam.
Wir wanderten oft durch das Flusstal des Ourcq, und hin und wieder kamen wir an kleinen Gedenkstätten vorbei, denen ich damals keine Beachtung schenkte. Erst später begriff ich, dass auf diesen Feldern im September 1914 die Erste Schlacht an der Marne begonnen hatte, die vielleicht wichtigsten Tage des 20. Jahrhunderts. Ich muss aufhören, über diese Zeiten zu schreiben. Ich habe diese Familie so sehr bewundert und sie trotzdem nicht für ihre Mühen belohnt, indem ich wenigstens versucht hätte, ein bisschen Französisch zu lernen.
Inzwischen bin ich Mitte fünfzig, und mein Französisch ist immer noch grauenhaft. Ein Teil von mir wünscht sich eine Privatbibliothek mit goldgeprägten französischen Meisterwerken, wie Friedrich der Große sie in Potsdam besessen hat, um in der noblen Sprache Racines zu schwelgen. Doch so weit wird es nie kommen. Mit diesem Buch habe ich mich nun zum ersten Mal der Herausforderung gestellt, unmittelbar über Frankreich zu schreiben, und die Erfahrung war beglückend und beängstigend zugleich.
Ein paar Worte zu den Ortsnamen
Die britischen Bezeichnungen für fremde Orte sind ein fröhliches Durcheinander haarsträubender Inkonsequenz. Einige Schreibweisen gibt es nur im Englischen: Basle etwa, Brussels, Antwerp, Ghent oder Dunkirk. Aus manchen Annäherungen spricht die reine Verzweiflung: Flushing statt Vlissingen, Brill statt Brielle und (zumindest früher) Dort statt Dordrecht. Den Haag haben wir zur allgemeinen Verwirrung in The Hague verwandelt, und zwar mit einer Aussprache, die eher an das englische vague erinnert als an aargh, wie es dem Niederländischen eigentlich entsprechen würde. Niederländern und Franzosen ist klar, dass die Stadt schlicht »die Hecke« heißt, aber vielleicht widerstrebte es englischen Diplomaten, an einem Ort mit derart albernem Namen akkreditiert zu sein.
Einige Namen haben im Laufe der Zeit Wandlungen durchlaufen. Im 17. Jahrhundert etwa schrieb man Gent im Englischen üblicherweise Gaunt (bekannt durch John of Gaunt, den Herzog von Lancaster). Die Umlaute von Städten wie Zürich wurden umstandslos gestrichen, und wenn man es genau nimmt, werden von den sechs Buchstaben des Namens Zürich im Englischen fünf falsch ausgesprochen. Kleve war selbstverständlich Cleves (und die deutsche Anna von Kleve wurde durch ihre Heirat mit Heinrich VIII. zu Anne of Cleves). Auch Calais wurde durch die englische Mangel gedreht und kam als »Käliss« ausgesprochen wieder heraus. Bei manchen Namen entscheiden wir seltsam widersprüchlich. So verwenden wir für Brügge beispielsweise die französische Form Bruges, im Fall von Zeebrugge haben wir dagegen statt Bruges-sur-Mer die flämische Variante übernommen. Das hat allerdings insofern eine Berechtigung, als der flämische Name nach einem tristen Fährhafen klingt (was in diesem Fall den Tatsachen entspricht), während die französische Fassung irrigerweise an Menschen denken lässt, die ihre Schnurrbärte zwirbeln oder ihre Sonnenschirme kreisen lassen, während sie neben einem Musikpavillon an kühlen Getränken nippen.
In manchen Städten war die Aussprache oder Schreibweise des Namens zeitweise von großer Bedeutung. Im Rheinland etwa führten französische Begehrlichkeiten dazu, dass Mainz, Trier, Aachen, Koblenz und Köln in Mayence, Trèves, Aix-la-Chapelle, Coblence und Cologne umbenannt wurden. Im 19. Jahrhundert waren diese Bezeichnungen im Englischen allgemein akzeptiert und verbreitet, doch nur die letzte hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Das könnte daran liegen, dass »Köln« kaum unfallfrei ins Englische zu übertragen ist, vielleicht aber auch, weil die Stadt so unauflöslich mit dem »Eau de« verbunden ist. Doch obwohl unsere Schreibweise dem Französischen entspricht, könnte die Aussprache kaum unterschiedlicher sein: Die Franzosen halten sich mit kollonje und dem in die Länge gezogenen »n« eng an das Deutsche, während die Briten so etwas wie kerr-loww-n hervorbringen.
Es gibt einige offenkundig heikle Punkte im Elsass und in Lothringen: Nancy/Nanzig etwa, Strasbourg/Straßburg, Sélestat/Schlettstadt oder Lunéville/Lünstadt. Die heutigen Elsässer Schildermaler dürften bei ihren Zunftmählern voller Nostalgie an die goldenen Zeiten zwischen 1870 und 1945 zurückdenken. Ähnliche Probleme gibt es in Belgien mit Wallonisch und Flämisch beziehungsweise Niederländisch: Bruxelles/Brussel, Gant/Gent, Bruges/Brugge, Liège/Luik, Ypres/Ieper, Louvain/Leuven, Courtrai/Kortrijk, Tournai/Doornik. Das Ganze setzt sich fort in Französisch-Flandern, auch wenn die Zahl der flämischsprachigen Einwohner dort mittlerweile verschwindend gering ist: Lille/Rijsel, Dunkerque/Duinkerke. Die Schweizer wiederum bewegen sich mühelos in ihrer Zweisprachigkeit: Bâle/Basel, Berne/Bern, Zurich/Zürich, Lucerne/Luzern.
Ein historisches Fossil sind die lustigen spanischen Namen, die viele Städte während der langen, spannungsreichen Herrschaft der Spanier erhielten: Brujas, Bruselas, Arrás, Lila, Luxemburgo, Mastrique, Gante, Dunquerque – heutzutage sind sie leider allesamt nicht mehr in Gebrauch. Manche Ortsnamen sind so robust, dass sie in jeder Sprache funktionieren: Breda kapituliert auf Spanisch, Englisch und Niederländisch gleich. Ich hatte gehofft, die Stadt würde auf Französisch Brède heißen, doch das tut sie nicht. Der scheußlichste niederländische Ortsname überhaupt, ’s-Hertogenbosch (»der Herzogenwald« – eine wunderschöne Stadt, die sehr viel mehr englische Besucher anlocken könnte, wenn diese nicht schon beim Anblick des Namens abgeschreckt würden), gewinnt im Spanischen und Französischen als Bolduque beziehungsweise Bois-le-Duc eine unübertreffliche Eleganz.
Traditionell neigen wir Engländer dazu, die Namen der Gebiete, die unseren Küsten gegenüberliegen, als pars pro toto für die gesamte Region zu verwenden, folglich ist der gesamte Norden des niederländischen Sprachgebiets für uns »Holland« und der Süden »Flandern«, während wir die Namen aller anderen Grafschaften und Herzogtümer (Hennegau etwa oder Gelderland) bedenkenlos unter den Tisch fallen lassen. Besonders extrem zeigte sich diese Haltung in der viktorianischen Gewohnheit, europäische Seeleute auf englischen Schiffen durch die Bank als Dutchmen, also Niederländer, zu bezeichnen, selbst wenn sie in Wahrheit aus Schweden, Italien oder sonst woher stammten.
Vom späten 16. Jahrhundert an gibt es verschiedene Bezeichnungen für jene niederländischen Provinzen, die sich gegen die spanische Herrschaft auflehnten. Diejenigen, die dabei erfolgreich waren, vereinigten sich zu einem Staatsgebilde, das in etwa dem heutigen Königreich der Niederlande entspricht. Diesen Vorläufer des Königreichs nenne ich die Republik der Vereinigten Niederlande, kurz die niederländische Republik, aber die Vereinigten Provinzen wäre eine ebenso korrekte Wahl gewesen. In den modernen englischen Bezeichnungen für die Schweiz (Switzerland) und die Niederlande (Netherlands) haben sich auf höchst angenehme Weise alte Gepflogenheiten erhalten. So bezeichnete man die Schweizer (insbesondere in ihrer Eigenschaft als Söldner) einst als Switzers (Hamlet etwa fragt: »Where are my Switzers?« – Wo sind meine Schweizer?), und nether ist der alte Begriff für »nieder« – was heute noch in Ortsnamen wie Nether Wallop anklingt. Niemand wird die Namen dieser beiden Länder je modernisieren und sie in Swissland oder The Lowlands umtaufen.
Ich verwende in diesem Buch durchgängig die heute allgemein üblichen Ortsbezeichnungen.
Die Struktur des Inhalts ist recht simpel. Weitgehend chronologisch zeichne ich nach, wie verschiedene äußere Mächte im Laufe der Zeit vergeblich versucht haben, die reichen, kulturell hochentwickelten Gebiete Lotharingiens unter ihre Kontrolle zu bringen.
Zu Beginn meiner Arbeit an diesem Buch habe ich mir eine grobe Landkarte Westeuropas ausgedruckt und mit einem gelben Textmarker in etwa die ersten Grenzen Lotharingiens von 843 eingezeichnet. Danach passte ich die Umrisse an, indem ich – aus den zuvor geschilderten Gründen – das Gebiet südlich des Genfersees entfernte und kleine Bereiche am rechten Rheinufer hinzufügte, da diese häufig als von den umliegenden Territorien »losgelöst« betrachtet wurden. Nach einer kurzen, turbulenten eigenständigen Existenz fiel Lotharingien an das Ostfränkische Reich, aus dem sich mit der Zeit das Heilige Römische Reich entwickelte. Doch verstummten in den folgenden Jahrhunderten weder die Proteste zahlreicher Bewohner der Region, die auf ihre Unabhängigkeit pochten, noch die französischen Einwände, diese Zuordnung sei schlicht und einfach unrechtmäßig gewesen.
Danach zeichnete ich in meiner Karte für jede ausländische Hauptstadt ein Auge ein, dessen begieriger Blick drohend auf Lotharingien gerichtet war. Allerdings bin ich ein sehr schlechter Zeichner, weshalb die Augen eher an einen Mann auf einem Tor, ein chinesisches Schriftzeichen oder ein landwirtschaftliches Nutztier erinnerten. Das wichtigste Auge jedenfalls war zu allen Zeiten Paris: Als Herrscher Frankreichs und Nachfahren Karls des Großen betrachteten die französischen Könige den Streifen Land in der Mitte stets als potenziellen Teil ihres Einflussbereichs – ein Anspruch, den sie mit wechselndem Erfolg bis weit ins 20. Jahrhundert hinein aufrechterhielten und auf dem Schlachtfeld durchzusetzen versuchten. Als Ludwig XIV. Friedrich Barbarossas alte Kaiserpfalz in Haguenau dem Erdboden gleichmachte, wollte er damit sämtliches »Germanentum« in der Region für alle Zeiten ausmerzen, doch das war nur ein Kapitel in einer langen Reihe chauvinistischer und gegen-chauvinistischer Zerstörungen. Zusätzlich verkompliziert wurde die Angelegenheit für Frankreich dadurch, dass die Grafschaft Flandern bei der Aufteilung des Reichs Karls des Großen dem Westfränkischen Reich, also Frankreich, zugeschlagen worden war, es den mächtigen Grafen jedoch über lange Zeit hinweg gelang, zumindest eine gewisse Eigenständigkeit zu wahren. Die östlichen Bereiche Flanderns sowie die Territorien nördlich und östlich davon (Brabant, Holland, Gelderland usw.) waren dagegen ohne Zweifel lotharingisch und somit Teil des Heiligen Römischen Reichs. Doch das galt nicht für den größten Teil Flanderns, der ebenso französischer Einflussnahme ausgesetzt war wie die weiter südlich gelegenen Gebiete Artois, Boulogne und Amiens bis hinunter an die Somme.
Das zweite Auge steht für London, für das die Sicherheit der Kent und Sussex gegenüberliegenden Küsten stets von elementarer Bedeutung war. Wann immer möglich, mischte sich London in die Vorgänge jenseits des Ärmelkanals ein (häufig kann man seine Politik an den per Schiff hin- und herreisenden britischen und europäischen Exilanten ablesen, die entweder vor heimischen Katastrophen flüchteten oder nach Hause zurückkehrten). Befreundete Häfen in Flandern, Seeland und Holland waren für London im 11. ebenso wichtig wie im 20 Jahrhundert.
Das dritte Auge ist Amsterdam. Die Siedlung wurde nach europäischen Maßstäben sehr spät gegründet und erhielt erst 1300 das Stadtrecht. Amsterdam hat von jeher seine eigenen Interessen verfolgt, obwohl dem Stadtstaat durchaus bewusst war, in welchem Maße seine Sicherheit davon abhing, dass ihm im Süden möglichst viele Provinzen wohlgesinnt waren. Die übrigen niederländischen Städte haben sich immer auf Amsterdams außergewöhnliche Ressourcen verlassen, wenn auch häufig voller Groll und mit dem nagenden Gefühl, dass Amsterdam sie fallen lassen würde, sobald sie der Stadt nicht mehr nützlich waren.
Das vierte Auge ist Madrid. Aus geradezu lächerlich unsinnigen dynastischen Gründen herrschten die Spanier vom 15. bis ins 18. Jahrhundert über große Teile Lotharingiens. Ihre Bemühungen, dieses von Holland bis hinunter an die Schweizer Grenze reichende Gebiet zu halten, seine aufmüpfigen Bewohner zu unterwerfen und andere interessierte Parteien abzuwehren, waren der Auslöser vieler bis heute nachwirkender Entwicklungen der europäischen Geschichte – bis die Spanier schließlich in einem Wirbel aus Sühnemessen und dichten Weihrauchwolken das Handtuch warfen.
Das fünfte und letzte Auge springt auf eine Art und Weise hin und her, die meine Metapher völlig ruiniert. Ganz allgemein gesprochen, ist es ein deutsches Auge, das zu gewissen Zeiten in Frankfurt angesiedelt werden könnte, wo der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gewählt wurde, oder in Aachen, wo er zum deutschen König gekrönt wurde (analog zur Krönung der französischen Könige in Reims – Kaiser wurde er offiziell erst mit der Krönung durch den Papst). Als ebenso legitimer Nachfolger Karls des Großen wie der westfränkischen Herrscher hatte der Kaiser/König seine ganz eigene Sicht auf Lotharingien, das er in seiner Gesamtheit als festen Bestandteil des Heiligen Römischen Reichs betrachtete. Zu den zahlreichen Aufgaben des Kaisers gehörte es, die westliche Grenze gegen Frankreich zu sichern, darüber hinaus hatte er sich jedoch auch um Italien und den Osten des Reichs zu kümmern, weshalb er häufig abgelenkt war. Die Debatte, was denn nun genau zu Frankreich beziehungsweise zum Heiligen Römischen Reich gehörte und was nicht, war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eine der zentralen Fragen Europas und ernährte Generationen eigens dafür angeheuerter Gelehrter. Vom frühen 17. Jahrhundert an, als Wien zur mehr oder weniger ständigen Hauptstadt wurde, sollte ich das Auge wohl fairerweise dort platzieren. In der postnapoleonischen Ära erbte dann Berlin die umstrittenen Grenzen im Westen, um die es bis 1945 erbitterte Kriege führte.
Die übrigen Akteure waren weniger bedeutend und spielten nur vorübergehend eine Rolle. Die Herzöge von Burgund (die gar keine echte Hauptstadt haben, der ich das Auge zuordnen könnte) gliederten im 14. und 15. Jahrhundert weite Teile Lotharingiens in ihren Staat ein und bewegten sich mit großer Vorsicht in den freien Räumen zwischen den rivalisierenden französischen und deutschen Herrschern. Auch Bern vertrat eigene Interessen in der Region, hauptsächlich aus Gründen der Verteidigung. Gerade die Städte spielten im Heiligen Römischen Reich lange Zeit eine wichtige Rolle. Zum einen die vielen Freien und Reichsstädte (Basel, Mülhausen, Aachen), aber auch die Zentren der geistlichen Territorien, die über viele Jahrhunderte Bestand hatten (Lüttich, Köln, Essen), und die Hauptstädte der kleineren, aber langlebigen Grafschaften und Herzogtümer (Kleve, Kurpfalz, Baden). Viele dieser Städte gehörten zumindest zeitweise zu den prächtigsten in Europa, und ihr Wohlstand sowie ihre Unabhängigkeit erregten nicht selten die Gier und Habsucht ihrer größeren Nachbarn.
Im Jahr 1672 fällten Waldarbeiter unmittelbar südlich der Rhône in der Nähe des heutigen Flughafens Lyon Saint-Exupéry einige riesige alte Eichen. Zu ihrer Verblüffung trafen ihre Äxte auf ein äußerst merkwürdiges Hindernis. Nachdem sie es freigelegt hatten, erkannten sie ein schauerliches Gewirr von Metallteilen und menschlichen Knochen, das in den Stamm und die Äste der Eiche eingewachsen war. Man kam zu dem Schluss, dass es sich um die sterblichen Überreste eines gepanzerten burgundischen Soldaten handeln müsse, der sich 1430 während der Schlacht von Anthon in dem hohlen Baum versteckt hatte und dort entweder eingeklemmt oder getötet worden war. In dieser Schlacht waren die Truppen des mit den Burgundern verbündeten Fürsten von Orange, Ludwigs II., in einen französischen Hinterhalt geraten, womit Ludwigs Versuch, die Dauphiné zu erobern, endgültig gescheitert war. Seine Truppen wurden niedergemetzelt, er selbst entkam schwer verletzt auf seinem Pferd über die Rhône.
Eine Warnung für potenzielle Leser: Dieses Buch ist voll von solchen Anekdoten.
1 Der eigenartige Name dieses lotharingischen Territoriums, der in der Bezeichnung des Bundeslands Rheinland-Pfalz erhalten blieb, verweist auf die Bedeutung seines Herrschers als eines der sieben Kurfürsten. »Pfalz« wiederum ist abgeleitet von der fränkischen Königspfalz – bedeutet also »zum Palast gehörig«. Darüber hinaus bezeichnete der Begriff »Pfalz« auch ein Territorium mit spezieller Verteidigungsfunktion (vergleichbar dem County Palatine of Chester, das die Waliser fernhalten sollte, oder dem County Palatine of Durham mit derselben Funktion in Bezug auf die Schotten). Auf dieselbe Wurzel geht auch das französische Wort »paladin« zurück.
KAPITEL EINS
Einige Gegenstände, die im Grab Childerichs I. in Tournai entdeckt wurden. Abbildung aus Jean-Jacques Chifflets Anastasis Childerici I. Francorum Regis, siue Thesaurus Sepulchralis Tornaci Nerviorum… (Die Wiederauferstehung Childerichs I., König der Franken, oder der Grabschatz aus der Nervierstadt Tournai), erschienen in Antwerpen 1655 bei Moretus (jener Verlegerfamilie, die das Geschäft von Christoph Plantin geerbt hatte – siehe Kapitel sieben).
Von Eisschilden zu Asterix
Die Frühgeschichte der Menschen in Nordwesteuropa wird uns wohl für immer ein Rätsel bleiben. Wir können zwar davon ausgehen, dass im Laufe der Jahrtausende alle möglichen heroischen Taten vollbracht und Erfindungen gemacht wurden, dass sowohl ernsthafte als auch lächerliche Herrscher scheiterten und es Naturkatastrophen und faszinierende Erkenntnisse in Sachen Gemüse gab, doch Genaueres werden wir darüber niemals erfahren. Die Neandertaler (benannt nach dem Neandertal unweit von Düsseldorf, wo ihre Überreste Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurden) scheinen vor vierzigtausend Jahren ausgestorben zu sein, möglicherweise ausgelöscht durch die Vorfahren des modernen Menschen. Unsere frühen Verwandten teilten sich ihren Lebensraum mit diversen furchteinflößenden Tieren, etwa europäischen Leoparden und Höhlenbären. Doch als die letzte Eiszeit den nördlichen Teil Europas in eine Polarwüste verwandelte, wurden diese – wie auch die meisten Menschen – vertrieben oder starben aus. Vor achtzehntausend Jahren zog sich das Eis dann allmählich zurück, und darunter kam eine recht vertraute Landschaft zum Vorschein. Wasserspiegel und Temperaturen stiegen, und die Menschen wanderten zurück nach Norden.
Der einzige eklatante Unterschied zum heutigen Erscheinungsbild Europas war eine Landmasse mit dem lustigen Namen Doggerland, die den größten Teil der jetzigen Nordsee ausfüllte. Dort vereinten sich Themse, Rhein, Maas, Seine und Schelde zu einem gewaltigen Fluss, der am heutigen westlichen Ende des Ärmelkanals ins Meer mündete. Dieses für uns höchst irritierende Land, über dessen Dörfern kleine Rauchfahnen in den Himmel stiegen und in dem Wölfe, riesige Hirsche und Auerochsen lebten, die schnaubend an den sumpfigen Ufern eines der größten Ströme der Welt entlangzogen, wurde nach und nach vom steigenden Meeresspiegel und Tsunamis verschlungen, bis es 6500 v. Chr. endgültig verschwand. In einem der dramatischsten geologischen Ereignisse der europäischen Vergangenheit (das auch einen unvorstellbaren Lärm verursacht haben muss) brach der letzte, etwa dreißig Kilometer breite Keil aus Fels und Schlamm weg, wodurch Britannien zur Insel wurde. Vor den Augen jener glücklichen Jäger und Sammler, die sich zufällig im höher gelegenen Proto-Kent oder Proto-Pas-de-Calais befanden, versank das bedauernswerte Doggerland in den Fluten, und es entstand der Ärmelkanal.
Blickt man auf die europäische Frühgeschichte zurück, so drängt sich unweigerlich der Eindruck auf, dass die wahre Schwerstarbeit von anderen geleistet wurde – von den Nordostasiaten beispielsweise, die am Ende der letzten Eiszeit ganz Amerika besiedelten, oder den Bewohnern Borneos, die später mit der Besiedelung von Madagaskar eine ähnlich epische Großtat vollbrachten. Diese Abenteuer stehen in krassem Gegensatz zu den zwar notwendigen, aber doch eher eintönigen Beschäftigungen der Europäer, die sich in kleinen Verbänden bemühten, in ihrer rauen, tundra-artigen Umgebung zurechtzukommen. Auch der Vergleich mit Regionen wie dem Fruchtbaren Halbmond, wo Tiere domestiziert, Feldfrüchte kultiviert, so nützliche Dinge wie das Rad oder die Schrift erfunden und die ersten Städte gegründet wurden, gestaltet sich in zunehmendem Maße peinlich. Während unter der glühenden Sonne Zehntausende Arbeiter nach Gutdünken ihrer goldgewandeten Priester und Könige riesige Tempeltürme errichteten, hantierten die Nordeuropäer mit ranzigem Bärenfett herum.
Aber auch in Nordwesteuropa entwickelte sich zu einem nicht näher definierbaren Zeitpunkt eine deutlich komplexere Gesellschaft, wenngleich diese immer noch nicht im Entferntesten an die kultivierten Verhältnisse im östlichen Mittelmeerraum heranreichte. Die traditionell in Museen präsentierten Rundhütten, die sich hinter einem erschreckend schwachen, aus Binsen oder dergleichen gefertigten Verteidigungswall zusammendrängen und in deren Mitte ein dünnes Rauchfähnchen von einem Lagerfeuer aufsteigt, während alle resigniert auf die römischen Invasoren warten, die endlich Abwasserkanäle und vernünftige Straßen bauen sollen, entsprechen längst nicht mehr dem aktuellen Wissensstand. Ein Historiker, der sich hauptsächlich mit dem eisenzeitlichen Europa beschäftigt, wies mich einmal darauf hin, dass der Ärmelkanal vor der Eroberung Britanniens durch die Römer von großen, aufwendig konstruierten und bis zum Rand mit Waren beladenen Segelschiffen befahren wurde, deren Besatzung allerdings aus gänzlich illiteraten Seeleuten und Händlern bestand. Im ersten Moment schwirrte mir bei der Vorstellung der Kopf, aber wenn man erst einmal darüber nachdenkt, ist es vollkommen logisch. Und dieser Aha-Effekt lenkte mein Denken in völlig neue Bahnen. Eine hochkomplexe merkantile und militärische Zivilisation, die Schiffe einsetzte, Tauschhandel betrieb und Rohstoffe sowie verarbeitete Güter aus dem ganzen nordwestlichen Europa bezog, brauchte nichts aufzuschreiben. Tatsächlich brauchte die gesamte Menschheit bis zu einem gewissen Punkt ihrer Entwicklung keine Aufzeichnungen. Aus dem Blickwinkel unserer schriftfixierten Kultur mag es schwierig sein, für diese in Tierfelle gehüllten, rätselhaften Menschen mit ihren merkwürdigen Göttern nicht wenigstens einen Hauch Mitleid zu verspüren. Doch das ist keineswegs angebracht. Über viele Generationen hinweg vollzogen sich dramatische Entwicklungen, die Menschen wanderten in fremde Regionen ein, Kämpfe tobten, es wurden Erfindungen gemacht und Bauten errichtet, und wir stehen nicht etwa deshalb ratlos vor den zahllosen Relikten jener Zeit, weil diese bedeutungslos wären, sondern weil wir ihre einst komplexe Bedeutung nicht zu entschlüsseln vermögen.
Die Archäologie liefert zu diesem vorschriftlichen Europa unablässig neue frustrierende Rätsel. Auf dem Glauberg vor den Toren Frankfurts wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe aufwendig gestalteter eisenzeitlicher Überreste gefunden. Bei späteren Ausgrabungen machte man dann eine noch spektakulärere Entdeckung: die beinahe unbeschädigte 1,80 Meter hohe Sandsteinfigur eines gepanzerten Mannes mit Schild, Halstuch und einer bizarren Kopfbedeckung, von der zwei überdimensionierte Klappen abstehen wie merkwürdige Hasenohren. Die Statue entstand offenbar um 500 v. Chr., doch bei ihrem Anblick fühlt man sich unweigerlich an das UFO von Roswell und außerirdische Invasoren erinnert. Es könnte sich um einen Fürsten handeln, einen Kultgegenstand oder das beliebte Logo einer Kette von Karrenwerkstätten. Aber wir wissen es nicht – und so ist diese Figur in äußerst schwankenden Anteilen faszinierend und langweilig zugleich. Fast nahm ich es ihr übel, dass sie zweieinhalb Jahrtausende unbehelligt im Boden gelegen hatte, bis sie nun plötzlich ohne jeden Zusammenhang und erklärende Geschichte aufgetaucht war und Unruhe stiftete. Das Einzige, was wir also mit Gewissheit sagen können, ist, dass jenes Nordwesteuropa, in dem wir leben, auf einem gewaltigen Fundament menschlicher Leistungen ruht, über die wir so gut wie nichts wissen.
Als die Römer auf der Bildfläche erscheinen und Julius Cäsar sein Werk Der Gallische Krieg verfasst, ist es, als werde ein riesiger, den gesamten Kontinent verhüllender Vorhang angehoben, und wir erblicken – beschrieben nicht nur von einem direkten Augenzeugen, sondern von dem Mann, der mehr als jeder andere für die Zerstörung dieser Kultur verantwortlich ist – eine Reihe bestens organisierter, hochentwickelter Gesellschaften, die den Römern mit ihrer Militärtechnik erhebliche Probleme bereiten und zudem über große, robuste, für das raue Wetter auf dem Atlantik konstruierte Schiffe verfügen. Wer Cäsars Bericht liest, fühlt sich hinsichtlich des nordwesteuropäischen Wesens unverzüglich getröstet, und doch sollte man auf der Hut sein. Die erhaltenen schriftlichen Zeugnisse und die für uns nun leichter verständlichen archäologischen Überreste jener Zeit vermitteln die Illusion einer völlig neuen Geschlossenheit und Entschlusskraft, dabei waren alle auch schon genauso eloquent, aggressiv, treulos, heldenhaft, ruhelos und unfähig, bevor diese unerfreulich hochgerüsteten Italiener ankamen.
Der womöglich eindrucksvollste Ort des vorrömischen Nordwesteuropa liegt auf einem Hügel bei Otzenhausen in einer dicht bewaldeten Region des Saarlands. Nur wenige Stätten vermitteln einen so anschaulichen Eindruck davon, wie sehr das Leben der Menschen in weiten Teilen Europas vom Wald bestimmt wurde. Kiefern und Buchen waren mächtige Gegner, ihre Samen breiteten sich unerbittlich aus und eroberten die vom Menschen aufgegebenen Plätze innerhalb einer Generation zurück. Im Mittelalter gestand man Siedlern deshalb während der sogenannten Rodejahre, in denen die Baumwurzeln aus dem Boden gerissen und das Land urbar gemacht wurde, besondere Privilegien zu. Doch sobald die Menschen von Katastrophen wie Kriegen, Pest oder Ernteausfällen heimgesucht wurden, bot sich den Bäumen eine neue Chance, alles zu überwuchern. Die befestigte keltische Siedlung bei Otzenhausen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten errichtet wurde, war riesig. Man hat ermittelt, dass sie während ihrer größten Ausdehnung (um die Zeit von Cäsars Invasion) aus ungefähr 56 Kilometern Baumstämmen und 240 000 Kubikmetern Stein bestand (was, wie Archäologen dankenswerterweise ausgerechnet haben, der Ladung von etwa neuntausend Güterwaggons entspricht). Der außergewöhnlich hohe Bedarf an Bau- und Feuerholz führte dazu, dass das heute wieder waldreiche Gebiet damals in weiten Teilen abgeholzt war und die wahrscheinlich mit Gehöften gesprenkelte und von breiten Wegen durchzogene Landschaft sich von der jetzigen so sehr unterschied, dass wir sie uns kaum vorstellen können.
Die Siedlung lag, durch einen – zumindest für mich – grauenvoll steilen Anstieg geschützt, auf der Kuppe des Dollbergs und wurde aus einer noch heute sprudelnden Quelle im Zentrum des Areals mit Wasser versorgt. Erbaut wurde die Anlage einst von den Treverern zur Verteidigung gegen marodierende Sueben. Von all seinen Gegnern zollte Cäsar den Treverern den höchsten Respekt, sie werden im Gallischen Krieg mehrfach erwähnt und bereiteten ihm im Laufe seines neunjährigen Feldzugs erhebliches Kopfzerbrechen. Schließlich waren die Römer von dem treverischen Herrscher Indutiomarus derart besessen, dass sie sich zu einer außergewöhnlichen Kampfstrategie entschlossen: Jeder Römer sollte einfach drauflosstürmen und versuchen, sich zu Indutiomarus durchzuschlagen. Auf diese Weise wollte man sicherstellen, dass er auf jeden Fall getötet wurde, egal, wie viele Opfer es kostete.
Da sich die Treverer ständig auf Kriegszug befanden, wurde ihre Festung im Saarland nie angegriffen – zumindest erwähnt Cäsar nichts davon. Allerdings gaben sie die Siedlung im selben Jahr auf, in dem ganz in der Nähe ein römisches Lager gegründet wurde. Ob dies freiwillig geschah oder ob sie von den Römern vertrieben wurden, wissen wir nicht. Die Treverer haben bis heute im Namen der Stadt Trier überlebt (deutlicher erkennbar in der französischen Variante: Trèves), und vermutlich sind auch ihre Gene noch in der ganzen Region zu finden. Das Wissen um die wahren Ursprünge der Befestigungsanlage war jedoch lange verloren, und so ist sie heute unter der vollkommen unhistorischen Bezeichnung »Hunnenring« bekannt, was ihr ein wohlig düsteres Flair verleiht.
Der Gallische Krieg ist eine so ungemein fesselnde Lektüre, weil man jetzt endlich von den aus zweiter, wenn nicht gar dritter Hand überlieferten griechischen Gerüchten über die Eigenheiten Nordwesteuropas und den wissenschaftlichen Analysen des Inhalts von Knochengruben mit einem Schlag auf strahlendes Technicolor umschaltet. Natürlich präsentiert Cäsar vor allem sich selbst im denkbar besten Licht, aber zugleich zeigt er sich ungemein interessiert, und das war auch sein damaliges Publikum. Wenn er von der Region zwischen den Flüssen Waal und Maas als der »Insel der Bataver« spricht, vermittelt er uns ganz nebenbei eine Vorstellung davon, dass das niederländische Flusssystem früher sehr viel weitläufiger, wilder und äußerst schwer passierbar gewesen sein muss. Außerdem berichtet er, wie leicht seine Gegner in die hügeligen Ardennen und in nördlicher Richtung in die »Marschen« (ein mittlerweile verschwundenes, aber damals fast amazonasgleiches Sumpfgebiet zwischen den zahllosen Mäandern von Rhein und Maas) ausweichen oder auf die der Küste vorgelagerten Inseln fliehen konnten, wo die Flut sie schützte. Er schreibt über die Belger und die Helvetier und schildert ihre außerordentliche Tapferkeit, was den Gallischen Krieg nicht nur zum Gründungsdokument des Nationalbewusstseins zweier moderner Staaten macht, sondern auch dazu führte, dass im 19. Jahrhundert unzählige Rathauswände mit zweitklassigen (wenn auch höchst unterhaltsamen) Fresken dekoriert wurden, auf denen Männer in Sandalen und mit prächtigen Schnurrbärten abgebildet sind. Cäsar berichtet vom Bau der ersten Brücke über den Rhein, die er wahrscheinlich in der Nähe von Koblenz errichten ließ, aber vor allem handelt sein Buch von Gewalt – von der Überlegenheit der römischen Gewalt über die keltische und von grausamen Massakern und Zerstörungen, nachdem der Widerstand gebrochen war.
Mein Bild der Römer in Gallien (und von Julius Cäsar) ist geprägt von meiner lebenslangen (und erfreulicherweise von meinen Söhnen geteilten) Liebe zu Goscinnys und Uderzos Asterix-Geschichten, die in einer Zeit einsetzen, als Cäsar bereits wieder nach Rom zurückgekehrt ist. Für mich gibt es keinen einzigen Aspekt der realen römischen Kultur, der nicht vom beißenden Spott dieser Bücher durchdrungen ist. Ich bin mir ziemlich sicher (und mit dieser Ansicht stehe ich gewiss nicht allein), dass Asterix als Legionär das möglicherweise witzigste Buch aller Zeiten ist, wenngleich man fairerweise zugeben muss, dass Asterix und Kleopatra einen ebenso berechtigten Anspruch auf diesen Titel anmelden kann. Es steigert den Reiz eines Besuchs der ansonsten zermürbend umfangreichen Sammlungen römischen Plunders in den Museen von Metz, Köln oder Mainz ganz ungemein, wenn vom Legionärshelm bis zur Toga tragenden Figur auf einem Grabstein sämtliche Exponate die Erinnerung an diese urkomischen Szenen heraufbeschwören.
Die Wurzeln der Asterix-Reihe sind so komplex, dass sie eine eigene Untersuchung verdienten – die Bildergeschichten waren eine Reaktion auf den Einmarsch der Nationalsozialisten und die darauf folgende Besatzung, eine Satire auf die französische Armee (in der Goscinny gedient hatte), eine Auseinandersetzung mit Goscinnys Judentum, eine Kritik an der zunehmenden Amerikanisierung und noch vieles mehr. Vor allem aber dienten sie als eine Art Abrissbirne, die mit schärfstem Spott sämtliche Überbleibsel des Faschismus zertrümmerte, der sowohl in der ursprünglich von Mussolini erdachten Variante als auch in der Vichy-Version die vermeintlichen Werte des Römischen Reichs – Disziplin, Ordnung und würdevolle Strenge – bitter ernst nahm. Nach Asterix war es nicht mehr möglich, exakt aufgereihte, Stahlhelm tragende Soldaten und Offiziere mit kantigen Gesichtszügen zu betrachten, ohne darin etwas anderes zu sehen als das Vorspiel zu einer weiteren burlesken Demütigung durch die gallischen Helden. Denn wie sagt Obelix in, glaube ich, jedem Band so schön: »Die spinnen, die Römer.«
Der Kriegsherr
Eskortiert von seinem wie stets nach Bartwichse, teurem Eau de Toilette und Metallpolitur duftenden Reiterzug, legte Kaiser Wilhelm II. am 11. Oktober 1900 in einem Gestöber aus bizarren Jägermützen, Abzeichen, besonderen Umhängen und Schärpen den Grundstein zu einem der unterhaltsamsten Projekte, die je im nördlich von Frankfurt gelegenen Taunus in Angriff genommen wurden: dem Wiederaufbau des als Saalburg bekannten Römerkastells.
Kaiser Wilhelm hatte viele Fehler, doch seiner kindlich-idealisierenden Schwärmerei für die germanische Vergangenheit haben wir viel zu verdanken. Nordwesteuropa ist übersät mit mehr oder weniger eindrucksvollen römischen Relikten, aber keines verströmt eine Atmosphäre wie die Saalburg. Wilhelm wischte das übliche Zögern und Zaudern der Akademiker kurzerhand beiseite und beschloss, das ganze Ding von Grund auf neu aufzubauen, und zwar so, wie es früher einmal gewesen sein musste. Da dies im Jahr 1900 geschah, kann man sich leicht vorstellen, welch vielschichtiger Beigeschmack dem Unterfangen anhaftete und welche ganz und gar un-asterixische kaiserliche Schicksalsschwere noch drückender in der Luft hing als der Duft von Eau de Toilette. Im Großen und Ganzen handelte es sich bei der Saalburg um eine persönliche Spielerei des Kaisers, wenn auch unterstützt durch eine Handvoll speichelleckender Archäologen, die es eigentlich besser hätten wissen müssen. So bestand der Kaiser beispielsweise auf dem Bau eines Mithras-Tempels, weil der Mithras-Kult einen so militärischen, brüderbündlerischen, initiatorischen und durch und durch männlichen Touch hatte, obwohl es nicht den geringsten Hinweis darauf gab, dass dieser Kult jemals in der Saalburg praktiziert worden war. Das Innere des Tempels ist eine wahre Pracht: Mit seinem blau getünchten, sternenübersäten Gewölbe und dem riesigen bemalten Reliefbild eines halbnackten Jünglings, der einen weißen Stier tötet, erinnert er an einen altmodischen, vor langer Zeit geschlossenen Nachtclub.
Das Kastell selbst ist eine deutlich ernstere Angelegenheit, ein Eindruck, der bei mir noch dadurch verstärkt wurde, dass ich es im tiefsten Winter besuchte – weshalb ich auch die Kostümaufführungen und nachgestellten römischen Gastmähler in der Taverne verpasste. Der schneebedeckte Boden und die kahlen Bäume waren hingegen geradezu ideal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese armen römischen Legionäre wie Gary Cooper in einer frostigeren Variante von Drei Fremdenlegionäre fernab ihrer Heimat festsaßen, müde in das östliche Dunkel spähten, von Zitronenbäumen träumten und auf den nächsten Angriff der Germanen warteten.
Weiter als bis zur Saalburg sind die Römer jenseits des Rheins nie gekommen. Es muss ein deprimierender Außenposten gewesen sein, aber er diente dem Schutz einer Reihe römischer Niederlassungen entlang des Rhenus (Rheins), die noch heute existieren, auch wenn ihre Namen im Laufe der Zeit gewisse Veränderungen durchlaufen haben: Colonia Agrippina (Köln), Confluentes (am Zusammenfluss – confluens – von Rhein und Mosel: Koblenz), Bonna (Bonn, unschwer zu erkennen), Moguntiacum (Mainz), Bingium (Bingen) und Novaesium (Neuss).
Wenn man auf den Wehrmauern der Saalburg entlanggeht, fühlt man sich fast wie ein echter Römer, haucht in die Hände, um sie warm zu halten, und hält Ausschau nach dem strengen, aber gerechten Wachoffizier. Die Mauern selbst erscheinen allerdings ein wenig niedrig. Ob das die antike Realität widerspiegelt oder lediglich Wilhelms Geldbeutel geschont werden sollte, bleibt unklar – jedenfalls suggeriert das Ganze ein recht optimistisches Vertrauen der Römer darauf, die germanischen Stämme würden schon nicht auf die Idee kommen, Trittleitern einzusetzen. Die im römischen Stil gehaltenen Lagerräume beherbergen ein Museum, in dem der übliche alte Plunder ausgestellt wird – unzählige Speerspitzen, Votivöllampen, Statuetten, Kellen, Rinnen, Töpfe. Tatsächlich scheint es nicht fair, dass diverse römische Überreste erhalten blieben, weil die unverwüstlichen Materialien, aus denen sie gefertigt wurden, die Zeiten überdauert haben, während die aus Holz und Fasern bestehenden Zeugnisse der umliegenden Kulturen weitgehend verschwunden sind. Man findet in diesem Museum sogar eine verstörende kleine Gewandnadel mit einem Hakenkreuz darauf, die römische Adaptation eines indischen Symbols. Außerdem gibt es eine hervorragende Präsentation zur Größe der unterschiedlichen römischen Militäreinheiten, dargestellt anhand von Playmobil-Figuren, was der Vorstellung ungemein auf die Sprünge hilft, wenn auch sicher nicht in Wilhelms Sinn. Der hineingeschummelte Mithras-Tempel wird durch fantastische Exponate ergänzt, die dem Besucher den Kult näherbringen, etwa in Bezug auf seine (bis heute absolut rätselhafte) Verwendung von Steinkugeln oder die Art und Weise, wie die Adepten die sieben Weihestufen von Rabe über Bräutigam, Soldat, Löwe, Perser und Sonnenläufer – bezeichnet mit dem wunderbaren Namen Heliodromus – bis hin zum Vater durchliefen, aber wie und warum, das werden wir wohl nie erfahren. Allerdings passt es zu den trotz allem anrührend verwirrten Gefühlen des Kaisers in Bezug auf Männlichkeit.
Der nordwestliche Teil des Römischen Reichs wurde einige Male umstrukturiert, aber die wesentlichen Gebietseinheiten Germania Inferior, Gallia Belgica und Germania Superior (superior