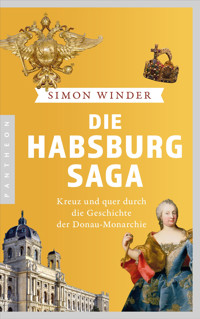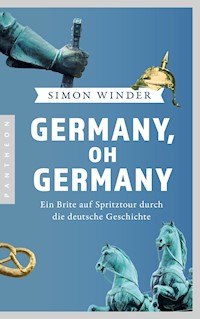
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der amüsante Bestseller erzählt Deutschlands Geschichte aus der Sicht eines Engländers
Kaum ein Engländer betritt freiwillig deutschen Boden, ohne dafür berufliche Gründe zu haben. Ein Fehler, meint Simon Winder. Er selbst ist regelrecht besessen von Deutschland. So nimmt er uns mit auf eine höchst unterhaltsame Reise durch unser Land und dessen Vergangenheit. Nebenbei stopft er Bildungslücken, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie hatten. Winder fasziniert dabei besonders das Ungewöhnliche und das, das man davon heute noch sehen kann: Er zeigt uns die schönsten Altstadtkerne, führt uns in Museen, Schlösser und Kirchen. Und erzählt von Künstlernaturen und Kriegswirren, von Wagner und Wald, von Erbfolgen, Einsamkeit und Erfindergeist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Kaum ein Engländer betritt freiwillig deutschen Boden, ohne dafür berufliche Gründe zu haben. Ein Fehler, meint Simon Winder. Er selbst ist regelrecht besessen von Deutschland. Mit feinem Gespür fürs Skurrile und Abseitige durchstreift er für uns die deutsche Geschichte, mit ihren dunklen Wäldern, ihren wackeren Helden und schlimmen Schurken. Stets gut gelaunt und höchst unterhaltsam zeigt er uns die spannendsten Städte mit ihren Geschichten, führt uns in Burgen, Museen und Kirchen. Und erzählt von Künstlernaturen und Kriegswirren, von Goethe und Germanen, von Erbfolgen, Einsamkeit und Erfindergeist.
Autor
Simon Winder, geboren 1963 in London, ist Cheflektor des englischen Verlags Penguin Books. Dort betreut er unter anderem die Bücher vieler bedeutender Historiker. 2010 erschien sein Bestseller »Germany, oh Germany: Ein eigensinniges Geschichtsbuch«, 2016 »Kaisers Rumpelkammer: Unterwegs in der Habsburger Geschichte«, 2019 folgte »Herzland. Eine Reise durch Europas historische Mitte zwischen Frankreich und Deutschland«.
Simon Winder
Germany, oh Germany
Ein Brite auf Spritztour durch die deutsche Geschichte
Aus dem Englischen von Sigrid Ruschmeier
Pantheon
© akg-images: (N.N.)
Die englische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel
»Germania – A Personal History of Germans Ancient and Modern« bei Picador, London.
Der vorliegende Text ist gegenüber der deutschen Erstausgabe von 2010 wesentlich erweitert. An der Übersetzung von Kapitel 10 und 11 war Grete Osterwald beteiligt, von Kapitel 12 und 13 Heike Steffen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Pantheon Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
»Germania« © 2010 by Simon Winder
Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © akg-images / Bildarchiv Steffens (Arm); © akg-images (Helm); © Katharina Notarianni / dreamstime (Brezel); © Kostin / Shutterstock (Quadriga)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29636-0V001
www.pantheon-verlag.de
Für Felix
»Was der Mensch doch nicht alles erfährt, wenn er sich einmal hinterm Ofen hervormacht!«
Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts
»Achtung! Historische Treppen!«
Schild an einem etwas schiefen Treppenaufgang in Luthers Geburtshaus in Eisleben
Inhalt
Vorwort
Warum zum Teufel sind Sie hier?
Erstes Kapitel
Aus dem Land der düsteren Wälder
Römische Germanen und Deutsche
Ein Alligator, fern der Heimat
Ich nehme grüne Soße dazu
Der mittelalterliche Parkplatz
Zweites Kapitel
Alte Pfalzen
Karl der Große
Fromm, kahl, dick
Eine sehr kleine Stadt
Das Wort verbreiten
Der Sonne entgegen
Vorstoß gen Osten
Drittes Kapitel
Von Mauern umgebene Städte
Überlegenheitskomplexe
Kurze Bemerkung zu politischen Strukturen
Deutsche Stämme
Hungersnot und Pest
Wo eine Million Diamanten funkeln
Viertes Kapitel
Ein kniender Kreuzfahrer
Der Fluch Burgunds
Familienspiele
Stadtgewimmel
Reichskreise
Habsburger
Fünftes Kapitel
Spitze, runde, eckige Türme
Ein Geburtshaus und ein Sterbehaus
Des Teufels Dudelsack
Der Herrscher der Welt
Das Neue Jerusalem
Ein unglücklicher Weinhändler
Sechstes Kapitel
Die Goldene Stadt der Gläubigen
Das Land, wo die Zitronen blühn
Schwarze Rüstungen
Der Schwedenschimmel
Überraschungsbesuch eines Asteroiden
Siebtes Kapitel
Wunderkammern und Spinnen, die Vögel fressen
»Musik, die Toten aus diesem Leben zu geleiten«
Die Zeit der gepuderten Perücken
Yatağane aus Damaszenerstahl
»Brennt die Pfalz nieder!«
Die katholische Kirche geht aufs Ganze
Achtes Kapitel
Die Nachkommen Kyros’ des Großen
Ein Tässchen Schokolade mit Straußen
Noch mehr tolle Gräber
Chromatische Fantasie und Fuge
Die sächsischen Auguste
Neuntes Kapitel
Die kleine Sophie von Zerbst
Parks und ihre Zierden
In Goethes Fußstapfen
Eine Glaspyramide mit Rotkehlcheneiern
Überraschungsauftritt einer Seekuh
Deutsche als Opfer
Hähnchen zum Spottpreis
Zehntes Kapitel
Militärmärsche
Karl und Albrecht
Turmeinsamkeit
Von Helden und Eicheln
Siegessäulen
Größe und Elend des nationalen Prinzips
Elftes Kapitel
Schneekugel-Partikularismus
Lämmer und Marienkäfer
Land der sadistischen Puzzles
Jägermeister
Eine Abwesenheit
Zwölftes Kapitel
Am Meer
Texanische Wenden
Deutsche Kolonialträume
Thomas und Ernie
Berliner Piefigkeit
Gesichter des Militarismus
Dreizehntes Kapitel
Scheitern
Das Ende der deutsch-englischen Ehe
Katastrophe
Niederlage und Revolution
In Erinnerung an die Toten
Königliche Nachbeben
Vierzehntes Kapitel
Ein reizloser See
Putsche und Sockenhalter
»5, 4, 3, 2, 1 …«
Der Tod der Wissenschaft
Letztes Aufbäumen
Ende
Zum guten Schluss
In den Bergen
Mendels Büste
Schostakowitsch und Schnitzler im Hofbräuhaus
Dank
Literatur
Register
Vorwort
Warum zum Teufel sind Sie hier?
In diesem Buch geht es um meine Liebe zur deutschen Geschichte und Kultur. Ich schreibe es heute, nachdem ich in den vergangenen sechs, sieben Jahren viel in Deutschland herumgereist bin, und die meisten Dinge, Orte und Bücher, die ich erwähne, kann man noch sehen, erkunden und lesen. Ich liebe Deutschlands Vergangenheit, wie es sie gab, bevor das »Dritte Reich« kam und seinen Schatten auf die deutsche Geschichte warf – nach wie vor scheint es alles, auch das sehr weit Zurückliegende, zu verdüstern. Beim Schreiben ist mir immer wieder aufgefallen, dass ich die deutsche Geschichte nur deshalb so lieben kann, weil viele tausend Deutsche seit der »Stunde null« einen Großteil ihres Lebens darauf verwendet haben, aus dieser Vergangenheit das zu retten und zu neuem Leben zu erwecken, was wertvoll ist. Ob als Maurer, Steinmetze und Architekten, die so viel von dem im Krieg Zerstörten wiederaufgebaut haben, oder als Historiker, Künstler und Kulturschaffende, von denen mittlerweile schon zwei, drei Generationen versuchen, neue Zugänge zur deutschen Geschichte zu schaffen und sie neu zu erzählen, damit sie nicht länger im Dienst toter Ideologien steht.
Aber die »wiedererschaffene« Geschichte ist natürlich nicht nur das Werk einzelner Fachleute, sondern Millionen gewöhnlicher Deutscher haben daran mitgearbeitet, indem sie die Orte und Kunstwerke bewundert oder auch bespöttelt, faszinierend oder eben langweilig gefunden haben. Dafür könnte ich unendlich viele Beispiele nennen, doch besonders haben mich immer Mut und Demut der überlebenden Gemeindemitglieder der Sebalduskirche in Nürnberg berührt, die eines der großartigsten Bauwerke in Mitteleuropa aus vollkommener Zerstörung neu errichtet haben. Auch die Menschen in Hildesheim haben ihre alte Innenstadt mit modernen Mitteln wiederaufgebaut, obwohl es anfänglich schien, als sei das ganz unmöglich und die wunderschönen Gebäude seien für immer verloren.
Die dazu notwendige riesige intellektuelle und emotionale Energie ist offenbar unerschöpflich. Wo immer ich war, wurde ich daran erinnert, wie die Menschen in den größten Städten oder den kleinsten Dörfern, von der Ostsee bis zu den Alpen, an einer Neuerzählung der deutschen Geschichte mitwirken. Ihre Arbeit möchte ich in diesem Buch würdigen, wobei ich natürlich gleichzeitig hoffe, dem Nutzen und der Bedeutung von Geschichte gegenüber aufmerksam und skeptisch zu bleiben; Geschichte kann die Menschen eben genauso verderben und in die Irre führen, wie sie ihrem Leben Sinn verleihen und, ja, Spaß machen kann.
Ich sehe der Veröffentlichung meines Buches mit einem gewissen Bangen entgegen. Weder bin ich wirklich Fachmann, noch kann ich – bis auf ein paar Wendungen – Deutsch, doch ich hoffe, es ist einigermaßen unterhaltsam, informativ und akkurat.
Ein Wort zu meiner Begeisterung für Deutschland und seine Geschichte. Ich erzählte einmal einem Berliner Verleger, dass ich nach der Frankfurter Buchmesse (ich arbeite selbst in einem Verlag) eine Woche in den Harz fahren wolle, nach Quedlinburg – einer meiner allerliebsten Lieblingsstädte –, und er fragte mich, ob ich den Verstand verloren hätte, denn solch verschlafene Provinznester besuche man doch nur, wenn man jenseits von Gut und Böse sei. Dass mich dieser Ort, der jahrhundertelang von adligen Nonnen beherrscht wurde, so faszinierte, verstand der deutsche Verleger nicht.
Was mein Interesse zuerst entfachte, ist schwer zu sagen. Zunächst einmal hatte ich das Glück, als Lektor die Arbeiten einiger der wichtigsten britischen Deutschlandhistoriker zu betreuen, die von Ian Kershaw, Christopher Clark und Niall Ferguson; die Gespräche mit ihnen haben über die Jahre hinweg meine Ansichten sehr geprägt. Aber angefangen hat es in dem Sommer, als ich dreizehn oder vierzehn war und mit meiner Familie in den Ferien auf einem stinkenden Kanalkahn durch Elsass-Lothringen schipperte – ein Desaster. Doch diese erste Begegnung mit der oberrheinischen Kultur und ihrer schwierigen, oft tragischen Geschichte beeindruckte mich sehr. Wie ein aknegeplagter britischer Wiedergänger Goethes war ich begeistert von Straßburg und interessierte mich fortan ziemlich heftig für Geschichte, und am allermeisten für die Geschichte alles Germanischen und Deutschen.
Aber hinter dem viel späteren Wunsch, ein Buch darüber zu schreiben, stand noch mehr: Frustriert, dass meine britischen Freunde oft so wenig über Deutschland wussten, wollte ich ihnen – mit Humor und allerlei kuriosen Fakten – wenigstens ansatzweise ein Verständnis dafür vermitteln, warum ich in regelmäßigen Abständen auf ein paar Tage verschwinde und hochzufrieden zurückkehre, weil ich in Schwäbisch Gmünd oder Erfurt gewesen bin. Doch davon abgesehen war ich allmählich auch überzeugt, dass es in jedem Fall ein Buch wie dieses geben müsse.
Als ich, kurz nachdem die Mauer gefallen war, Deutschland zum ersten Mal richtig besuchte, war ich mehrere Tage lang in Magdeburg – und im Nu von seiner Geschichte fasziniert. Zum Zweck der Kolonisierung und Missionierung erbaut, hat es die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges aufs schlimmste zu spüren bekommen und ist heute ein Ort, an dem man überall auf Spuren des deutschen Nationalismus und Nationalstaatsgedankens im neunzehnten Jahrhundert, der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und des DDR-Sozialismus stößt. Es fühlte sich an, als sei der Boden der Stadt noch warm von dem, was hier passiert war. Besonders interessierte mich dann hier die Arbeit des Bildhauers Heinrich Apel. Beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg schuf er in den 1960er Jahren wunderschöne Türen, und für den großartigen Magdeburger Dom gestaltete er grandiose Bronzegriffe in Form von Eulen oder menschlichen Gesichtern, die sowohl absolut modern als auch seltsam alt aussehen. Wo immer ich dann auf Apels Spuren stieß, sonst noch in Magdeburg oder in Naumburg, staunte ich über die Zuversicht, mit der er Werke schuf, die bestimmt auch noch im zweiundzwanzigsten und dreiundzwanzigsten Jahrhundert in Ehren gehalten werden.
Eine andere Geschichte, die ich später noch ausführlicher beschreibe, habe ich am Schloss Sanssouci erlebt. Da stand ich am Grab Friedrichs des Großen, dort, wo er 1991 endlich begraben wurde, wie er es gewünscht hatte, und sah eine Gruppe älterer Deutscher, von denen etliche Tränen in den Augen hatten. Zuerst verstand ich gar nicht, warum sie beim Anblick des Grabes dieses seltsamen Mannes so traurig waren. Dann aber begriff ich, dass man durchaus tiefen Schmerz empfinden kann über all die Irrungen und Wirrungen, die die Deutschen im Laufe der Geschichte seit der Zeit Friedrichs bis heute mitgemacht haben. Ganz besonders in der ehemaligen DDR.
Der Besuch Magdeburgs, bei dem ich sah, wie die Stadt sich ihren alten Dom neu angeeignet hatte, und der Besuch des neuen Grabs für Friedrich den Großen im heutigen Potsdam gaben mir also vielleicht den entscheidenden Anstoß zu diesem Buch.
Auf jeden Fall war aber auch eine Begegnung in Regensburg vor fünf Jahren sehr wichtig. Ich mag die Steinerne Brücke über die Donau dort, und ich esse gern Bratwurst. Um diesen beiden Leidenschaften auf einmal zu frönen, ging ich zu dem unvergesslichen kleinen historischen Wurstkuchl an der Brücke und unterhielt mich mit einem sehr reizenden Paar aus Rottweil über das Wetter und die leckere Wurst. Nach einer Weile nahm der Mann seinen ganzen Mut zusammen und fragte: »Warum zum Teufel sind Sie hier?« Er und seine Frau verstanden nicht, warum ein englischer Tourist sich für eine bayerische Provinzstadt interessierte – und sie hatten ja auch recht, es liefen fast nur deutsche Touristen dort herum. Als ich, die Semmel mit der Bratwurst in der Hand, auf den Fluss schaute, zusah, wie sich an den Brückenpfeilern große Wasserstrudel bildeten, auf den Absätzen wippte und mich freute, an einem historisch so wunderbaren Ort zu sein, war mir dann vollends klar, dass ich ein Buch schreiben musste, in dem ich versuchen würde, diese Frage zu beantworten.
Erstes Kapitel
Aus dem Land der düsteren Wälder
Römische Germanen und Deutsche
Ein Alligator, fern der Heimat
Ich nehme grüne Soße dazu
Der mittelalterliche Parkplatz
König Wilhelm I. 1869 bei einem Besuch im Atelier Ernst von Bandels, wo er den Kopf des Hermannsdenkmals in Augenschein nimmt, das zur Erinnerung an den Sieg des Cheruskerfürsten über die Römer im Teutoburger Wald errichtet werden soll. (© akg-images: (N.N.))
Aus dem Land der düsteren Wälder
Besonders gut kann man über die Mythen der altehrwürdigen Ursprünge Deutschlands nachdenken, wenn man dem Vorspiel zum 2. Akt des Siegfried lauscht. Binnen weniger Minuten entsteht vor einem ein wild wuchernder, wegloser, düsterer Wald – es dräut Gefahr (namentlich in Gestalt eines schlafenden Drachen) –, die Spannung steigt und man ahnt, wie viele Jahre die Zwerge und Götter mit den Fingern getrommelt und gewartet haben, dass die großen (wenn auch weiß Gott albernen) Ereignisse ins Rollen kommen.
Schade, aber auch wieder gut, dass Nichtdeutsche zu Wagners Musik keine unmittelbare Beziehung haben. Natürlich gibt es unter ihnen viele heftig Wagner-Begeisterte und große -Interpreten, doch die Wurzeln des Dramas und sein Bedeutungsgehalt fallen geradewegs in den Zuständigkeitsbereich der Deutschen. An diesem Vorspiel im Walde ist mehreres für die deutsche Kultur sehr typisch: Englische Wälder hat man so schnell durchquert, dass man sie verpassen könnte, und darin spazieren zu gehen gilt eher nicht als sportliche Betätigung. Alle zehn Meter oder so kommt ein Kinderspielplatz, eine Imbissbude oder eine Schautafel. Aber in Deutschland kann man immer noch auf einem Hügel stehen und, so weit das Auge reicht, nichts als wogende Bäume sehen – und doch sind das nur Reste des uralten Waldes, heute top gepflegt. Auch der Drache, die Zwerge und die Götter wirken gerade in diesem Land überzeugend, wie Geschöpfe aus einer Spielzeugkiste, die in den Bergen und Wäldern schlummern und von Generationen von Sprach- und Volkskundlern oder Komponisten immer wieder hervorgeholt, neu bemalt und in den Mittelpunkt zahlloser Festspiele und Kinderbücher gestellt werden.
Die Deutschen haben mit ihrer weit zurückliegenden Vergangenheit erheblich mehr Aufwand betrieben als die Engländer. Deren Neugierde auf ihre Ursprünge war immer gebremster. Die beiden Länder lagen lange unter derselben urzeitlichen Eisplatte, doch mit deren Schmelzen gingen sie getrennte Wege. (Süddeutschland war nicht von Eis bedeckt, womit es dummerweise selbst im Pleistozän schon anders wurde.) Die historischen Anfänge Englands sind oft einfach nur peinlich. Als römische Kolonie war Britannien ein Härteposten und eine ziemliche Lachnummer. Schön wäre es, wenn die Römer uns wenigstens eine edle Stirn oder ein Gen für die Liebe zum klassischen Bildungsgut hinterlassen hätten, aber allein der Mangel an überlieferten Informationen über die Provinz besagt schon, wie wenig ihre Besitzer sie wertschätzten. Und während sich Europa im 19. Jahrhundert obsessiv mit der grauen Vorzeit beschäftigte, mussten die Briten ihre Überlegenheitsgefühle aus anderen Quellen beziehen. Nach Abzug der Römer wurde ihr Land nämlich auch noch zum Tummelplatz, wo sich jeder dahergelaufene Eindringling austoben konnte. Welle um Welle vergnügungssüchtiger Nordgermanen, Dänen und Norweger brandete heran; sie schwangen ihre Kampfbeile, bis das Land dann, als letzte Schmach, von den Normannen erobert wurde. In all diesem blutigen Gerangel tauchen immer wieder Arthur und Alfred auf – Ersterer von französischen Dichtern erfunden, Letzterer unter all den nachfolgenden Marodeuren so wenig auszumachen, dass man sich fragt, ob das moderne England überhaupt etwas mit ihm zu tun hat.
Weil England also als Betätigungsfeld für hackwütige Immigranten galt, taugt seine frühe, eher schmähliche Geschichte so gut wie nicht für ein erbauliches Narrativ. In Deutschland hat die sehr weit zurückliegende Vergangenheit allerdings auch immer eine zerstörerische, verhängnisvolle Wirkung gehabt. Wie viel schiefgehen kann, wenn man der vermeintlichen eigenen Geschichte zu viel Bedeutung beimisst, sieht man nirgends besser als daran, wie Deutschland seine allerersten Anfänge verstanden und verarbeitet hat. Da mögen diese in Opern ästhetisch noch so lustvoll daherkommen.
Überall im Lande haben Maler und Schriftsteller, teilweise getrieben von den gleichen Obsessionen wie Wagner, teilweise von ihm erst inspiriert, in dem historisch nicht gesicherten Abraum Mitteleuropas herumgestochert, um ein paar Hinweise darauf zu finden, woher sie kommen. Das einzige echte Dokument, das sich dann auch gleich sehr unglücklich auf die europäische Geschichte ausgewirkt hat, war Tacitus’ Schrift Über Ursprung und geografische Lage der Germanen, bekannt als die Germania. Das einzige Exemplar davon fand man in dem hessischen Kloster Hersfeld und verbrachte es 1455 nach Rom, wo man nach und nach die eigentliche Bedeutung des Textes begriff. Er ist im Übrigen weit umfangreicher und interessanter als der Agricola, die Beschreibung Britanniens vom selben Autor, und immer wieder hat man ihn Satz für Satz auseinandergenommen. Einige Leute versuchten ihr Leben lang auch noch das letzte Fitzelchen ungesicherter Information herauszufiltern, zunächst italienische Humanisten, die mit großem Aufwand den wenig dienlichen Mythos von den Urgermanen in den Wäldern erfanden und ihre Mitmenschen nördlich der Alpen mit diesem verheerenden Geschenk beglückten. Dass die Germania überhaupt noch existierte, war erstaunlich. Die um 100 n. Chr. geschriebene, allem Anschein nach kenntnisreiche, sehr genaue Schilderung fasst zusammen, was das Römische Reich über die Germanen wusste, und überlebte im Gegensatz zu vielen anderen Werken des Autors fast dreizehnhundert Jahre lang nicht nur Brände und die Unbilden des Wetters, sondern auch die Launen von Klosterbibliothekaren und -kopisten.
Bekanntlich gelang es den Römern, die ihre nördliche Grenze entlang Rhein und Donau befestigten, nie, die Germanen zu unterwerfen. Auch deshalb betrachteten deutsche Nationalisten die Germania als Gründungsdokument der Nation – einer Nation, in der »ein reiner, nur sich selbst gleicher Menschenschlag von eigner Art« lebte, um Tacitus’ fatale Worte zu benutzen. Er verglich die Tugenden der Germanen mit den Schwächen ihrer verweichlichten, unmoralischen, Toga tragenden Nachbarn und schilderte sie als robust, hitzköpfig, schlicht, ehrenhaft und gute Kämpfer. Sobald sie aber so dumm waren, sich auf eine offene Feldschlacht mit den Römern einzulassen, zogen sie den Kürzeren. Tacitus hielt eine feine Balance zwischen den Behauptungen, dass die Germanen einerseits so furchterregend waren, dass es jedem einleuchtete, warum sie außerhalb des Römischen Reiches lebten, und andererseits so barbarisch, dass es sich doch auch gar nicht lohnte, sie in die Knie zu zwingen. Im Ton klingt es ähnlich, wie britische Anthropologen bis vor kurzem noch die Afrikaner darstellten und ihnen das gleiche frappierend enge Spektrum typischer Aktivitäten zuschrieben: raufen, feiern, sich begatten und danach faul herumliegen.
Freilich ist die Germania in vielerlei Hinsicht ein Ammenmärchen, doch weil sie das einzige Zeugnis dieser Art ist, werden wir nie wissen, wie sehr. Sie stellt Germanien zum Beispiel als geografisch und ethnisch eindeutig definierten Teil der Welt dar, woraufhin man seit Kenntnis des Textes jahrhundertelang – und manchmal mit schrecklichen Resultaten – versucht hat, an der Einheit eines Landes festzuhalten, das sich in Wirklichkeit aufreizend beharrlich einer Festlegung entzogen hat. Außerdem spricht Tacitus nur deshalb von den Tugenden der Germanen, samt unheilvoller Reinheit, um es dem seiner Meinung nach korrupten, sexuell promisken Drunter und Drüber in Rom entgegenzuhalten; keineswegs wollte er das im Jahr 100 des Herrn in einem nur vage verstandenen, unwirtlichen Teil Europas lebende Volk damit ernsthaft beschreiben. Wir werden nie unterscheiden können, wann Tacitus uns Informationen gibt, die er aus zuverlässiger Quelle hat – er selbst ist nie auch nur in der Nähe Germaniens gewesen –, und wann er den Seinen daheim nur geschickt etwas unterjubeln will. Also: Liebten die Germanen ihre Gattinnen tatsächlich und waren sie ihnen treu, oder stichelt Tacitus nur gegen seine Freunde?
Allerdings vermittelt die Germania einen lebendigen Eindruck davon, dass die Einwohner des gleichnamigen Gebiets doch sehr anders sind als die des Imperiums, und das muss den Tatsachen entsprochen haben. Im Imperium Romanum lebte eine sesshafte Bevölkerung, die Straßen benutzte, Steuern zahlte und sich zentral regieren ließ, während jenseits des Rheins unstete, mordlustige, halb anarchische Gesellen in lockeren Banden auf Lichtungen in unendlichen, dünn besiedelten Wäldern hausten und keine Straßen brauchten. Die Römer hassten diese Wälder – immerhin erlitten sie in einem Wald eine der berüchtigtsten militärischen Niederlagen ihrer Geschichte: in der Schlacht im Teutoburger Wald, in der Arminius, Hermann der Cherusker, mal eben zwanzigtausend Legionäre und ihre Befehlshaber niedermetzelte. Hermann taucht dann auch folgerichtig im neunzehnten Jahrhundert immer wieder mit dichtem Schnauzbart und angestrengt rechtschaffenem Stirnrunzeln in Gemälden und als Statue auf.
Wie sehr die Römer Germania verabscheuten, setzt Ridley Scott in seinem Film Gladiator wunderbar in Szene. Er beginnt mit den Feldzügen Kaiser Mark Aurels gegen die Germanen. Vor der großen Schlacht fährt die mit einem besonders grauen Graufilter ausgestattete Kamera in einen gespenstischen, eisigen, nebelumwaberten Wald, und spätestens, wenn das Wort »Germania« ins Bild springt, wissen wir nun, zweitausend Jahre danach, dass der Schatten des Römischen Reiches lang ist. Und wir sehen hier keinen deutschen Wald, in dem Vöglein zwitschern und Scharen älterer Herrschaften idyllische schöne Wanderwege beschreiten, sondern einen finsteren Albtraum, so wie sich Menschen aus dem Land der Zitrusfrüchte am tiefblauen Meer oder eben Kalifornier den deutschen Wald vorstellen. Der Erfolg des Films hat die Diskussionen über den Charakter der alten Germanen auf vergnügliche Weise wiederentfacht. Es werden hier sagenhaft schmuddelige, mutige, aber strategisch strohdoofe Soldaten gezeigt, die den etepeteten, angeekelten römischen Legionären Flüche samt einer Ladung Schnodder entgegenschleudern. Auch sonst fühlten die Filmemacher sich nicht zwanghaft einem Realismus verpflichtet, sondern richten es sogar so ein, dass wir den von Russell Crowe gespielten römischen General verstehen, weil er Englisch (beziehungsweise Deutsch) spricht und nicht etwa Latein, während die bedauernswerten Germanen, wie gesagt, zu blöde sind, für eine ordentliche Deckung zu sorgen, und ihrer unausweichlichen Niederlage entgegenröcheln.
Aber waren die alten Germanen wirklich so? Haben also etwa die Menschen in der Frankfurter U-Bahn irgendetwas mit diesem zottelmähnigen Völkchen gemein? Das Unheil, das Tacitus’ Germania über all die Jahrhunderte anrichtete, besteht darin, dass man heute – schon wegen des Titels – glaubt, dass es eine solche Verbindung gibt. Für den römischen Geschichtsschreiber war »Germania« lediglich ein Gebiet mit nichtrömischen Menschen, zahlreichen verschiedenen Stämmen, die sich oft nicht grün und streit- und feiersüchtig waren. Moderne Deutsche verstanden aber seltsamerweise nicht, dass der Rassenstolz, der hier beschworen wurde, sich auf beharrliche Rückständigkeit, Uneinigkeit, Trägheit und Chaostrinken gründete. Stattdessen beriefen sie sich auf das Fantasiestück von Tacitus, um ihren Batzen Land als bedeutende Einheit und vor allem durch und durch »deutsch« darzustellen. Tacitus förderte außerdem das Bild von Deutschland als Land der Wälder und der persönlichen Freiheit, wenn diese auch merkwürdig verquickt war mit geradezu idyllischem, bedingungslosem Gehorsam gegenüber dem jeweiligen Stammesoberhaupt.
Durch das Gebiet, das heute Deutschland heißt, sind in den tausend Jahren zwischen der Germania und dem Entstehen eines ansatzweise echten mittelalterlichen Deutschland so viele Völker hin- und hergewandert, dass man die Stämme, über die Tacitus redet, nur im allerentferntesten Sinne als Vorväter der Deutschen bezeichnen kann. Berühmt-berüchtigt sind die marodierenden, aber klugen Wandalen, die anscheinend aus dem Gebiet des heutigen Schlesien nach Spanien und gegen Ende des Römischen Reichs nach Nordafrika gewandert sind und durch ihre Gewalteskapaden ihren Namen in mehreren Sprachen hinterlassen haben. Die Burgunder, deren Reich letztendlich zwischen dem späteren Frankreich und Deutschland lag, wanderten durch Mitteleuropa, stammten aber allem Anschein nach von der schwedischen Insel Gotland. Wie viele sie waren, wie viele Stämme sie massakrierten oder was für einen Einfluss sie auf die Stämme hatten, in die sie einheirateten, werden wir nie wissen, wie ja auch sonst eigentlich kaum etwas aus ihrer Zeit. Trotz intensivster Forschung bleiben wir über die Bewohner oder Stammesnamen ganzer Gegenden in Deutschland mehr oder weniger im Dunklen. Manche dieser Völker müssen eine Art Urdeutsch gesprochen haben, doch neben ihnen lebten zahlreiche andere Stämme und unzählige übelriechende, bärtige Zugezogene, die sich durch die angeblich undurchdringlichen Wälder einen Weg schlugen: Hunnen aus Zentralasien, Goten aus Schweden, Scharen von Awaren, Tschechen und Sorben. Sie alle strömten von Osten oder Norden nach Mitteleuropa, vertrieben jedes Mal andere Stämme und schufen neue Gesellschaften und Religionen und wurden, kaum dass sie sesshaft geworden waren und kapiert hatten, wie man Ackerbau betreibt, von den nächsten Neuankömmlingen schon wieder weiter gen Westen vertrieben.
Gemeinhin werden diese Wanderungen und Verschiebungen von Völkern über circa tausend Jahre als Prozesse gesehen, die irgendwann abgeschlossen waren – vom ersten Kontakt mit den Römern bis um das Jahr 900 n. Chr., als sich die Magyaren in Ungarn niederließen. Doch zu den Kuriositäten der deutschen Geschichte gehört, dass die Grenzen unglaublich fließend waren, weil jede größere Volksgruppe oder Untergruppe zu verschiedenen Zeiten ihre Nachbarn unterwarf und eine Vielzahl sich tragisch überlappender Mythen darüber schuf, wer rechtmäßig über wen in welchem Gebiet herrschte. Je mehr man die kaum noch wahrnehmbaren Wanderwege der alten Stämme begrübelte, desto falschere, absurdere, aber auch mörderischere Muster konnte man erkennen. Nationalisten des neunzehnten Jahrhunderts betrachteten die Spannungen zwischen Sachsen und Wenden oder Polen und Preußen als in dunkler Urvergangenheit wurzelnd, obwohl es ausschließlich um moderne Probleme von Macht und Vorrechten ging. Alle liebten diese metseligen Vorfahren mit den schicken Flügelhelmen, die mit den Fäusten auf Banketttafeln hämmerten und jedem, der ihnen in die Quere kam, ewige finstere Rache schworen.
In Theodor Fontanes märkischem Roman Vor dem Sturm, der 1878 erschien und dessen Handlung sechsundsechzig Jahre früher beginnt, gibt es eine wundervolle Szene, in der in einem entlegenen, konservativen Teil Brandenburgs zwei alte Freunde, ein Pastor und ein Justizrat, einen von zweifellos vielen schönen Abenden miteinander verbringen und über das winzige Bronzemodell eines Streitwagens aus einer Ausgrabung diskutieren. Ist es, mit Odins Raben verziert, ein Meisterstück germanischen Kunsthandwerks oder ein Schulbeispiel für die große wendisch-slawische Kultur, das Spielzeug eines obotritischen Fürstensohnes mit Otternfellmütze und zu einer Zeit verfertigt, als die Germanen noch »unter Fichten und Eichen wohnten und sich in Tierfelle kleideten« und mit grob behauenen Faustkeilen herumfuchtelten?
Die Argumente fliegen hin und her, die beiden Männer schöpfen aus einem geradezu absurden Fundus an Beweisen aus Sprache und Metallurgie, und dann kommt der Pastor mit dem schlagenden Argument, dass sogar der Name des Guts seines Freundes, Hohen-Vietz, zutiefst slawisch klingt. Natürlich liest man schmunzelnd, wie sich ein großer deutscher Romancier auf dem Höhepunkt des deutschen Chauvinismus über ebendiesen lustig macht, doch in dem kurzen Kapitel werden auch alle Unklarheiten über die Anfänge des »Deutschtums« zusammengefasst. Realiter war und ist Deutschland ethnisch vollkommen durchmischt, ja, ein regelrechtes Fundbüro, in dem man nach einem »reinen Menschenschlag« zuallerletzt suchen sollte. Während der Jahrhunderte, in denen Dutzende von Stämmen kamen und wieder gingen, sich vernichteten oder durch Heirat vermischten, wurde es immer unmöglicher, zu erkennen, wer Muttersprachler war und wer einfach irgendwann den weisen Entschluss gefasst hatte, Deutsch zu lernen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in der Elterngeneration des Muttersprachlers noch Keltisch, ein nordgermanischer Dialekt, oder sogar Obotritisch gesprochen wurde, war auch groß.
Was allerhöchstens als Lokalgeschichte oder schrulliges Privathobby amüsant sein mag, konnte schrecklich mutieren, wenn es Regierungspolitik wurde. Am komischsten sind vielleicht die Versuche im Nationalsozialismus, so etwas wie eine heidnische Atmosphäre in Deutschland wiederzuerschaffen und sogenannte »Thingtheater« zu bauen, riesige Freiluftarenen, die man mit knorrigen, hohen Eichen, zerklüfteten Felsvorsprüngen und dem üblichen Quatsch ausstattete und wo man sich nach althergebrachter nordischer Sitte versammeln und Historienspiele reinen Germanentums anschauen sollte. Die Vorstellung, wie Leute, die die Nazis gewählt hatten, in Kälte und Regen hocken und andere Leute in altgermanischen Trachten anschauen mussten, die neonordischen Nonsens deklamierten, bereitet mir gelinde, aber zutiefst empfundene Genugtuung. Die Thingtheater waren ein Flop, und es wurden auch nur wenige gebaut; wenn sie heute nicht verfallen sind, werden sie gar nicht oder für Rockkonzerte genutzt. Unendlich viel schauriger war allerdings das Neoheidentum der SS, die besessen war von Reinheit des Bluts, Runen, heiligen Eiden, Fackeln und Weihestätten. Zum Glück leben wir heute in einer Zeit, in der wir ermessen können, wie verachtenswert dieser deutsche Rückbezug auf die Vergangenheit war.
Römische Germanen und Deutsche
Die Mythen des »alten Germanien« waren an sich schon verworren, doch gleichermaßen verblüffend ist es, dass südlich der Donau und westlich des Rheins wichtige Gebiete der späteren deutschen Welt voll in das Römische Imperium integriert waren. Sie lagen ja weit vor den Kampflinien, die in Gladiator so liebevoll gezeigt werden.
Städte wie Koblenz, Wien, Worms und Augsburg (die Stadt des Augustus) begannen als Militärlager, die Augustus oder Tiberius im ersten nachchristlichen Jahrhundert errichten ließen. Auch Regensburg, Baden-Baden, Heidelberg, Köln und viele andere Städte wurden von den Römern gegründet. Dieses nicht zottelmähnige, nicht dichtbewaldete Germanien, in dem es von Straßen, Brücken, Krügen mit Olivenöl und Verwaltungszentren nur so wimmelte, bot ein vollkommen anderes Bild und prägte zu viele wichtige deutsche Städte, als dass man es als nicht echt oder nicht deutsch ansehen konnte. So bekamen die Germanen und dann die Deutschen einen unmittelbaren Zugang zur römischen Kultur, der dem von Tacitus beschriebenen natürlich ziemlich entgegensteht – wenngleich nicht weniger albern, als alte Waldvorfahren heraufzubeschwören.
Auch die Existenz einzelner Ensembles römischer Bauten in Orten wie Regensburg oder Trier schafft kein festeres Band zwischen ihren ursprünglichen, längst entschwundenen Bewohnern und den zufällig heute dort Lebenden. Doch wie fiktiv auch immer, viele Deutsche legten auf diese Verbindung zum alten Rom großen Wert; und es lag ja auch alles so lange zurück, dass Echtes von Falschem kaum mehr zu unterscheiden war. Am sinnfälligsten wird die Vermischung darin, dass die mittelalterlichen Könige sich und das Heilige Römische Reich in der Nachfolge Karls des Großen (742 – 814) sahen, der als »Kaiser, der das Römische Reich regiert«, tituliert wurde, großen Wert auf klassische Bildung legte, sich an römischen und byzantinischen Vorbildern orientierte und in Rom vom Papst gekrönt wurde.
Einer von Karls mächtigsten angeblichen Vorgängern, Konstantin der Große, hatte als junger römischer Kaiser Anfang des vierten Jahrhunderts von der alten römischen Stadt Trier, Augusta Treverorum, aus geherrscht, wo er sich die Zeit damit vertrieb, rebellische Frankenführer wilden Tieren zum Fraß vorzuwerfen. Aus schierer Unkenntnis hatte ich mir Konstantin immer unter südlicher Sonne vorgestellt, wie er faul in einem Palasthof herumlümmelt, durch den Schwaden duftenden Räucherwerks ziehen, mit Goldstaub bedeckte Eunuchen ministrieren und von Handtrommeln und Harfen kunstreiche Musik erklingt. Doch dieses Potpourri aus späteren byzantinischen Klischeebildern passt mitnichten zu dem jungen Konstantin, der im düsteren Trier sitzt, einer rauen, militärisch geprägten Stadt in einem zersplitterten, von kriegerischen Horden überrannten Europa, und sich einen Kopf macht, was es mit dem Christentum nun auf sich hat.
Trier ist im Zweiten Weltkrieg stark zerstört worden, besitzt aber immer noch ein paar kuriose römische Relikte. Die riesige, deprimierend kalte Porta Nigra und Konstantins Palastaula vermitteln einen Eindruck davon, wie hoch das römische Leben, selbst hier, so weit im Norden, entwickelt war. Der Palastaula ist von Architekten, Unfällen und Bomben derartig zugesetzt worden, dass man kaum fassen kann, wie lange – seit sechzehnhundert Jahren! – diese Mauern hier schon stehen. Aber Triers Lage im Herzen der »deutschen« Christenheit verlieh ihm für die nächsten Jahrhunderte stets einen gewissen Glanz; der Erzbischof von Trier gehörte später zum siebenköpfigen Kurfürstenkollegium des Heiligen Römischen Reiches.
Das unbestritten römische Element im Leben der Deutschen kam Generationen deutscher Gelehrter sehr zupass, und sie pickten sich aus den Erörterungen römischer Schriftsteller über die Vorzüge der Republik oder des Kaiserreichs eifrig das heraus, was ihre jeweiligen Anliegen stützte. Dabei waren viele der von viel späteren Herrschern gebauten, überall in deutschen Landen verstreuten römisch inspirierten Schlösser und Statuen durch die italienische Renaissance beeinflusst, doch da sie wirkten, als gehörten sie seit jeher an ihre Standorte, bestärkten sie vor allem die Bewohner Süd- und Westdeutschlands in dem Gefühl, dass es sich hier um ein direktes, wenn auch kompliziertes Erbe der Antike handelte.
Das Heilige Römische Reich war ein Ausbund an Widersprüchen, Dummheiten und genialen Kompromissen, man war aber immer darauf bedacht, seine Legitimität vom Imperium Romanum herzuleiten. Latein blieb weitgehend die Schriftsprache in geistigem Leben, Recht und Politik – das war im Übrigen auch die einzig vernünftige Art und Weise, die Flämisch, Polnisch, Dänisch, Ungarisch und Deutsch sprechenden Menschen innerhalb der Reichsgrenzen zusammenzubringen, und zum anderen betonte man damit die legendäre Kontinuität. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (und sein gewählter Nachfolger) agierte angeblich in einer Abfolge von Herrschern, die über Karl den Großen direkt auf Rom zurückgingen, und führte seit der späten Ottonenzeit zwischen Königswahl und Kaiserkrönung den Titel »römischer König«.
Die Romanitas-Manie zeigt sich heute immer noch in den deutschen Museen, die mit offenbar unerschöpflichen Beständen an wenig interessanten römischen Objekten vollgestopft sind. Ein hässlicher Raum in Mainz steht so voller schwarzer Pötte, dass man sich lebhaft vorstellen kann, wie römische Kaufleute sich einen leichtsinnigen, aber nachhaltigen Scherz erlauben und munter eine Schiffsladung nach der anderen in den Fluss kippen, um späteren Archäologen Rätsel aufzugeben. Da sich über Geschmack bekanntlich nicht streiten lässt, finden manche Museumsbesucher Räume mit Münzen, Grabinschriften, angeknacksten Statuen und Helmen total faszinierend. Zugegeben, es sind bisweilen herrliche Sachen aufgetaucht – am eindrucksvollsten ein riesiger Mosaikfußboden in Köln, 1941 bei Bauarbeiten zu einem Luftschutzbunker –, doch im Grunde war das »germanische« Römische Reich ziemlich unbedeutend. Mit wenigen Ausnahmen wie Trier gründeten die Römer ja lediglich Garnisonen, um Stämme von jenseits des Rheins und der Donau fernzuhalten und die viel reicheren italienischen und gallischen Kernlande zu schützen.
Nach Abzug der Römer verödeten viele Städte mehr oder weniger; durchziehende Fremde wohnten eine Weile darin, kamen und gingen. Die großen Bauten verfielen, die Steine benutzte man anderweitig, in den Grundmauern legte man Gemüsegärten an. Manchmal ließ sich ein Stammesfürst an einem Ort nieder und schützte ihn, doch für ernsthafte, längerfristige Nutzungen gibt es nur wenige Indizien und für Neubebauungen in der Zeit nach 500 n. Chr. gar keine.
Wie erwähnt, haben diese vermeintlichen römischen Wurzeln einen starken, widersprüchlichen Einfluss auf die deutsche Geschichte ausgeübt, und deutsche Altphilologen, Architekten, Dichter und Musiker haben sie sich in unterschiedlichster Weise zu eigen gemacht. Viel ist auch dem kulturellen Einfluss aus Italien selbst geschuldet – nicht nur einem spezifisch germanisch-römischen Erbe –, doch das hat manche Stadt im Rheinland und die Herrscher Bayerns und Österreichs nie daran gehindert, sich mit getürkten Verbindungen zum Römischen Reich zu schmücken. Auch die Auffassung vieler Deutscher von Friedrich dem Großen an, dass sie zuvörderst ein kriegerisches Volk seien, wurde von Vergleichen mit dem Römischen Reich genährt – wenngleich man zahllose Beispiele für sehr unrömische, germanisch-deutsche militärische Inkompetenz dagegen ins Feld führen könnte. Hitler ließ sich übrigens vom Britischen Empire mindestens ebenso inspirieren wie vom Römerreich; er wollte die Slawen behandeln wie die Briten die Inder und behandelte sie letztlich wie die Briten die Aborigines. Doch seine Truppen verhielten sich wie die römischen, und er hatte irrwitzige, römisch anmutende Kolonisationspläne mit Veteranensiedlungen am Ural – so hatte ja auch Köln einmal begonnen.
Fantasievorstellungen über die Römer frönte man natürlich nicht nur in Deutschland – so verschiedene Herrscher wie Ludwig XIV. und Mussolini haben sie gepflegt, und ein pseudorömischer Stil findet sich rund um den Globus, vom Jefferson Memorial in Washington D. C. bis zur Alexandersäule in St. Petersburg. Das Vermächtnis Roms ist eben so vielgestaltig, dass sich jeder daraus bedienen kann.
Das bis 1806 bestehende, zusammengestoppelte und äußerst instabile Vielvölkergebilde namens Heiliges Römisches Reich und die Behauptung des Kaisers, in direkter Nachfolge des antiken Rom zu stehen, sorgten allerdings auch für manche Erheiterung. Da die herrschenden Kreise in diesem Reich Deutsch sprachen, kam man dann auch bald auf den Gedanken, dass Deutschland nach dem Vorbild Roms eine umfassendere Mission habe, nämlich ganz Europa zu beherrschen, und dass es einen natürlichen Anspruch auf so weit auseinanderliegende Regionen wie Belgien, Italien und die östliche Ostsee habe. Selbstverständlich entbehrte das jeglicher Grundlage, war doch das Herz des Reiches in der Frühzeit unter den Sachsenkaisern gerade die primitive, waldreiche, trostlose Region gewesen, die sich vor Zeiten einmal mit Klauen und Zähnen gegen alles, was Rom bot, gewehrt hatte. Doch das ignorierte man geflissentlich.
1945 trieben die Westalliierten die nationalsozialistischen Parteigenossen, die noch nicht das Weite gesucht hatten, mit Absicht langsam durch die Ruinen von Trier, der ältesten deutschen Stadt und einstmaligem Sitz des weströmischen Kaisers, die nun einer Mondlandschaft glich, deren Straßen mit Trümmern übersät und deren große Monumente offenbar unwiederbringlich verloren waren. Hin und wieder handeln Menschen einfach absolut richtig, und hier in Trier – in dieser Situation! – war das der Fall. Das »Dritte Reich« war im Grunde ein Versuch, Phantasmagorien von heidnischer Dunkelheit, Wald und einem reinen Menschenschlag mit der Erschaffung eines neuen Römischen Reiches zu verquicken; die Hauptstadt Berlin sollte »Germania« heißen. Dem Christentum, für dessen frühe Verankerung im Westen Trier stand, sollte irgendwann natürlich der Garaus gemacht werden. Mit einer gewissen Befriedigung frage ich mich, was den geistig noch Viferen unter den Nazis auf diesem Marsch durch Trier wohl durch den Kopf ging.
Ein Alligator, fern der Heimat
Neben diesen zunächst augenfälligsten Bezügen zur römischen Kultur haben viele Deutsche sich aber auch gerade auf Aspekte in überlieferter römischer Literatur bezogen, die gänzlich unmilitärisch, privat, ästhetisch oder demokratisch sind. Und weil Rom eine solch zentrale Rolle im Christentum spielte, aus dem wiederum eine enorm umfangreiche Literatur in Latein entstand, war das Erbe so groß und komplex, dass man es eben nicht nur in einzelne Richtungen interpretieren oder nur bestimmte Lektionen daraus lernen konnte, wenngleich das etliche deutsche Herrscher oder Schriftsteller nach Kräften versuchten. Das Vermächtnis des »nichtrömischen« Germanien kam aber auch sehr gelegen. In England dagegen hat sich (außer Rudyard Kipling und ein, zwei anderen) niemand sonderlich für mit Waid blaugrün gefärbte, sich mannbar der Römer erwehrende Britannier oder die kentischen und mercischen Königreiche der Nachrömerzeit interessiert. Selbst die altnordischen Eindringlinge leben in der Erinnerung der Engländer bestenfalls als diejenigen fort, die mit Gusto Mönche in Lindisfarne massakrierten oder deren König Knut der Große sein Gefolge am Meer belehrte, wie gering seine royale Macht war: Er zeigte ihm nämlich, dass nicht er über Ebbe und Flut gebieten konnte, sondern allein Gott. Das alte Germanien wiederum, auf das man bei Tacitus oder in den fragmentarischen Überlieferungen zum Leben in dem turbulenten Hin und Her der Stämme im frühen Mittelalter einen Blick erhascht, hat auf die modernen Deutschen stets eine starke Anziehungskraft ausgeübt. Der Wald wurde immer wieder als Wiege und Hort der Wahrheit gepriesen – von Goethe über die Brüder Grimm bis zu Martin Heidegger.
Diesen Kult des alten Germanentums spürt man heute noch auf sehr reduzierte Weise unweit des Touristenorts Königswinter am Rhein mit seinen heruntergekommenen Hotels und freudlosen Reisegruppen. Angeblich hat Brünnhilde in den Bergen im Osten geschlafen, und es gibt reizvolle Wagner-Wanderwege. Das Highlight ist die 1913 zum Gedenken an Wagners einhundertsten Geburtstag erbaute Nibelungenhalle am Hang des Drachenfels. Ihre runde Form und prunkvolle Ausstattung soll den Eindruck erwecken, als komme sie aus altehrwürdiger Vergangenheit, als stehe hier die Festhalle eines Stammesfürsten samt Inventar direkt aus dem Nibelungenlied. Tatsächlich beeindruckt an dem Gebäude neben den Vorkriegs-Jugendstildekorationen eine dümmliche Begeisterung, die vom Nationalsozialismus noch nichts wusste, und man sollte es schon deshalb stets in Ehren halten. Im Inneren kann man sich auf rissige, betagte Lederbänke (offenbar Teil der Erstausstattung) setzen und eine Wagnerbüste bewundern. An den Wänden hängen symbolistische Gemälde mit Szenen aus dem Ring (nicht alle davon unbedingt gleich packend) in schweren Rahmen.
Weil diese Festhalle für viele Touristen offenbar von nie versiegendem Reiz war, haben sich die Besitzer um zusätzliche, nicht unbedingt gelungenere Attraktionen bemüht. Aus Lautsprechern ertönen nonstop Orchesterpassagen aus dem Ring, und draußen kann man Honig aus merkwürdigen Bienenkörben kaufen, die als Köpfe mit George-W.-Bush-Fratze gestaltet sind; die Bienen können durch den geöffneten Mund ein- und ausfliegen. Eine massige Drachenplastik, vermutlich Fafner aus Siegfried, erreicht man durch einen gruselig gemeinten, gewundenen unterirdischen Korridor. Leider wirkt der Drache so blässlich, dass man die Verzweiflung versteht, mit der die Macher dann versuchten, das Drachenthema noch einmal anders anzugehen. Zu einem einigermaßen geglückten Ergebnis fanden sie mit der Einrichtung eines kleinen Reptilienzoos. Nachdem ich also die Ehrenhalle für Hunding, Gunther und andere Wagner-Ikonen verlassen hatte und durch das übliche Gewusel von Königsnattern, Tigerpythons und Anacondas spaziert war – die nur deshalb, weil der Zoo schon so lange existiert, zu prächtigen Exemplaren herangewachsen waren –, erlebte ich endlich einen Moment reinen Glücks: In einem Freiluftbecken trieb, fast reglos, ein Alligator aus Louisiana, der erschreckend groß war, aber im Grunde überhaupt nichts hermachte. Da er fast ganz im Wasser lag, bildeten die unzähligen Hubbel und Kuhlen auf seinem Rücken natürliche Trinkwassertümpel für die Bienen aus den nahen Anti-Bush-Bienenkörben. Wenn er in regelmäßigen Abständen ein wenig tiefer ins Wasser glitt, flogen die Bienen auf, drehten ihre Kreise und warteten, bis die Tümpel wieder erschienen.
Eine Oper über Deutschlands entfernteste mythische Vergangenheit – eine Vergangenheit, über die auch ein kurzer, jahrhundertelang verschollener römischer Text berichtet – hat Menschen des Fin de Siècle zur Rekreation einer germanischen Festhalle veranlasst – und ihre Erben animiert, Bienenkörbe und eine verblichene Drachenskulptur aufzustellen, und schlussendlich sogar dazu, eine Kreatur aus den Sümpfen Louisianas, deren Ahnenkette noch viel weiter zurückgeht, lebenslänglich in einem Betonbecken am Rhein einzuschließen. Wir leben schon in einer sehr seltsamen Welt.
Ich nehme grüne Soße dazu
Wenn es eines gibt, bei dem sich mehr oder weniger alle Briten oder US-Amerikaner einig sind, dann ist es das horrormäßige deutsche Essen. Während wir Engländer eine Mixtur aus Zucker, Salz und Fett in der Mikrowelle brutzeln lassen oder Tortillachips mit Currygeschmack knuspern (eine britische Monstrosität), schütteln wir den Kopf darüber, was für einzigartig grauenhafte Dinge die Deutschen essen, nicht ohne es mit einem Witz darüber abzurunden, was sie alles in der Wurst verwursten.
Natürlich kommt einem bei dem Gedanken an viele Landschaften in Deutschland nicht als Erstes die Haute Cuisine in den Sinn. Manche Teile Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs erinnern durchaus an Dakota – verlassene, winddurchpeitschte Mondlandschaften mit versprengten kleinen Häusergruppen, gemeinhin als aneinandergeschmiegt beschrieben, aber schon in einer Phase, in der sie das nicht mal mehr um des Überlebens willen tun. Man denkt beim Anblick dieser beschränkten Welt gleich an den Hausherrn, der darauf wartet, dass die Gattin die Kreissäge anschmeißt, um noch ein bisschen Winterkohl zu schneiden, während er zum DVD-Player rennen und seinen Lieblingsfilm Deckgewohnheiten von Ackergäulen abspielen kann. Die genannten Provinzen waren den preußischen Planern des neunzehnten Jahrhunderts ein Dorn im Auge. Sie träumten davon, weitere Tausende zählebiger Rübenbauern dort anzusiedeln, mussten stattdessen aber erleben, wie diese millionenfach nach Amerika auszogen, wo die Möglichkeiten unbegrenzt waren. Neben diesen kargen Landschaften gibt es freilich auch ungeheuer fruchtbare wie die sattgrünen Gefilde in Schwaben oder die berühmte Goldene Aue, die sich zwischen zwei thüringischen Gebirgszügen erstreckt und mit ihren adretten Feldern, Wiesen und Obstgärten aussieht wie aus dem Bilderbuch. Wenn man sich ein bisschen bückt und verrenkt, bemerkt man auch die pyramidenhaften Erhebungen aus Bergwerksschlacke oder die heruntergekommenen Schnapsfabriken nicht. Fast überall ist die Landschaft der englischen nicht unähnlich, gleichermaßen geprägt von relativ schwachem Sonnenlicht und frustrierender Nördlichkeit.
Wenn Deutschland das Land der Gewürzgurken und des Schnapses und eben nicht Hort der feinen Küche ist, dann liegt das auch an seiner geografischen Beschaffenheit. Mit den in den glücklichen Mittelmeerländern gebotenen Gaumenfreuden kann man schwer mithalten. Die deutschsprachigen Gebiete müssen die einzigen sein (wenn man, wieder einmal, das Land der Briten und Iren außer Acht lässt), die mit langen Wintern im Norden, der klimatischen Katastrophe der Berge im Süden und einem halbwegs gemäßigten mittleren Bereich gestraft sind. Wie ein Hamster im Laufrad wird die deutsche Kulinarik vom Klima dazu angetrieben, in einem fort Gerichte mit Würsten, Steckrüben und Kartoffeln auszuwerfen. Innerhalb dieser engen Grenzen gibt es freilich erhebliche regionale Unterschiede, die deutlich vom Einfluss der Nachbarländer bestimmt werden. Im Norden huldigt man dem Verzehr lang verendeten Fischs nach Art der Skandinavier, im Süden isst man eine Form von Pasta, die eigentlich keine Zukunft hat. Im Westen muss man bis an die Mosel fahren, um wirklich appetitliche, frische Salate zu bekommen, doch je weiter man in den Osten geht, desto wahrscheinlicher trifft man auf denaturierte, gewürzfreie Versionen von Gulasch und die allgegenwärtige Soljanka, eine fast geschmacklose Variante einer an sich schon nicht reizvollen ukrainischen Suppe. Die Abneigung gegen Gewürze teilen alle Menschen im Norden Europas. Jedes Jahr importiert Deutschland riesige Mengen Zimt und Paprika – und mengt sie in wahren Wolken süßen oder herzhaften Gerichten bei –, aber wie wenig sich diese vermutlich angejahrten Pulver geschmacklich bemerkbar machen, ist beeindruckend. Paprikachips »ungarischer Art« (das deutsche Äquivalent der gesalzenen Kartoffelchips) sind in ihrer Allgegenwart ein Fluch für Reisende, denn meist gibt es an kleinen Bahnhöfen nur die zu kaufen. Ein schreckliches Nahrungsmittel und dann auch noch so wenig scharf, dass es eine Beleidigung für alles Magyarische ist.
Diese wiederkehrenden zivilisatorischen Notlagen sind zu erwarten. Immerhin haben wir es mit einem Teil Europas mit kulinarischem Minderwertigkeitsgefühl und wenigen Zutaten zu tun, der aber umgeben ist von Gesellschaften, die von Sonnenlicht absolut verwöhnt werden. In Deutschland wachsen keine Melonen und Oliven, keine Orangen. Man muss also nach dem Kernland der deutschen Küche vernünftigerweise in der mittleren Zone suchen – und mit erbarmungsloser Logik stellt sich das als richtig heraus. Die Region, grob geschätzt von Frankfurt bis Regensburg, wartet mit der klassischen deutschen Küche auf, also echt leckeren, deftig gewürzten Würstchen und Eintöpfen. Hier genießt man auch den feinen Flussfisch. Mir war das leider nicht vergönnt, weil ich in Nürnberg, der Hochburg für gutes traditionelles deutsches Essen, das zweitschlechteste Mahl meines Lebens zu mir genommen habe. Es bestand aus einem großen blauen Karpfen, so gebacken und serviert, dass sich sein Kopf und Schwanz trafen, garniert mit lieblos gekochten Kartoffeln und Petersilie. Ein Graus. Ich musste daran denken, dass ich mal gelesen hatte, die gesamte Haut ginge einem in einem Rutsch wie Handschuhe von den Händen ab, wenn man sie sich in manchen, von Metallen und Chemikalien verseuchten Flüssen in New Jersey wusch. Dieser Fisch schien ähnlich zu Tode gekommen zu sein, wobei die blaue Farbe es noch schlimmer machte. Als ich versehentlich ins Fleisch schnitt, entströmte daraus ein Geruch wie aus einer Grabesgruft, aus der gerade erst nach einer Überschwemmung das Wasser abgelaufen ist. Ich würgte ein paar Bissen herunter und schwor dann jeder weiteren Kostprobe von den sagenhaften deutschen Süßwasserfischen ab. (Selber schuld wahrscheinlich.)
Da ich nun lang und breit meine zweitschlechteste Mahlzeit geschildert habe, wollen Sie sicher wissen, welche noch schlechter war. Bitte schön: Ich ging mal mit ein paar Freunden in ein traditionelles Frankfurter Gasthaus, das sich als Kultstätte für deutsche Hardcore-Essgenüsse herausstellte: ungenießbarer Äppelwoi und Gäste, die gierig Schwarzbrotschnitten mit dick Schmalz darauf in sich hineinstopften. Auf der verstörend kurzen Speisekarte bestand die Wahl nur zwischen warmen fetten Schinkenscheiben mit der berüchtigten Frankfurter Grünen Soße (ein alter Feind – ich erinnere mich an in Essig eingelegte gehackte Kräuter) und natürlich auch Bratwurst der Art, die selbst mir langsam über war. Etwas, das, glaube ich, »Schlachterplatte« hieß, stellte sich als ein Gebirgskamm Sauerkraut in der Mitte des Tellers heraus, flankiert von zwei mit metallenen Wundklammern verschlossenen Hautsäcken, der eine gefüllt mit einer Mischung aus Leber, Fett und Wasser, der andere mit einer blutgetränkten mehlig-schrotigen Substanz. Wenn man die Gabel in eines der Gebilde stieß, fiel es in sich zusammen, aber nicht, ohne gleichzeitig seinen Inhalt über das Sauerkraut zu verspritzen. Zugegeben, ich war feige, doch ich brachte keinen Bissen davon herunter. Gerettet wurde das Mahl, als ich herumzualbern begann und nicht nur die Schlachterplatte mit dem Handy fotografierte, sondern ihr schauriges Aussehen noch verbesserte, indem ich die von meinem Begleiter verschmähte Grüne Soße darüberkippte. Dessert stand nicht auf der Speisekarte, und der Kellner behauptete auch, keines zu haben. Auf unseren Hinweis, die Leute am Nachbartisch schaufelten doch Vanilleeis mit Himbeeren in sich hinein, erwiderte er, das sei schweres Fett mit Himbeeren – aber vielleicht hielt er uns auch nur zum Besten.
Gut, großartig Werbung für die deutsche Küche mache ich damit nicht. Aber in ganz begrenztem Maße – und das begrenzte Maß gilt wie stets auch für die unterentwickelte Küche einer gewissen hochmögenden Inselgruppe vor den Küsten Europas – gibt es in Deutschland auch einige großartige Gerichte. Ein Schwein und eine Kartoffel sind hier immer zur Hand, und aus diesen beiden Lebensformen kann man eine Menge zaubern. Gewürfelt, püriert, gedünstet, auf jeden Fall irgendwie zerhackt – Hunderte von Jahren immer produktiveren Einfallsreichtums sind darauf verwendet worden, Kartoffeln und ihre Freunde Wurzelgemüse und Kohl von ihrer besten Seite zu präsentieren, nämlich in unzähligen Suppen, Eintöpfen und Braten, mit den stets gleichen, aber seltsam befriedigend darübergestreuten Schnittlauch- oder Petersilienschnipseln.
Was die Deutschen mit Enten und Gänsen machen, muss man probieren, um es zu glauben. In Remarques Im Westen nichts Neues (das Buch handelt mindestens so sehr vom Essen wie vom Stellungskrieg) gibt es eine zentrale Szene, in der zwei Soldaten eine Gans stehlen und ohne jegliche Kochgerätschaften in einem dunklen Schuppen braten. Die pedantische Detailversessenheit, mit der Remarque die darauffolgende Essensorgie beschreibt, beweist: Diese Gans ist nicht umsonst gestorben.
Ich bin vermutlich in mehr Ratskellern gewesen als die meisten Menschen auf diesem Planeten, und manchmal verwandle ich mich schon in einen stiernackigen, selbstgefälligen Städter mit glasigem Blick und Trachtenanzug, wenn ich mir den Nacken mit einer Leinenserviette abwische, dann schwer atmend einen weiteren übervoll gehäuften Teller mit dicken Speckscheiben, Sauerkraut und Bratkartoffeln in Angriff nehme und das Ganze mit literweise Bockbier oder einem im Kerzenlicht funkelnden Glas Riesling herunterspüle und emulgiere.
Leider teilen die meisten Deutschen meine rührend nostalgische Begeisterung für deutsches Essen nicht, aber ich bin auch vor den drastischeren Auswirkungen dieser Ernährung geschützt. Bei sporadischen Besuchen in Deutschland sind riesige Schüsseln Kartoffelsuppe nach Bauernart oder Jägereintopf eine schöne Abwechslung – doch wenn ich in einer Stadt wie Bamberg wohnen und mich dort einleben müsste, klar, dann wäre ich von einer solchen Kost schnell gelangweilt und bald darauf tot. Selbst in der schönsten Umgebung – und was gibt es Schöneres als den Ratskeller in Lübeck mit seinen kleinen holzverkleideten Nischen und Unmengen an überall herabhängendem Krimskrams? – bemerkt man unschwer, dass viele Mitgäste in einem schockierenden Zustand sind. Massige Gestalten mit dem Leibesumfang und der Gesichtsfarbe von Gert Fröbe als Goldfinger sowie Bierschaumfetzchen und Schweinestückchen im Bart sind vielleicht keine idealen Vorbilder.
Zuweilen sitze ich bis auf einen arthritischen alten Nationalisten mit Gamsbarthut und glasigem Blick ganz allein in einem bezaubernd traditionellen »Hof«. So auch bei einer besonders krassen Abendmahlzeit in Ingolstadt. Doch als ich später durch eine eisverkrustete Straße lief, staunte ich nicht schlecht. Aus Eingangstüren ertönten schreiendes Gelächter, Möbelkippen, Gruppengesang und sonstige Heiterkeitsausbrüche. Die gesamte Bevölkerung der zugefrorenen Stadt ließ offenbar in den Dutzenden innerhalb der Stadtmauern sich drängenden indischen, griechischen, chinesischen, italienischen und Thai-Restaurants die Puppen tanzen. Offenbar sehen seit mindestens einer Generation die meisten aktiven, klugen, dünnen, zukunftsorientierten Deutschen ihr traditionelles Essen als vernachlässigbaren, wenn nicht gefährlichen Aspekt ihres kulinarischen Erbes, genauso wie der Deutschen liebste Urlaubsfantasie nicht auf die Wonnen einer beherzten Wanderung im Harz gerichtet ist, sondern auf die schweißdampfenden Freuden in einem Thai-Massagesalon. Aber das ist ein anderes Thema. Deutsches Essen ist auf dem Rückzug, die meisten Deutschen laben sich nun an grünen Curries, Vindalhos und Gnocchi, und nur ich und der ältere Mann mit dem Gamsbarthut (der, wenn ich es recht bedenke, vielleicht einen kleinen Schlaganfall gehabt hat) bleiben übrig und lassen sich ihre Leckerbissen nach Bauernart schmecken.
Eine Tradition, die weiterhin floriert, wenn auch nur bei Deutschen über fünfzig, sind Nachmittagskaffee und -kuchen. Nachtisch als Teil der Mahlzeit interessiert eigentlich keinen mehr, auch wenn das Adjektiv der Wahl, passend zum Bauernart-Hauptgericht, fast immer das unvermeidliche »traumhaft« ist (wie in »traumhaftes Schokoladenpralinémarzipannougat-Eis-Dessert«). Schon angesichts der medizinischen Probleme, die der Hauptgang bereiten mag, bedarf es einer geradezu selbstmörderischen Tollkühnheit, zum Abschluss eine solche Köstlichkeit zu ordern. Auch deshalb, weil man sich ohnehin jederzeit und überall kräftige Portionen Zucker einverleiben kann. Konditoreien gibt es in Deutschland (in Österreich nicht minder) wie Sand am Meer, überraschend oft betrieben von Geflüchteten (und deren Nachfolgern) von aus den 1945 verlorenen deutschen Ostgebieten. Anscheinend lässt sich das Können ohne Weiteres transferieren – eine Konditorei in Breslau kann leicht nach Goslar umziehen und wartet dann dort mit einer Reihe nostalgisch dekorativer Fotos aus der Vornazizeit auf. Wie gern bin ich immer in diese Cafés eingetaucht, doch nach einer schlechten Erfahrung in Wörlitz hatte ich endgültig die Nase voll. Die Trefferquote für ein Stück wirklich köstlichen Kuchen war mir dann doch zu niedrig. Auf jede perfekt geratene Sachertorte kamen fünf oder sechs altbackene Desaster mit Sahne von der Konsistenz von Isolierschaum, den man in Mauerlöcher spritzt. Aber vielleicht ist meine Reaktion auch unfair und ein Hilfeschrei von einem, der sich nach Jahren schweren Zuckermissbrauchs seiner Gesundheit zuliebe am Riemen reißen muss.
Der mittelalterliche Parkplatz
Speyer ist ein unschuldiges, beinah schon eintöniges Städtchen am Oberrhein. Wenn die Bewohner friedlich ihren Alltagsgeschäften nachgehen, scheinen sie sich kaum daran zu stören, dass mittendrin etwas steht, das aussieht wie das monströse Trümmerteil eines Raumschiffs aus einem interplanetaren Krieg à la Battlestar Galactica. Es ist der Dom zu Speyer – ein stark beschädigter, oft restaurierter, doch immer noch überwältigend mächtiger, tausend Jahre alter Steinklotz, nicht minder ein Überlebender einer untergegangenen Zeit als Machu Picchu oder die Akropolis. Deutschland war und ist übersät von solchen Relikten, die, wettergegerbt und ramponiert, dennoch seltsam an frühere deutsche Größe gemahnen und sich moderneren Zeiten als Ansporn und Anreiz aufdrängen.
Die Faszination, die für Deutsche des neunzehnten Jahrhunderts vom Mittelalter ausging, beruhte auf einer breiteren Bildung und einem wachsenden Interesse an einer Nationalgeschichte. Für das moderne England war das Mittelalter, glaube ich mit Fug und Recht behaupten zu können, recht unproblematisch. Einige spektakuläre Baudenkmäler (wie die Kathedrale von Durham, der Tower in London und so weiter) werden als herausragende nationale und lokale Erinnerungsorte in liebevollen Ehren gehalten. Dass sie von kolonialen Besatzungsmächten erbaut wurden, wen schert’s? Man liebt seine Geschichtsschreibung ohne Haken und Ösen und ignoriert solche Feinheiten. Die Ereignisse des englischen Mittelalters werden in Form traulicher Geschichten tradiert, die in der Regel um Robin Hood und Maid Marian kreisen. Dabei geht es auch hier – sieh einer an! – um koloniale Unterwerfung. Robin Hood kämpft nämlich dafür, dass England besser von Richard Löwenherz, einem wackeren, liebenswürdigen Fremden, regiert werde als von dem hinterhältigen Lügenbold Johann Ohneland. Selbst die haarsträubendsten Schlappen wie zum Beispiel der Hundertjährige Krieg werden in der englischen Historiografie verwoben zum leuchtend bunten Gespinst adlig-edler Großtaten (man denke an den Schwarzen Prinz, die Schlacht von Azincourt, den Hosenbandorden), wo eine tollkühne Szene die andere jagt.
So erzählen die Deutschen ihre Geschichte nicht unbedingt. Aber die Wurzeln ihrer Mittelalterfaszination im 19. Jahrhundert sind den englischen sehr ähnlich, vor allem wegen der gemeinsamen Begeisterung für Sir Walter Scotts Ivanhoe, Quentin Durward und andere dicke Wälzer, aber auch weil die Leute allmählich gebildeter wurden und neugieriger auf die Nationalgeschichte insgesamt. Weiten Anklang fand zum Beispiel Goethes Aufsatz über das Straßburger Münster, das er 1772 besucht hatte und in dem er die gotische Kunst komischerweise als durch und durch deutsch rühmt. Das Mittelalter war für die Deutschen damals in hohem Maße Mahnung und Herausforderung – wie sie meinten, eine Zeit hervorragender Leistungen, kultureller Kühnheit und nationaler Einheit, ein krasser Gegensatz zu dem Chaos der darauf folgenden Kleinstaaterei, der wachsenden militärischen Macht Frankreichs und Habsburgs sowie der wachsenden kulturellen Macht Italiens. Die Epochen nach dem Mittelalter empfand man geradezu als schmachvoll. Dabei wäre bei halbwegs vernünftigem Nachdenken klar gewesen, dass das Mittelalter für das Leben im Deutschland der Neuzeit im Grunde recht unerheblich war – dito in England –, doch die Diskussionen darüber wurden aus spezifisch deutschen Gründen immer stärker politisch aufgeladen und richteten so manchen Schaden an. Und da die Idee, dass Geschichte etwas ist, das man sich ständig vergegenwärtigen und analysieren muss, weitgehend aus Deutschland kommt, kann man die Beschäftigung mit dem Mittelalter als beispielhaft für den Umgang mit der Vergangenheit betrachten.
Als Heinrich Heine 1824 frohgemut durch das hübsche Harzstädtchen Goslar wanderte, war er überrascht, dass der große, prächtige, unter Kaiser Heinrich III. (1017 – 1056) und seinen Nachfolgern erbaute Dom dort vier Jahre zuvor wegen Geldmangels abgerissen worden war. Den Kaiserthron hatte man auch noch gleich zum Schrottwert verscherbelt. Doch er hat durch bizarre Glücksfälle überlebt und befindet sich jetzt wieder in Goslar. Vom Dom ist nur die große Vorhalle geblieben, ansonsten erstreckt sich dort, wo er stand, ein riesiger staubiger Parkplatz. In solch einer massiven visuellen Abwesenheit herumzuwandern ist schon merkwürdig. Hätte der Dom, der immerhin schon mehr als siebenhundert Jahre auf dem Buckel hatte, noch zwanzig Jahre länger ausgehalten, wäre er gerettet, gehegt und gepflegt worden, mit all der konfusen deutschen romantischen Liebe zum Mittelalter, mit der man die erhaltenen Bauten aus der Zeit schier erstickte.
Für die Deutschen entstand mit den Wirren der Napoleonischen Ära und der Erfahrung, dass ihr Land in den Kriegen vollkommen schutzlos gewesen war, gedemütigt und herumgeschubst, ein seltsames Paradox. Den Ausweg daraus sahen viele Schriftsteller, Politiker, Journalisten und Maler darin, dass die Nation zur Einheit finden müsse, wenn sie es mit Frankreich, Großbritannien oder Russland aufnehmen wollte. Auch der Fortschritt verlangte das Ende der Kleinstaaterei, unter der das Land, das auf der Karte stets aussah, als habe es in einer Puzzle-Fabrik eine Explosion gegeben, schwach blieb und bleiben würde, obwohl man mit dem von Napoleon angestoßenen Reichsdeputationshauptschluss 1803 schon mächtig angefangen hatte zu rationalisieren. Nach dem Ende der Napoleonzeit meinte man aufs Mittelalter zurückgreifen zu müssen, auf das »Erste Reich«, als die Karolinger, Ottonen, Salier und Staufer vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert selbstbewusst, deutsch und militärisch erfolgreich waren und angeblich ja auch spezifisch deutsche Bauwerke, Dome, Burgen und Pfalzen, erschaffen hatten, die noch überall in der Landschaft herumstanden und ihre verweichlichten Nachfolger alt aussehen ließen. Wenn also englische Mittelalterfans schlimmstenfalls romantische Tories waren, die sich vor allem größeren Respekt vor den Klassenunterschieden in der Gesellschaft zurückwünschten (schließlich gehört »der Reiche ins Schloss, der Arme ans Tor«), und bestenfalls Leute, die sich gern verkleideten, betrachteten manche Deutsche es als ernst zu nehmendes politisches Modell.
Jedenfalls zeitigte die verworrene Begeisterung für das Mittelalter im gesamten neunzehnten Jahrhundert tiefgreifende Wirkungen. Man konnte nämlich die Epoche aus überzeugt konservativer, provinzieller, rückwärtsgewandter, biedermeierlicher Perspektive ebenso lieben wie aus einer nationalen, fortschrittlichen, gelegentlich auch freiheitlichen. Jedenfalls mündete die Liebe in eine ungeheuer mächtige Bewegung, deren Einflüsse zum Guten oder Schlechten bis zur Gegenwart in Deutschland sichtbar und spürbar sind; in der Ehrfurcht, dem Ideenreichtum und der Sorgfalt, mit der so viele mittelalterliche Gebäude nach 1945 wiederaufgebaut wurden, ebenso wie in den widerwärtigen Träumen der SS unmittelbar zuvor.
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gab es in Deutschland viele uralte große Kirchen, die aus technischen, finanziellen oder konfessionellen Gründen nicht fertig gebaut worden waren. Entweder hatten sich die Pläne der Architekten als zu wahnwitzig und ehrgeizig erwiesen, oder die Stadt war wegen der Kosten für das Gebäude oder einer schlecht getimten Invasion pleite, oder das bedauernswerte Gotteshaus war nach der Reformation schlicht unerwünscht.
Das beherrschende Wahrzeichen von Köln war zum Beispiel jahrhundertelang nicht der Dom selbst, sondern der riesige, vor sich hin rottende Baukran aus dem vierzehnten Jahrhundert, der aus dem halbfertigen Südturm ragte. Es war ein Schlachtfeld von Baustelle, das Kirchenschiff vollgepackt mit kleinen Handwerkerhütten und sonstigen Arbeitsräumen. Weil nationalbewusste deutsche Bürger das im vorvorigen Jahrhundert dann aber doch als Schande empfanden, sorgten sie dafür, dass der Dom mit sechseinhalb Millionen Goldtalern (einschließlich eines gepfefferten Betrags vom preußischen Staat) fertiggestellt wurde. Die Eisenbahnschienen am Dom waren übrigens schon lange verlegt, als die Steinmetze immer noch auf dem Gerüst herumturnten oder Wasserspeier meißelten. Was wie der Turmbau zu Babel ein perfektes Symbol für menschliche Selbstüberhebung sowie ein Hoch auf die germanisch-deutsche Ungeschicklichkeit hätte werden können, signalisierte bei seiner Vollendung 1880 auf pompöse, beunruhigende Weise, dass in Zukunft mit noch mehr deutschem Größenwahn zu rechnen war.
Bedeutende Städte wie Ulm und Regensburg besaßen ebenfalls imposante, wenn auch turmlose Gotteshäuser, aber in Deutschland wollte man ja nun im Großen wie im Kleinen mit Macht all diese plötzlich nicht mehr hinnehmbaren Absonderlichkeiten beseitigen und Ordnung schaffen. Übermächtig war der Wunsch, an das Mittelalter anzuknüpfen und es aufzuwerten und überhaupt mit der Fertigstellung der Bauten dem Streben nach Einigkeit und Freiheit von Fremdherrschaft Ausdruck zu verleihen.
Wenn man die siebenhundertundachtundsechzig Stufen zur Turmspitze des Ulmer Münsters hinaufkraxelt – der höchsten Kirchturmspitze der Welt –, dazu wie ich ein mäßig gutes Buch über Goethe mitschleppt und in dem immer enger werdenden Treppenaufgang mit seinem schwarz gewordenen Mauerwerk nach Luft ringt, erlebt man jäh und hautnah den Enthusiasmus des neunzehnten Jahrhunderts, den Wahn einer Welt, die solche monströsen Werke eben bauen wollte. Nur einmal kann man auf dem strapaziösen Marsch in der Senkrechten Erholung in einem verstaubten Raum voll alter Fotos von Sakralbauten aus aller Welt suchen. Manche davon sind nur berühmt und sakral, die meisten aber wegen der Höhe ihrer Türme ausgewählt worden, weil man darauf hinweisen kann und es infantilerweise auch tut, dass der Turm des Ulmer Münsters höher