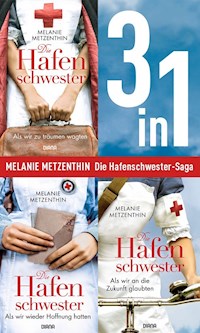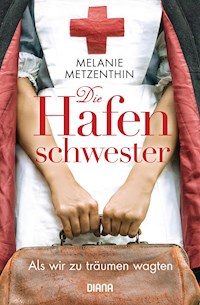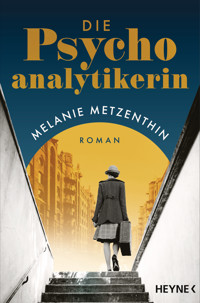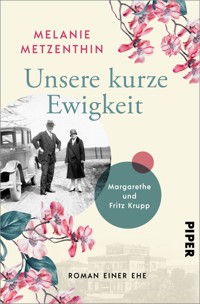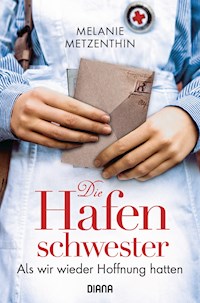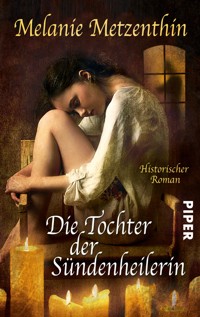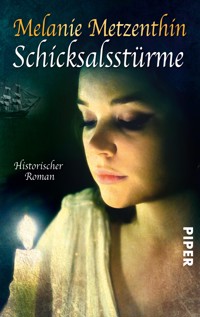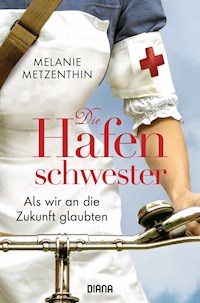
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hafenschwester-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Martha und Paul haben während der Infl ation 1923 alle Ersparnisse verloren und die finanzielle Lage ist prekär. Ihre Tochter Ella will unbedingt Ärztin werden, muss ihren Traum jedoch zunächst auf Eis legen und die Familie unterstützen. Sie tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und beginnt eine Schwesternausbildung. Dann kommen die Nazis an die Macht. Ella fiebert dem Studium entgegen, doch die Einschreibung an der Universität wird ihr untersagt. Als die Familie in eine schreckliche Lage gerät, ruhen alle Hoffnungen auf dem jüngsten Sohn Fredi. Er macht bei der Mordkommission Hamburg Karriere. Und lässt sich auf einen gefährlichen Pakt mit der Gestapo ein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 843
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch
Eine Frau Kämpft für ihren Traum – doch das NS-Regime stellt sich dagegen
Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Martha und Paul haben während der Inflation 1923 alle Ersparnisse verloren und die finanzielle Lage ist prekär. Ihre Tochter Ella will unbedingt Ärztin werden, muss ihren Traum jedoch zunächst auf Eis legen und die Familie unterstützen. Sie tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und beginnt eine Schwesternausbildung. Dann kommen die Nazis an die Macht. Ella fiebert dem Studium entgegen, doch die Einschreibung an der Universität wird ihr untersagt. Als die Familie in eine schreckliche Lage gerät, ruhen alle Hoffnungen auf dem jüngsten Sohn Fredi. Er macht bei der Mordkommission Hamburg Karriere. Und lässt sich auf einen gefährlichen Pakt mit der Gestapo ein …
Das große Finale der Hafenschwester-Saga
Band 3
Über die Autorin
Melanie Metzenthin wurde 1969 in Hamburg geboren, wo sie heute noch lebt und als Fachärztin für Psychiatrie arbeitet. Mit der Geschichte ihrer Heimatstadt fühlt sie sich ebenso verbunden wie mit der Geschichte der Medizin, was in vielen ihrer Romane zum Ausdruck kommt. Die Hafenschwester. Als wir an die Zukunft glaubten ist der dritte Band und Abschluss einer Serie um die Krankenschwester Martha.
MELANIE
METZENTHIN
Die
Hafen
schwester
Als wir an die Zukunft glaubten
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Volknant
Umschlaggestaltung: Favoritbüro, München
Umschlagmotiv: © Stephen Mulcahey/Trevillion Images,
© Arkivi UG All Rights Reseved/Bridgeman Images,
© United Archives/Lämmel/Bridgeman Images
Autorenfoto: © privat
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-26623-3V001
www.diana-verlag.de
TEIL 1
Die Weimarer Republik
1
Hamburg, November 1923
Martha machte gern Hausbesuche, auch wenn es oft anstrengend war, nach ihrer regulären Schicht im Krankenhaus noch all die Patienten aufzusuchen, die ihr am Herzen lagen. Vor allem an verregneten Novembertagen. Sie schüttelte kurz ihren Regenschirm im engen Treppenhaus ab, bevor sie an der Tür von Familie Hansen klingelte.
Es dauerte eine Weile, bis ihr geöffnet wurde.
»Guten Abend, Schwester Martha! Wie schön, dass Sie es einrichten konnten.« Frau Hansen streckte den Arm aus, um ihr die Hand zu reichen, als sie bemerkte, dass sie noch das Bügeleisen in der Rechten hielt.
»Störe ich Sie gerade beim Hemdenbügeln?«, fragte Martha.
»Nein.« Frau Hansen lächelte leicht verschämt. »Kommen Sie doch rein.«
Sie führte Martha in die Küche, wo das Bügelbrett stand.
»Wär’n das alles Hemden, wär ich ’ne reiche Frau. Aber so …«
Martha sah fasziniert zu, wie Frau Hansen mit dem Bügeleisen über einen Zehntausendmarkschein fuhr, der auf dem Plättbrett lag.
»Das war der letzte für heute«, sagte sie dann und legte ihn in die volle Kiste zu den übrigen Scheinen.
»Warum bügeln Sie denn Ihr Geld?«, fragte Martha. Sie selbst wäre nie auf diese Idee gekommen.
»Na, damit die Scheine nicht so zusammenkleben, wenn ich das Bündel beim Krämer raushole. Dieser ganze Klumpatsch in der Tasche …« Frau Hansen schniefte. »Mein Herbert lässt sich ja immer noch die Zehntausender andrehen. Der kriegt den Mund ja nicht auf, wenn der Chef ihm den Lohn auszahlt. Dabei hab ich ihm schon so oft gesagt, jetzt gibt’s Scheine mit Millionen und sogar Milliarden drauf.«
Martha nickte, das waren die, die Paul in seiner Lohntüte mitbrachte. Früher hatte er den größten Teil des Verdienstes umgehend zur Sparkasse gebracht, aber inzwischen war es besser, das Geld so schnell wie möglich auszugeben, ehe es weiter an Wert verlor. So wie der Rest ihrer Ersparnisse.
Martha atmete tief durch und schüttelte die unangenehmen Erinnerungen ab. Wenigstens waren sie gesund und hatten immer noch ihre Arbeit.
»Wie geht es denn der kleinen Rosie?«, fragte sie, um auf den eigentlichen Grund ihres Besuches zurückzukommen.
»Schon viel besser, aber ich fürchte, einen Mann wird sie so nicht mehr finden.«
Martha zog die Brauen hoch. »Sie ist doch erst vier, ist es da nicht ein bisschen zu früh, daran zu denken?«
Frau Hansen seufzte erneut. »Na, das Bein wird doch nicht wieder gut, oder? Und wer will schon so ein Hinkebein, das weder tanzen noch sonst etwas leisten kann?«
»Warten wir erst mal ab«, erwiderte Martha. »Wir können dankbar sein, dass die Kleine die Kinderlähmung überhaupt so gut überstanden hat. Denken Sie nur daran, was dem Jungen der Furtwänglers passiert ist.«
Frau Hansen wurde blass, schluckte, dann nickte sie. Der Sechsjährige war im Eppendorfer Krankenhaus qualvoll erstickt, weil die Lähmung auch auf das Zwerchfell übergegriffen hatte. Eine seltene Komplikation, aber schwer gefürchtet. Was war dagegen schon ein lahmes Bein?
Die kleine Rosie war in der vergangenen Woche in stabilem Zustand entlassen worden, auch wenn sie ihr rechtes Bein kaum bewegen konnte und die Muskulatur erkennbar verkümmert war.
Frau Hansen stellte das Bügeleisen ab und brachte Martha in das Kinderzimmer, wo außer Rosie auch noch Baby Walter schlief. Um den Kleinen hatte Martha sich anfangs große Sorgen gemacht, denn die Kinderlähmung war sehr ansteckend, aber zum Glück war sonst niemand in der Familie erkrankt.
Rosie saß auf dem abgetretenen Teppich vor dem Bett und spielte mit ihren Puppen. Man sah auf den ersten Blick, welches der beiden nackten Beine, die unter ihrem Rock hervorlugten, das kranke war. Es war nicht nur deutlich dünner, sondern der Fuß war auch nach innen verdreht.
Martha ging vor Rosie in die Hocke.
»Guten Tag, Rosie.«
»Guten Tag, Schwester Martha«, antwortete das Mädchen artig und legte die Puppe beiseite.
»Darf ich mir dein Bein ansehen?«
Rosie nickte. Martha versuchte, den Fuß in eine normale Stellung zu bringen, doch die Muskulatur war bereits zu sehr verkürzt.
»Kannst du mit dem Fuß überhaupt noch auftreten?«, fragte sie das Mädchen.
»Ja«, sagte Rosie.
»Dann zeig mir das mal.« Sie reichte Rosie die Hand, damit die sich mit ihrer Hilfe aufrichten konnte.
»Das nennst du Stehen?«, sagte Martha. »Du musst versuchen, den Fuß auf die Sohle zu stellen, nicht so auf die Kante.«
»Aber dann tut’s weh.«
»Du brauchst eine Schiene, weißt du. Eine, die dein Bein gerade zieht.«
»Aber das tut weh. Das will ich nicht.«
»Das ist nur am Anfang unangenehm, Rosie. Später wirst du froh sein, wenn du wieder normal gehen kannst. Oder willst du dein Leben lang so schlecht stehen können?«
Rosie sagte nichts.
»Können wir uns das denn leisten?«, fragte Frau Hansen. »Solche Schienen sind doch teuer, und Sie sehen ja selbst, wie uns das Geld durch die Finger fließt.«
»Es gibt für verkrüppelte Kinder Unterstützung von der Fürsorge«, sagte Martha. »Ich werde mich darum kümmern, dass Sie eine Bescheinigung erhalten und nur eine geringe Summe zuzahlen müssen. Aber es ist wichtig, dass Rosies Bein so bald wie möglich mit einer Schiene versorgt wird. Vielleicht kann man durch die gleichmäßige Belastung verhindern, dass es bereits jetzt das Wachstum einstellt, und wenn wir großes Glück haben, wird sie später vielleicht ohne Krücken laufen können.«
»Glauben Sie wirklich?«
»Sie ist noch sehr jung, der kindliche Körper kann sich an vieles anpassen.«
Martha wollte sich gerade verabschieden, als jemand Sturm an Frau Hansens Tür klingelte.
»Herrschaftszeiten, was ist denn heute bloß los?«, rief Frau Hansen und riss die Tür auf.
Ein vielleicht zwölfjähriges blondes Mädchen in einem verblichenen und vielfach geflickten blauen Kleid stand unruhig trippelnd vor der Tür.
»Jutta, was um Himmels willen ist denn passiert?«
»Ist Schwester Martha noch bei Ihnen?«, rief sie aufgeregt. »Die muss schnell kommen, der olle Menck hat sich auf’m Trockenboden aufgehängt!«
»O mein Gott!«, rief Frau Hansen. »Uns bleibt auch nix erspart!«
Martha zuckte zusammen. »Rufen Sie sofort einen Unfallwagen«, wies sie Frau Hansen an. »Vielleicht ist ja noch was zu retten.« Dann folgte sie Jutta, während Frau Hansen losrannte, um in der Eckkneipe zu telefonieren.
»Wann hast du ihn denn gefunden?«, fragte Martha, während sie gemeinsam die Stiegen nach oben liefen.
»Na gerade eben, als ich die Wäsche abnehmen wollte.« Das Mädchen wirkte trotz der schrecklichen Entdeckung seltsam abgeklärt, aber Martha ahnte bereits, dass der Schock erst noch kommen würde. So war es immer, wenn etwas Schlimmes passierte. Meist funktionierten die Menschen in den ersten Minuten wie Automaten, bevor die Erkenntnis, was wirklich geschehen war, Einlass in ihre Seele fand.
»Hast du ihn angefasst?« Insgeheim hoffte Martha, dass sie ihn vielleicht abgehängt hatte, dass noch ein Hauch von Leben in ihm war, obwohl sie wusste, dass beides höchst unwahrscheinlich war.
»Nee, der sah so gruselig aus!« Jutta schüttelte sich. »Wie konnte der das bloß machen?«
Martha sagte nichts. Was hätte sie auch sagen sollen? Dass es in letzter Zeit häufiger vorkam? Dass der alte Menck nicht der Erste war, der sich aufgehängt hatte? Und auch nicht der erste Erhängte, den sie in ihrem Leben zu Gesicht bekam? All das würde Jutta nicht trösten, ganz im Gegenteil.
Der alte Menck bot tatsächlich einen grausigen Anblick, mit seinem aufgequollenen, blauen Gesicht und offenem Mund, aus dem die Zunge ein Stück herausragte.
Martha sah den umgefallenen Schemel, auf den er gestiegen war, um das Seil am Dachbalken zu befestigen. Sie atmete zweimal tief durch, dann überwand sie ihre Abscheu und berührte den Erhängten – seine Hände waren bereits ganz kalt, da war kein Puls mehr zu fühlen. Für medizinische Hilfe war es längst zu spät.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Jutta mit zitternder Stimme. »Ist er tot?«
»Ja«, sagte Martha leise. »Kanntest du ihn gut?«
Jutta schluckte. »Nee, der wohnte ganz allein im Erdgeschoss und hat nie viel geredet. Der hat uns Kindern immer hinterhergebrüllt, wir sollen nicht so’n Lärm machen, sonst würde uns der Teufel holen. Und jetzt hat er ihn selbst geholt.«
Noch bevor Martha antworten konnte, hörten sie Schritte auf der Treppe zum Dachboden. Doch es war nicht die Besatzung des Unfallwagens, sondern Frau Hansen in Begleitung von Wachtmeister Rütten.
»Ja, das ist der alte Gustav Menck«, sagte Rütten und nahm die Mütze ab. »Mensch, Deern, da haste ja wat wirklich Schlimmes entdeckt. Ich hoff mal, du kriegst nu keine Albträume.«
Jutta schluckte. »Brauchen Sie mich noch, Herr Wachtmeister?«
»Ja, so ’n paar Fragen habe ich schon, aber das können wir auch später noch machen, wenn der Polizeiarzt und die Kriminalen da waren.«
»Die Kriminalen?« Jutta bekam große Augen.
»Ist bei unnatürlichen Todesfällen immer so. Die wollen dann nur noch mal wissen, wann du ihn gefunden hast und ob da sonst noch jemand war.«
»Meinen Sie, der wurde ermordet?« Juttas Augen wurden immer größer.
»Nee, das nicht, aber muss man immer ausschließen, ne? Ist nur Routine, hab ma keine Angst, hier geht schon kein Mörder um.«
»Wollen wir ihn da nicht mal runternehmen?«, fragte Martha.
»Nee, das soll die Kripo machen, die wollen das immer ganz genau sehen und fotografieren.« Der Wachtmeister zog ein weißes Taschentuch hervor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »So, Jutta, und du gehst jetzt zu deinen Eltern, ne? Ich komm nachher noch mal zu euch.«
»Und die Wäsche?«, fragte Jutta.
»Die kannste auch später holen, wenn der Tote weg ist, ne?«
Jutta nickte und ging. Martha überlegte kurz, ob sie dem Mädchen nachgehen sollte, aber ihr fiel nichts Tröstliches ein, was sie dem Kind hätte sagen können. Stattdessen sah sie Wachtmeister Rütten an. »Brauchen Sie mich noch?«
»Nee, alles gut, Schwester Martha. Sie können auch gehen, dem ist ja wirklich nicht mehr zu helfen.« Er seufzte. »Und dabei dachte ich, ich könnte meine Runde heute gemütlich beim Glas Bier im Anker ausklingen lassen.«
»Na, ich war jedenfalls froh, dass ich Sie dort gefunden hab, Herr Wachtmeister«, meinte Frau Hansen. »Das hat man ja nicht alle Tage, dass sich der Nachbar aufhängt.«
»Nee, zum Glück nicht. Aber ist auf jeden Fall besser, als wenn einer den Gashahn aufdreht. Dann trifft’s womöglich auch Unschuldige. In Berlin ist neulich sogar ein Haus deswegen explodiert.«
Frau Hansen schlug entsetzt die Hand vor den Mund. »Mein Gott, und ich dachte, jetzt, in der schönen Wohnung mit Gasherd, wird alles besser.«
Martha räusperte sich. »Ich mache mich dann mal auf den Weg. Sie wissen ja, wo Sie mich finden, falls Sie mich noch brauchen, Herr Wachtmeister.«
»Selbstverständlich, Schwester Martha. Ich wünsche Ihnen trotz allem noch einen schönen Abend.«
Paul war schon von der Arbeit nach Hause gekommen, als Martha in die Wohnung kam. Sie hörte, wie er mit den Kindern im Wohnzimmer sprach, aber da war noch eine andere Stimme. Ihre Freundin Carola Kellermann. Martha hängte schnell den Mantel an die Garderobe und spannte den nassen Regenschirm über der Badewanne zum Trocknen auf, bevor sie ins Wohnzimmer ging.
»Siehst du, da kommt sie schon«, sagte Paul zu Carola.
Ella stand auf und holte eine Tasse aus dem Wohnzimmerschrank. »In der Kanne ist noch Tee, Mama«, sagte sie, während sie die Tasse auf den Tisch stellte.
»Vielen Dank, mein Engel.« Martha hauchte ihrer Tochter einen Kuss auf die Wange und schenkte sich ein, bevor sie sich neben Carola aufs Sofa setzte.
»Na, wie viele Leben hast du heute gerettet?« Paul zwinkerte seiner Frau liebevoll zu.
»Keins«, erwiderte Martha. »Ganz im Gegenteil. Ein Nachbar der Hansens hat sich auf dem Dachboden erhängt.«
»O Gott, der wievielte in diesem Monat ist das?«, fragte Carola. »Das passiert seit der Inflation ja ständig. Selbst in den besten Kreisen. Wobei die natürlich eher stilvoll zur Pistole greifen.«
Paul räusperte sich geräuschvoll. »Ein bisschen mehr Pietät im Angesicht des Todes«, sagte er. Und vor den Kindern, dachte Martha, auch wenn sie nichts sagte. Rudi war schon achtzehn, und auch der sechzehnjährige Fredi würde sich dagegen verwahren, als Kind bezeichnet zu werden, aber Ella war erst dreizehn. Andererseits war Ella vielleicht die Abgeklärteste von allen, denn sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, Medizin zu studieren. Sie hatte sogar schon einmal mit einer besonderen Erlaubnis von Professor Wehmeyer die anatomische Sammlung besuchen dürfen, die normalerweise nur Medizinstudenten und Ärzten offen stand. Die eingelegten Organe und Leichenteile hatten sie nicht im Mindesten erschreckt.
»Ja, du hast recht«, lenkte Carola sofort ein. »Allerdings frage ich mich, wie man diese Zeiten ohne einen gesunden Zynismus überstehen soll.«
»Warum sind Moritz und Sophia eigentlich nicht mitgekommen?«, wechselte Martha schnell das Thema.
»Moritz hat ein Problem mit seiner Beinprothese, die ist gerade in der Werkstatt. Er hat ja dieses neue Modell mit dem künstlichen Kniegelenk, das auf Gewichtsverlagerung reagiert. Und das klemmt irgendwie. Als ich ihm vorgeschlagen habe, den Rollstuhl zu nehmen, hat er mich angesehen, als hätte ich von ihm verlangt, nackt auf die Straße zu gehen. Und Sophia wollte den Papa natürlich nicht allein lassen, sondern lieber ›Mensch ärgere Dich‹ mit ihm spielen.«
»Heißt das Spiel nicht ›Mensch ärgere Dich Nicht‹?«, fragte Paul.
»Bei uns nicht.« Carola grinste. »Die beiden ärgern sich nämlich jedes Mal, wenn sie rausgeschmissen werden. Da sieht man gleich, von wem Sophia diese Schnute geerbt hat. Wobei es natürlich viel niedlicher ist, wenn sich eine Vierjährige ärgert.« Carola trank einen Schluck Tee. »Warum ich aber eigentlich hier bin … Lida hat heute früh aus München angerufen und mich gefragt, ob ich für Die Frau im Staat einen Artikel über diese Putschisten schreiben möchte, etwas über die Hintergründe. Sie meint, ich würde mit meinem Stil den richtigen Ton treffen.«
»Welche Putschisten?«, fragte Martha.
»Habt ihr das nicht mitgekriegt? Die haben deshalb doch in München den Ausnahmezustand verhängt.«
»Nein.« Paul schüttelte den Kopf. »In München ist doch immer irgendwas los, seit die da unten nach Unabhängigkeit streben. Ich habe nie verstanden, warum Lida ausgerechnet dorthin gezogen ist.«
»Und was hat es mit diesem Putsch nun auf sich?«, fragte Martha.
»Nun, wie Paul schon angedeutet hat, viele da unten wollen, dass Bayern wieder ein eigenständiges Land wird. Das nimmt natürlich kein normaler Mensch ernst, aber in München gibt es viel mehr Extremisten als hier bei uns.« Carola atmete schwer. »Ohne die Hyperinflation wären die vermutlich längst in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.«
»Und schuld daran sind die Franzosen«, zischte Paul, und die Art, auf die er das Wort »Franzosen« betonte, erschreckte Martha. Paul war nie jemand gewesen, der anderen Nationen Ressentiments entgegengebracht hatte, ganz im Gegenteil. Nicht einmal, nachdem er schwer verletzt aus Frankreich zurückgekehrt war. Aber die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen hatte ihn massiv aufgebracht. Schon der Friedensvertrag von Versailles mit seinen hohen Reparationsforderungen hatte ihn erbost. Die deutsche Wirtschaft lag am Boden, die Bevölkerung verarmte immer mehr, und man konnte die hohen Forderungen nicht erfüllen. Daraufhin waren die Franzosen im Januar kurzerhand ins Ruhrgebiet einmarschiert, hatten alle Bergwerke und Industrieanlagen unter französische Verwaltung gestellt und sämtliche Erzeugnisse nach Frankreich abtransportiert. Martha erinnerte sich noch gut an die Zeitungsberichte. Zahlreiche Deutsche waren aufgrund der so entstandenen Kohleknappheit im kalten Winter erfroren. Aber all das scherte die Besatzer nicht. Der Hass auf die Franzosen wuchs noch weiter, als sie damit begannen, Einheimische aus dem Ruhrgebiet zu vertreiben. Ausweisungen nannten sie das. Die Zeitungen waren in jenen Tagen voll davon. Überall sah man Fotografien von Familien, denen nur ein einfacher Pferdewagen mit spärlichem Hausrat geblieben war. Hinzu kamen Geschichten von brutalen Vergewaltigungen und schlimmen Misshandlungen. Die deutsche Regierung rief daraufhin den Generalstreik aus. Die Franzosen reagierten mit aller Härte und verurteilten etliche Streikende zum Tode. Doch der Hass auf die Franzosen war mittlerweile so gewachsen, dass die Arbeiter sich nicht länger einschüchtern ließen. Und die Reichsregierung unterstützte sie, indem sie die Lohnfortzahlungen sicherstellte. Zwar hatte der Staat nicht die nötigen Geldreserven, aber findige Regierungsmitglieder glaubten, man könne das Problem lösen, indem man einfach immer mehr Geld druckte. Ein fataler Irrglaube, denn das war der Beginn der Hyperinflation.
Binnen weniger Wochen waren die Ersparnisse eines ganzen Lebens wertlos geworden. Auch Marthas Familie war betroffen. Tausend Mark hatten sie in den vergangenen drei Jahren für die Ausbildung ihrer Kinder zusammengespart. Bereits zwei Monate nach dem Beginn der Ruhrbesetzung bekam man für dieses einstmals so hart erarbeitete Geld nur noch ein Glas Bier im Gasthaus. Die meisten Menschen litten bittere Not, und die Schuldigen waren schnell ausgemacht: die gierigen Franzosen, der alte Erbfeind.
»Habt ihr mitbekommen, dass Gustav Stresemann vorletzten Monat zu einem Ende des Generalstreiks aufgerufen hat?« Carolas Frage riss Martha aus ihren Gedanken.
»Ja«, bestätigte Paul. »Er will das auf diplomatischem Weg regeln, weil er eine Währungsreform anstrebt, um die Inflation zu beenden.«
Carola nickte. »Nun, die Putschisten sehen das anders. Sie sagen, es sei Verrat am Volk, den Generalstreik zu beenden, während die Franzosen das Land weiter ausplündern und Deutsche schikanieren. Deshalb hat General Ludendorff gestern zusammen mit einem Kneipenredner namens Hitler und einem Haufen anderer zwielichtiger Gestalten versucht, die bayrische Regierung zu stürzen. Die meisten sind verhaftet worden, nur dieser Hitler ist noch auf der Flucht. Aber ich schätze, den kriegen sie auch bald.«
»Darf ich deinen Artikel vorab lesen, wenn er fertig ist?«, fragte Martha.
»Das will ich meinen, deshalb bin ich doch überhaupt gekommen.« Carola lächelte sie breit an. »Und um eine Nachricht von Moritz zu überbringen. Sobald seine Prothese wieder einsatzbereit ist, würde er Paul gern zu einer kleinen Wochenendreise nach Berlin einladen.«
»Nach Berlin?« Paul sah Carola überrascht an. »Wie komme ich denn zu der Ehre?«
»Moritz setzt sich doch schon seit Jahren für Kriegsbeschädigte ein. Und dabei ist er auf einen sehr interessanten Mann gestoßen. Ernst Friedrich, so heißt er, hat kürzlich in Berlin ein Anti-Kriegsmuseum gegründet und sucht nach Männern mit schweren Kriegsverletzungen, um sie für das Museum zu fotografieren. Er will die Erinnerungen an die Kriegsgräuel wachhalten, damit so etwas nie wieder geschieht. Moritz würde ihn gern unterstützen.«
Paul strich gedankenverloren über die Narben in seinem Gesicht.
»Wann will Moritz denn fahren?«
»Er kann sich ganz nach dir richten. Sonnabends arbeitest du doch nur bis eins, oder? Wenn ihr nächsten Sonnabend um zwei den Zug nach Berlin nehmt, seid ihr abends da, und dann kann Friedrich euch am Sonntag sein Museum zeigen und anschließend fotografieren.«
»Das klingt gut«, sagte Paul. »Richte Moritz bitte aus, dass ich ihn sehr gern begleiten werde.«
2
Am nächsten Morgen wurden Martha und Paul vom Klingeln des Zeitungsjungen geweckt, der die Sonntagsausgabe des Hamburger Echos brachte.
»Ich geh schon.« Paul stand auf und griff nach seinem Morgenmantel. Martha nutzte die Gelegenheit, ins Badezimmer zu schlüpfen, bevor die Kinder wach wurden. Wie sich die Zeiten doch ändern, dachte sie, während sie Wasser ins Waschbecken laufen ließ. Früher weckten uns die Kinder bereits vor Sonnenaufgang, und jetzt bekommen wir sie kaum noch aus den Federn. Allerdings musste sie sich eingestehen, dass ihr diese Entwicklung gefiel.
Eine Stunde später saß die Familie gemeinsam am Frühstückstisch. Während Ella und Fredi munter und vergnügt wirkten, hing Rudi unrasiert und völlig übernächtigt auf seinem Stuhl.
»Der Dollar steht heute bei 631 Milliarden Mark.« Paul legte das Hamburger Echo beiseite und schenkte sich Tee ein. »Das heißt, Kaffee bleibt bis auf Weiteres unbezahlbar.«
»Steht auch irgendetwas Vergnügliches in der Zeitung?«, fragte Martha und strich sich Marmelade auf ihr Graubrot. Richtige, fruchtige Erdbeermarmelade, die sie im Sommer selbst eingekocht hatte aus ihrer Schrebergartenernte.
»Wie wäre es damit: In Berlin streiken die Buchdrucker.«
»Und das findest du vergnüglich?« Martha runzelte die Stirn.
»In gewisser Weise. Hier steht, von dem Streik ist auch der Druck von Banknoten betroffen. Und dabei brauchen wir doch jetzt haufenweise Billionenscheine.«
»Du, Papa, wenn die jetzt kein Geld mehr drucken können, ist das doch gut, oder? Du hast doch gesagt, es ist erst wertlos geworden, als die Regierung zu viel gedruckt hat.«
»Dazu ist es inzwischen leider längst zu spät, Ella.« Paul seufzte. »Ich schätze, sie werden einfach den Notendruckereien das Streiken untersagen.«
Martha fiel auf, dass ihr Ältester ungewöhnlich still war, und sah zu ihm hin. Rudis Augen waren geschlossen, und sein Kopf sank langsam in Richtung Tischplatte. Das Frühstücksmesser entglitt seiner Hand und landete mit einem lauten Klirren auf dem Teller. Er schreckte hoch. »Oh«, murmelte er. »Tut mir leid.«
»Sag mal, schläfst du hier schon am Tisch ein?«, fragte Paul verärgert. »Wo warst du letzte Nacht überhaupt so lange? Du siehst ja schlimmer aus als ein durchgekauter Frosch.«
Ella und Fredi prusteten los.
»In der Spätvorstellung vom Hansa-Theater.« Rudi setzte sich etwas aufrechter hin und schenkte sich Tee ein.
»Im Varieté?« Paul hob überrascht die Brauen. »Woher hattest du denn das Geld dafür?«
»Pieko hatte Freikarten von seinem Vater.« Rudi rührte so langsam in seiner Teetasse, dass Martha befürchtete, er würde gleich wieder einschlafen.
»Pieko?«, wiederholte Paul. »Was ist denn das für ein Name?«
»Ist der Spitzname von Peter Kollwitz«, nuschelte Rudi.
»Ist das ein Schulfreund von dir?«
»Ja.« Rudi rieb sich die Augen und blinzelte mehrmals.
»Sag mal, habt ihr danach auch noch Alkohol getrunken?«
»Na ja, ein paar Freunde von Piekos Vater haben Lokalrunden geschmissen. Meinten, ist besser, man vertrinkt das Geld, solange es noch was dafür gibt. Und da wäre es doch unhöflich gewesen, wenn wir abgelehnt hätten, ne?«
»Aha. Und was macht Piekos Vater beruflich, dass er so großzügig Theaterkarten zu verschenken hat? Und was sind das für Freunde, die Lokalrunden für Minderjährige schmeißen können?«
»Ist das ein Verhör?«, murrte Rudi.
»Als dein Vater ist es meine Pflicht, darauf zu achten, dass du nicht in schlechte Gesellschaft gerätst.«
»Denkst du, dass Piekos Familie aus Spitzbuben besteht?«, gab Rudi bissig zurück.
Bevor Paul etwas erwidern konnte, klingelte es.
»Ich sehe nach.« Martha stand auf und ging zur Tür.
Vor ihr stand ein Junge mit pechschwarzem Haar und mandelförmigen Augen. Er trug einen beigefarbenen Anzug, der Martha an die Fotografien von Safarireisenden erinnerte. Nur dass er statt eines Tropenhelms eine weiße Matrosenmütze trug.
»Tante Martha«, rief er fröhlich und fiel ihr überschwänglich in die Arme. »Wir sind wieder da!«
»Arthur! Was für eine wunderbare Überraschung. Fast hätte ich dich nicht erkannt.« Sie drückte ihn fest an sich. »Gut siehst du aus. Gesund und braun gebrannt wie ein Zigeuner.« Dann führte sie ihn in die Küche.
»Seht mal, wer da ist!«
»Na so was, der Weltreisende!« Paul sprang auf und umarmte seinen neunjährigen Neffen ebenfalls. »Seit wann seid ihr denn wieder im Lande? Und wie war es im asiatischen Meer?«
»Wir haben gerade angelegt. Mama und Papa sind mit Lilli nach Hause gegangen, aber ich wollte unbedingt gleich zu euch.«
»Das ist auch gut so!«, sagte Paul. »Wir haben euch sehr vermisst.«
Seit etwas über einem Jahr war Marthas Bruder Heinrich Kapitän des Dampfschiffs Weser, das auf der Ostasienroute verkehrte. Er war sehr stolz auf sein Schiff und die Tatsache, dass er als Kapitän das Vorrecht genoss, seine Familie mit auf große Fahrt zu nehmen.
»Möchtest du etwas essen?«, fragte Martha, nachdem Paul Arthur wieder losgelassen hatte.
»Nee, wir haben schon an Bord gefrühstückt. Aber Papa hat gesagt, ihr sollt heute Nachmittag um drei zu uns kommen, wir haben ganz viele Sachen für euch und Opa mitgebracht. Sogar Kakao und Kaffee.«
»Kaffee!«, rief Paul begeistert. »Wenn mir etwas fehlt, dann ein ordentlich starker Kaffee am Morgen.«
»Das merkt man an deiner Laune«, murmelte Rudi.
»Du halt mal lieber den Mund, Freundchen. So wie du aussiehst, fehlt der dir noch viel mehr als mir.«
Ella und Fredi lachten.
Dann wandte Paul sich wieder seinem Neffen zu. »Wo wart ihr denn überall, Arthur?«
»In Hongkong und in China und in Japan. Und als das große Erdbeben in Japan war, haben wir ganz viele Leute gerettet!« Arthurs Augen leuchteten.
»In Japan war ein Erdbeben?«
»Ja, ein ganz schlimmes. Aber das erzählt Papa euch nachher. Ich muss jetzt noch zu Opa, damit der auch um drei zu uns kommt.«
Martha strich ihrem Neffen liebevoll über das dunkle Haar. Sie fand es immer wieder faszinierend, dass er trotz der unverkennbar asiatischen Züge, die er von seiner Mutter geerbt hatte, beim Reden genau dieselbe Mimik zeigte wie sein Vater.
»Na, dann lauf mal zu Opa. Ich bring dich noch zur Tür, mein Schatz.«
Fredi und Ella freuten sich auf den Besuch bei ihrem Onkel Heinrich, nur Rudi schnitt eine Grimasse. »Ich bin heute doch schon mit meinen Freunden verabredet«, nuschelte er und zog die Nase hoch.
»Nimm bitte ein Taschentuch, wir sind hier nicht bei den Wilden«, sagte Paul verärgert.
»Was hast du immer an mir rumzunörgeln?«, fauchte Rudi. »Verdammt, ich bin erwachsen.«
»Noch nicht ganz. Du wirst erst mit einundzwanzig volljährig.«
»Und deshalb soll ich jetzt zum Kaffee zu Onkel Heinrich?«
»Nein«, beschwichtigte Martha. »Onkel Heinrich hat Verständnis dafür, wenn ein junger Mann wie du den Sonntag lieber mit seinen Freunden verbringen will.«
»Ja, und dem ist es bestimmt auch lieber, wenn er nicht in deine sauertöpfische Miene blicken muss«, schimpfte Paul.
»Na, dann sind doch alle zufrieden«, gab Rudi giftig zurück. »Ich geh jetzt wieder ins Bett. Ich bin sowieso nur aufgestanden, um euch einen Gefallen zu tun. Dabei hatte ich noch überhaupt keinen Hunger.« Er stand auf und verließ die Küche.
»Wer hätte gedacht, dass wir jemals den Tag erleben, an dem Rudi keinen Hunger und keine Lust zum Reden hat«, sagte Paul. »Fredi, kennst du eigentlich diesen Pieko?«
»Ja, der ist in Rudis Klasse. Sein Vater ist Theaterkulissenmaler. Deshalb kriegt Pieko immer Freikarten, je nachdem, wo sein Vater gerade arbeitet.«
»Das erklärt vieles«, sagte Paul und griff wieder zur Zeitung.
Heinrich wohnte mit seiner Familie nur wenige Häuserblocks entfernt in einem modernen Mietshaus im zweiten Stock. Die Familie erreichte das Haus gerade in dem Augenblick, als auch Marthas Vater Karl Westphal eintraf. Auf seiner Schulter saß Äffchen Maximilian. Der Kapuziner trug ein warmes rotes Jäckchen und eine dazu passende kleine Hose. Maximilian besaß fast so viele Kleidungsstücke wie ein Kind, und das war auch dringend notwendig, damit er sich als Leierkastenaffe an kalten Wintertagen nicht den Tod holte.
»Wusstest du, dass Heinrichs Schiff heute einläuft?«, fragte Karl seine Tochter. Martha schüttelte den Kopf. »Nein, ich hatte auch nur die offizielle Verspätungsmeldung der Reederei.«
»Arthur hat erzählt, dass es in Japan ein Erdbeben gab. Meint ihr, die Verspätung hängt damit zusammen?«
»Wir werden es bestimmt gleich erfahren«, sagte Paul und hielt seinem Schwiegervater die Haustür auf.
Während sie gemeinsam in den zweiten Stock hochgingen, bemerkte Martha, wie schwer ihrem Vater heute das Treppensteigen fiel, und das lag nicht nur an seinem steifen Bein, sondern vor allem an seiner Kurzatmigkeit. Brütete er eine Erkältung aus? Oder forderte das Alter seinen Tribut? Immerhin war er bereits siebenundsechzig Jahre alt. Doch ehe sie sich darüber weiter Gedanken machen konnte, klingelte Paul schon an der Wohnungstür.
Heinrichs Frau Li-Ming öffnete.
»Wie schön, euch alle zu sehen«, sagte sie freudestrahlend. Sie nahm ihnen Hüte und Mäntel ab und brachte sie dann ins Wohnzimmer, wo Heinrich und die Kinder bereits an der gedeckten Tafel warteten. Heinrich hatte den Tisch ausgezogen und noch Stühle aus der Küche dazugestellt, damit zehn Personen Platz finden konnten.
»Wo ist denn Rudi?«, fragte er.
»Dem waren seine Freunde wichtiger als die Familie«, sagte Paul.
»Na ja, so sind die jungen Männer, ne?«, meinte Heinrich. »Waren wir viel besser?«
»Immerhin bin ich früher nie nach einer durchzechten Nacht am Frühstückstisch eingeschlafen.« Paul warf einen Blick zur Decke.
»Keine Kondition mehr, die Jugend von heute.« Heinrich lachte. »Aber nun gibt es erst mal Kaffee und für alle, die keinen Kaffee mögen, Kakao. Dazu natürlich den unwiderstehlichen Gugelhupf mit Zuckerguss von Li-Ming.«
Li-Ming lächelte verlegen. Seit sie im Krieg angefangen hatte, sich für die Kriegskochkurse zu interessieren, waren ihre Back- und Kochkünste sehr weit fortgeschritten.
»Arthur hat uns ja schon ganz neugierig gemacht, was ihr alles erlebt habt«, sagte Marthas Vater und trank genüsslich einen Schluck Kaffee. »Ah, das habe ich vermisst.«
»Ja, diese Reise hatte es in sich«, sagte Heinrich und trank ebenfalls einen Schluck.
Nach dem verlorenen Krieg hatte es für die deutsche Seefahrt mehr als traurig ausgesehen. Nicht nur die Kriegsflotte war zerschlagen worden, sondern die Siegermächte hatten auch einen Großteil der deutschen Handelsflotte beschlagnahmt und legten deutschen Handelshäusern unzählige Steine in den Weg. Die Zeit, da deutsche Ozeanriesen die Weltmeere befahren hatten, war vorbei. Selbst der stolze Imperator, auf dem Martha und ihre Familie 1913 nach Amerika gereist waren, fuhr nun unter anderem Namen für eine britische Reederei. Für deutsche Kapitäne war es schwer, noch ein Kommando zu erhalten, und vielen blieb nichts anderes übrig, als weit unterhalb ihrer Qualifikation auf ausländischen Schiffen anzuheuern, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch Heinrich hatte zwei harte Jahre überstehen müssen, nachdem er aus der Kriegsmarine ausgeschieden war. Unter ausländischer Flagge als untergeordneter Schiffsoffizier zu fahren kam für ihn nicht infrage. Dagegen stand nicht nur sein Stolz, sondern auch die Tatsache, dass er noch länger von seiner Familie getrennt sein würde, wenn sein Schiff einen fremdländischen Heimathafen weitab von Hamburg hatte. Stattdessen hatte er in der Registratur der Hafenmeisterei angefangen. Der Verdienst war ausreichend, um die Wohnung zu behalten und seine Familie zu ernähren, aber er hasste die Schreibtischarbeit. Die See fehlte ihm.
Als er hörte, dass die Hapag ein neues Dampfschiff für die Ostasienroute in Dienst stellen wollte und einen Kapitän suchte, bewarb er sich. Natürlich standen die Bewerber Schlange, aber Heinrich kam zugute, dass er neben seiner seemännischen Qualifikation als einziger Bewerber fließend Chinesisch sprach.
Verglichen mit seinem alten Segelschiff Fortuna, das er im Krieg verloren hatte, war die Weser riesig. Sie beförderte vorwiegend Fracht, hatte jedoch auch Plätze für einhundertfünfundsechzig Passagiere. Auf dem Segelschiff war Li-Ming stets seekrank geworden, aber die Weser lag viel ruhiger im Wasser. Und so konnte sich Heinrich seinen lange gehegten Wunsch erfüllen und seine Frau und Kinder mit auf große Fahrt nehmen. Das einzige Problem bestand darin, dass Arthur schulpflichtig war und die Lehrer es nicht gern sahen, wenn er dem Unterricht monatelang fernblieb. Heinrich löste das Problem, indem er einem stellungslosen jungen Absolventen des Lehrerseminars eine kostenlose Weltreise an Bord der Weser anbot, wenn der im Gegenzug Arthurs Aufgaben überwachte. Der junge Mann namens Rolf Haselbaum nahm Heinrichs Angebot mit Freuden an, war es doch eine ideale Möglichkeit, die Zeit zwischen dem Ende seiner Ausbildung und dem Antritt seiner ersten Stelle zu überbrücken. Zudem verbesserte es seine Referenzen, denn welcher deutsche Volksschullehrer war jemals bis ins asiatische Meer gekommen?
Auch wenn die Weser nicht mit den glamourösen Passagierdampfern vergangener Tage vergleichbar war, so war es für Heinrich, der früher nur auf Frachtschiffen das Kommando geführt hatte, eine große Umstellung. Als Kapitän wurde von ihm erwartet, zu repräsentieren und mit den wohlhabenden Passagieren abends zu dinieren. Er empfand das als lästige Pflicht, aber Li-Ming fühlte sich in der Rolle der Kapitänsfrau ausgesprochen wohl. Sie hatte sich in den zehn Jahren ihrer Ehe zu einer selbstbewussten und weltgewandten Frau entwickelt, die neben ihrer Muttersprache Chinesisch nicht nur fließend Deutsch, sondern auch Englisch sprach. Ihr bereitete es Vergnügen, anspruchsvolle Konversationen zu führen und dabei mühelos von einer Sprache in die andere zu wechseln, je nachdem, mit wem sie es zu tun hatte.
Davon wiederum profitierte Heinrich in den asiatischen Häfen. Die Tatsache, dass er eine chinesische Ehefrau hatte, die nicht nur hübsch, sondern auch noch klug war, trug ihm unter den Einheimischen Achtung ein, zumal die meisten Europäer mandeläugige Frauen zwar als exotische Geliebte schätzten, aber nur sehr selten als Ehefrauen akzeptierten.
Heinrich stellte seine Kaffeetasse auf den Tisch und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
»Auf See haben wir gar nicht so viel von der Hyperinflation mitbekommen«, sagte er. »Ein Teil der Geschäfte läuft über ausländische Investoren und wird in britischen Pfund abgerechnet. Auf diese Weise konnte ich auch so günstig an begehrte Waren wie Kaffee oder Kakao kommen. Aber ich wollte euch ja von unserer letzten Fahrt erzählen. Ende August erreichte die Weser die japanischen Inseln, und wir hatten ein paar Tage Aufenthalt im Hafen von Yokohama. Für die Kinder war es ein großes Abenteuer. In China haben sie alles verstanden, aber in Japan gab es viel weniger Menschen, die Chinesisch sprachen, und viele der Lohnarbeiter stammten aus Korea.«
»Ja, genau!«, rief Arthur aufgeregt dazwischen. »Papa hat uns erklärt, dass das so ähnlich wie in Europa ist. Die Menschen sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, aber tatsächlich sind sie völlig verschieden.«
»Ganz genau«, bestätigte Heinrich. »Und die sind sich auch nicht so wirklich grün. Die Chinesen und Japaner mögen sich genauso gern wie die Deutschen und Franzosen.« Er lachte leise. »Na ja, am 31. August verließ die Weser dann den Hafen von Yokohama, und am folgenden Mittag lagen die japanischen Inseln schon weit hinter uns. Wir saßen gerade zusammen mit Hauslehrer Haselbaum beim Essen, als Felix, der Bordfunker, so aufgeregt zur Tür reinstürzte, dass er sogar das Klopfen vergaß.
›In Japan hat’s ein großes Erdbeben gegeben!‹, rief er. ›Yokohama ist fast vollständig zerstört, und Tokio brennt! Es gibt unzählige Todesopfer und Verletzte. Deshalb wurden alle Schiffe in der Umgebung gebeten, Menschen zu evakuieren.‹
Ich bin sofort aufgesprungen, um die Kursänderung zu befehlen.«
»Es musste alles so schnell gehen«, mischte Li-Ming sich ein. »Ich sollte den Passagieren mitteilen, warum sich unsere Reise verzögern würde. Außerdem brauchten wir Platz für die Flüchtlinge, und da habe ich auch gleich gefragt, wer bereit wäre, jemanden in seiner Kabine aufzunehmen. Die meisten Passagiere hatten Verständnis, aber es gab doch tatsächlich einige, die sich über die Reiseverzögerung ärgerten und es als Zumutung empfanden.«
»Ja, und da musste ich dann erst mal ein Machtwort als Kapitän sprechen«, bestätigte Heinrich. »Aber als die japanischen Inseln in den frühen Morgenstunden erneut vor uns auftauchten und wir den Schein der noch immer lodernden Feuer sahen, verflog der Ärger. Da wurde wirklich allen bewusst, wie groß die Not der Menschen war. Der Hafen war zum größten Teil zerstört, ein kleiner britischer Frachter lag bereits vor Anker, da die Kaianlagen nicht mehr zum Festmachen taugten, während ein französisches Passagierschiff im Hafenbecken dümpelte. Wir haben versucht, per Funk die Hafenmeisterei zu erreichen, aber stattdessen bekamen wir Antwort von dem französischen Schiff, das uns mitteilte, dass die Funkeinrichtungen am Hafen zerstört seien. Sie selbst hätten einen Maschinenschaden erlitten, der sie am Auslaufen hinderte. Mein Funker Felix war ja so ’n büsschen schadenfroh, ne. Aber wisst ihr, auf See, da muss der kameradschaftliche Zusammenhalt unter den Seeleuten aller Nationen gelten, und deshalb habe ich den Franzosen gesagt, dass wir einen Ingenieur und Ersatzteile an Bord hätten, und gefragt, ob wir ihnen helfen können.
Ob das mein Ernst wär, hat Felix mich gefragt, während wir auf Antwort warteten.
›Bezahlen müssen sie das natürlich‹, habe ich ihm gesagt.
Kurz darauf antworteten die Franzosen überaus höflich, dass sie dankbar für unsere Hilfe wären. Ich hab dann gleich unseren Maschinisten mit zwei Leuten auf den Weg geschickt. Und im nächsten Moment meldete sich auch das britische Schiff, das den Funkverkehr aufgefangen hatte. Der englische Käpt’n schlug vor, dass wir drei Kapitäne uns zusammensetzen sollten, um zu besprechen, wie wir am besten helfen könnten. Da die Weser das größte Schiff war, hab ich die beiden Kollegen zu uns eingeladen. Es wurde dann eine ganz entspannte Runde, in der überhaupt gar nix von den Nachkriegsspannungen zu spüren war. Die beiden Kollegen waren auch echte Vollblutseeleute, für die die alten Ehrbegriffe unter Seeleuten galten. Kapitän Fournier, der Franzose, hatte auch noch als Schiffsjunge auf einem Segelschiff angefangen, genau wie ich. Nachdem der Schaden an Bord der Bonaparte mit unserer Hilfe behoben worden war, fragte Kapitän Fournier von sich aus nach den Kosten und akzeptierte anstandslos meinen Preis. Am Ende des Tages lief die Weser dann mit zweihundertneunundsiebzig Flüchtlingen aus zwanzig Nationen aus. Alle rückten zusammen, und ein Zeitungsreporter, der ebenfalls als Flüchtling an Bord gekommen war, schrieb später, dass sich die Fremden aller Nationalitäten an Bord zum ersten Mal nach dem Krieg wieder als große Familie fühlten. Recht hatte er. Die Feindseligkeiten waren verschwunden, und wir waren alle nur Menschen. Tja, und deshalb hat das alles deutlich länger gedauert als geplant. Aber das war es wert. Inzwischen wissen wir, dass mehr als einhunderttausend Menschen bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind. Vor allem in Tokio war es schlimm, denn dort sind die Gasleitungen der Häuser durch das Erdbeben gerissen, und ein Funke genügte, um alles in die Luft zu jagen. Die Feuer haben tagelang gebrannt. Es war wie in der Hölle.«
»Du erlebst immer wieder die dollsten Abenteuer«, sagte Paul. »Dagegen ist es hier ja richtig langweilig.«
»Du hättest eben auch zur See fahren sollen.« Heinrich lachte.
»Immerhin unternimmt Paul demnächst mit Moritz eine Reise nach Berlin«, meinte Martha. »Das ist besser als nichts.«
»Stimmt«, gab Paul zu. Dann sah er Li-Ming an. »Könnte ich noch ein Stück von diesem wunderbaren Gugelhupf haben?«
»O ja, ich auch!«, riefen Ella und ihr Großvater fast gleichzeitig und hielten Li-Ming ihre Teller entgegen.
Li-Ming lachte. »Nur gut, dass ich noch einen zweiten Kuchen im Ofen habe, der müsste gleich fertig sein. Verhungern wird hier jedenfalls keiner.«
3
In den vergangenen Jahren hatte Paul Studt in Moritz Kellermann einen guten Freund gefunden. Zwar kannte er ihn schon sehr lange, aber wirklich nahegekommen waren sich die beiden Männer erst im Krieg. Moritz hatte 1915 durch einen Angriff mit dem Flammenwerfer seinen rechten Arm und das rechte Bein verloren. Es war vor allem Marthas unermüdlichem Einsatz zu verdanken gewesen, dass er seine Hoffnungslosigkeit überwand und sich mehreren Hauttransplantationen unterzog, durch die eine prothetische Versorgung der Amputationsstümpfe möglich wurde. Anfangs hatte Moritz nicht einmal ohne Hilfe stehen können. Aber dank eines starken Willens und moderner Prothesen hatte er sich ins Leben zurückgekämpft.
Als Paul im Jahr 1916 durch einen Granatangriff schwer entstellt wurde, war er ebenfalls kurz davor gewesen, in einer tiefen Depression zu versinken. Nase und Oberlippe waren abgerissen, er sah aus wie ein Monster, konnte nicht mehr vernünftig sprechen und hatte auch beim Essen große Schwierigkeiten. Zu jener Zeit besuchte Moritz ihn regelmäßig im Krankenhaus und trug als Schicksalsgefährte dazu bei, dass Paul sich nicht aufgab. Erst nach mehreren komplizierten Operationen war sein Gesicht wieder so weit hergestellt, dass er sich in der Öffentlichkeit zeigen konnte. Natürlich zog die aus Muskelgewebe neu geformte Oberlippe nach wie vor Blicke auf sich, aber das war Paul egal. Er konnte wieder normal essen und sprechen, und das war das Wichtigste. Wen scherte da noch das fehlende Lippenrot? Die Rekonstruktion der Nase war sogar ausgesprochen gut gelungen. So gut, dass die meisten Fremden glaubten, die Verwundung habe nur seine Lippe betroffen. Mittlerweile kannte Paul andere Männer, die ähnliche Verletzungen erlitten hatten, aber keine so guten operativen Ergebnisse vorweisen konnten. Manche von ihnen mussten dauerhaft künstlich ernährt werden, da der ganze Kiefer zerstört war.
In den vergangenen Jahren hatten Paul und Moritz erleben müssen, wie wenig Kriegsversehrte dem Staat galten. 1919 waren die letzten sogenannten Kriegskrüppelheime geschlossen worden. Man hatte die behinderten Männer einfach vor die Tür gesetzt und ihrem Schicksal überlassen. Seither trieben sich viele von ihnen als Bettler auf den Straßen herum und schliefen nachts in Obdachlosenasylen, oft genug gequält von chronischen Schmerzen und abhängig von Morphium, für das sie nur mit Müh und Not das Geld auftreiben konnten. Moritz wäre es ohne die Hilfe seines Bruders Joseph vermutlich nicht viel besser ergangen. Zwar bezog er als Feldwebel a. D. eine Invalidenrente, aber die war so niedrig, dass er sich davon allenfalls ein Zimmer zur Untermiete hätte leisten können. Umso dankbarer war er seinem Bruder, dass der ihn und seine Familie nicht nur in seinem Haus aufgenommen hatte, sondern sie auch finanziell großzügig unterstützte.
Es war jedoch ein zweischneidiges Schwert, denn jeder in Hamburg wusste, dass Joseph Kellermann sein Geld mit zwielichtigen Geschäften verdiente. So besaß er etliche Bordelle und Animierbetriebe auf St. Pauli. In den letzten Jahren hatte er auch in den Bau mehrerer moderner Mietshäuser investiert, die nach und nach die alten Häuser des Gängeviertels ersetzten. Joseph war einer der wenigen Menschen, der von der galoppierenden Inflation profitierte, denn er hatte die Häuser über Kredite finanziert, und durch die Hyperinflation war er binnen kürzester Zeit schuldenfrei geworden. Sein neuestes Projekt war der Bau eines modernen Kinos, denn auch in schlechten Zeiten sehnten sich die Menschen nach Unterhaltung. Es gab viele Gerüchte, wie der Sohn eines einfachen Hurenwirts wohl an sein Startkapital gekommen war. Eines davon besagte, dass er einflussreiche Männer mit kompromittierenden Fotografien erpresst habe. Paul traute das Joseph durchaus zu, und obwohl er mit Moritz befreundet war, ging er dessen Bruder nach Möglichkeit aus dem Weg. Andererseits war die Bekanntschaft aber auch von Vorteil, denn Joseph Kellermann hatte den Ruf, alles zu jeder Zeit besorgen zu können. Und es war ihm in den letzten fünf Jahren gelungen, in den besseren Kreisen zumindest als halbwegs seriöser Geschäftsmann wahrgenommen zu werden. Ein paar großzügige Spenden für städtische Stiftungen hatten das Ihre dazu beigetragen.
Bereits eine Woche nachdem Moritz seine Beinprothese aus der orthopädischen Werkstatt zurückerhalten hatte, machten sie sich auf nach Berlin. Der Zeitpunkt passte gut, denn Carola war mit der kleinen Sophia nach München gereist, um mit der Zeitungsverlegerin Lida Heymann den Artikel über den Hitler-Ludendorff-Putsch und den anstehenden Prozess zu besprechen. Mittlerweile waren sämtliche Unruhestifter verhaftet und die NSDAP verboten worden. Paul hoffte, dass damit endlich wieder Ruhe einkehren würde. Es war an der Zeit, dass fähige Politiker wie Gustav Stresemann ungestört für politische Entspannung und den wirtschaftlichen Aufschwung sorgen konnten.
Schon die Bahnfahrt nach Berlin war ein kleines Abenteuer, denn Moritz bestand darauf, seine Krücken zu Hause zu lassen und sich lediglich mit einem Gehstock zu behelfen. Der Weg zum Bahnhof war kein Problem, da Joseph einen Benz 16/50 PS besaß und seinen Chauffeur anwies, nicht nur Moritz zum Hauptbahnhof zu fahren, sondern auch Paul unterwegs abzuholen.
Dafür stellten die Treppen, die zu den Gleisen führten, eine umso größere Herausforderung für Moritz dar. Dennoch lehnte er jede Hilfe ab und forderte Paul und den Gepäckträger auf, einfach vorzugehen. »Ich schaff das schon«, sagte er.
Paul nickte. Als er unten auf dem Bahnsteig angekommen war, sah er, dass sein Freund in der Zeit gerade mal fünf Stufen überwunden hatte.
»Moritz, unser Zug geht in sieben Minuten. Meinst du, den erwischen wir noch?«
»Nun hetz mich doch nicht so«, rief Moritz schwer atmend zurück. »Der Zug ist doch noch nicht mal eingefahren.«
Paul sagte nichts mehr und sah zu, wie Moritz immer erst den linken Fuß auf die Stufe setzte, dann das künstliche rechte Bein daneben setzte, während er die greifzangenartige Armprothese über das Treppengeländer gleiten ließ und sich mit dem Stock in der Linken abstützte.
»Haben Sie ein steifes Bein aus’m Krieg behalten?«, fragte der Gepäckträger, nachdem Moritz endlich unten angekommen war.
»Sieht das so aus?«, fragte Moritz zurück.
»Ja.«
»Dann mach ich ja Fortschritte. Das ist eine Prothese.«
»Donnerknispel, dafür sind Sie wirklich gut zu Fuß.« Der Mann pfiff anerkennend durch die Zähne.
Moritz grinste und bezahlte den Gepäckträger. In diesem Moment fuhr ihr Zug ein. Die Dampflokomotive schnaufte, und der Geruch von Rauch und Kohlen erfüllte die Luft.
Sie hatten Karten für ein Abteil in der zweiten Klasse. Paul hätte sich auch mit der dritten begnügt, während Joseph Moritz bedrängt hatte, die erste Klasse zu nehmen.
»Das ist Geldverschwendung«, hatte Moritz geantwortet. »Die zweite tut’s auch.«
Und obwohl Paul aufs Geld achtete, seit ihre Ersparnisse von der Inflation aufgefressen worden waren, war er froh, dass er sich zur zweiten Klasse durchgerungen hatte, denn die gepolsterten Sitze waren doch wesentlich angenehmer als die einfachen Holzbänke der dritten Klasse.
Sie hatten Glück, dass sie ein Abteil für sich allein hatten. Moritz ließ sich seufzend in die Polster fallen, während Paul ihre Reisetaschen im Gepäcknetz verstaute.
»Wie bist du eigentlich auf diesen Ernst Friedrich aufmerksam geworden?«, fragte Paul, nachdem er Moritz gegenüber Platz genommen hatte.
»Mein ehemaliger Vizefeldwebel Peter Wirtzel hat mich vor ein paar Wochen besucht. Nachdem sie unser altes Regiment aufgelöst haben, hat er bei der Berliner Schutzpolizei angefangen. Er ist da jetzt Wachtmeister. Und dann hat er mir von Ernst Friedrich und seinem Anti-Kriegsmuseum in der Parochialstraße 29 erzählt.«
Moritz machte eine kurze Pause und kramte eine kleine Blechdose mit Keksen hervor. »Magst du einen? Sind mit Nüssen. Die haben Carola und Sophia vor ihrer Abreise nach München als Wegzehrung für uns gebacken.«
»Vielen Dank.« Paul nahm einen Keks. »Ich hoffe, sie haben auch für sich selbst welche eingepackt. Nach München ist es ja deutlich weiter.«
»Darauf kannst du wetten. Die beiden hätten eine ganze Konditorei bestücken können. Die haben auch noch eine hübsche Dose für Lida eingepackt. So eine mit Blumen drauf, du weißt schon, diese eleganten Dosen für Frauen.«
Paul probierte den Keks. »Schmeckt lecker«, sagte er. »Dann hat Peter Wirtzel dir also das Museum empfohlen? Hat es ihm so gut gefallen?«
Moritz lachte laut auf. »Nee, ganz im Gegenteil. Der hat darüber geschimpft wie ’n Rohrspatz. Er meinte, Ernst Friedrich wär ’n Vaterlandsverräter, der die Ehre der Soldaten mit diesem Museum beschmutzt. Außerdem hätte er sich gedrückt, denn er hat im Krieg im Knast gesessen, weil er den Kriegsdienst verweigert hat. Der nennt sich voller Stolz Anarchist. Deshalb muss Peter da als Wachtmeister regelmäßig nach dem Rechten sehen, damit der bloß nix in seinem Museum ausstellt, was das Vaterland verunglimpfen könnte. Vor allem hat Peter sich darüber aufgeregt, dass der Friedrich eben nicht die Glorien zeigt, sondern vor allem die Gräuel des Krieges.«
Paul zog überrascht die Brauen hoch. »Und das hat dich neugierig gemacht?«
»Ja, und wie. Vor allem Carola wurde gleich hellhörig, die hat ja eine Schwäche für Anarchisten. Und von Kriegsgräueln haben wir ja nun auch genug erlebt, ne? Carola hat mir dann zugeredet, den Mann mal anzuschreiben. Er hat mir auch geantwortet. Er ist so ’n bisschen verdreht, aber mal ganz ehrlich, das, was unsere Armee ausgemacht hat, ehe dieser große Krieg losging, ist sowieso längst verloren. Ich war mit Leib und Seele Feldwebel, aber das, was da in den Schützengräben abgelaufen ist, das hat nix mehr mit ehrenvollem Kampf fürs Vaterland zu tun. Das konnte ich dem Peter natürlich nicht sagen, der hätte bloß gedacht, ich hätte mit meinen Gliedern auch meinen Mumm verloren. Aber ich glaub, man braucht viel mehr Mumm, freiheraus zu sagen, dass die Pazifisten recht hatten. Und dass jemand, der lieber ins Gefängnis geht, anstatt sich an die Front schicken zu lassen, eigentlich viel mutiger ist, weil er ja nun damit leben muss, als Krimineller zu gelten. Auch wenn er natürlich nicht seinen Hals riskiert oder seine Gesundheit, so wie wir.«
Paul nickte. Er erinnerte sich noch gut daran, was er selbst an der Front gefühlt hatte, obwohl er lediglich als Ingenieur für die Wartung des Kriegsgeräts zuständig gewesen war. Mehr als ein Mal hatte er sich damals ausgemalt, wie es wohl wäre, wenn er die Befehle verweigern und einfach die Waffen niederlegen würde. Wäre er kein verheirateter Familienvater gewesen, wäre er der Versuchung womöglich erlegen. Wegen seiner Verantwortung für Martha und die Kinder war er letztlich zu feige gewesen, das zu tun, was Ernst Friedrich getan hatte. Umso bemerkenswerter war es, dass selbst Moritz als ehemaliger Berufssoldat ähnlich dachte.
»Wärst du eigentlich auch zur Polizei gegangen, wenn du noch unversehrt wärst?«, fragte Paul, als er merkte, dass die Erinnerungen an den Krieg das Gespräch zu ersticken drohten.
»Ich glaube nicht. Nachher hätte ich noch einen von Josephs Läden hochnehmen müssen.« Moritz lachte.
»Aber der hat sich inzwischen doch zum angesehenen Bürger gemausert. War er nicht vor einem Monat sogar zu einem Empfang im Rathaus geladen?«
»Ja, er hat ein glückliches Händchen für die richtigen Bekanntschaften«, bestätigte Moritz.
»Und wird er irgendwann auch in die höchsten Kreise einheiraten?«, fragte Paul weiter.
»Nee, der ist viel zu misstrauisch zum Heiraten. Der hätte Angst, den Frauen geht’s nur um sein Geld. Deshalb hat er sogar schon meine kleine Sophia als Haupterbin in seinem Testament bedacht, weil er nicht davon ausgeht, noch eigene Kinder zu haben.«
»Tatsächlich? Hat er denn so schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht?«
»Das steckt noch von früher in ihm drin. Ich glaub, der hat nie verwunden, dass unsere Mutter mit einem spanischen Kapitän durchgebrannt ist. Ich war da drei Jahre alt und kann mich kaum an sie erinnern, aber Joseph war schon sechs.«
»Deine Mutter ist durchgebrannt, als ihr noch so klein wart? Das wusste ich nicht.«
»Wir reden normalerweise auch nicht drüber. Unsere Mutter war aus’m Gewerbe, die hat schon mit dreizehn angeschafft. Mit sechzehn hat sie meinen Vater um den Finger gewickelt, der war damals achtunddreißig. Er hat sie geheiratet, weil er sie liebte. Mit siebzehn hat sie Joseph gekriegt, drei Jahre später kam ich. Das hat ihr aber nicht genügt, vielleicht hat sie auch gedacht, dass so ’n Hurenwirt besser verdient. Irgendwann kam jedenfalls der spanische Kapitän, hat ihr schöne Augen gemacht, und dann war sie weg. Wir haben nie wieder was von ihr gehört. Viel getaugt hat sie ja nicht, welche Mutter lässt schon zwei kleine Kinder allein. Mein Vater nannte sie immer nur das Luder und hat dann nie mehr geheiratet. Er sagte, das Luder wär sein größter Fehler gewesen, das einzig Gute daran wären seine Jungs.«
»Immerhin wart ihr was Gutes für ihn.«
»Ja, und wenigstens sind wir ehelich geboren, sonst hätte ich später bei der Armee auch nicht Feldwebel werden können. Die haben da ja auch so ’n Dünkel, und deshalb hab ich im Musterungsbüro auch gelogen und behauptet, meine Mutter wär gestorben, als ich noch klein war, und mein Vater wär Gastwirt auf St. Pauli. Dass der Hurenwirt für die Häuser im Rademachergang war, musste ja keiner wissen.«
»War vermutlich besser so«, sagte Paul. »Umso bemerkenswerter ist, wie weit ihr es gebracht habt.«
»Na ja, ohne Joseph wär’s bei mir ja eher wieder ein Abstieg geworden.« Er klopfte mit der Armprothese gegen die Beinprothese. Dann hielt er Paul die Keksdose erneut hin. »Willst du noch einen?«
Am frühen Abend rollte der Zug im Berliner Hauptbahnhof ein. Die beiden nahmen sich ein Doppelzimmer in einer kleinen Pension in Bahnhofsnähe, die auf Geschäftsreisende ausgerichtet war. Anschließend gönnten sie sich ein Taxi, um das Berliner Nachtleben zu erkunden.
»Wird garantiert nicht mit der Reeperbahn mithalten können«, meinte Moritz. »Aber ein vernünftiges Lokal mit anständigem Essen finden wir bestimmt.«
Der Taxifahrer empfahl ihnen das Wein-Restaurant Traube in der Leipziger Straße 117, das drei Kilometer von ihrer Pension entfernt lag.
»Früher wär das ein netter Abendspaziergang gewesen«, meinte Moritz.
»Früher«, bestätigte Paul.
Der Taxifahrer hatte nicht zu viel versprochen. Die Traube war ein elegantes Lokal, auch wenn es in den Zeiten der Inflation einiges vom Glanz der Kaiserzeit verloren hatte. Die Tische waren aus Nussbaumholz, die gepolsterten Stühle mit dunkelgrünem Stoff bezogen. Der Bogengang zwischen Hauptrestaurant und Weinstube war einem riesigen Weinfass nachempfunden.
»Sieht ja ganz hübsch aus«, meinte Moritz.
»Guten Abend«, wurden sie von einem Ober in schwarzem Anzug und mit adretter Fliege begrüßt. »Wünschen die Herren zu speisen oder nur zu trinken?«
»Beides«, sagte Moritz. »Wir haben ordentlich Hunger mitgebracht.«
Der Ober nickte und führte sie im Hauptrestaurant an einen Tisch für zwei Personen. Als Moritz die Karte nahm, lachte er laut auf.
»Guck dir das an.« Er reichte sie Paul. Die Preise waren aufgrund der Inflation so schnell gestiegen, dass es sich nicht gelohnt hatte, jedes Mal eine neue Karte drucken zu lassen, und so waren die Preise schon mehrfach durchgestrichen und neu berechnet worden.
»Mein Gott, für das, was heutzutage eine Flasche Wein kostet, hätten wir früher einen ganzen Luxusdampfer ausstaffieren können«, meinte Paul. »Allerdings haben sie auch schon den Preis in Rentenmark danebengeschrieben, und der scheint fast wieder so wie früher. Eine Rentenmark entspricht jetzt einer Billion Papiermark.«
»Das kann dir heute alles egal sein, ich lad dich ein«, sagte Moritz.
Nachdem der Kellner ihnen den Wein gebracht hatte, fragte Paul: »Was hält Joseph eigentlich von der Währungsreform? Glaubt er, dass die Preise jetzt stabil bleiben?«
»Zumindest hofft er es«, sagte Moritz. »Aber so ’n Rentenmarkschein habe ich bislang noch nicht in die Finger gekriegt. Ich frag mich auch, ob den jemand im Laden annimmt, wenn man die nur aus den Abbildungen in der Zeitung kennt. Ich habe noch die frisch gedruckten Billionenscheine in der Tasche.«
Paul nickte, und dann wechselten sie das Thema.
Es wurde ein angenehmer Abend mit gutem Wein und ebenso gutem Essen. Sie überlegten kurz, ob sie noch eine der zahlreichen Varietédarbietungen der Hauptstadt besuchen sollten, mussten sich aber eingestehen, dass sie von der langen Bahnfahrt recht erschöpft waren. Paul hatte zudem schon seit sieben Uhr in der Früh auf der Werft gearbeitet. Zwar hielt sich die körperliche Arbeit für einen Ingenieur in Grenzen, doch er hatte sich am Vormittag mit einem kniffligen Problem befassen müssen. Stahl war nahezu unerschwinglich geworden, aber die Auftragsbücher waren voll für den Bau kleiner Spezialschiffe, wie sie im Hafen eingesetzt wurden. Also war es Pauls Aufgabe zu berechnen, wo man in den Konstruktionsplänen statt auf Stahl auf Holz zurückgreifen konnte. Von seiner Arbeit hing es ab, ob die Wolkau-Werft die Aufträge weiterhin erfüllen konnte und die Krise überstand oder ob sie, wie so viele andere Betriebe, Pleite machen würde. Eine große Verantwortung, die Paul manchmal schier zu Boden drücken wollte. Andererseits hatte Wolkau viel für ihn getan und auch in den schwierigen Zeiten, als er wegen seiner Verwundung nur eingeschränkt arbeiten konnte, an ihm festgehalten. Seit sechsundzwanzig Jahren arbeitete er jetzt auf der Werft, und sie war seine zweite Familie geworden. Er würde alles dafür tun, dass sie erhalten blieb.
4
Am folgenden Morgen frühstückten Paul und Moritz aus giebig in ihrer Pension. Die Zimmerwirtin gab sich viel Mühe, allerdings war der Kaffee so dünn, dass Paul vor dem ersten Schluck dachte, es handle sich um Tee.
Draußen war es kalt und neblig. Die letzten Novembertage zeigten sich von ihrer unangenehmen Seite. Paul zog den Hut tief ins Gesicht und schlug den Kragen seines Mantels hoch, als sie zum wartenden Taxi gingen.
»Das Sauwetter hat auch sein Gutes. Immerhin muss ich mich heute nicht ärgern, dass ich so einen kleinen Spaziergang nicht mehr durchhalte«, meinte Moritz, während er sich umständlich mit Gehstock und Beinprothese ins Taxi hievte.
Nach kurzer Fahrt durch die Innenstadt hielt das Taxi vor einem kleinen, zweistöckigen Häuschen, wie man sie auch in Hamburg zu Hunderten im Gängeviertel fand. Über dem großen Schaufenster war die Aufschrift »Anti-Kriegsmuseum« angepinselt, und im Fenster selbst hingen einige Fotografien, die jedoch so klein waren, dass Paul vom Taxi aus nicht erkennen konnte, was sie darstellten. Zudem schien es, als wäre ein Großteil der Bilder recht unsanft entfernt worden, denn an der Scheibe hingen noch einige Klebestreifen mit den Ecken abgerissener Fotografien.
»Dat wollen Sie sich wirklich antun?«, fragte der Taxifahrer mit zweifelndem Blick.
»Ja, warum denn nicht?«, fragte Moritz, während er die Taxirechnung zahlte.
»Na, der Knabe, der das eröffnet hat, ist ’n unverbesserlicher Anarchist und Drückeberjer. Der hat vor nix Ehrfurcht. Da war erstjestern die Polizei da und hat den schlimmsten Schund entfernt.«
»Den schlimmsten Schund?«, fragte Paul. »Sie meinen, die Polizei hat die Bilder abgerissen?«
»Ja, natürlich, denn die entehren doch allet, wofür Leute wie Sie stehen.«
Paul war irritiert. »Wofür stehen Leute wie wir denn?«
»Na, Ihnen sieht man doch an, dass Sie sich nicht vorm Dienst am Vaterland jedrückt haben.« Der Taxifahrer musterte Pauls entstellte Oberlippe.
Unwillkürlich schob Paul die Unterlippe vor.
»Haben Sie auch gedient?«, fragte Moritz.
»Ja, ich war Jefreiter im 1. Jrenadier-Rejiment«, erwiderte der Fahrer voller Stolz.
»Ich war Feldwebel im 2. Hanseatischen Regiment«, sagte Moritz.
»Na, dat ist mir aber ’ne Ehre, Herr Feldwebel. Dann sollten Sie sich das da wirklich nicht antun. Der da drinnen, der hat nur Verachtung für Männer wie Sie übrig, die allet fürs Vaterland jejeben haben.« Sein Blick fixierte Moritz’ künstlichen Arm. Die Frage dahinter blieb unausgesprochen, war aber deutlich fühlbar. Paul hoffte, dass Moritz das Gespräch einfach abbrechen und aussteigen würde, aber irgendetwas im Verhalten des Taxifahrers hatte Moritz’ Widerspruchsgeist geweckt.
»Haben Sie von den Grabenkämpfen um Les Éparges in Frankreich gehört?«, fragte er. »Da hat mich der Flammenwerfer erwischt.« Er hob demonstrativ seine Armprothese an. »Dreizehn Offiziere und vierhundertdreiundzwanzig Mannschaften wurden bei den Kämpfen getötet. Der erste große Verlust auf deutscher Seite.«
»Die Männer haben tapfer jekämpft. Ich bewundere dat sehr. Sie alle verdienen unsere Bewunderung und sollten als Vorbilder für die Jugend jelten. Aber dieser Friedrich mit seinem Muse…«
»Die Männer sind elendig verreckt«, schnitt Moritz ihm das Wort ab. »Da war nix, was die Jugend von heute bewundern oder gar erstreben sollte. Rein gar nix! Ich möchte jedenfalls nicht, dass irgendein junger Bursche so wie ich mit ansehen muss, wie seine Hand verkohlt, ehe der Schmerz ihm das Bewusstsein raubt. Und dass er dann als halber Mann wieder zu sich kommt, weil es auch das Bein erwischt hat. Dieser ganze Krieg war sinnlos. Völlig sinnlos!«
Nachdem sie ausgestiegen waren, atmete Moritz zweimal tief durch, ganz so, als hätten sich die grausamen Erinnerungen seiner erneut bemächtigt und er müsste sie mit Macht abschütteln.
Ernst Friedrich erwartete die beiden schon.
»Wie schön, dass Sie da sind«, begrüßte er sie. »Herr Kellermann, Herr Studt, willkommen in meinem Anti-Kriegsmuseum.« Er streckte die Hand aus. Moritz ergriff sie lächelnd mit der Linken und sagte: »Sie wissen ja, links kommt von Herzen.«
Ernst Friedrich erwiderte das Lächeln. Ein junger Mann von neunundzwanzig Jahren, glatt rasiert und mit einem Leuchten in den Augen, das deutlich zeigte, wie sehr er hinter seiner Sache stand.
»Es ist selten, dass sich ehemalige Berufssoldaten so offen zu meiner Arbeit bekennen«, sagte er, während er Moritz’ Hand schüttelte. Dann reichte er auch Paul die Hand.
»Nicht, dass Sie da was falsch verstehen«, sagte Moritz. »Herr Studt war nie Berufssoldat, der hatte bloß das Pech, mit einundvierzig auf’n letzten Drücker eingezogen zu werden, weil die für ihre Maschinen einen Ingenieur an der Front brauchten.«
»Haben Sie denn nie erwogen, den Kriegsdienst zu verweigern, Herr Studt?«
»Nein, ich musste an das Auskommen meiner Familie denken. Im Gefängnis hätte ich nicht dafür sorgen können.«
»Wenn Sie gefallen wären, hätten Sie das auch nicht gekonnt.«
»Ich bin aber nicht gefallen«, erwiderte Paul gereizt, denn das Gespräch nahm eine Richtung, die ihm nicht gefiel. Warum um alles in der Welt sollte er sich für irgendetwas rechtfertigen? Nur weil Friedrich selbst als Kriegsdienstverweigerer im Gefängnis gesessen hatte? Moritz bemerkte Pauls Unmut und lenkte das Gespräch rasch in eine andere Bahn.