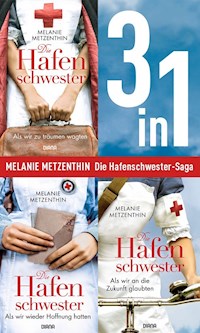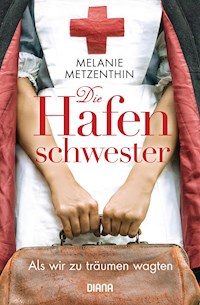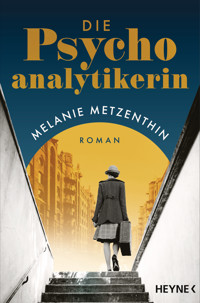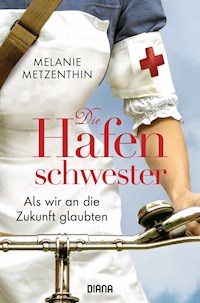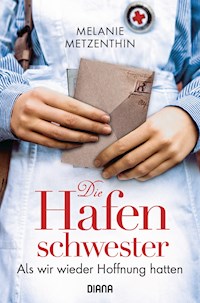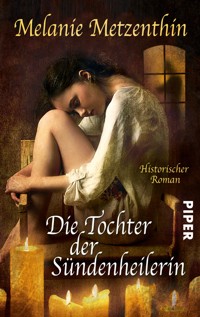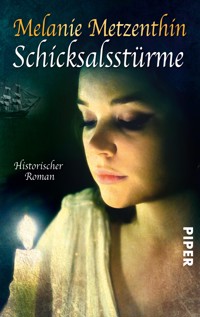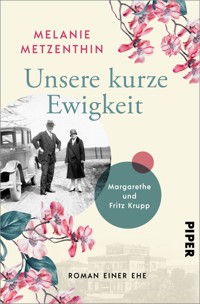
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die große Liebe wurde ihre größte Herausforderung Essen, 1882. Der begehrteste Junggeselle des Ruhrpotts heiratet eine alte Jungfer: Für Fritz Krupp und die gleichaltrige Margarethe mag es eine Liebeshochzeit sein, doch die feine Gesellschaft sieht in der Braut keine gute Partie. Margarethe beweist allerdings schnell, was in ihr steckt. Immer wieder muss sie für ihren kränklichen Gatten einspringen und ihn in privaten wie beruflichen Belangen vertreten. Ihr Mann, das Unternehmen und die Krupp-Dynastie verlangen ihr alles ab – ihre Ehe wird für sie zur Lebensaufgabe, Erfüllung und Herausforderung zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Unsere kurze Ewigkeit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Vintage Germany/Essen, Villa Hügel, um 1926. Unbekannter Fotograf; Jupiterimages/Getty Images und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Prolog
Teil 1
Herbst 1878
1 – »Wenn du als Dienstbotin …
2 – Die Fahrt zur Villa Hügel …
3 – Die Überfahrt nach …
4 – Das Leben im Haus …
5 – Als der Frühling kam, …
6 – Fritz’ Antrag, der …
7 – Der Abschied von …
8 – Margarethe freute sich …
9 – Margarethe lebte sich …
10 – Maria-Anna erwies …
11 – Im Sommer 1881 …
12 – Ostern 1882 wurden …
13 – Die Hochzeitsfeier fand …
14 – Das Leben als junges …
15 – Das Wetter in Biarritz …
16 – Das Leben als junges …
17 – Mit dem abgeschlossenen …
18 – Im Herbst 1885 stellte …
19 – Anfang 1887 bemerkte …
20 – Nach Alfreds Tod …
21 – Die vielen Veränderungen …
Teil 2
Sommer 1894
22 – Die große Reise nach …
23 – Der Besuch des …
24 – Margarethe war erleichtert, …
25 – Von nun an verbrachte …
26 – Nach ihrer Rückkehr …
27 – Am 23. März 1902 …
28 – Im Mai kehrte Fritz …
29 – Der Besuch der …
30 – Fritz kam bereits …
31 – Professor Otto Binswanger …
32 – Am Samstag, dem 15. …
33 – Als der Zug endlich …
34 – Die Wut auf Fritz …
35 – Nach der Beisetzung …
36 – Das Jahr 1903 stand …
37 – Frau Lorenz meldete …
38 – Margarethe blieb …
39 – In diesem römischen …
40 – Die Tage nach Berthas …
41 – Nach der Beisetzung …
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Villa Hügel in Essen, 27. Februar 1931
Es sollte eine Beisetzung im engsten Familienkreis werden, ein stiller Abschied ohne pompöse Gästeliste. Doch die Familie hatte nicht mit der Zuneigung der Bevölkerung gerechnet. Vom einfachen Stahlwerksarbeiter bis zur elegant gekleideten Dame waren sie gekommen. Mehr als einhundertfünfzigtausend Menschen säumten die Straßen vor der Villa Hügel! Man sah vornehme Herren ebenso wie Mütter mit kleinen Kindern. Halbwüchsige Burschen standen zwischen jungen Mädchen und hochbetagten Greisinnen, die sich ergriffen über die Augen wischten und leise von der guten alten Zeit erzählten, damals, als der Kaiser hier noch ein und aus gegangen war. Ein alter Mann, dessen krummer Rücken von lebenslanger harter Arbeit zeugte, richtete sich auf, um einen Blick auf den Trauerzug zu erhaschen. Uniformierte Schutzleute standen neben einem blassen Buchhalter, der sich immer wieder die dicken Brillengläser putzte, um ja nichts zu verpassen. Man sah Fotografen und Reporter, die diesen Tag für die Nachwelt festhalten wollten. Sie alle waren gekommen, um Margarethe Krupp die letzte Ehre zu erweisen. Industriellengattin, Firmenchefin und Ehrenbürgerin Essens. Stifterin der Margarethenhöhe, eines Wohngebiets aus wunderschön angelegten Häusern im Grünen. Diese waren Familien vorbehalten, deren Geldbeutel zu schmal für ein eigenes Häuschen war. Auch wenn manch böse Zungen behaupteten, Margarethe Krupp habe mit ihrer Wohltätigkeit von den Skandalen ihrer Familie ablenken wollen, so fühlten die meisten doch instinktiv, dass Margarethes Barmherzigkeit einem aufrechten und wahrhaftigen Bedürfnis entsprungen war. Und so hatten sich die Menschen versammelt, um Margarethe Krupp ein letztes Mal ihren Respekt zu bekunden.
Teil 1
Herbst 1878
1
»Wenn du als Dienstbotin arbeiten willst, brauchst du dich hier nie mehr blicken zu lassen. Dann bist du nicht mehr meine Tochter!«
Dieser Satz ging Margarethe nicht mehr aus dem Kopf. Nicht einmal die wunderschöne Landschaft, die an ihrem Zugfenster vorbeiflog, konnte sie ablenken. Unter anderen Umständen hätte sie mit Sicherheit ihren Skizzenblock hervorgezogen, um die herbstroten Wälder und die ockerfarbenen Felder festzuhalten. Sie hätte nach Rehen, Fasanen und Füchsen Ausschau gehalten. Doch diesmal war alles anders. Zu schmerzhaft hatten sich die harschen Worte in ihr Herz gegraben. Die letzten Worte, bevor sie aufgebrochen war, um ihr Elternhaus für lange Zeit, wenn nicht gar für immer, zu verlassen. Wenigstens hatte sie das Zugabteil für sich allein. Sie hätte es nicht ertragen, mit irgendeinem Fremden höfliche Konversation betreiben zu müssen, während ihre Gefühle durcheinanderwirbelten.
Es waren nicht nur Schmerz und Enttäuschung, sondern vor allem Wut. Unbändige, heiße Wut, die ihre Schläfen pochen und den Kopf schmerzen ließ, als wolle er zerspringen. Ein Schmerz, so stark, dass sie am liebsten geschrien hätte, um sich Erleichterung zu verschaffen. Natürlich tat sie das nicht, sie war schließlich eine Freiin von Ende, dazu erzogen, stets auf ein tadelloses Benehmen zu achten. Und zu einem tadellosen Benehmen gehörte es, sich nicht mit der Mutter zu zanken. Dennoch ärgerte sie sich maßlos, dass sie ihrer Mutter nicht widersprochen hatte. Zunächst hatte sie sich eingeredet, es wäre ihr natürlicher Respekt vor der Frau, die sie geboren hatte. Und in gewisser Weise stimmte das. Sie war schon vierundzwanzig Jahre alt, doch dieser Respekt beherrschte noch immer ihr Handeln. In Wirklichkeit war es aber ihre Feigheit. Sie hatte Angst davor gehabt, sich mit einer angemessenen Widerrede Luft zu verschaffen, denn sie wusste, dass sich nicht einmal ihr Vater August im Streit gegen die Mutter durchsetzen konnte. Und der war immerhin amtierender Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau. Andererseits bewies ihre Reise, dass sie sich in gewisser Weise doch durchgesetzt hatte. War es nicht die viel bessere Antwort, zu handeln, anstatt hitzige Worte zu wechseln, die doch zu keiner Lösung führten?
Sie war keine Dienstbotin, ganz gleich, was ihre Mutter sagte. Sie war Absolventin des Lehrerinnenseminars und hatte über den Verein deutscher Lehrerinnen in England eine gut bezahlte Stellung als Gouvernante im Haushalt des britischen Admirals John MacKenzie angeboten bekommen. Er war achtundfünfzig Jahre alt, seine Frau Anabella um vier Jahre jünger. Das Paar hatte vier Kinder, Anni, die nur drei Jahre jünger als Margarethe selbst war, den vierzehnjährigen Stammhalter Kenneth und die beiden Töchter Laura und Lissie, elf und zwölf Jahre alt, ihre künftigen Schützlinge. Margarethe war sehr stolz gewesen, als sie dieses Stellenangebot bekommen hatte. Die Bezahlung war viel besser als in Deutschland, und Mrs MacKenzie hatte ihr einen begeisterten Brief geschrieben, in dem sie ihrer Freude Ausdruck verliehen hatte, dass eine Frau mit solch guten Referenzen künftig die Erziehung ihrer jüngsten Töchter übernehmen würde. Mit Sicherheit hatten die Empfehlungsschreiben, die Bertha Krupp und die Gräfin von der Leyen ihr ausgestellt hatten, einen Großteil zu dieser Begeisterung beigetragen.
Margarethe erinnerte sich daran, wie sie Mrs MacKenzies Brief stolz ihrer Mutter gezeigt hatte. Doch anstatt sich zu freuen, war diese empört gewesen: »Du bist die Freiin von Ende und Enkelin des Grafen von Königsdorff«, hatte sie geschrien, bevor jene bitteren Worte gefallen waren, die Margarethe noch immer verfolgten. Das Pochen in ihren Schläfen verstärkte sich wieder. Am meisten ärgerte sie die Doppelmoral ihrer Mutter. Jetzt kam sie ihr mit der vornehmen Herkunft ihrer Familie. Dabei hatte sie von ihr jahrelang verlangt, für die Familie zu putzen, die Wäsche zu machen und die jüngeren Geschwister zu hüten, weil zu wenig Geld für ordentliches Personal da war. Wäre sie Gouvernante beim deutschen Hochadel geworden, hätte ihre Mutter mit Sicherheit voller Stolz mit ihr renommiert. Aber die Familie MacKenzie war nun mal bürgerlich.
Ob ihre Mutter diese Doppelmoral wohl schon als Kind erlernt hatte? Oder war es ihre Art der Bewältigung gewesen, weil ihr Leben nicht so verlaufen war, wie sie es sich eigentlich gewünscht hatte? Diese Frage hatte Margarethe sich nie beantworten können. Sie wusste nur, dass sie niemals so leben wollte wie ihre Mutter, die mit achtzehn Jahren ihr erstes Kind bekommen hatte und mit neununddreißig Jahren zum dreizehnten Mal niedergekommen war. Ihre beiden Erstgeborenen hatte sie bereits als Säuglinge zu Grabe tragen müssen, ebenso wie den kleinen Ehrenfried, ihr zwölftes Kind. Danach war nur noch die kleine Irene geboren worden. Eleonore von Ende mochte einen schwierigen Charakter haben, aber sie hatte auch kein leichtes Leben gehabt. Wenigstens hatte sie ihre Töchter trotz aller Querelen niemals dazu genötigt, eine ungewollte Ehe einzugehen. Als Margarethe daran dachte, verrauchte ihre Wut. Sie hat mich verletzt, aber sie hat mich nie daran gehindert, das zu tun, was ich wirklich will. Ich kann alles schaffen, ich muss nur die Konsequenzen tragen. Und wenn ich dazu bereit bin, kann mich nichts aufhalten.
Heute fuhr sie ein letztes Mal für lange Zeit nach Essen, um ihrer mütterlichen Freundin Bertha Krupp einen Abschiedsbesuch abzustatten. In zwei Tagen ging es dann von der Villa Hügel aus nach Hamburg. Dort würde sie die Fähre nach England nehmen und von Harwich weiter nach Holyhead in Nordwales reisen.
Ein Ruck ging durch den Waggon. Margarethe schreckte aus ihren Gedanken und sah, dass der Zug in einem kleinen Bahnhof angehalten hatte. Noch vier Stationen bis Essen. Sie schaute aus dem Fenster und betrachtete einige der wartenden Fahrgäste. Ein uniformierter Soldat, eine fünfköpfige Familie und ein Mann um die vierzig mit einem gewaltigen Schnauzbart. Sie hoffte, dass sie noch eine Weile mit ihren Gedanken allein bleiben könnte. Es gab schließlich genügend freie Abteile.
Als die Pfeife des Schaffners ertönte, war Margarethe erleichtert, denn niemand war in ihr Abteil gestiegen. Doch als der Zug anfuhr, stellte sie fest, dass sie sich zu früh gefreut hatte. Der schnauzbärtige Mann kam den Gang hoch, schaute in ihr Abteil und öffnete es dann.
»Guten Tag, ist hier noch ein Platz frei, meine Dame?«
Sie nickte stumm.
Der Mann hievte seinen kleinen Koffer in das Gepäcknetz, dann nahm er ihr gegenüber Platz. »Ich hasse es, allein in einem Abteil zu sitzen. Da bin ich doch sehr froh, dass ich Sie hier getroffen haben, meine Dame.« Er warf einen Blick auf ihre Hände, die in weißen Handschuhen steckten. Vermutlich taxierte er, ob sie einen Ehering darunter trug, denn sofort fragte er: »Oder ist Ihnen Fräulein lieber?«
»Verzeihen Sie, aber mir ist im Augenblick nicht nach Konversation zumute.«
»Oh, habe ich da in ein Wespennest gestochen? Haben Sie gar Liebeskummer? Wissen Sie, mit mir können Sie über all das reden, ich bin ein guter Zuhörer, und ich habe schon so manches Herzensleid während einer Bahnfahrt gelindert.«
Margarethe sah ihm direkt in die Augen. »Mein Herr, ich sagte, mir ist nicht nach Konversation zumute.«
»Nun, vielleicht sollte ich Ihnen dann erst einmal von mir erzählen, damit Sie etwas Vertrauen fassen. Ich bin Fridolin Stemmler, Geschäftsreisender auf dem Weg nach Essen.«
Margarethe unterdrückte einen Seufzer. Musste dieser aufdringliche Mensch ausgerechnet das gleiche Ziel wie sie haben?
»Wollen Sie wissen, was ich vertrete?«
Margarethe schaute schweigend aus dem Fenster. Das schien ihr Gegenüber als Aufforderung zu verstehen.
»Beste Savon de Marseille. Die gute Seife aus Marseille, die für ihren hohen Anteil an Olivenöl bekannt ist. Reinigend und dennoch schonend zur Haut und dabei wohlduftend. Ich habe nicht nur Rosen- und Lavendelduft im Angebot, sondern auch exotische Düfte wie Schokolade.«
Margarethe sah weiterhin aus dem Fenster.
»Wissen Sie, warum ich nach Essen fahre? Weil man sich vor dem Essen die Hände waschen sollte.« Er lachte albern. »Nun kommen Sie schon, meine Dame, das war lustig. Wollen Sie nicht einmal lächeln und mir das Strahlen Ihrer Zähne zeigen?«
Margarethe zog ein kleines in Leder eingeschlagenes Büchlein aus ihrem Handtäschchen. Zwar war ihr nicht nach Lesen zumute, aber es zog eine sichtbare Grenze zwischen ihr und ihrem Gegenüber.
»Was lesen Sie da?«, fragte der Schnauzbart.
»Ein Buch.«
»Worum geht es in diesem Buch? Ist es anspruchsvolle oder erbauliche Literatur?«
Margarethe überhörte die Frage.
»Wie wäre es, wenn Sie mir den letzten Satz, den Sie gerade gelesen haben, vorlesen, und ich versuche zu raten, um welches Buch es sich handelt. Ich bin nämlich sehr belesen, wissen Sie?«
Es lag Margarethe auf der Zunge, ihn zu fragen, ob er Ruhe geben würde, wenn er den Titel des Buches nicht erraten würde, aber sie begnügte sich damit, ihn zu ignorieren.
»Sie sind nicht sehr redselig, meine Dame.«
Margarethe tat so, als sei sie in ihr Buch vertieft. Wann würde dieser impertinente Mensch endlich begreifen, dass sie keinerlei Interesse hatte?
»Wissen Sie, meine Dame, es ist nicht sehr höflich, sich der Konversation zu entziehen.«
Sie atmete tief durch, dann sah sie dem Mann direkt in die Augen. All die Wut, die sie beim letzten Streit mit ihrer Mutter hinuntergeschluckt hatte, all die Worte, die sie damals nur im Geiste geformt, aber aus Höflichkeit niemals ausgesprochen hatte, drängten nach draußen, damit sie nicht daran erstickte.
»Ich sagte Ihnen bereits zweimal, dass mir derzeit nicht nach Konversation ist. Bitte respektieren Sie, dass ich hier nicht zu Ihrer Unterhaltung sitze, und hören Sie auf, mich zu einem Gespräch nötigen zu wollen, das ich nicht führen möchte. Das ist nämlich das, was man im Allgemeinen als unhöflich bezeichnet.«
»Oh, jetzt zeigen Sie mir die Krallen, meine Dame?« Er zwirbelte seinen Schnurrbart. »Das gefällt mir, denn jetzt kommt wenigstens etwas Leben in Ihr trauriges Gesicht.«
Margarethe unterdrückte einen Seufzer. Kurz überlegte sie, das Abteil zu verlassen, doch dann entschied sie sich dagegen. Sie war schließlich zuerst hier gewesen, und vielleicht war dieser seltsame Mensch auch ein Geschenk des Schicksals, an dem sie erproben sollte, ob sie in der Lage war, sich ausreichend Respekt zu verschaffen, so wie es ihrer künftigen Rolle als Gouvernante entsprach.
Sie tat so, als vertiefe sie sich erneut in ihr Buch.
»Warum fällt es Ihnen so schwer, sich mit mir ein anregendes Gespräch zu gönnen, meine Dame?«
Margarethe legte ihr Buch beiseite. »Ich werde es Ihnen verraten, wenn Sie mir zuvor eine Frage ehrlich beantworten.«
Er strahlte sie an. »Jede, meine Dame.«
»Warum legen Sie so viel Wert darauf, wie ein Rüpel zu erscheinen, der keine angemessene Erziehung genossen hat?«
Er starrte sie mit großen Augen an, und sein Mund erinnerte sie an einen Karpfen, der nach Luft schnappt.
»Ich warte auf Ihre Antwort, mein Herr.«
»Ich … ähm, ich bin kein Rüpel.«
»Aber Sie wirken so, wenn Sie nicht auf die freundlich formulierten Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen eingehen.«
Sie sah ihm auf dieselbe Weise in die Augen wie eine Lehrerin, die einen ungezogenen Buben ausschimpft. Und tatsächlich zeigte es Wirkung, denn Fridolin Stemmler senkte den Blick.
»Es tut mir leid, ich … ich wollte doch nur amüsant sein.«
»Nun, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung«, sagte Margarethe. »Bei mir erreichen Sie mit dieser Art das Gegenteil dessen, was Sie sich wünschen. Und da Sie das nun verstanden haben, möchte ich Sie zum wiederholten Mal bitten, meinen Wunsch nach Ruhe zu respektieren.«
Stemmler nickte. »Ich glaube, dann werde ich wohl lieber das Abteil wechseln.«
»Das ist ein vortrefflicher Gedanke«, lobte Margarethe. »Vielleicht finden Sie anderswo die Konversation, die Sie sich wünschen.«
Als der Zug endlich am Bahnhof in Essen hielt, wurde sie schon von Wilhelm, einem der Droschkenkutscher des Hauses Krupp, erwartet. Er nahm ihr die Reisetasche ab und brachte sie zu dem eleganten Zweispänner. Zuerst hielt er ihr die Tür auf und verstaute dann ihr Gepäck. Sie warf einen Blick zurück auf den Bahnhof und sah, wie Fridolin Stemmler die Unterstützung eines Gepäckträgers abwies und seinen Koffer ganz allein die Straße entlangtrug. Und obwohl sie sich anfangs so sehr über ihn geärgert hatte, spürte sie seltsamerweise Mitleid mit ihm.
Wilhelm trieb die Pferde an. Endlich würde sie Bertha wiedersehen, ihre mütterliche Freundin, die ihrem Herzen so viel näherstand als ihre eigene Mutter.
2
Die Fahrt zur Villa Hügel dauerte eine gute halbe Stunde. Margarethe war diesen Weg schon oft gefahren, wenn sie Bertha Krupp besuchte. Meist hielt Wilhelm die Zügel, und obwohl er ein sehr schweigsamer Mann war, hatte sie inzwischen das Gefühl, ihn gut zu kennen. Schon seltsam, dass gemeinsames Schweigen Menschen einander manchmal näherbrachte als viele Worte.
Ihre Gedanken schweiften zurück zu jenem Tag, als sie Bertha das erste Mal begegnet war. Damals war sie achtzehn gewesen und die Villa Hügel noch eine riesige Baustelle, die sie vom Klosterbuschhof, dem damaligen Anwesen der Familie Krupp, nicht nur sehen, sondern auch lautstark hören konnte. Da August von Ende kurz zuvor zum Regierungspräsidenten von Düsseldorf befördert worden war, gehörte es zu seiner Aufgabe, bei den einflussreichsten Bürgern im Bezirk einen Antrittsbesuch zu absolvieren. Margarethe hatte sich immer sehr gefreut, wenn sie ihre Eltern dabei begleiten durfte. Schließlich war sie nun schon eine junge Dame, die sich in der Gesellschaft zu benehmen wusste. Manchmal dachte sie, ihre Mutter würde ihre Begleitung nur deshalb erlauben, damit sie irgendwo genügend Eindruck schinden könnte, um einen passenden Mann zu finden. Ob es an jenem Tag so war, bezweifelte sie allerdings. Zwar hatten die Krupps einen Sohn, aber nicht einmal ihre Mutter hätte Friedrich Alfred, kurz Fritz genannt, ernsthaft als künftigen Schwiegersohn in Betracht gezogen. Schwerreiches Bürgertum passte ebenso wenig zu verarmtem Adel wie ein achtzehnjähriger, stets etwas kränkelnder Jüngling zu einer gleichaltrigen Jungfer, die in den Augen ihrer Mutter bereits vertrocknet wäre, bevor der junge Mann sich von einem unreifen grünen Apfel in eine süße Frucht verwandelt hätte.
Margarethe war das nur recht gewesen, denn so hatte sie die Möglichkeit, den Antrittsbesuch auf dem Hügel unbeschwert zu genießen. Während ihr der Hausherr Alfred Krupp, ein hochgewachsener, hagerer Mann mit weißem Haar, sehr Respekt einflößend und unnahbar erschien, strahlte seine deutlich jüngere Frau Bertha eine Warmherzigkeit aus, die Margarethe von ihrer eigenen Mutter nicht kannte. Es fühlte sich beinahe wie ein Nachhausekommen an, ganz so, als würde sie Bertha schon seit Urzeiten kennen, obwohl sie während des formellen Antrittsbesuchs nur wenig Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen. Damals wurde Margarethe zum ersten Mal bewusst, was sie in ihrem Innersten längst geahnt hatte: Nicht Worte drückten die Nähe zwischen zwei Menschen aus, sondern die Art, wie sie aufeinander zugingen. Gesten sagten oft viel mehr als Worte, ja sie enttarnten sie sogar. Ein Runzeln der Stirn, ein Verdrehen der Augen, und schon war die freundlichste Begrüßung wertlos, während ein Strahlen in den Augen für Aufrichtigkeit stand. Und sie bemerkte zum ersten Mal, dass manche Menschen nur mit den Augen lächelten, wenn die Contenance ein offen erkennbares Amüsement verbot.
Fritz, der Sohn des Hauses, war ihr ebenfalls sofort sympathisch, auch wenn er auf den ersten Blick nicht über jene Attribute zu verfügen schien, die Frauen an jungen Männern schätzten. Er war zwar hübsch anzusehen, aber kein galanter Unterhalter. Zudem wirkte er beinahe wie ein schüchterner Pennäler, dem der Respekt vor dem Vater deutlich anzusehen war. Eine Form des Respekts, die Margarethe schon fast als Furcht erlebte, dem anspruchsvollen Vater niemals etwas recht machen zu können. Es war nicht nur die vorsichtige Wortwahl, sondern vor allem die Körperhaltung. Stets unterwürfig und defensiv unterstützte jede Faser seines Körpers die Umsicht, mit der er sich äußerte. Aber gerade dadurch fühlte Margarethe sich ihm unwillkürlich nah. Schließlich erfüllte sie die Erwartungen ihrer Mutter ebenso wenig.
Und es gab noch etwas, das sie mit ihm gemein hatte: Es gab einen ausgleichenden Elternteil, der all das aufwog, was der andere nicht geben konnte. Sie hatte einen herzensguten Vater, den sie über alle Maßen liebte und verehrte, ganz so, wie Fritz seine Mutter liebte. Jedes Mal, wenn er sich ihr zuwandte, straffte sich seine Haltung, die Stimme wurde fester, aber der Blick weicher. Und so hatte Margarethe das Gefühl, in Fritz eine Art Spiegelbild ihrer selbst zu finden. Jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Während der relative Geldmangel ihrer Familie sie oft dreimal überlegen ließ, was sie sich leisten konnte, spürte der junge Krupp schon jetzt die Bürde eines umfassenden Erbes auf den Schultern. Eine Verantwortung nicht nur für das Vermögen, sondern vor allem für das Geschäftsimperium, das es begründete. Diese Bürde lastete gewiss doppelt schwer, da sein Vater ihm keinen Raum für eigene Ideen oder auch nur Wünsche ließ. Das wurde Margarethe besonders deutlich, als der Hausherr im Verlauf des Antrittsbesuchs zu ihrem Vater sagte: »Mein Herr Sohn wünscht das Polytechnikum in Braunschweig zu besuchen, um dort zu studieren. Was halten Sie denn davon, Herr Regierungspräsident?«
Margarethe war sofort der kritische Unterton des Gastgebers aufgefallen, die strenge Falte zwischen seinen Augen. Sie sah zu Fritz, der so beschämt die Augen senkte, als hätte sein Vater ihn eines Kapitalverbrechens beschuldigt. Doch Margarethes Vater hatte diese Warnsignale nicht erkannt. »Das lobe ich mir«, hatte er stattdessen gesagt. »Man sollte junge Menschen stets unterstützen, wenn sie sich Bildung aneignen wollen. Sie können stolz auf Ihren Sohn sein.«
Während sich die Brauen des Hausherrn nun ganz offen verärgert zusammenzogen, bemerkte Margarethe erstmals dieses stille Lächeln in Fritz’ Augen, das nur in seinem Blick lebte, aber nicht die Lippen erreichte. Sie schaute weiter zu Bertha Krupp, die den Kopf leicht senkte, so als täte ihr dieser Affront leid. Eleonore von Ende warf ihrem Mann einen warnenden Blick zu, aber August bemerkte nicht, in welches Fettnäpfchen er getreten war, sondern zählte voller Überzeugung die Vorteile eines Studiums im Polytechnikum auf. Erst als er nach diesem Antrittsbesuch nie wieder auf den Hügel eingeladen wurde, dämmerte ihm, dass er an jenem Abend wohl das Falsche gesagt hatte …
Bertha war Margarethe jedoch ungeachtet des Fauxpas ihres Vaters von Anfang an freundschaftlich verbunden und wurde die mütterliche Freundin, die Margarethe sich vom ersten Augenblick an gewünscht hatte. In den kommenden Jahren lud Bertha Margarethe wiederholt für mehrere Wochen in die Villa Hügel ein, wo sie dem jungen Mädchen half, den letzten Schliff im Umgang mit der feinen bürgerlichen Gesellschaft zu erlernen, der anders war als beim Hochadel. Ihrer eigenen Mutter war nur wichtig gewesen, dass sie wusste, wie sie höhergestellte Adelige richtig ansprach.
Margarethe lächelte versonnen bei diesen Erinnerungen, als die Droschke an dem kleinen Wächterhäuschen vorbei in das Wäldchen rollte, das die Villa Hügel umgab. Der Wächter kannte Wilhelm und Margarethe, und so blieb es ihnen erspart, anzuhalten, um den sonst obligatorischen Passierschein vorzulegen, wenn man den Privatbesitz der Familie Krupp betreten wollte. Angeblich trieben sich nicht nur ungebetene Spaziergänger hier herum, sondern es wurde auch gern mal gewildert. Margarethe dachte daran, wie der Forstaufseher ihr bei einem ihrer früheren Besuche von einem Schusswechsel mit Wilderern erzählt hatte. Allerdings hatte er dabei so ausufernd erzählt, dass sie den größten Teil der Geschichte schnell ins Reich der Fabeln geschoben hatte. Und tatsächlich hatte Fritz ihr später erzählt, dass nur ein einziger Schuss abgefeuert worden war, um den Wilderer zu warnen, der sich daraufhin sofort ergeben hätte. Ein armer Bursche, der nur den Speiseplan seiner Familie hatte aufbessern wollen und den sie dann mit einer strengen Verwarnung heimgeschickt hatten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben.
Ob Fritz wohl zu Hause war? Sie hatte ihn in den letzten Jahren ebenfalls regelmäßig getroffen. Es war natürlich keine romantische Beziehung, schließlich galt sie mit ihren mittlerweile vierundzwanzig Jahren längst als alte Jungfer, und Fritz wurde von seinem Vater nach wie vor wie ein kleiner Junge gegängelt. Ein Studium war ihm verwehrt geblieben, denn sein Vater war der Überzeugung, ein solches sei nur für Untergebene. Ein echter Unternehmer lernte durch das Beispiel seines Vaters, denn er müsse lediglich führen, für alles andere hätte er seine Leute. Und Führungsstärke liege im Blut. Alfred Krupp sah studierte Leute als Dienstboten, weil er sie für ihre Dienste bezahlte. Ihre Mutter Eleonore sah sie jetzt auch als Dienstbotin, weil sie eine gut dotierte Stellung bei einer angesehenen, aber bürgerlichen britischen Familie antreten würde. Noch eine Gemeinsamkeit, dachte Margarethe.
Sie war auch deshalb so gern mit Fritz zusammen, weil sie sich in seiner Gegenwart stets frei gefühlt hatte, ihre Gedanken zu allen möglichen Themen offen zu äußern. Ihre Mutter hatte ihr allerdings immer geraten, Männern nie ihre Intelligenz zu zeigen, denn das würde die Herren der Schöpfung nur verschrecken. Aber da sie Fritz wie einen ihrer Brüder sah, musste sie nichts befürchten. Zudem hatte sie ihn mit ihren geistreichen Gesprächen nie verschreckt, ganz im Gegenteil. Er suchte ihre Nähe und den Austausch mit ihr, vertraute ihr seine Gedanken ebenso an wie seinen Kummer mit dem Vater. Und er war genauso schweigsam, wenn sie über ihre eigenen Sorgen sprach. Ein echter Freund eben, jemand, auf den sie sich verlassen konnte, und niemand, der sie wie einen Paradiesvogel einfangen wollte, um sich mit ihm zu schmücken. Vermutlich, weil es da auch nicht viel zu schmücken gibt, dachte sie, während die Villa Hügel langsam vor ihnen auftauchte. Ich bin zu unscheinbar, als dass ein Mann mit mir renommieren könnte, und außerdem zu alt für Fritz.
Die Droschke hielt vor dem Portal der Villa. Die Baustelle von damals hatte sich längst in einen imposanten Palast verwandelt, angemessen, um Könige und Kaiser zu empfangen und vom Stolz des Bürgertums zu zeugen. Auch das war Margarethe gut in Erinnerung geblieben: der Stolz, den Alfred Krupp auf seine bürgerliche Herkunft und die Fertigkeit seiner Familie verspürte. Das war etwas, was ihre Mutter nie verstanden hatte. Dass es Menschen gab, die auf ihre Leistung genauso stolz waren wie der Adel auf eine vornehme Geburt, ja schlimmer noch, die sogar so stolz auf ihr Großbürgertum waren, dass sie die Erhebung in den Adelsstand ablehnten. Alfred Krupp war reich genug, dass er keinen Adelstitel nötig hatte. Der Hochadel ging trotzdem ein und aus. Vielleicht war genau das der Grund, warum er diese Ehre abgelehnt hatte. Er war keiner der Ihren, aber sie mussten ihn dennoch hofieren, weil der Kaiser auf seine Stahlproduktion angewiesen war. Gab es einen besseren Weg, den alten Dünkel zu zerschlagen, als einen neuen Geldadel zu gründen? Keinen von Gottes Gnaden, sondern geboren aus der eigenen Leistung und der seiner Familie?
Bertha erwartete Margarethe bereits im großen Foyer der Villa. Doch zunächst trat ein Diener lautlos heran und half ihr aus dem Mantel. So unauffällig und selbstverständlich, dass sie es nur deshalb bemerkte, weil die Dienerschaft bei ihr zu Hause nicht so gut geschult war.
»Ich bin so froh, dass wir uns noch einmal sehen, bevor es für so lange Zeit ins kalte England geht.« Bertha umarmte Margarethe.
Diese erwiderte die Zuneigung. »Ich werde Sie so sehr vermissen, meine liebste Freundin. Aber ich freue mich auch auf meine neue Aufgabe und die wilde Natur in Holyhead. Mrs MacKenzie hat mir so schwärmerisch davon geschrieben, dass ich es kaum erwarten kann, mit ihren Töchtern den Strand entlangzuwandern.«
Bertha führte sie in den Salon, wo eine Erfrischung vorbereitet war. Es gab frisch gebrühten Kaffee und eine ansprechende Auswahl an Gebäck. Die Dame des Hauses griff hinter ihr Sesselkissen, wo sie bis dahin etwas vor Margarethes Blicken versteckt hatte.
»Ein kleines Präsent für die Reise, aber es ist nicht ganz uneigennützig.« Sie reichte ihr mit verschmitztem Lächeln ein in grünes Seidenpapier eingeschlagenes Paket mit einer großen roten Schleife.
»Vielen Dank!« Margarethe nahm es und betastete es vorsichtig. »Ist es ein Buch?«
»Öffnen Sie es, meine Liebe.«
Vorsichtig löste sie die Schleife und noch behutsamer das Papier, um es nicht zu zerreißen. Im Haushalt ihrer Mutter wurde Geschenkpapier stets aufgehoben und wiederverwendet. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, so galt es doch als unschicklich, ein Geschenk einfach ungehobelt aufzureißen.
Es war ein teures Skizzenbuch, so wie es Künstler an den Akademien verwendeten, außerdem eine Schachtel mit Pastellkreiden und eine mit Bleistiften unterschiedlicher Härtegrade.
»Das ist wundervoll, vielen Dank!«
»Ich weiß doch, wie gern und mit wie viel Talent Sie zeichnen, und da dachte ich mir, auf diese Weise kann ich später bei Ihrer Rückkehr an dem teilhaben, was Sie gesehen haben.«
»Ich werde mir Mühe geben, jede einzelne Seite dieses Buches mit Leben zu erfüllen.«
»Das weiß ich, die Kunst liegt Ihnen im Blut.«
Margarethe lächelte. Die Kunst war tatsächlich eines der wenigen Dinge, die sie mit ihrer Mutter gemein hatte. Eleonore suchte regelmäßig mit ihrer Staffelei die Gemäldegalerie in Kassel auf, um die dortigen Meisterwerke gekonnt zu kopieren. Und Margarethes jüngerer Bruder Felix war sogar dabei, sich als Kunstmaler so weit zu etablieren, dass er davon seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Bei dem Gedanken an ihren Bruder kamen unwillkürlich die schweren Gedanken zurück. Für ihre Söhne war Eleonore von Ende nur das Beste gut genug. Hätte eine ihrer Töchter den Wunsch geäußert, Malerin zu werden, wäre das als Flausen abgetan worden, ganz gleich, wie groß das Talent war. Eine Frau sollte schließlich Ehefrau und Mutter sein und könnte sich nebenher den schönen Künsten widmen.
»Woran denken Sie, meine Liebe? Sie sehen auf einmal so betrübt aus. Fällt Ihnen der Abschied doch schwerer als erwartet?« Bertha sah sie mitfühlend an.
»Nein, keine Sorge.« Margarethe schenkte ihr ein Lächeln und griff nach der Kaffeetasse, die ein aufmerksames Dienstmädchen eingeschenkt hatte, während sie das Paket geöffnet hatte. Im Hause Krupp bekam der Begriff Hausgeister eine ganz neue Bedeutung. Unsichtbar und doch allgegenwärtig, wie man es von gutem Personal erwartete.
»Ich dachte nur an den Abschied von meiner Mutter.« Sie seufzte leise.
»Ist sie immer noch dagegen, dass Sie als Gouvernante arbeiten wollen?«
»Als Gouvernante in Holyhead bei einer bürgerlichen Familie«, erwiderte Margarethe. »Hätte ich eine Stellung bei einer Adelsfamilie angenommen, die im Rang über der gräflichen Familie meiner Mutter steht, wäre sie gewiss vor Stolz zerplatzt. Aber den Dienst bei Bürgerlichen sieht sie als Abstieg an.« Und dann wiederholte sie die bitteren Worte, die gefallen waren.
»Das tut mir sehr leid.« Bertha sah Margarethe aufrichtig betroffen an. »Aber ich denke, mit der Zeit wird Ihre Mutter sich beruhigen, und Ihr Vater wird das Rechte dazu tun. Er ist ja ein einfühlsamer Mann, der in Ihrem Sinne Einfluss auf seine Frau zu nehmen weiß.«
»Ich hoffe es.« Margarethe nippte an ihrer Tasse. »Aber meine Mutter macht es ihm nicht leicht.« Das war eine sehr behutsame Umschreibung für die heftigen Temperamentsausbrüche ihrer Mutter, denen der Vater längst nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Außer seiner Beharrlichkeit. Seine Strategie erinnerte Margarethe manchmal an einen altgedienten General, der einen kurzen Vorstoß auf die feindliche Burg wagte und dann bei gegnerischem Geschützfeuer sofort den Rückzug antrat, um es später erneut zu versuchen. So lange, bis der Feind das Pulver verschossen hatte und die Festung gefahrlos gestürmt werden konnte. Allerdings kostete diese Strategie viel Zeit, und Margarethe war sich sicher, dass es diesmal keine Frage von Wochen wäre, sondern vielmehr von Monaten.
Aber vielleicht würden sich die Wogen in einem Jahr geglättet haben, sodass sie nächstes Jahr schon wieder Weihnachten mit ihrer Familie verbringen könnte.
Die Tür zum Salon ging auf, und Fritz betrat den Raum.
»Wie schön, dass du da bist, um unseren Gast zu begrüßen«, sagte seine Mutter.
»Liebe Margarethe, ich freue mich sehr, Sie noch einmal vor Ihrer Abreise zu sehen.« Er lächelte sie liebevoll an, während er ihre Hand ergriff.
Er ist reifer geworden, dachte Margarethe. Vermutlich reif genug, dass sein Vater ihm demnächst eine geeignete Ehefrau aussucht, damit die Familienlinie erhalten bleibt.
Ohne dass sie es wollte, verspürte sie einen Stich. Weniger, weil sie Fritz romantische Gefühle entgegenbrachte, sondern weil eine künftige Ehefrau genau das denken würde. Und dann wäre die Zeit der unbeschwerten Gespräche mit ihrem Seelenverwandten vermutlich für immer vorbei.
»Ohne einen Abschiedsbesuch hätte ich eine so weite Reise niemals angetreten«, erwiderte sie lächelnd.
»Immerhin eine Reise über das Meer«, griff Fritz ihren scherzhaften Ton auf. Genau das liebte sie so an ihm. Er teilte ihre Art des Humors. Mochte er in der Gegenwart seines Vaters auch schüchtern und ungelenk erscheinen, in ihrer Anwesenheit und auch in der seiner Mutter war er ganz er selbst. Wie schade, dass Alfred Krupp diese Seite seines Sohnes niemals zu Gesicht bekommen hatte. Und wie bedauerlich, dass Fritz nicht in der Lage war, sie ihm zu präsentieren. Wir sind so, wie unsere Eltern uns formen, dachte sie. Und wir haben beide Glück, dass wir immerhin einen Elternteil haben, der uns zeigt, wie wir sein können. Schon seltsam, dass es bei ihm die Mutter und bei mir der Vater ist. Er holt sich das weiche Vorbild der Mutter und ich mir das beständige des Vaters.
»Was geht Ihnen durch den Kopf, Margarethe?«, fragte Bertha, der nicht entgangen war, dass Margarethes Gedanken abgeschweift waren.
»Ich dachte darüber nach, welchen Einfluss die Erziehung auf Kinder hat«, sagte sie ausweichend. »Ich denke in letzter Zeit häufig darüber nach, damit ich meiner Aufgabe als Gouvernante gerecht werden kann.«
»Sie werden eine hervorragende Gouvernante sein. Sie haben nicht nur das rechte Herz dazu, sondern sind auch in der Lage, sich in die Bedürfnisse der Kinder einzufühlen«, sagte Fritz. Seltsamerweise hatte Margarethe das Gefühl, er würde weniger über die Töchter des Admirals sprechen als über sich selbst.
»Das hoffe ich. Auch wenn ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich die Stunden klassischer Pädagogik im Lehrerseminar bisweilen geschwänzt habe.«
»Sie haben jemals Stunden geschwänzt, Fräulein von Ende?« Fritz musterte sie mit gespieltem Ernst. »Da offenbaren sich uns ja finstere Abgründe, nicht wahr, Mutter?«
Bertha lachte. »Wer sich niemals in irgendeiner Weise dem Unterricht entzogen hat, war niemals jung.«
»Oh«, sagte Fritz. »Dann bin ich wohl als Greis geboren.«
Margarethe und Bertha lachten.
»Keine Sorge, auch du warst ein richtiger Junge. Muss ich dich an die Klavierstunden erinnern?«
Fritz räusperte sich. »Gott sei Dank«, sagte er mit gespielter Erleichterung.
Es wurde ein vergnüglicher Nachmittag, aber als sie später gemeinsam mit dem Hausherrn Alfred Krupp zu Abend aßen, war Fritz’ Unbeschwertheit wieder dieser ernsthaften Verschüchterung gewichen, die sie an ihre erste Begegnung erinnerte. Daran hatte sich in all den Jahren nichts geändert. Was wäre wohl passiert, wenn Fritz sein Leben in die eigene Hand genommen und sich gegen den Willen seines Vaters beim Polytechnikum eingeschrieben hätte? Hätte der alte Herr ihn dann enterbt? Die Gefahr war gering, schließlich war er der einzige Sohn. Oder hätte er ihm alle finanziellen Mittel gestrichen? Nun, das war gut möglich, aber wenn Fritz wirklich einen derartigen Plan gehegt hätte, wäre es ihm möglich gewesen, etwas zurückzulegen. Vermutlich war es ihm nicht wichtig genug, um den Zorn des Vaters auf sich zu ziehen. Es war leichter, sich anzupassen und darauf zu vertrauen, dass die Lehren seines Vaters schon die rechten wären.
»Und was sagt Ihre Mutter dazu, dass Sie als Gouvernante nach England gehen?« Die Frage des Hausherrn schreckte Margarethe aus ihren Gedanken. Sie hob den Blick und sah dem alten Krupp direkt in die Augen. In seiner Miene las sie keine Missbilligung, sondern aufrichtiges Interesse an einer ehrlichen Antwort.
»Es missfällt ihr, dass es ein bürgerlicher Haushalt ist«, erwiderte sie.
»Aber sie hat es Ihnen nicht untersagt?«
»Nun, sie drohte mir Konsequenzen an«, sagte Margarethe vorsichtig. »Aber ich bin bereit, die Folgen zu tragen, denn ich bin davon überzeugt, dass ich das Richtige tue.«
Krupp nickte langsam. »Nur wer bereit ist, Entscheidungen zu treffen und die daraus resultierenden Konsequenzen in Kauf zu nehmen, zeigt Führungsstärke. Darin unterscheiden wir uns von Dienstboten. Dienstboten warten darauf, dass wir ihnen sagen, was sie tun sollen, und sind dankbar, dass sie selbst nichts entscheiden müssen.«
»Nun, meine Mutter warf mir vor, ich würde als Dienstbotin arbeiten.«
»Kennen Sie den Unterschied zwischen Dienstboten und Menschen, die in Diensten stehen?«, fragte Krupp.
»Ich verstehe nicht ganz, worauf Sie hinauswollen.«
»Nun, ein Dienstbote ist ein Befehlsempfänger, der genau das tut, was ihm aufgetragen wird. Ein Mensch, der in Diensten steht, ist seinem Dienstherrn gegenüber loyal, aber er braucht Sachverstand und die Fähigkeit, selbstständig Entscheidungen zu treffen, da er einem eigenen Verfügungsbereich voransteht. Wenn Sie als Gouvernante arbeiten, ist Ihr Wort Gesetz für die Kinder der Herrschaften. Sie übernehmen die Verantwortung für die jungen Menschen, stehen also als moralische Instanz über ihnen, so wie mein Verwaltungsdirektor über den Arbeitern steht. Er untersteht mir und muss meine Anweisungen umsetzen, aber die Art und Weise, wie er das zuwege bringt, liegt bei ihm, solange seine Entscheidungen dem Geiste der Firma entsprechen.«
»Somit wäre ich Ihrer Definition nach keine Dienstbotin, sondern stünde in Diensten.«
»So ist es. Und vielleicht hilft Ihnen diese Definition ja auch, sich nach Ihrer Rückkehr aus England wieder mit Ihrer Mutter zu versöhnen.«
Margarethe war erstaunt. Das hatte sie von dem strengen Patriarchen nicht erwartet. Waren seine Worte wirklich nur für sie bestimmt gewesen oder auch für Fritz? Hätte er sich von seinem Sohn statt schüchterner Unterwerfung auch mehr Selbstsicherheit gewünscht? Sie sah verstohlen zu Fritz, der ihren Blick jedoch nicht erwiderte, sondern starr auf seinen Teller schaute, sodass sie nicht in seiner Miene lesen konnte.
3
Die Überfahrt nach England war im Herbst ein ungewisses Abenteuer. Margarethe war nach einem herzlichen Abschied von Familie Krupp wie geplant nach Hamburg aufgebrochen und hatte dort zwei Tage später die Fähre nach Harwich bestiegen. Sie teilte sich eine Kabine mit einer älteren Dame namens Henriette Germer, die bereits seit Jahren als Gouvernante tätig war und ebenfalls eine neue Stelle antrat, nachdem die Kinder eines Hamburger Kaufmanns, für deren Erziehung sie zuvor zuständig gewesen war, ihrer Obhut entwachsen waren.
»Waren Sie schon mal in England?«, fragte Margarethe.
»Ja, vor sehr vielen Jahren, als ich noch so jung und frisch war wie Sie.« Fräulein Germer lächelte verschmitzt.
»Und wie war es dort?«
»Ich hatte Glück mit der Familie, denn sie lebte auf einem Landsitz mitten im Nirgendwo, dort gab es nicht viel Zerstreuung. Deshalb war diese Stellung nicht so beliebt wie die Haushalte in den großen Städten. Andererseits glich die Familie es durch ihre Freundlichkeit und den Familienanschluss aus. Wenn man damit rechnen muss, keinen schnellen Ersatz für die vergraulte Gouvernante zu bekommen, wird sie mehr wertgeschätzt.«
»Und wohin zieht es Sie diesmal?«
»Nun, inzwischen habe ich mir einen Ruf erarbeitet, der es mir erlaubt, die Stellung selbst auszusuchen. Ich hatte mehrere Offerten und habe mich für einen Haushalt in London entschieden. Wenn man in meinem Alter aufgrund seiner Referenzen ein gewisses Renommee erworben hat, kehren sich die Vorzeichen um. Während junge Frauen nur selten zwischen mehr als zwei Offerten auswählen können, ist es in meinem Fall deutlich anders. Sollte es mir bei der Familie nicht gefallen, habe ich noch drei weitere Angebote innerhalb Londons in der Hinterhand. Und es würde ein schlechtes Licht auf die Familie werfen, wenn ich von mir aus vorzeitig kündigen würde. Mein Leumund ist mittlerweile zu gut, als dass mir eine einzige Familie Steine in den Weg legen könnte.«
»Tatsächlich?«, fragte Margarethe erstaunt nach.
»Ja, meine Liebe. Gouvernanten sind wie Wein. Je älter, desto kostbarer. Nur wenn sie zu alt sind, werden sie ungenießbar. Aber ich bin jetzt dreiundvierzig, also im besten Alter.«
»Und Sie haben nie darüber nachgedacht, selbst eine Familie zu gründen?«
»Um Himmels willen!«, rief Fräulein Germer. »Nichts heilt eine Frau wirkungsvoller von den romantischen Vorstellungen einer Ehe als das Gouvernantendasein. Wir lernen die Eheleute kennen, wenn die erste große Liebe längst verflogen ist, sofern sie überhaupt jemals vorhanden war. Die meisten Ehen in den besseren Kreisen wurden ohnehin arrangiert, denn Geld heiratet immer zum Geld, so wie ein Adelstitel immer nur zu einem weiteren Titel heiratet. Die glücklichsten Ehepaare, denen ich begegnete, waren die, in denen sich die Gatten tunlichst aus dem Weg gingen. Zweisamkeit mit einem Seelenverwandten, wie man sie in einschlägigen Kolportageromanen liest, gibt es im wahren Leben nicht. Und bevor ich mir einen Klotz in Form eines Ehemannes ans Bein binde, der allenfalls als Zuchtbulle taugt, bleibe ich lieber frei und verdiene mein eigenes Geld. Zu den meisten meiner einstigen Schützlinge habe ich nach wie vor Kontakt, und sie schreiben mir regelmäßig. Manchmal besuchen wir uns auch, wenn sich zufällig die Gelegenheit ergibt. Oft stellen sie mir dann ihre eigenen Kinder vor. Ich fühle mich dann beinahe wie eine echte Großmutter.« Fräulein Germer lachte. »Fräulein von Ende, was bietet die Ehe einer klugen Frau in unserer Gesellschaft anderes als die Beschränkung ihrer Freiheit? Die Ehe wurde für Frauen erfunden, die einen Versorger brauchen und eine Horde Kinder aufziehen wollen. Für alle anderen ist sie ein unerträgliches Gefängnis. Und was meinen Sie wohl, warum die feine Gesellschaft über ledige Mütter so sehr die Nase rümpft? Die Männer tun es, weil eine ledige Frau, die sich im Leben durchkämpft, ihre Machtstellung als Versorger bedroht, und die Frauen tun es, weil sie keine Ausrede mehr hätten, sich von einem ungeliebten Mann nicht zu trennen, wenn er nicht länger die einzige Legitimation für eine ehrbare Mutterschaft wäre.«
»Das sind ausgesprochen revolutionäre Gedanken.«
»Nein, das ist die Lebenserfahrung nach mehr als zwanzig Jahren als Gouvernante. Sie werden schon sehen, meine Liebe, in ein paar Jahren teilen Sie meine Auffassung.«
Über diese Worte musste Margarethe lange nachdenken. War es wirklich so? Nun, wenn sie an ihre Eltern dachte, konnte sie Fräulein Germers Aussage durchaus bestätigen. Aber wie war es bei ihrer mütterlichen Freundin Bertha? Auch wenn Alfred Krupp nach außen hin ein strenger Patriarch war, so wusste Margarethe doch, dass er seine Frau aufrichtig liebte und ihr in den Zeiten der Abwesenheit viele liebevolle Briefe geschrieben hatte. Sie hatten nur ein einziges Kind, obwohl Bertha gern mehr Kinder gehabt hätte. Bertha konnte frei verfügen und tun, was sie wollte. Nicht umsonst hatte sie ihre persönliche Freiheit auch genutzt, um den Kontakt zu Margarethe zu halten, nachdem August von Ende sich beim Antrittsbesuch durch seine offenen Worte in den Augen des Hausherrn diskreditiert hatte.
Schon bei einem der ersten Treffen hatte Bertha ihr gestanden, dass sie Margarethe aufgrund des ersten Eindrucks, den sie auf sie gemacht hatte, unbedingt hatte wiedersehen wollen. »Es war mir, als würden wir uns schon sehr lange kennen«, hatte sie gesagt, und dieses Geständnis hatte Margarethe tief berührt, zumal sie ebenso fühlte. Hätte Bertha eine solche Ehe geführt, wie Fräulein Germer sie gerade geschildert hatte, hätte sie gewiss nicht die Tochter eines Mannes eingeladen, den ihr Gatte nicht mehr sehen wollte.
Andererseits war auch Berthas Ehe nicht vollkommen. Alfred war oft bis spät in die Nacht mit seinen Geschäften befasst oder kam gar nicht heim, weil irgendetwas in der Fabrik vorgefallen war. Einmal hatte Bertha mit einem Augenzwinkern bei einem gemeinsamen Abendessen zu ihrem Mann gesagt, sie sei wohl die einzige Ehefrau, die mit einer Firma als Geliebter konkurrieren müsse. Daraufhin hatte er geantwortet, seine Firma würde das Gleiche sagen, wäre sie eine Frau aus Fleisch und Blut. Alle hatten gelacht, sogar Fritz. Es war einer der seltenen Momente, in denen Alfred Krupp Humor gezeigt hatte. Allerdings lag mehr als ein Funken Wahrheit in dieser Aussage. Alfred Krupp war mit seiner Firma verheiratet, sie kam immer an erster Stelle. Und so führte Bertha zwar keine unglückliche Ehe, aber sie lebte auch nicht die Zweisamkeit, die in Romanschmonzetten idealisiert wurde. Wobei diese Schmonzetten ja stets endeten, wenn die Hochzeitsglocken läuteten.
Schon seltsam, dachte Margarethe. Trivialromane enden mit der Eheschließung, mit der dann alles gut sein soll. Nur die ernsthafte Literatur beschreibt das Drama der Ehe, wie die Gatten aneinander verzweifeln und schließlich zerbrechen. Möglicherweise hat Fräulein Germer doch nicht unrecht.
Nachdem Margarethe den Rest des Abends mit Zeichnen verbracht hatte, während Fräulein Germer gekonnt ein Taschentuch bestickte, gingen sie zu Bett. Mitten in der Nacht wachte Margarethe jedoch von einem seltsamen Scharren auf. Erst als sie sich im Bett aufrecht hinsetzte, begriff sie, dass das Schiff so stark schwankte, dass ihr Skizzenbuch immer wieder über den Tisch rutschte. Deshalb war der Tisch also am Boden festgeschraubt und verfügte über eine Kante, die verhinderte, dass das Buch und die Stifte zu Boden fielen. Ihre Zimmergefährtin schien der Seegang nicht im Geringsten zu belasten, denn sie schlief tief und fest. Margarethe griff nach ihrer Uhr, die auf ihrem Nachtschrank lag. Es war halb drei Uhr morgens. Sie hörte, wie Wasser gegen das Kabinenfenster schlug. War das Regen oder die stürmische See?
Sie stand auf, griff nach ihrem Morgenmantel und trat an das winzige Bullauge, doch sie sah nur die Schwärze der Nacht und zahlreiche Wassertropfen an der Scheibe. War das ein schlimmer Sturm oder nur das ganz normale Herbstwetter auf der Nordsee? Sie öffnete leise die Kabinentür und schaute auf den Gang. Wenn es etwas Ungewöhnliches wäre, würde sie dort bestimmt auch andere Passagiere treffen. Doch da war niemand. Vermutlich wäre es das Beste, wieder zu Bett zu gehen und sich von dem Schaukeln sanft in den Schlaf wiegen zu lassen. Zuvor packte sie allerdings ihr Skizzenbuch und den Bleistift in ihre Tasche, damit das Scharren sie nicht länger störte.
Meine erste Nacht auf See, dachte sie. Es stürmt, aber ich bin kein bisschen seekrank. Vermutlich ist das ein gutes Omen für meine künftige Tätigkeit bei einem Admiral zur See. Sie lächelte über ihren albernen Gedanken, fühlte sich aber trotzdem etwas zuversichtlicher, was die Reise anging. Sie würde alles schaffen, was sie sich vorgenommen hatte.
Am folgenden Morgen war der Sturm vorbei. Fräulein Germer hatte nichts mitbekommen, aber viele der übrigen Passagiere klagten beim Frühstück in der Messe über die unruhige Nacht.
»Ich dachte schon, das Schiff geht unter«, hörte Margarethe eine junge Frau am Nachbartisch sagen.
»Ach, Mäuschen, was du dir immer für Sorgen machst.« Der Mann ihr gegenüber tätschelte ihr liebevoll die Hand.
»Noch ist sie sein Mäuschen«, flüsterte Fräulein Germer Margarethe zu. »Aber je länger die Ehe andauert, umso größer werden die Tiere, mit denen die Dame des Hauses verglichen wird. Die üblichen Schritte sind Mäuschen, Häschen, Ziege und schließlich Kuh.«
Margarethe musste sich ein lautes Lachen verkneifen. »Und wie ist die Namensgebung bei Männern?«
»Nicht ganz so vorhersehbar, denn Männer mögen nicht so gern mit Tieren verglichen werden, außer natürlich mit Hengsten oder Stieren. Später enden sie dann aber oft als Esel oder Ochse.«
»Ich beginne langsam zu ahnen, in was für Familien Sie tätig waren, Fräulein Germer.«
»Sie werden sehen, dass es eher die Regel als die Ausnahme ist. Und wir können dankbar sein, dass wir uns diesem Zirkus auf ehrbare Weise entziehen konnten.«
»Nennen Sie die Ehe wegen der vielen Tiere einen Zirkus?«
»Ja, und wegen der Clowns, als die sich so manche Männer entpuppen, die nicht den Abstieg vom Stier zum Ochsen hingelegt haben.«
Margarethe lachte leise. Die Art, wie Fräulein Germer derartige Geschichten mit einem gutmütigen Augenzwinkern zum Besten gab, gefiel ihr, denn es bewies, dass sie es nicht allzu ernst meinte. Möglicherweise war sie einst selbst auf der Suche nach der großen Liebe enttäuscht worden und betrachtete die Dinge zwar mit einem guten Quäntchen Zynismus, aber vielleicht auch etwas Wehmut.
Werde ich in zwanzig Jahren genauso sein? Margarethe wusste nicht, ob sie dieser Gedanke erschrecken oder trösten sollte.
Der Abschied von Fräulein Germer fiel ihr nicht leicht, denn sie hatte ihre Kabinengefährtin während der Überfahrt zu schätzen gelernt, ihren Humor und vor allem ihre Lebensweisheiten, die sie auf so unorthodoxe Weise weitergab. Und so tauschten die beiden Frauen beim Abschied Adressen aus und versprachen einander zu schreiben und in Kontakt zu bleiben.
Die Reise von Harwich nach Holyhead war ausgesprochen beschwerlich, denn Margarethe musste einmal durch das ganze Land von Küste zu Küste reisen. Ohne die Handreichungen und Fahrpläne, die Mrs MacKenzie ihr geschickt hatte, hätte sie sich vollkommen verloren gefühlt. Zudem war es unmöglich, ihr Ziel innerhalb eines Tages zu erreichen.
Es war bereits Nacht, als ihr Zug in Liverpool einrollte. Margarethe war dankbar, dass die Familie MacKenzie so fürsorglich gewesen war, ihr vorab in Bahnhofsnähe ein Pensionszimmer zu buchen, damit sie von Liverpool aus am nächsten Morgen den Zug nach Holyhead nehmen konnte. Immerhin hatte sich ihr Englisch als ausreichend erwiesen. Sie hatte bislang nur englische Privatstunden bei deutschen Lehrern gehabt und ihre Kenntnisse der Grammatik und des Vokabulars lediglich durch das Lesen englischer Novellen verbessert. Das geschriebene Wort verstand sie gut, aber sie hatte große Sorge, wie es wohl mit der gesprochenen Sprache war. Vor allem in Liverpool, denn Fräulein Germer hatte sie gewarnt. Die Leute würden dort so schwer verständliches Englisch sprechen, dass selbst mancher Brite Probleme mit ihnen hätte. Nun, die alte Dame, die die Pension führte, verstand sie gut. Es war eine gewöhnliche Absteige für Vertreter und Handelsreisende. Die Zimmer waren einfach, die Dielenbretter knarrten, und von den Türrahmen und Fensterläden blätterte die Farbe, aber immerhin war das Bett frisch bezogen, und das genügte Margarethe. Erschöpft, wie sie war, fiel sie rasch in einen traumlosen Schlaf. Als sie am folgenden Morgen von der Zimmerwirtin geweckt wurde, hatte sie das Gefühl, gerade erst eingenickt zu sein. Das Frühstück bestand aus Toast, Butter und Rührei mit Speck. Sie aß mit großem Appetit, schließlich hatte sie im Zug nur eine kleine Mahlzeit im Speisewagen zu sich genommen, die so teuer gewesen war, dass man in Deutschland eine ganze Familie für den Preis satt bekommen hätte. Vor diesem Hintergrund fragte sie sich, ob das gute Gehalt in Großbritannien vielleicht doch nicht so großzügig bemessen war, wenn die Lebenshaltungskosten um so vieles höher waren. Andererseits hatte sie Kost und Logis frei und könnte das meiste sparen.
Als sie etwas später endlich im Zug nach Holyhead saß, war sie erleichtert. Wenn sie das nächste Mal ausstieg, wäre sie am Ziel, und die Familie MacKenzie hatte ihr zugesichert, sie vom Bahnhof abholen zu lassen. Trotz der guten Vorbereitung durch Mrs MacKenzie hatte Margarethe bei jedem Umstieg unter Anspannung gestanden. Immer war sie in Sorge, aufgrund ihrer noch unzureichenden Sprachkenntnisse wichtige Durchsagen zu verpassen. Erst jetzt konnte sie sich entspannt zurücklehnen und griff nach dem Skizzenbuch, um ihre Eindrücke mit dem Bleistift festzuhalten. Die übrigen Fahrgäste übten sich in britischer Zurückhaltung, niemand drängte ihr ein Gespräch auf. Allerdings ertappte sie sich dabei, dass es ihr diesmal sehr recht gewesen wäre, denn dann hätte sie ihr Englisch erproben können. Als eine Stunde später ein Mann in einer Marineuniform in ihr Abteil kam, die Anwesenden freundlich grüßte und dann ungefragt von sich selbst erzählte, war Margarethe neugierig, mehr zu erfahren. Er stellte sich als Adam Harrison vor, Kapitän zur See, der gerade seine alte Mutter besucht hatte und jetzt zum Hafen von Holyhead unterwegs war, um von dort auf sein neues Schiff zu gelangen.
»Sie haben ein Schiff in Holyhead?«, fragte Margarethe interessiert.
»Nein, es ist in Belfast, wo es gerade vom Stapel gelaufen ist. Aber von Holyhead geht die Fähre nach Irland. Mein erstes eigenes Dampfschiff. Meine Freunde haben mich für verrückt erklärt, dass ich das Kommando meines Viermasters für so was Modernes aufgegeben habe, aber die Zukunft gehört der Dampfschifffahrt! Und ich bin jung genug, um diesen entscheidenden Wechsel mitzugestalten.«
»Und ist es so einfach möglich, von einem Segelschiff auf ein Dampfschiff umzusteigen?«, fragte Margarethe.
»Nun ja, ich habe mich mit den Feinheiten der Dampfschifffahrt bereits vertraut gemacht. Wichtig ist, dass ich einen zuverlässigen Maschinisten an Bord habe. Ob es nun der Wind oder die Dampfkraft ist, die ein Schiff antreibt, die Regeln der Schifffahrt und die Kapitänsaufgaben bleiben gleich.«
»Und wenn das Schiff in einen Sturm gerät? Muss man dann andere Befehle geben?«
»Gewiss, mit einem Dampfschiff ist es einfacher zu navigieren, da kann einem nicht die Takelage weggerissen werden. Ich denke, der Umstieg von einem Segler zum Dampfschiff ist immer einfacher als andersrum. Deshalb ist es ja weiterhin so wichtig, dass die Jungen noch auf Segelschiffen ausgebildet werden. Nichts formt den Zusammenhalt besser, als gemeinsam ein Segelschiff zu führen.«
»Und was für ein Dampfschiff werden Sie übernehmen? Ein Passagierschiff oder ein Handelsschiff?«
Der Kapitän freute sich, dass Margarethe so interessiert war, und erzählte ihr freimütig, dass sein Dampfer zwar auch Passagiere aufnehmen konnte, aber überwiegend für den Warentransport über die Weltmeere ausgerichtet war.
»Er wird die Fahrt über den Atlantik deutlich schneller zurücklegen als jedes Segelschiff. Und ich freue mich schon darauf, regelmäßig mit Amerika Handel zu treiben.«
Margarethe nickte. Sie konnte seine Freude gut nachvollziehen. Die Fahrt auf der Fähre war ihr in weitaus besserer Erinnerung geblieben als jede Zugfahrt, trotz der rauen See. Wie wundervoll mochte es erst sein, mit einem Schiff die Weltmeere zu überqueren. Und so lauschte sie noch eine ganze Weile den interessanten Erzählungen von Kapitän Harrison und vergaß dabei immer mehr, dass er Englisch mit ihr sprach. Sie hörte auf, sich seine Worte im Geiste zu übersetzen, sondern sah sofort die Bilder, ja, sie fing sogar an, selbst auf Englisch zu denken. Und da wusste sie, dass sie sich wegen der Sprache keine Sorgen machen musste.
Als der Zug in den Bahnhof von Holyhead rollte, meinte der Kapitän: »Wir sind eingelaufen. Darf ich Ihnen mit dem Gepäck behilflich sein, Mylady?«
Margarethe erwiderte sein Lächeln. »Vielen Dank, das wäre sehr liebenswürdig, der Koffer ist recht schwer.«
»Jetzt habe ich so viel von mir erzählt, aber ich weiß rein gar nichts von Ihnen.«
»Mein Name ist Margarethe von Ende, und ich bin auf dem Weg zur Familie MacKenzie, weil ich dort als Gouvernante anfangen werde.«
»Die Familie von Admiral MacKenzie?«
»Ja. Kennen Sie ihn?«
»Vom Namen her. Den Erzählungen nach ein großartiger Mann, er war auch eine Zeit lang für den Hafen von Holyhead verantwortlich.«
Der Kapitän holte erst ihren Koffer aus dem Gepäcknetz, dann seinen Seesack und trug beides mühelos aus dem Zug. Margarethe wollte gerade nach einem Gepäckträger rufen, als der Kapitän sie auf einen Mann am Bahnsteig hinwies, der ein Schild hochhielt, auf dem der Name MacKenzie stand.
»Mir scheint, das ist für Sie. Da können Sie sich den Gepäckträger sparen, ich helfe Ihnen.« Und schon schritt der Kapitän mit kräftigen Schritten voraus, sodass Margarethe beinahe Mühe hatte, ihm zu folgen.
»Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Holyhead«, sagte er zum Abschied. »Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder.« Dann schenkte er ihr ein letztes Lächeln und ging.
Der wartende Mann stellte sich indes als William vor, Kutscher der Familie MacKenzie. Er habe die Aufgabe, die neue Gouvernante abzuholen. Sein Name verleitete Margarethe zu der kecken Bemerkung, dass dies wohl ein typischer Name für Kutscher sei, da sie auch in Deutschland einen Kutscher namens Wilhelm kennen würde.
»Ich wusste gar nicht, dass der deutsche Kaiser in seinem hohen Alter noch selbst kutschiert«, gab William trocken zurück.
Margarethe lachte. »Ich liebe diese Art von Humor«, sagte sie und freute sich, als er in ihr Lachen einstimmte, dann ihren Koffer nahm und ihn zur Droschke trug, die vor der Bahnhofshalle wartete. In diesem Moment fühlte sie sich zum ersten Mal richtig willkommen, auch wenn ihre Mutter ihr gemeinsames Lachen mit einem Dienstboten gewiss für undamenhaft gehalten hätte.
Während der Fahrt vom Bahnhof zum Haus der MacKenzies genoss Margarethe die klare, herbstliche Seeluft. William hatte ihr ganz fürsorglich noch eine Decke über die Beine gelegt, da sie zwar, entgegen des Vorurteils über das britische Wetter, ein strahlend blauer Himmel empfangen hatte, aber die Sonne längst nicht mehr die Kraft des Sommers besaß. Es war eine angenehme Kühle, noch weit entfernt vom Frost des Winters, aber wenn man still saß, konnte sie einem schnell in jeden Knochen kriechen. Dennoch war sie froh, dass die Droschke mit offenem Verdeck fuhr und sie so einen ersten Eindruck von Holyhead bekam. Nach den Erzählungen von Fräulein Germer hatte sie mit einem winzigen Nest gerechnet, in dem nichts los wäre, aber spätestens seit Kapitän Harrisons Erzählung wusste sie ja, dass hier der Fährhafen nach Irland war. Entsprechend bot der kleine Ort durchaus einige Unterhaltungen, wenngleich die meisten eher für Seeleute geeignet waren und weniger für sittsame Gouvernanten und deren Schützlinge. Aber ihnen würde auf jeden Fall das Meer bleiben mit seiner felszerklüfteten Küste abseits des Strandes, der so ganz anders war als die Strände an der deutschen Nordsee.
Das Haus der Familie MacKenzie lag etwas außerhalb, aber mit einem großartigen Blick auf das Meer. Es erinnerte Margarethe an eine kleine Burg, was nicht nur an dem winzigen Turm lag, der das zweite Stockwerk krönte, sondern auch an den grauen Steinquadern, die viel größer als deutsche Ziegel waren. Um das Anwesen lief eine kleine Mauer aus demselben grauen Gestein, die Margarethe allerdings gerade mal bis zur Brust reichte und somit mehr der Zierde diente als der Abwehr von Spitzbuben. Es gab einen kleinen Vorgarten, in dem ein gepflegter Rasen dominierte und am Rand Beete mit verschiedenfarbigen Rosen standen, deren Blüten wie ein letzter Abschiedsgruß an den Sommer wirkten.
William lenkte die Droschke um das Haus herum, sodass Margarethe nicht nur den großen Garten hinter dem Haus, sondern auch den Wirtschaftshof und die Stallungen sah. Dort hielt er und half ihr galant beim Aussteigen.
Die Familie MacKenzie erwartete sie im Salon, wo sie zunächst Admiral John MacKenzie vorgestellt wurde. Sie hatte sich keine große Vorstellung davon gemacht, wie er wohl aussehen mochte. Aber irgendwie hatte sie immer an die britischen Seehelden gedacht, deren Bildnisse man auf den Gemälden in den Kunstgalerien sah. Admiral MacKenzie trug zu Hause jedoch keine Uniform, sondern einen normalen, dunklen Anzug, wie er auch in jede deutsche Familie gepasst hätte. Sein Haar, das ursprünglich dunkel gewesen war, zeigte den eleganten silbernen Schimmer, der Männern trotz fortgeschrittenen Alters noch eine jugendliche Lebendigkeit zugestand. Zudem trug er einen Backenbart, der in den Schnurrbart überging und den Eindruck des tatkräftigen gereiften Mannes noch unterstrich.
Seine Frau Anabella hatte hellbraunes Haar, das ebenfalls von einigen silbernen Strähnen durchzogen und zu einer eleganten Hochfrisur aufgesteckt war. Sie strahlte eine herzliche Offenheit aus, die Margarethe sofort verzauberte. Dann stellte sie die Kinder vor, die Älteste, Anni, bei deren Anblick Margarethe sich sofort fragte, ob es wohl angemessen wäre, wenn sie als Gouvernante der Jüngeren die Freundschaft der beinahe gleichaltrigen ältesten Tochter suchen würde. Dann folgte der Stammhalter Kenneth, der mit seinen vierzehn Jahren irgendwo im Niemandsland zwischen Knabe und Mann stecken geblieben schien. Und schließlich begrüßten sie ihre Schützlinge Laura und Lissie, die eigentlich Louise hieß, aber von niemandem so genannt wurde. Die Mädchen trugen adrette dunkelblaue Wollkleider, die sie beinahe wie Zwillinge erscheinen ließen, auch wenn Laura erst elf und Lissie schon zwölf war. Die beiden Mädchen reichten Margarethe artig die Hand und begrüßten sie zu ihrer Überraschung auf Deutsch, indem sie, wenngleich mit starkem britischen Akzent, »Guten Tag und herzlich willkommen« sagten.
»Ihr sprecht Deutsch?«, rief Margarethe überrascht aus.
»Sie sind noch nicht sehr gut darin«, sagte Mrs MacKenzie nun ebenfalls auf Deutsch. »Aber wir hoffen, dass sich ihre Deutschkenntnisse durch Ihre Ankunft schnell verbessern, liebes Fräulein von Ende.«
»Nennen Sie mich bitte Margarethe, das ist nicht so steif.«
Mrs MacKenzie lächelte. »Sehr gern, Fräulein Margarethe.«
Nachdem die Vorstellung beendet war, hatte Margarethe erst einmal Zeit, ihr Zimmer zu beziehen und sich von der Reise frisch zu machen. Sie bekam eine Stube im obersten Stockwerk, direkt neben dem Aufgang zum kleinen Turm.
»Was ist in dem Türmchen?«, fragte sie den Hausdiener, der ihr Gepäck trug.
»Das Arbeitszimmer des Admirals«, lautete die Antwort. »Von dort aus kann er das Meer am besten sehen. Aber auch der Ausblick aus Ihrem Zimmer ist beeindruckend.«
Als er die Tür öffnete, war Margarethe nicht nur von der Aussicht beeindruckt, sondern auch von der gesamten Einrichtung. Es gab ein großes Himmelbett aus dunklem Holz, dessen Pfosten mit Schnitzereien in Form von Blütenranken verziert waren. Dazu gehörte ein ebenso verzierter Kleiderschrank, und auch der Waschtisch mit der großen Keramikschüssel griff die Ornamente wieder auf. Gegenüber stand ein dazu passender Schreibtisch direkt vor dem Fenster, sodass man beim Arbeiten stets einen Blick auf das Meer hatte. Nachdem der Hausdiener den Koffer abgestellt und das Zimmer verlassen hatte, setzte Margarethe sich hinter den Schreibtisch und stellte sich vor, wie sie den Ausblick in ihrem Skizzenbuch festhalten würde. Doch jetzt galt es erst einmal, ihre Sachen auszupacken, sich frisch zu machen und dann mit der Familie zum Nachmittagstee zusammenzukommen. Aber allein dieses Zimmer verriet ihr, dass die Wertschätzung, die sie schon durch die Briefe von Mrs MacKenzie erfahren hatte, ehrlich gewesen war und ihr hoffentlich während ihres gesamten Aufenthaltes in diesem Haushalt erhalten bleiben würde.