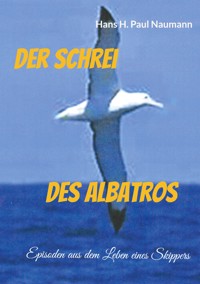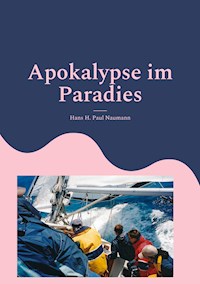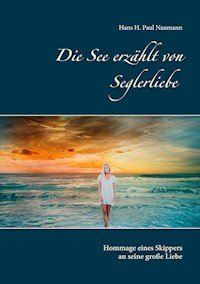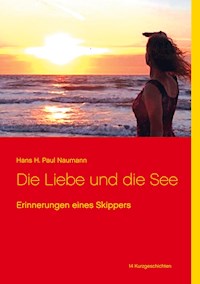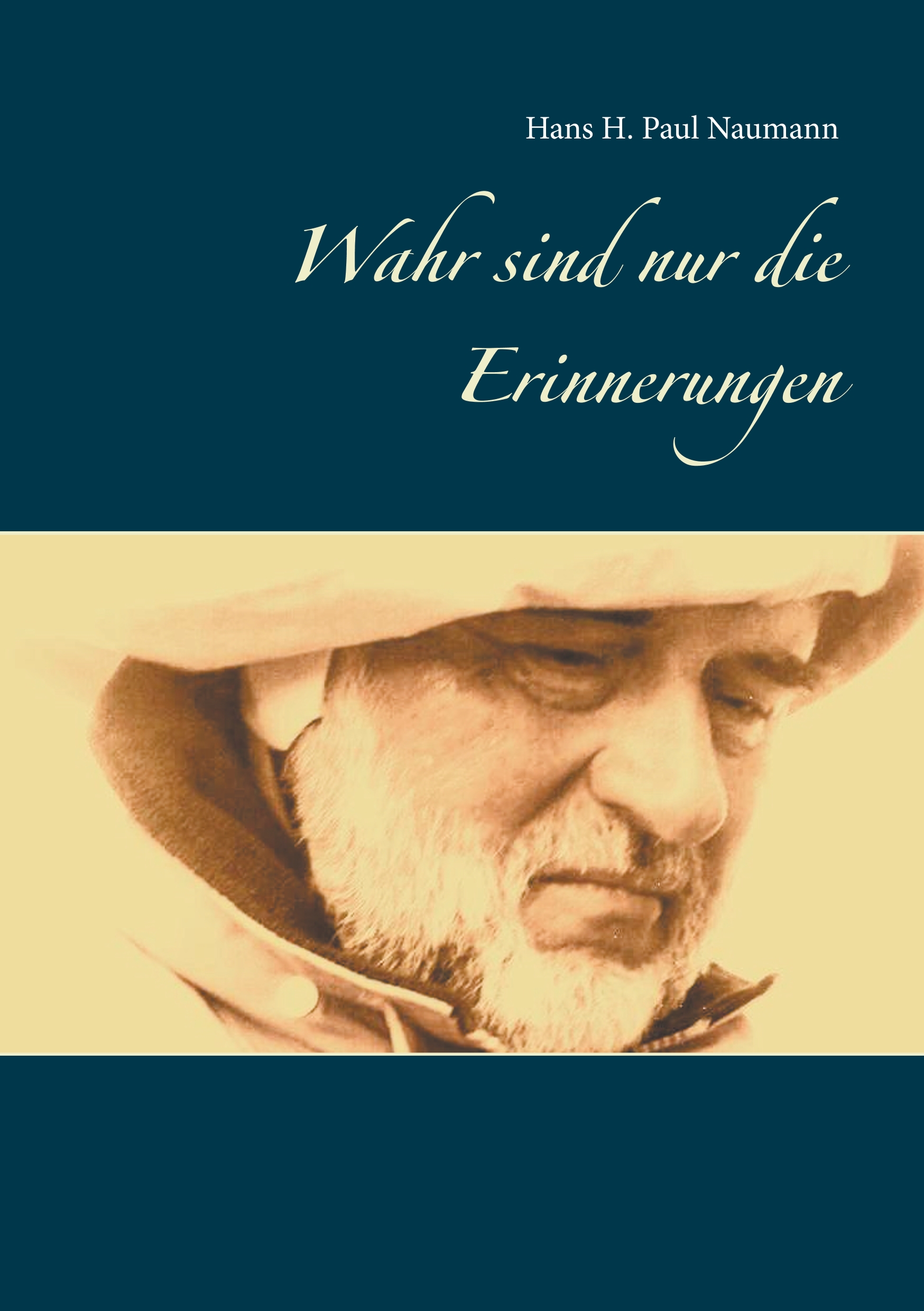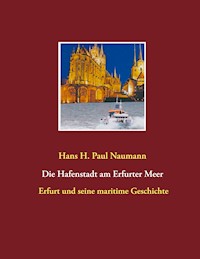
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein paar Erinnerungen,etliche tausend alte Fotos, ein paar mal ins Archiv gehen und dann alles aufschreiben, so einfach ist das.Wie man sich doch irren kann. beim betrachten der Fotos kommen die Erinnerungen, ebenso beim Lesen der alten Briefe der Kameraden oder der über 100 Jahre alten Zeitungen, finde bekannte Namen und Schicksale, versuche das Puzzle zusammenzusetzen und muss erkennen, dass es nicht möglich ist, alle Fragen zu beantworten.So habe ich meine maritimen Erlebnisse und die meiner Kameraden aufgeschrieben, vor dem Hintergrund der in der jeweiligen Zeit herrschenden Marinepolitik, beginnend mit der Brandenburger Flotte, den kaiserlichen Geschwadern bis zur deutschen Marine und begleitet vom maritimen Erfurt mit seiner Zeit der Hanse, seinen mindestens sechs Marine-Vereinen, seinem Marinedenkmal und der einmal geplanten Wasserstraßen Anbindung an die Nordsee. Ich hoffe, mit diesem Buch etwas von der maritimen Geschichte meiner Heimatstadt Erfurt zu erhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Koggen und Kontore – Die Hansestadt Erfurt
Die brandenburgische Flotte
Die Geburtsstunde der preußisch-deutschen Kriegsflotte
Die Reichsflotte 1848 - 1872
Das Übungsgeschwader
„Verein ehem. Kameraden der Marine“ in Erfurt
Tirpitz und das Deutsch-Britische Marine-Wettrüsten
Erster Weltkrieg und die strategische Niederlage der Flotte
Marine-Verein Erfurt von 1922
Flottenbund Deutscher Frauen Ortsgruppe Erfurt
Das Vereinsleben 1922 – 1935
Hafenstadt Erfurt?
Das Erfurter Marine-Ehrenmal
Die Marine 1920 bis 1945
Vereinsleben zwischen den Weltkriegen
Die Volksmarine der DDR
Die Deutsche Marine
Die „vereinigte“ Deutsche Marine
GST Seesport und die maritime Betätigung in der DDR
Club maritim Erfurt
Marinekameradschaft Erfurt 1886/1992 e.V.
Die Vereinsfahne von 1902
Korvette ERFURT – Patenschiff der Stadt
Marine-Verein Erfurt e.V
Das Erfurter Meer
Epilog
Quellennachweis
Bildnachweis
Prolog
Maritimes Erfurt gestern und heute.
Als der Autor mich um ein paar einleitende Worte bat, habe ich sofort zugesagt. Damals in Rochester an der Themse sind wir uns begegnet und seit dem freundschaftlich verbunden. In zwei Weltkriegen waren unsere Völker Gegner und nun seit 70 Jahren Bündnispartner, damit nie wieder ein Krieg in Europa stattfindet.
Nun habe ich Erfurt gemeinsam mit dem Autor erlebt, seine Liebe zu dieser Stadt und gleichzeitig zum Meer. Das Buch ist kein wissenschaftlich historisches Werk, es öffnet aber den Blick für die maritime Geschichte Erfurts und seiner maritimen Vereine im Kontext der jeweiligen politischen Epoche, deren maritime Aspekte nur wenige in neuerer Zeit so intensiv erlebt haben wie er. Möge dieses Buch dazu beitragen, auch weiterhin im schönen Erfurt maritime Traditionen und seemännisches Brauchtum zu pflegen.
Sincerely Yours
Matthew Taylor
Koggen und Kontore – Die Hansestadt Erfurt
Manchmal denke ich über dieses Phänomen nach, denn einen nicht unerheblichen Teil meines Lebens habe ich in Erfurt verbracht, Erfurt in Thüringen, dem grünen Herz Deutschlands.
Weitab vom Meer, oder doch nicht? Mit einem Hafen am Stadtrand von Erfurt? Die Stadt Erfurt war nachweislich seit 1286 am hansischen Handel beteiligt. Im Mittelalter hatten nur wenige befreundete Städte gleichgerichtete Interessen in unmittelbarer Nähe. Daher war die wirtschaftliche Verbindung zu den norddeutschen Küstenstädten, die im 14. und 15. Jahrhundert vor allem über die Städte des niedersächsischen Quartiers der Hanse verlief, von besonderer Bedeutung.
Im 13./14. Jahrhundert waren in der Hansezeit die handelsgesellschaftlichen Verbindungen besonders gut entwickelt und Erfurter Kaufleute unterhielten Handelsniederlassungen in Lübeck, Hamburg, Lüneburg u.a. Städten. Bekannt ist, dass 1290 der Lübecker Flandernkaufmann Reinekin Mornewech in Brügge 4.406 lübecksche Mark für den Lübecker Rat zahlte, die zu einem Viertel von Erfurter Kaufleuten - fast alle waren Ratsmitglieder - stammten. Diese Summe von etwa 1.100 Lübecksche Mark hätten heute etwa eine Kaufkraft von einer halben Million Euro. Die Investition der Lübecker diente der Anschaffung von Immobilien für die Hanse in Flandern. Bemerkenswert ist dabei, dass der Anteil der Erfurter an der Lübecker Investition in Brügge aus Erfurter Einnahmen in Brügge bezahlt wurde, also Erfurter Bürger in Brügge großen Handel betrieben.
Erfurt war auch eine wichtige kirchliche und Universitätsstadt in Thüringen, unter der Kontrolle der Erzbischöfe von Mainz, aber im 13. und 14. Jahrhundert wurde die Macht allmählich von den Erzbischöfen an die Stadtverwaltung übergeben und ein Bündnis mit Nordhausen und Mühlhausen gebildet.
Wichtige Handelsstraßen führten durch Erfurt und die Produkte der Erfurter Waidhändler wurden weithin verkauft, um die große Nachfrage in den hansischen Seestädten zu befriedigen. Von Lübeck aus exportierten die Kaufleute Erfurter Waid, Hanf, Getreide und Gewürze bis nach England, Livland, Russland und Schweden. Im Fernhandel wurden aus dem Norden vor allem Heringe, Pelze, Tuche und Wachs gekauft.
Die Bestrebungen, einen möglichst großräumigen Markt zu schaffen und die Furcht vor den bewaffneten Hussiten führten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einer Verdichtung der Beziehungen zwischen thüringischen Städten und der Hanse. Im Jahr 1430 trat Erfurt gemeinsam mit Mühlhausen und Nordhausen als südlichste Städtegruppe lose dem größten Städtebund der deutschen Hanse, dem starken Goslarer Bund bei. Der Beitritt basierte auf der Grundlage einer langjährigen Interessengemeinschaft mit den sächsischen Hansestädten hinsichtlich des Handels und des Schutzes vor landesherrlicher Willkür. Die Zugehörigkeit zum Goslarer Bund stellt den Höhepunkt der politischen Beziehungen der Stadt zur Hanse dar. Zur rechtlichen Stellung der Stadt war festgelegt, dass sie Eigentum des Erzstifts Mainz sei und auf jegliche Reichsstandschaft verzichte.
Der Dreißigjährige Krieg schädigte die Stadt schwer. Erfurt wurde von 1632 bis 1635 und von 1637 bis 1650 von den Schweden besetzt. Der Westfälische Friede brachte der Stadt nicht die erhoffte Reichsfreiheit. Dadurch wurden wieder jahrelange Auseinandersetzungen ausgelöst. 1664 eroberten französische und Reichsexekutionstruppen des Mainzer Kurfürsten und Erzbischof Johann Philipp von Schönborn die Stadt. Damit begann die kurmainzische Herrschaft. Erfurt wurde nun als Hauptstadt des Erfurter Staats zusammen mit dem Eichsfeld von einem Mainzer Statthalter regiert, der seinen Sitz in der Kurmainzischen Statthalterei (heutige Staatskanzlei) hatte.
Um weiteren Aufständen vorzubeugen und als Schutz gegen die protestantischen Mächte ließ der kurmainzische Kurfürst und Erzbischof, Johann Philipp von Schönborn, auf dem Gelände des Petersberges eine Zitadelle errichten. In dieser Zeit sind keine nennenswerten seefahrerischen Aktivitäten der Erfurter Bürger bekannt, jedoch zeugen einige Bürgerhäuser von der damals engen Bindung zur Hanse.
Es ist wohl verständlich, dass diese Verbindung der Stadt Erfurt mit der Hanse im Mittelalter sich auch im städtischen Leben in Erfurt in vielen Bereichen widerspiegelte. So war der Import an Salzheringen nach Erfurt so groß und wohl auch für die Ernährung wichtig, dass man scherzhaft die Erfurter „Heringsnasen“ nannte. Auch dass die Erfurter ihren Hauptmarkt „Fischmarkt“ nannten, verweist auf einen hohen Fischverbrauch, der sicher mit der großen Anzahl von Klöstern zu tun hatte, weil deren Bewohner durch die Fastenvorschriften einen besonderen Markt für den Handel mit Fisch erforderlich machten. Aber auch viele der mittelalterlichen Hausnamen erinnern heute noch an Maritimes.
Die Häuser einiger dieser Bürger standen in der Johannesstraße (Ostseite) z.B. die Nr. 178, das Haus „Zum Grünen Sittich und Gekrönten Hecht“ (16. Jh.), wo die Keller noch aus dem 13. Jahrhundert stammen. Hier wohnte der Fernhändler Theodor von Lübelin, der Geld an die Hanse geliehen hat.
Und es ist wohl auch kein Zufall, dass die Patrizierfamilie Kellner, als sie 1413 den ehemaligen Hof der Schwarzburger Grafen in der heutigen Regierungsstrasse 64 erwarb und 1472 umbauen ließ, ihn fortan als Hof „Zum Bunten Schiff“ bezeichnete. Später wurde das Gebäude auch „Zum Bunten Schiff und Halben Mond“ und heute als „Vierherrnhaus“ bezeichnet.
In dieser Zeit wurde auch der große Speicher der Stadt in der Ackerhofsgasse erbaut (1664). Nicht nur in der Regierungsstraße 64 wurde 1472 ein Haus „Zum Bunten Schiff“ gebaut. Auch das so genannte Dacherödensche Haus am Anger 36/37 heißt eigentlich Haus „Zum Großen und Neuen Schiff“ und Haus „Zum Güldenen Hecht“.
Sicher sind auch solche Namen wie Haus „Zum Stockfisch“ (Stadtmuseum) und Haus „Zum Grünen Sittich und Gekrönten Hecht“ in der Johannesstraße auf frühere maritime Beziehungen zurückzuführen.
Haus zum Stockfisch
Es sind auch an vielen Jahrhunderte alten Gebäuden Schmuckreliefs, die Dank der Arbeit der Denkmalpflegeinstitutionen wieder farbig gut hergestellt sind, geeignet auf maritime Beziehungen der mittelalterlichen Stadt hinzuweisen, wie am Haus „Zum Stockfisch“ über dem Eingangsportal oder am Haus „Zum Grünen Sittich und Gekrönten Hecht“ in der Johannesstraße. Ein goldener Anker am Haus „Zum Güldenen Rad“ in der Marktstraße weist wohl auf den neuen Besitzer des Hauses hin, der Anfang des 18. Jahrhunderts das Haus übernahm und aus Holland kam. Am Haus „Zur Arche Noah und Engelsburg“ in der Michaelisstraße sind sogar „geflügelte Fische“ - fliegende Fische - zu sehen. Und „Arche“ ist ja schließlich auch ein Schiffsname, der natürlich auf kirchlichen d.h. biblischen Einfluss verweist.
Erfurt beherbergte viele Klöster und in der Fastenzeit wurde viel Fisch gegessen. Davon zeugen noch heute der Fischmarkt, der Wenigemarkt und die historischen Namen vieler Häuser, wie das „Haus zum Stockfisch“.
Die brandenburgische Flotte
Dank der Unternehmungslust deutscher Kaufleute, die sich in der Hanse zusammengeschlossen hatten, erwarb sich Deutschland im späten Mittelalter eine führende Stellung im Seehandel mit England, Russland und den skandinavischen Ländern. Der Hanse war es mit einer starken Kriegsflotte und im Bündnis mit Holländern und Schweden im Frieden von Stralsund (1370) gelungen, Dänemark unter ihre Kontrolle zu bringen. Damit konnte sie über anderthalb Jahrhunderte die Seeherrschaft über die Ostsee ausüben. Hinter der deutschen Hanse als ein loser Bund deutscher und einiger niederländischer Städte, dem auch Erfurt angehörte, stand jedoch nicht die Seegewalt eines deutschen Staates. Dieser Bund stellte solange eine wirtschaftliche und politische Macht dar, wie seine Mitglieder sich einig in ihren Zielen waren und ihnen von den erstarkenden Nachbahrstaaten keine ernsthafte Gefahr drohte.
Im späten 15. Jahrhundert änderte sich dieser Zustand. Die Hanse litt unter dem Fehlen einer Staatsgewalt und wachsender Zwietracht. Es begann der Niedergang. Währenddessen dehnten die europäischen Nationalstaaten unter dem straffen Regime ihrer ehrgeizigen Herrscher ihren Seehandel und ihre Schifffahrt auf Kosten der Hanse immer weiter aus. Namentlich die Holländer, Engländer, Schweden und Russen nahmen den Hanseaten ihre Privilegien. Die Hanse verlor seit dem Dreißigjährigen Krieg jede Bedeutung. Die deutschen Kaufleute hatten die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Der deutsche Seehandel war zu dieser Zeit in ausländische Hände übergegangen. Während andere europäische Länder im Schutz eigener Kriegsflotten den Sprung nach Übersee wagten, zog sich Deutschland in sein kontinentales Schneckenhaus zurück. Die deutschen Küsten und Flussmündungen gerieten unter fremde Herrschaft. Als einziger Fürst im Deutschen Reich hatte Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg die Bedeutung der Seefahrt und überseeischer Handelsniederlassungen für den Wohlstand seines Staates erkannt.
Er trat schon frühzeitig für die Wiederherstellung der Seegewalt des deutschen Kaisers ein. Bereits während seiner Studienzeit in Amsterdam reifte in ihm die Absicht, aus Brandenburg eine seefahrende Nation zu machen. Dieses Ziel verlor er nie mehr aus den Augen. Erst nach Jahrzenten konnte er ernsthaft daran denken, seine maritimen Pläne zu verwirklichen.
1640 übernahm er dann die Regierungsgeschäfte in einem völlig verarmten, vom Krieg verheerten, fast menschenleeren Land. Erst nach sechs Regierungsjahren war er ihm möglich, an den Aufbau einer brandenburgischpreußischen Flotte zu denken. Außer in den großen Hansestädten gab es zu diesem Zeitpunkt keine deutsche Seefahrt.
Mit holländischer Unterstützung begann der Kurfürst eine Reichsmarine aufzubauen, 25 Schiffe sollten erworben werden, die zum Schutz des Seehandels aber auch gegen den Feind des Reichs eingesetzt werden könnten. Die erste Flottille bestand aus den drei Schiffen, u.a. „Clevischer Lindenbaum“ , „Churfürst von Brandenburg“ und „Lübische Schule“. Später wurde das gekaperte spanische Schiff „Curolus Secundus“ unter dem neuen Namen „Markgraf von Brandenburg“ das Flaggschiff der brandenburgischen Flotte.
Das Flaggschiff
Die Geburtsstunde der preußisch-deutschen Kriegsflotte
Ein Hindernis für die Zukunft einer eigenen Seefahrt stand noch im Wege. Friedrich Wilhelm musste die volle Souveränität über Preußen erlangen, um Kriegsschiffe unter eigener Flagge in die Ostsee zu schicken, die seine Handelsschifffahrt gegen feindliche Übergriffe schützen konnten. Es gelang ihm, sich im Frieden von Labiau 1656 von schwedischer Lehenshoheit zu befreien und im Vertrag von Wehlau von Polen die Souveränität über diese Gebiete zu erreichen. Damit waren die Voraussetzungen zum Aufbau einer eigenen Kriegsflotte geschaffen. Seine Hoffnung auf den Erwerb Stettins und Stralsunds erfüllten sich jedoch nicht. Ohne diese erstklassigen Häfen konnte er sein Vorhaben nicht verwirklichen.
Nach Einstellung der Feindseligkeiten begann sich der Kurfürst erneut mit überseeischen Plänen zu befassen. Er wollte in seiner Eigenschaft als Reichsfürst eine Reichsmarine aufbauen. Dazu wollte er sich mit dem Kaiser und mit dem spanischen König zusammentun und mit Hilfe des letzteren Stützpunkte in Indien erwerben. Kaiser Leopold I. reagierte uneingeschränkt positiv. Schon im April 1661 berieten die kaiserlichen Bevollmächtigten etwa eine Woche über das Unternehmen. Daraufhin wurde ein Mitspracherecht des spanischen Königs ausgeschlossen. Österreich und Brandenburg sollten das Unternehmen gemeinsam leiten. Die Pläne gingen weit über das reine Handelsinteresse hinaus. Eingehend war über das Verhalten im Kriegsfall nachgedacht worden.
Eine Verwirklichung der Pläne hätte nicht nur zur Stärkung der inneren Struktur des Reiches, sondern durch die beabsichtigte, gegenseitige Schutzverpflichtung auch zum Aufbau einer respektablen Seemacht des Kaisers geführt.
Im Folgenden wurde allerdings der Kurfürst nicht mehr in den weiteren Fortgang der Geschäftsleitung führend einbezogen. Friedrich Wilhelm war sehr enttäuscht.
Es war das letzte Mal, dass der Kurfürst bei seinen maritimen Plänen an die Wohlfahrt des Deutschen Reiches dachte. Er war überzeugt, dass sich seine Seefahrt am besten unter dem Schutz der eigenen Flagge entwickeln ließe.
In den nächsten 14 Jahren widmete er sich dem Ausbau des Seehandels und stellte die Unterhaltung einer Kriegsflotte einstweilen zurück. 1676 nahm er dann auf eigene Faust den Seekrieg gegen Schweden auf.
Der Kurfürst konnte sich zwar finanziell keine Flotte leisten, aber er akzeptierte den Vorschlag des niederländischen Reeders Benjamin Raule, mit 10 Fregatten auf eigene Rechnung unter brandenburgischer Flagge die schwedische Seemacht anzugreifen. Bereits das erste Unternehmen Raules war mit 21 gekaperten schwedischen Schiffen ein voller Erfolg. Raule schuf seinem Fürsten eine schlagkräftige Flotte, zunächst auf Mietbasis, ab 1684 im Eigentum des Kurfürsten.
Er beklagte sich aber auch darüber, dass in ganz Preußen nur 12 Seeleute zu finden gewesen seien. Aus diesem Grunde schlug er vor, ein Regiment Marinetruppen in Stärke von 500 Mann aufzustellen und in Königsberg, Kolberg und Stettin zu stationieren. Die brandenburgisch-preußische Flotte hatte sich im Krieg gegen Schweden siegreich behaupten können und durch ihren Vorstoß in den Atlantik und in die Karibik an überseeischer Erfahrung gewonnen.
Die Leistungen der Flotte überzeugten den Kurfürsten von der Bedeutung einer eigenen Seemacht für die Sicherheit des Staates und den Schutz des Seehandels durch eigene Seestreitkräfte. Er entschloss sich, eine eigene, ständig einsatzbereite Flotte aufzubauen. Nachdem der Kurfürst wegen seiner beschränkten Mittel zunächst neun Schiffe langfristig gemietet hatte, entschloss er sich, diese Schiffe zum 1. Oktober 1684 zu kaufen. Diese Transaktion kann als die Geburtsstunde einer preußisch-deutschen Kriegsflotte gelten.
Was bedeutete diese Entwicklung für Erfurt?
Erstmals dienten auch einige Freiwillige aus Erfurt und dem Umfeld in der im Aufbau befindlichen Kriegsflotte.
Der Westfälische Friede brachte der Stadt Erfurt aber nicht die erhoffte Reichsfreiheit. Dadurch wurden wieder jahrelange Auseinandersetzungen ausgelöst.
Gemäß dem Reichsdeputationshauptschluss kamen Stadt- und Landgebiet Erfurt 1802 als Entschädigung für verlorengegangene linksrheinische Gebiete zu Preußen. Nach dem Sieg Napoleons über Preußen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt besetzten französische Truppen am 16. Oktober 1806 die Festung Petersberg kampflos nach ihrer Kapitulation.
Napoleon erklärte 1807 Erfurt zusammen mit Blankenhain als Fürstentum zu einer kaiserlichen Domäne, die nicht Teil des Rheinbunds war, sondern ihm direkt unterstand. Im Jahr 1814 endete dann nach erfolgreicher Belagerung von Erfurt durch preußische, österreichische und russische Truppen die französische Besetzung. Daraufhin wurde Erfurt 1815 aufgrund des Wiener Kongresses wieder Preußen zugesprochen, das den größten Teil des Landgebietes und das Blankenhainer Gebiet erhielt.
Noch immer sind für Erfurter Bürger keine wesentlichen Aktivitäten in der Flotte nachweisbar, aber die Werbung für die neue Waffengattung zeigte auch hier schon Wirkung.
Die Reichsflotte 1848 - 1872
Forderungen nach einer deutschen Marine hatte es in der ersten Jahrhunderthälfte gelegentlich schon gegeben. Einmal war sogar die Bundesversammlung damit befasst worden. Das war im Frühjahr 1817 gewesen, nachdem tunesische Seeräuber im Kanal und in der Nordsee deutsche Schiffe belästigt und dem Handel hohen Schaden zugefügt hatten. Damals hatte der badische Gesandte die Dringlichkeit einer deutschen Marine um der Nationalehre, der deutschen Handelsindustrie und des deutschen Völkerrechts willen betont. Allerdings hatte diese Ermahnung keinerlei konkrete Folgen gehabt. Die Gründungsakten und Verträge des Deutschen Bundes kannten keine Marine. Obwohl es in Hamburg, Bremen und Lübeck und auch in Preußen bedeutende Häfen gab, waren die deutschen Handelsflotten ohne militärischen Schutz durch eine Seemacht. Man glaubte teilweise, dass auswärtige Bundesmitglieder den Schutz leisten könnten. Hannover war bis 1837 mit Großbritannien in einer Personalunion verbunden. 1845 schlug der preußische König sogar dem dänischen König vor, Großadmiral Deutschlands zu werden. Ergebnislos. Die einzig nennenswerte Flotte der deutschen Staaten hatte Österreich. Diese war aber in Venedig und Triest stationiert. Das einzige verfügbare preußische Kriegsschiff war 1848 das SMS „Amazone“.
Bereits kurz vor der Märzrevolution hatte Preußen sich bemüht, andere deutsche Nordsee-Anrainer zu einer gemeinsamen Handelspolitik zu bewegen, eine Kriegsflotte gehörte zu den Ideen bereits dazu. Der preußische Prinz Adalbert hatte eine „Seewehr“ vorgeschlagen.
Er stieß aber auf Widerstand, denn eine Flotte war mit hohen Kosten verbunden und wurde für die Landesverteidigung nicht als notwendig erachtet. Im März 1848 erhoben sich die Herzogtümer Schleswig und Holstein gegen den König von Dänemark. Der Krieg zeigte überdeutlich, wie verwundbar deutsche Handelsschiffe und Seehäfen waren. Eine große Zahl preußischer Schiffe wurde beschlagnahmt.
Daraufhin bildeten sich in fast allen größeren deutschen Städten Flottenvereine und Ausschüsse, die Geld für eine Reichsflotte sammelten.
Der Wunsch nach einer starken Flotte fand in der Gründung des Deutschen Flottenvereins (DFV) seinen nachhaltigen Ausdruck. Dieser wurde 1898 gegründet und entwickelte sich bis 1914 zur mitgliederstärksten und bedeutendsten gesellschaftlichen Interessengruppe im Kaiserreich.
Werbung für den Flottenverein in Erfurt
Erst nach Ausbruch der Märzrevolution 1848 rief das Vorparlament den Bundestag, die Küstenstaaten und das deutsche Volk zur Bildung einer Kriegsmarine auf. Es forderte den Bundestag auf, Kriegsschiffe zu erwerben und Verteidigungsanlagen an den Küsten zu bauen.
Zahlreiche private Initiativen schlossen sich leidenschaftlich dem Ruf nach einer deutschen Seemacht an und begannen Geld zu sammeln.
In einer ersten Reaktion begannen die norddeutschen Küstenstaaten Handelsschiffe zu bewaffnen und zu Kriegsschiffen aufzurüsten. Die Hamburgische Admiralität kaufte diese aus Spendengeldern finanzierten Schiffe für die aufzubauende Reichsflotte auf. Die unter Hamburger Führung stehende Flottille wurde damit zum Grundstock der Reichsflotte. Gleichzeitig begann der Aufbau einer eigenen kleinen Marine in Schleswig-Holstein. Diese Schleswig-Holsteinische Marine kämpfte in der Nord- und Ostsee gegen die dänische Marine. Sie unterstellte sich nur formal der Reichsflotte.
Preußen sah sich nicht nur der Bedrohung seiner Handelsschifffahrt ausgesetzt, sondern befürchtete einen Kriegseintritt Russlands auf der Seite Dänemarks. Deshalb wurde der Aufbau einer eigenen Marine beschleunigt. 40 Ruderkanonenboote wurden als erste Maßnahme gebaut, die bis 1870 in Dienst blieben. Eines davon wurde von Erfurter Bürgern finanziert.
Wie der Bundestag gründete auch die Nationalversammlung am 28. Mai 1848 einen Marineausschuss. Nach einer Analyse sollte ein Stufenplan zum Bau von Schiffen vorliegen. Für die erste Bauphase forderte der Ausschuss sechs Millionen Taler. Die deutsche Flotte sollte inneres und äußeres Zeichen der deutschen Einigung sein.
Was geschah wirklich am 14. Juni 1848?
Wer an diesem Tag auf den Zuschauerrängen der Frankfurter Paulskirche saß, wo die Konstituierende Nationalversammlung tagte, um als Konsequenz einer Revolution im ganzen Lande einen neuen Staat zu errichten, konnte folgenden Vorgang erleben.
Der Präsident, Heinrich v. Gagern, verlas nach gut zweistündiger Debatte den nachstehenden, als Frage formulierten Antrag: „Beschließt die Nationalversammlung, dass die Bundesversammlung zu veranlassen sei, die Summe von 6 Millionen Thalern zum Zweck der Begründung eines Anfangs für die deutsche Marine, über deren Verwendung und Vertretung die zu bildende provisorische Zentralgewalt der Nationalversammlung verantwortlich sein wird, auf bisher verfassungsmäßigem Wege verfügbar zu machen, und zwar 3 Millionen sofort, und die ferner 3 Millionen nach Maßgabe des Bedürfnisses?“
Der Präsident bat dann „diejenigen Mitglieder, welche wollen, dass der Bundestag auf diese Weise zu veranlassen sei,“ sich von ihren Plätzen zu erheben. Fast alle Abgeordneten entsprachen dieser Bitte. Der Präsident stellte fest: „Die Frage ist mit einer an Stimmeinhelligkeit grenzenden Majorität bejaht“. Ein allgemeines Bravorufen ging durch den Saal.
In der Rückschau mag dieser Vorgang wie ein Spuk erscheinen. Da waren Volksvertreter seit noch nicht einmal vier Wochen versammelt, um eine Verfassung für ein geeintes Deutschland auszuarbeiten. Sie Beschlossen die Verfügbarmachung einer Summe für den Flottenbau, ohne ein dafür zuständiges Exekutivorgan zu haben; die provisorische Zentralgewalt wurde erst 14 Tage später geschaffen. Sie beschlossen dies, ohne das verfassungsmäßig erst noch zu konstituierende Haushaltsrecht zu besitzen.
Und bekanntlich konnte der Beschluss zum Bau der Flotte sogar verwirklicht werden. Gegen Ende des Jahres 1849 lagen auf der Weser unter dem Kommando des Konteradmirals Brommy neun Dampffregatten oder Dampfkorvetten, zwei Großsegler und 27 Kanonenboote.
Aber auch diese Flotte mutet den rückschauenden Betrachter wie ein Spuk an: Sie war zu einem Zeitpunkt einsatzbereit, als die Nationalversammlung längst auseinandergegangen und das Stuttgarter Rumpfparlament verjagt worden war.
Ihr Auslaufen war riskant, da ihre Flagge mangels einer hinter ihr stehenden Regierungsgewalt völkerrechtlich nicht geschützt war. Am 02. April 1852 beschloss die inzwischen reaktivierte Bundesversammlung ihre Auflösung. Die Schiffe wurden zu Spottpreisen versteigert oder verkauft.
Es gab eine breite Palette von Gründen, warum die Nationalversammlung 1848 als ersten Beschluss den der Gründung einer deutschen Flotte fasste.
Das Spektrum reichte von militärischer Sicherheit über Handelsvorteile, Beseitigung anachronistischer Zollbarrieren, Kolonialexpansion, Industrieförderung, Arbeitsbeschaffung, Förderung der Landwirtschaft zu internationalem Kulturaustausch, zivilisatorischem Fortschritt, politischer Freiheit, Volkserziehung und schließlich wiederum zur nationalen Demonstration.
Der Zusammenhang zwischen Flottengründung und Revolution wird hier deutlich. Die Marine erschien den Zeitgenossen als geeignetes Instrument zur Erreichung revolutionärer Ziele wie nationaler Geschlossenheit und Souveränität, wirtschaftlicher Entfaltungsmöglichkeit, sozialer Sicherheit, internationaler Partnerschaft, moralischer Höherentwicklung und schließlich auch zu Selbstbestätigung, Macht und Imperium.
In Marinekreisen ist der Standpunkt vertreten worden, dass die Notwendigkeit einer Flotte selbstverständlich sei. Man solle vielmehr fragen, warum es nicht längst vorher in Deutschland eine Flotte gegeben habe. Bis zum Ende der Bismarck-Ära (1890) galt für das Deutsche Reich die Maxime, sein Schicksal werde auf dem Land, nicht auf dem Meer entschieden.