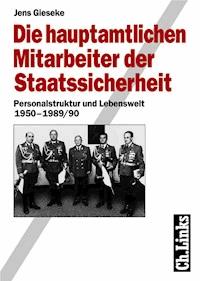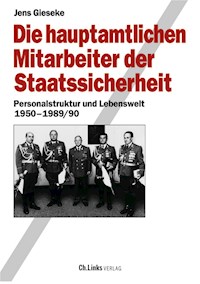
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissenschaftliche Reihe des BStU
- Sprache: Deutsch
Das Ministerium für Staatssicherheit war – gemessen an der Bevölkerung – die größte Geheimpolizei der Welt. Jens Gieseke untersucht in seinem im Jahr 2000 erschienenen Buch erstmals systematisch die personelle Zusammensetzung dieses Apparats, dokumentiert die Hintergründe seines Wachstums und beschreibt die Motivlage des hauptamtlichen Korps. Einbezogen werden dabei die Entscheidungsprozesse in der Staats- und Parteiführung sowie der Einfluß der sowjetischen "Tschekisten". Der historische Bogen spannt sich vom deutsch-deutschen "kalten Bürgerkrieg" der Gründerjahre über den Aufstieg zur unantastbaren Sicherheitselite bis hin zur Entmachtung im Herbst 1989. Mit präzisen Fallstudien und anschaulichen Milieubildern gelingt dem Autor eine Geschichte der Staatssicherheit "von innen".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1224
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Analysen und Dokumente
Wissenschaftliche Reihe des BStU
Band 20
Analysen und Dokumente
Wissenschaftliche Reihe
des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik
Herausgegeben von der Abteilung Bildung und Forschung
Redaktion:
Siegfried Suckut, Ehrhart Neubert, Walter Süß, Roger Engelmann, Jens Gieseke
Jens Gieseke
Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit
Personalstruktur und Lebenswelt 1950–1989/90
Ch. Links Verlag, Berlin
Die Meinungen, die in dieser Publikationsreihe geäußert werden, geben ausschließlich die Auffassungen der Autoren wieder.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Gieseke, Jens :
Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit:
Personalstruktur und Lebenswelt 1950–1989/90 /
Jens Gieseke. – 1. Aufl. Berlin : Links, 2000
Zugleich Diss. Universität Potsdam
(Analysen und Dokumente; Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik; Bd. 20)
Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin
www.christoph-links-verlag.de
Entspricht der 1. Druckauflage von 2000, erschienen im Christoph Links Verlag – LinksDruck GmbH
Umschlaggestaltung: KahaneDesign, Berlin, unter Verwendung eines Fotos aus dem
BStU-Archiv: Der Minister für Staatssicherheit, Armeegeneral Erich Mielke, ernennt am 3.10.1983 auf Beschluß des Nationalen Verteidigungsrates zum
Generalmajor (v.l.n.r.): den Leiter der Hauptabteilung Kader und Schulung, Dr. jur. Günter Möller, den stellvertretenden Leiter der Hauptabteilung I, Manfred Dietel, den 1. stellvertretenden Leiter der Arbeitsgruppe des Ministers, Erich Rümmler, und den Leiter der Bezirksverwaltung Erfurt, Dr. jur. Josef Schwarz.
ISBN 978-3-86153-227-1
eISBN 978-3-86284-532-3
Inhalt
Vorwort
I. Einleitung: Das Personal der Staatssicherheit – Konturen eines Problemfeldes
1. Öffentliches Interesse und historische Aufarbeitung
2. Herrschaftsgeschichte als Gesellschaftsgeschichte – konzeptionelle Angebote
Totalitarismustheorien
NS-Forschung
Stalinismusforschung und Sowjetologie
Sozialgeschichte der DDR
3. Zu den Untersuchungsebenen
Entwicklung des Personalbestandes
Kaderpolitik und Personalstruktur
Die Staatssicherheit als Lebenswelt
4. Forschungsstand und Quellenlage
II. Vom NKWD zur Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft 1945 bis 1950
1. Der Aufbau geheimpolizeilicher und geheimdienstlicher Strukturen in der SBZ/DDR
Sowjetische Sicherheitsorgane
Anfänge einer deutschen politischen Polizei 1945 bis 1947
K 5 – der politische Zweig der Kriminalpolizei
Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft
Weitere polizeistaatliche Strukturen in der SBZ
2. Auf dem Wege zur „Volks“polizei? Zu Kaderpolitik und Personalstruktur
Kaderpolitik in der Polizei
Die Mitarbeiter der K 5
III. Bildung und Aufbau der Staatssicherheit als stalinistische Geheimpolizei 1950 bis 1953
1. Personalentwicklung
Aufgaben des MfS
Personeller Aufbau
„Verschärfung des Klassenkampfs“ und Abschluß der Aufbauphase 1952/53
2. Kaderpolitik und Personalstruktur
Akteure und Rahmenbedingungen
Die Gründer der Staatssicherheit – ein kollektives Porträt
Anfänge der Kaderwerbung
Bilanz des Aufbaus: personelle Strukturen 1953
3. Innere Verfassung
Tschekismus als Avantgardekonzeption
Zur Aneignung des tschekistischen Selbstverständnisses
Mentalität und Herrschaftsalltag
Die MfS-Mitarbeiter in der Junikrise
IV. Zwischen Junischock und Entstalinisierung 1953 bis 1957
1. Personalentwicklung
Kursbestimmung nach dem 17. Juni
Wollwebers Moratorium und Entstalinisierung
Die paramilitärische Komponente: Wacheinheiten und „Innere Truppen“
2. Kaderpolitik und Personalstruktur
Die erste Kaderrichtlinie
Prioritäten der Rekrutierung
Qualifikation und Schulung
3. Innere Verfassung
Konsequenzen der Junikrise?
Tschekismus zwischen Kampfgeist, Willkür und „Verrat“
Die Entstalinisierungsdebatte als innere Krise
V. Transformation zur modernisierten Repressionsbürokratie 1958 bis 1967
1. Personalentwicklung
Neue Weichenstellungen nach dem Ministerwechsel
Revitalisierung im Poststalinismus
Nach dem Mauerbau: Abwehr der Statuskritik und „Take-off“
Schwerpunkte des Wachstums: Diversifizierung und Bürokratisierung
2. Kaderpolitik und Personalstruktur
Systematisierung und Straffung der Kaderpolitik
Bildungsoffensive und Professionalisierung
„Partielle Modernisierung“ in der Generationenstruktur
Das Frauenkommuniqué 1961 und die Geschlechterfrage
Sozialstruktur und Bilanz
3. Innere Verfassung
Disziplinierung: Auf dem Wege zur totalen Institution
Gewalt im Poststalinismus
Umrisse des elitären Sicherheitsmilieus
VI. Expansion in der Entspannung 1968 bis 1982
1. Personalentwicklung
Institutioneller Aufstieg im Zuge des Machtwechsels Ulbricht/Honecker
Entspannung als „verschärfter Klassenkampf“
Viele Gewinner und keine Verlierer: die Diensteinheiten in der Expansion
2. Kaderpolitik und Personalstruktur
Rekrutierung im „entwickelten Sozialismus“
Der MfS-Nachwuchs 1968 bis 1982 im soziopolitischen Profil
Die zweite Etappe der nachholenden Akademisierung
Abschiede und Aufstiege in der Expansion
3. Innere Verfassung
Homogenisierung der tschekistischen Lebenswelt
Entspannung und Feindbild
„Real existierender“ Tschekismus
Der Fall Stiller
VII. Auf dem Weg in die Finalitätskrise 1983 bis 1989
1. Personalentwicklung
Das Schreiben 2/83: Ende des Expansionismus
Sparzwang und „Aufgabenzuwachs“
Binnenstrukturen
2. Kaderpolitik und Personalstruktur
Rekrutierungstechniken und die Grenzen des Potentials
Das MfS-Milieu im Sozialprofil
Aus- und Weiterbildung: eine Reform und ein Trick
Das Ende interner Mobilität
3. Innere Verfassung
Konformität und Legitimitätsverfall
Atmosphärischer Wandel im Mikroraum
Radikalisierung und „operative Frustration“
„Neues Denken“ – ideologischer Raumgewinn und Feindbildverlust
Das MfS als Reformpotential?
VIII. Das Ende des MfS 1989/1990
1. Revolution und Entmachtung
Am Vorabend
Die Staatssicherheit in der Revolution
Das Amt für Nationale Sicherheit
Verfassungsschutz – Nachrichtendienst – Auflösung
2. Innenansichten des Zusammenbruchs
Zwischen Gewaltbereitschaft und Zweifeln
Verordnetes Stillhalten und Entsolidarisierung in der Dienstklasse
Endzeitstimmung
Nach den Besetzungen
Individuelle und kollektive Überlebensstrategien
IX. Resümee: Wer war die Staatssicherheit?
1. Die sicherste DDR der Welt
2. Das Profil einer sozialistischen Repressionselite
3. Das tschekistische Milieu
X. Statistiken
1. Personalentwicklung 1949 bis 1989
2. MfS-Etat 1954 bis 1990
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Quellen- und Literaturverzeichnis
Personenregister
Sachregister
Angaben zum Autor
Vorwort
Wer sich im Westen mit dem „realen Sozialismus“ zu seinen Lebzeiten zu beschäftigen begann, stieß unweigerlich früher oder später auf die Vertreter der „Firma“. In meiner Generation gaben den Anlaß Biermann, Fuchs, Bahro, die Freunde, die sich die „Schwerter zu Pflugscharen“ von der Jacke schneiden mußten, der Pastor, dem seine Mitarbeiterin die Anwerbung beichtete, das Woher und Wohin und die gefilzten Taschen an der Grenze, die freundlich-bedrohliche Anfrage beim Gastgeber, ob man nicht mal ein Gespräch mit dem Besucher aus dem Westen … Solche Begebenheiten lösten vor vielen Jahren mein „vorwissenschaftliches Interesse“ am hauptamtlichen Personal der Staatssicherheit aus – ohne daß sich damals viel mehr erfahren ließ, als bei Fricke oder Stiller nachzulesen war. Nach der Zeitenwende führte mich die Idee zu diesem Projekt zur Abteilung Bildung und Forschung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Der Bundesbeauftragte Joachim Gauck hat mich selbst mehrmals ermuntert, meine (wie er sie sah) „nüchterne und dröge“ Forschung weiterzutreiben und mich durch den Ruf nach stärker nachgefragten Gegenständen nicht irritieren zu lassen. In den frühen Jahren (und manchen späteren Zeiten), als die Meldungen der Tagespresse den Takt der Stasidebatte vorgaben, war mir dies eine Stütze, auf die ich ungern verzichtet hätte.
Die Universität Potsdam hat das vorliegende Produkt meiner Studien als Dissertation angenommen. Ganz besonders danke ich meinem Doktorvater Prof. Dr. Christoph Kleßmann, der die Forschungen seit den ersten Überlegungen begleitet hat, und dem Zweitgutachter Prof. Dr. Klaus-Dietmar Henke, der 1993 als Abteilungsleiter beim Bundesbeauftragten den Weg für dieses Projekt frei machte. Den Diskussionen mit ihnen verdanke ich viele Anregungen; ihre Gutachten gaben mir hilfreiche Ratschläge für die Druckfassung. In diesen Dank schließe ich Prof. Dr. Hans-Heinrich Nolte (Universität Hannover) sehr herzlich ein, bei dem ich das wertvolle Handwerkszeug des Historikerberufs erlernte.
Meinen vom Aktenstudium verengten Horizont immer wieder erweitert haben die Abende im Forschungskolloquium zur Neueren Geschichte und Zeitgeschichte an der Universität Potsdam, geleitet von Professor Kleßmann und Prof. Dr. Manfred Görtemaker, dem ich ebenfalls wertvolle Anregungen verdanke. Zu meinem großen Nutzen über die Jahre mit mir diskutiert und Texte kommentiert haben neben anderen Stephan Fingerle, Peter Helmberger, Helmut Müller-Enbergs, Marie Räkel, Herbert Reinke, Michael C. Schneider, Silke Schumann, Agnes Tandler, Tobias Wunschik und bis zu seinem Tod Martin Bott. Für ihre Kritik und ihren Zuspruch sei ihnen gedankt. Zutiefst verpflichtet bin ich auch Siegfried Suckut, Walter Süß und Roger Engelmann, die mich von Zeit zu Zeit ermuntert haben, zum Ende zu kommen. Sie haben das Manuskript „von Amts wegen“ ganz gelesen und mir unzählige Verbesserungen vorgeschlagen, von denen ich die meisten übernommen habe – vor allem aber haben sie im Gehäuse einer Behörde den intellektuellen Raum geschaffen und verteidigt, in dem Forschungen wie diese erst gedeihen können. Den Text habe ich selbstredend allein zu verantworten.
Für engagierte Hilfe bei der Materialsuche habe ich den Kolleginnen und Kollegen in den Archiven des Bundesbeauftragten zu danken, allen voran Frau Schuldt, Frau Wenderholm, Frau Puhlmann, sowie dem „Karteifuchs“ Herrn Bessel. Auch im Bundesarchiv und im Militärischen Zwischenarchiv, damals beide in Potsdam, und der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen im Bundesarchiv in Berlin fand ich alle erdenkliche Hilfe. Daß sich diese Arbeit nicht nur auf Akten stützt, bekamen oft genug die Mitarbeiterinnen der Bibliothek des Bundesbeauftragten zu spüren, von deren Tatkraft das Literaturverzeichnis zeugt. Schließlich profitierte die Arbeit von Interviews, Diskussionen und Briefwechseln mit ehemaligen hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS, die Auskünfte gaben und sich der Selbstreflexion stellten. Dafür sei auch ihnen gedankt.
Den Text korrigiert und für den Druck vorbereitet haben das Publikationsteam der Abteilung Bildung und Forschung, vor allem Anke Eidner, die die Zahlen nachrechnete und die letzten Tage managte, Sabine Käding und Christiane Neumicke, die die Computer im Griff behielten, sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ch. Links Verlages. Sie alle hier dankend zu erwähnen verbinde ich mit einem schmerzlichen Abschiedsgruß an unseren Verleger Christoph Links. Er beendet mit diesem Band die Zusammenarbeit mit uns, weil ihm Zumutungen nicht erspart geblieben sind.
Zu guter Letzt danke ich Ulrike, Rasma und Tjark Knigge, daß sie die vergangenen Jahre mit mir ausgehalten haben. Meinen Eltern Klaus und Hildegard Gieseke, die mich unterstützten, die zuweilen brotlos erscheinende Kunst des Historikers zu erlernen, widme ich dieses Buch.
Berlin, im Mai 2000 Jens Gieseke
I. Einleitung: Das Personal der Staatssicherheit – Konturen eines Problemfeldes
1. Öffentliches Interesse und historische Aufarbeitung
Als in den Herbsttagen des Jahres 1989 der Ruf „Stasi in die Produktion“ durch die Straßen von Leipzig, Erfurt und vielen anderen Orten der DDR schallte, standen die hauptamtlichen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) für den Moloch der allseits präsenten, doch immer den Schutz des Dunklen suchenden Überwachungsbürokratie, errichtet und unterhalten auf Kosten derjenigen, die sie zu schützen vorgab. Sie galten als Gefahr, und ihnen die Macht zu nehmen war deshalb einer der wichtigsten Schritte zur Befreiung von der Diktatur. Bürger besetzten die Betonburgen des staatssozialistischen „Schutz- und Sicherungsorgans“ und spülten das Heer der Geheimpolizisten von der historischen Bühne – ein Akt des Wagemuts, der in seiner scheinbaren Leichtigkeit noch heute in Erstaunen versetzt.
Als die größte Gefahr gebannt, der Apparat ausgeschaltet und die Mitarbeiter entwaffnet waren, wandte sich das öffentliche Interesse bald von den MfS-Hauptamtlichen ab. Es verlagerte sich auf die Zuträger, Spitzel und Einflußagenten der Staatssicherheit, die „inoffiziellen Mitarbeiter“ – ihr Dienstkürzel „IM“ sollte alsbald zum Inbegriff aller Aufarbeitung der SED-Diktatur werden. Zu dieser Verschiebung des Blicks hatten ehemalige MfS-Hauptamtliche das Ihre beigetragen: Als erstes traf es im Vorfeld der Wahlen im März 1990 den Spitzenkandidaten der „Allianz für Deutschland“, Wolfgang Schnur, dessen Fall eine gezielte Indiskretion aus Kreisen der hauptamtlichen MfS-Mitarbeiter vorausging.1 In der Tat mußten die IM weitaus gefährlicher erscheinen, denn sie tummelten sich (wie weitere Fälle zeigten) zuweilen kräftig im erwachenden öffentlichen Leben. Sie aufzuspüren erschien als moralisch geboten und politisch notwendig, um die junge Demokratie vor verdeckten Manipulationen durch die Kräfte der alten Ordnung zu schützen. Von den hauptamtlichen Mitarbeitern erregten in den folgenden Monaten vorwiegend die „Offiziere im besonderen Einsatz“ (OibE) die Gemüter. Diese Offiziere kombinierten den hauptamtlichen Status mit den Aufgaben und der Tarnung des inoffiziellen Mitarbeiters und erweckten deshalb den Eindruck einer besonders gefährlichen Elitetruppe des MfS. Sie standen im öffentlichen Bewußtsein für den vermuteten Willen der Staatssicherheit, sich im Untergrund zu reorganisieren – eine Sorge, die sich als unbegründet erwies.2
Was schließlich blieb, waren gegensätzliche Eindrücke: Verkörperte die Staatssicherheit die „Intelligenz“ des staatssozialistischen Systems, während die Parteiführung mit „Blindheit“ geschlagen war, wie der Dramatiker Heiner Müller (aus persönlicher Anschauung) meinte?3 Oder war sie ein „unkultivierter, kleinkarierter Laden“ von „zahllose[n] Ignoranten“, der es „unter soziologischen Gesichtspunkten […] interessant“ erscheinen ließe, „ob das DDR-System nicht unter anderem wegen der Blödheit der Stasi zusammengekracht“ ist, wie der langjährige Rowohlt-Lektor Michael Naumann nach der Lektüre der Akten über ihn und seinen Verlag urteilte.4 Wer waren diese Exekutoren der Diktatur, die dem Lyriker Adolf Endler bei Lichte betrachtet als „sportive Herren im volkseigenen Trainingsanzug, vom diabolischen Glanz mittlerer Postangestellter“5 erschienen, und die sich selbst einen „arteigenen Geruch, so eine Mischung aus Waffenöl, Bohnerwachs und Schweiß“6 zuschrieben?
Um diese Fragen einer Antwort näher zu bringen, lenkt die vorliegende Arbeit den Blick erneut auf den hauptamtlichen Apparat des MfS. Dieses Buch handelt deshalb nicht, jedenfalls nicht in erster Linie, von dem, was die Staatssicherheit in vierzig Jahren getan hat, sondern von den historischen Akteuren dieses „erschreckendsten und zugleich groteskesten Teils des SED-Herrschaftssystems“7selbst. Es soll Auskunft darüber geben, woher diese Träger des Staatssozialismus kamen und wie sie zur Staatssicherheit fanden, über welchen sozialen, weltanschaulichen und intellektuellen Horizont sie verfügten und welche Atmosphäre in ihren Reihen herrschte. Soziologisch gesprochen zielt diese Arbeit darauf, gesellschaftliche Voraussetzungen und biographische Bedingungen, individuelle und kollektive Handlungsräume und Grenzen zu rekonstruieren, die die kommunistische Diktatur über vierzig Jahre möglich machten – und schließlich zum Unvermögen beitrugen, sie vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Die hier betriebene Form historischer Aufarbeitung ergänzt die vielfältigen Bemühungen, sich ein Bild von den Methoden und den Wirkungen der Staatssicherheit zu verschaffen, und versucht zugleich den Schritt über die Empörung hinaus, die sich bei den damit verbundenen Entdeckungen unweigerlich immer wieder einstellt. Martin Broszat hat ein solches Erkenntnisinteresse in bezug auf den Nationalsozialismus als „Historisierung“ bezeichnet –„einer recht verstandenen historischen Aneignung dieser Zeit, die kritisches und verstehendes Vermögen verbindet“.8 Er argumentierte:
„Historisierung […] bedeutet aber gerade auch, daß die während des Dritten Reiches entfesselte Gewaltsamkeit nicht nur einem bestimmten politisch-ideologischen System zugeordnet wird, das wie eine Art omnipotenter Fremdherrschaft die autonomen Kräfte und Normen der Gesellschaft gänzlich niedergedrückt habe. Sie zwingt vielmehr dazu, die Verankerung von Gewaltpotentialen auch in der Gesellschaft selbst aufzudecken und die durch diese Potentiale bedingten desperaten Veränderungswünsche, die glaubten, sich nur mit Gewalt auf Kosten anderer Gruppen und mystifizierter Feinde Durchbruch schaffen zu können.“9
Zwar war der Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft zweifellos breiter „verankert“ als der Staatssozialismus und mobilisierte ungleich verheerendere Gewalt, doch ist der Zusammenhang von diktatorischer Herrschaft und deren politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen damit mutatis mutandis auch für die DDR-Geschichte umrissen. Es geht dabei um eine Aneignung der Geschichte in ihrer Komplexität, die im Ergebnis zu einem „politischeren“ und auch „beängstigenderen Diktaturbild“10 führen kann. Dieser Ansatz ist also keineswegs politisch-moralisch indifferent; Konrad Jarausch spricht deshalb von einer „kritischen Historisierung“:
„Auch wenn eine solche Historisierung verstehen statt verdammen will, bedeutet diese Distanzierung nicht, einen Schlußstrich unter die Aufarbeitung zu ziehen und alle Vergehen zu verzeihen. Denn sie verlangt gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit den vielen Verbrechen, um die Wiederkehr linker wie rechter Diktaturen in der Zukunft zu vermeiden.“11
Eine so verstandene Aneignung des Geschehenen wird in vollem Umfange noch nicht erreichbar sein, solange daraus resultierende, höchst gegenwärtige politische Konflikte, die Erinnerungspolitik der Zeitzeugen (zu denen in diesem Falle auch die Historiker zählen) sowie die um Distanz bemühte Analyse ineinander verschränkt sind. Doch als Perspektive ist sie notwendiges Element der „Geschichtswerdung“12 der DDR in der kontroversen öffentlichen Debatte. Die politische Entscheidung für eine weitgehende Öffnung der Archive, nicht zuletzt der des Ministeriums für Staatssicherheit, hat dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen.
Ein solches Unternehmen läßt sich methodisch „sauber“ nicht ohne einige theoretische Erwägungen auf den Weg bringen; auch der bereits erreichte Forschungsstand und die Quellensituation verdienen vorab Beachtung. Davon handeln die folgenden Abschnitte der Einleitung. Dem stärker am historischkonkreten interessierten Leser sei empfohlen, sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern sogleich zum Kapitel II zu blättern.
2. Herrschaftsgeschichte als Gesellschaftsgeschichte – konzeptionelle Angebote
Totalitarismustheorien
Wer sich mit der Geheimpolizei einer kommunistischen Diktatur und noch dazu mit deren Kaderpolitik beschäftigt, scheint gleichsam von selbst auf den Pfaden der Totalitarismustheorie zu wandeln. Bei Carl Friedrich und Zbigniew Brzezinski zählt die Geheimpolizei als Verfolgungsinstrument gegen „Volksfeinde“ zu den konstitutiven Säulen der totalitären Diktatur, ebenso der personelle Unterbau eines als Partei organisierten Apparates.13 Zuweilen nimmt die Einstufung des DDR-Sozialismus als „totalitär“ sogar über den Status einer diskutierbaren analytischen Kategorisierung hinaus die „nahezu kanonische Geltung“14 einer gleichsam objektiven Wahrheit an, die man nur aussprechen oder verschweigen könne.15
In der Tat drängt sich die Charakterisierung der DDR-Staatssicherheit als Instrument totalitärer Herrschaft förmlich auf. Wäre der Begriff des Totalitären nicht bereits in der Debatte gewesen, dann hätte ihn jeder Analytiker, der die geistige Welt des Erich Mielke untersuchen wollte, erfinden müssen. Insofern ist der Totalitarismusansatz ein wichtiges Mittel, um sich die innere Logik verständlich zu machen, auf der die DDR-Staatssicherheit gründete, deren Gemeinsamkeiten mit anderen „weltanschaulichen Exekutivapparaten“ herauszustellen und die zerstörerischen und selbstzerstörerischen Potentiale dieser Logik zu bestimmen.16 Er markiert einen Idealtypus des kommunistischen Politikmodells, in dem wichtige Funktionsprinzipien analytisch „rein“ herauspräpariert sind. Außerdem ist er als Herrschaftsformenlehre ein wichtiges Instrument, um dem Inhalt ihrer Ideologien nach unterschiedliche, ja gegensätzliche Systeme zu vergleichen.
Dem stehen jedoch Schwächen und Grenzen gegenüber.17 Dem breit angelegten Erklärungsanspruch liegen schon bei den Klassikern, wie den zitierten Friedrich und Brzezinski, Hannah Arendt und anderen, höchst unterschiedliche Basistheoreme zugrunde. Und in der Forschungspraxis erfolgen – je nach konkretem Forschungsgegenstand – erhebliche Umgewichtungen und Umdefinitionen der zentralen Kriterien, um der Theorie jene Flexibilität zu verleihen, die notwendig ist, um über die totalitaristischen Referenzsysteme des deutschen Nationalsozialismus und des sowjetischen Stalinismus hinaus zum Beispiel die DDR der achtziger Jahre als totalitär einzustufen.18 Als politologisches Modell von eigentümlicher Statik bietet es dem Forscher kaum Handhabe, historischen Wandel zu erklären – ein Problem, das sich im Zusammenhang mit dem Systemzusammenbruch des SED-Staates und der Rolle der Staatssicherheit darin massiv stellt19, aber auch für mittel- und langfristige Prozesse von Bedeutung ist. Der Systemwandel ließe sich unter diesen Vorzeichen allenfalls als Annähern an den bzw. Entfernen vom totalitären Idealtypus beschreiben, verbunden mit besagter Um- oder Neudefinition der jeweils ausschlaggebenden Merkmale, ohne jedoch selbst operationalisierbare Analyseinstrumente bereitzuhalten.20 Auf den Gegenstand dieser Untersuchung bezogen heißt das: Geheimpolizeiliche Repression und Überwachung sowie die im Nomenklatursystem verdichtete Kaderpolitik lassen sich zwar auf der normativen Ebene als totalitäre Merkmale deuten, ohne daß sich jedoch damit der Wandel in diesen Bereichen von Staat und Gesellschaft analysieren ließe.21 Erst der Blick über die totalitäre Ideologie hinaus macht es möglich zu erkennen, warum sie als Handlungsantrieb der MfS-Offiziere gewissermaßen lebendig wurde. Zu klären ist dann, in welcher Art und Weise sie in deren Tätigkeit für sie „Sinn“ machte, das heißt welche Elemente des Ideologiegebäudes für sie praktisch im Vordergrund standen und welche anderen, nicht-ideologischen Antriebe für ihr Handeln von Belang waren.
NS-Forschung
Bieten Totalitarismustheorien also nur Handhabe für Ausschnitte der hier untersuchten Fragen, so liegen auf der Ebene von Theorien und Methoden mittlerer Reichweite umfangreiche Erfahrungen zum Verhältnis von Herrschaft und Gesellschaft in der Diktatur vor, besonders aus der Erforschung des Nationalsozialismus.22 Bereits die Untersuchungen Hans Buchheims über Struktur und Mentalität der SS im Zusammenhang mit dem „Auschwitz-Prozeß“ 1964 lieferten grundlegende Erkenntnisse.23 Für die hier verfolgten Interessen von Bedeutung sind zudem neuere Studien, die die Gründe für den „Zivilisationsbruch“ des Holocausts erkunden anhand biographischer Untersuchungen zu den Erfahrungs- und Handlungshorizonten der NS-Führungseliten sowie jener „ganz normalen Männer“, die ihn unmittelbar persönlich exekutierten. Im Zentrum standen Studien zu sozialen und generationellen Hintergründen, mentalen Prägungen sowie institutionellen Kontexten, zum Beispiel zu den SD-Einsatzgruppen oder dem Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes und seinen prominentesten Vordenkern.24 Auch die „Entzivilisierung“ der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) durch die exzessiv genutzte Tötungsgewalt ist untersucht worden.25 Zugleich ist seit einiger Zeit das Interesse für die gesellschaftliche Basis der Gestapo-Verfolgung erwacht, wie sie sich etwa in Denunziationen aus der Bevölkerung zeigte26 – ein Thema, das ebenfalls zu Vergleichen mit der MfS-Tätigkeit anregt, hier aber nicht weiter verfolgt werden kann.27 Zwar hat die NS-Forschung mit einer erheblich schlechteren Materiallage zu kämpfen, so daß einige Elementarinformationen (wie zum Beispiel der quantitative Umfang des Gestapo-Personals) noch mühsam rekonstruiert werden müssen28, doch sind hier wertvolle methodologische Erfahrungen verarbeitet.
Zweitens laden diese Studien zum Vergleich der empirischen Befunde ein, zum Beispiel hinsichtlich der Apparatstruktur, der Funktion im Herrschaftssystem und der Wirkungen und Folgen. Drittens schließlich lassen sich schon auf den ersten Blick biographische Parallelen unter den prägenden Figuren erkennen, wenn man etwa die Lebensläufe von Reinhard Heydrich (Jahrgang 1904) oder Werner Best (Jahrgang 1903) einerseits, Erich Mielke (Jahrgang 1907) andererseits in Beziehung setzt. Hier offenbart sich der Erfahrungshorizont historischer Akteure im „Jahrhundert der Extreme“ (Hobsbawm29), die aus unterschiedlichen sozialen Klassen kamen und politisch entgegengesetzte Lebenswege einschlugen, denen jedoch die „gewaltsame Vergesellschaftung […] im Krieg“ gemeinsam war, „die Übertragung körperlicher Gewalterfahrung in gesellschaftliche Energie und politische Phantasie, die Selbst-Traumatisierung durch extreme Zerstörungsgewalt“.30
Stalinismusforschung und Sowjetologie
Impulse für die hier ins Auge gefaßte Fragestellung gehen auch von der neueren sowjetologischen Forschung zum Stalinismus der dreißiger Jahre aus. Die dort ursprünglich (in den fünfziger und sechziger Jahren) dominanten totalitaristischen Erklärungsmuster sind mittlerweile erheblich durch „revisionistische“ Interpretationen und einen zweiten Schub von – nun auf breiter Front archivgestützter – Forschung in Frage gestellt worden.31 Je intensiver die Forschung, desto deutlicher tritt das komplexe Geflecht von terroristischen Impulsen der „Revolution von oben“, massiven gesellschaftlichen Modernisierungsdefiziten, ethnisch-kulturellen Konflikten sowie der Eigendynamik revolutionärer Mobilisierung zutage. Während diese gesellschaftsgeschichtliche Perspektive auch hier zu neuen Ansätzen etwa in der Denunziationsforschung sowie der Analyse der Opfergruppen geführt hat,32 ist das geheimpolizeiliche Personal noch kaum untersucht.33
Für das hier verfolgte Interesse besonders wichtig ist die Generation der wydwischenzy, der von Stalin geförderten Aufsteiger der zwanziger Jahre, die nicht zuletzt die Reihen der marodierenden Geheimpolizei füllten und sich in dieser Rolle in Terrorexzessen bis hin zu „sozialistischen Verhaftungswettbewerben“ ergingen.34 Erste Erkundungen anhand der Biographien von mehreren hundert führenden Funktionären des Volkskommissariats des Innern (NKWD) der Jahre 1934 bis 1941 zeigen, daß mit den Wechseln an der Spitze, von Jagoda zu Jeschow, von Jeschow zu Berija, jeweils massive Umbesetzungen verbunden waren. Vor dem Großen Terror rekrutierten sich die Führungskader vornehmlich aus der Generation der über 40jährigen, die aus bürgerlichen Verhältnissen kamen und schon zu Zeiten Dzierzynskis in den Apparat gekommen waren. Fast 40 Prozent waren Juden und rund 30 Prozent hatten vor 1917 anderen Parteien angehört (vorwiegend linke Sozialrevolutionäre, Anarchisten, Menschewiki und Bundler). Es folgte ein blutiger Generationswechsel: 1939 waren die leitenden Positionen mehrheitlich mit 30- bis 35jährigen besetzt, zu 80 Prozent mit ehemaligen Arbeitern oder Bauern, zu 75 Prozent mit Kadern, die erst nach 1925 in den Apparat gekommen waren. Von den Juden waren nur noch 4 Prozent verblieben, Polen, Deutsche und Letten ausnahmslos verhaftet und erschossen. Es dominierten nun Russen und Ukrainer. Hatte in der Führungsetage der Tschekisten also zunächst eine gewisse nachrevolutionäre Vielfalt geherrscht, so fand sie 1937 bis 1939 ihr Ende: 241 von 322 Funktionären ließ die Führung verhaften und fast alle erschießen. Von den insgesamt rund 25.000 sowjetischen Tschekisten (1937) sind etwa zehn Prozent verhaftet worden. Nach der Entlassung Jeschows folgte dann 1939 eine zweite Welle: 7 372 Tschekisten mußten den Dienst quittieren, 973 wurden verhaftet – und zwar vornehmlich Vollstrecker des Massenterrors selbst.35 Diese Daten werfen derzeit mehr Fragen auf als sie beantworten, doch skizzieren sie bereits das personelle Profil genau jener Generation von Offizieren, die in den vierziger und fünfziger Jahren ihre Erfahrungen und ihr Selbstverständnis als Instrukteure und Berater in die Sicherheitsapparate der SBZ/DDR „exportierten“.
Die Rolle des Komitees für Staatssicherheit (KGB) in der poststalinistischen Sowjetgesellschaft stellt ebenfalls einen wichtigen Fluchtpunkt des hier verfolgten Ansatzes dar, harrt jedoch der näheren Forschung, die trotz einiger Dokumentenveröffentlichungen sowie den Memoiren von Generälen und Offizieren durch die noch immer dürftige Materiallage behindert ist.36 Aussagen zur gesellschaftlichen Rolle des KGB-Apparates und seiner Mitarbeiter bewegen sich mithin überwiegend im Reich mehr oder minder begründeter Spekulation. Am weitesten reichen die Analysen Amy Knights anhand veröffentlichter biographischer Daten über leitende KGB-Offiziere der Zentrale sowie der Unionsrepubliken. Sie lassen erkennen, daß der KGB – nach einem Zustrom externer Kräfte in den fünfziger Jahren – starke Züge einer institutionell homogenen „closed profession“ annahm, die starken Korpsgeist entwickelte und im politischen Entscheidungsprozeß an Bedeutung gewann.37 Knight bestätigt damit Überlegungen, die den KGB als interessengeleitete „soziale Kraft“ interpretieren und daraus seine Bedeutung und Rolle in den verschiedenen Etappen der sowjetischen Geschichte zu bestimmen versuchen – unter den Reformversuchen Chruschtschows, in der „Stagnationsperiode“ der Ära Breschnew sowie im Zeichen der schließlich vom vormaligen KGB-Chef Andropow vorbereiteten und unter Gorbatschow vom Systemwandel zum Systemwechsel eskalierenden Politik der Perestroika. Diese ersten Erkundungen legen nahe, daß der KGB eine ähnliche Rolle spielte wie der (weitaus besser erforschte) „militärisch-industrielle Komplex“.38
Die Sowjetunion stellt nicht nur einen wichtigen Fluchtpunkt dar, weil sie vergleichbare methodische Vorgehensweisen nahelegt, sondern auch, weil sie die Referenzgesellschaft für die Vorstellungen der SED-Führung war und in vielen Punkten das praktische Vorbild lieferte. Dort lag der Ursprung für wesentliche Elemente der Ideologie, der institutionellen Struktur und der sozialen Prozesse, die die DDR und ganz besonders die Staatssicherheit und ihr Personal in den Aufbaujahren prägten. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Begriff des „Stalinismus“. Hierunter wird im folgenden eine Weltanschauung und ein daraus resultierendes politisches Programm verstanden, die ihre Grundlagen in Theorie und Praxis des sowjetischen Herrschaftssystems seit etwa Mitte der zwanziger Jahre bis zum Tode Stalins 1953 hatten. Sie beruhten auf der von Stalin entwickelten Theorie vom „Aufbau des Sozialismus in einem Lande“ unter den Bedingungen der kapitalistischen Umkreisung, mit der er von der „internationalistischen“ Hoffnung auf ein alsbaldiges Überspringen des revolutionären Funkens auf das kapitalistische Zentrum Abstand nahm und den Aufbau eines starken Staats- und Sicherheitsapparates als Organ der „Diktatur des Proletariats“ unter den Vorzeichen der angeblich gesetzmäßigen „Verschärfung des Klassenkampfes beim Aufbau des Sozialismus“ legitimierte. Die sozialistische Theorie dogmatisierte und katechetisierte er zur Mobilisierungs- und Herrschaftsideologie des „Marxismus-Leninismus“. Damit verband sich eine forcierte, zentralistisch gesteuerte Industrialisierung und die Kollektivierung der Landwirtschaft unter Einsatz exzessiven staatlichen Terrors, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen. Des weiteren zentralisierte und monopolisierte er als Führer („woschd“) von Partei und Staat Politik und Ideologie noch über das bereits unter Lenin erreichte Maß hinaus, beseitigte jeden Spielraum innerparteilicher Diskussion und veranlaßte periodische Säuberungen in den verschiedenen Apparaten, in deren Zuge er unter anderem mit wenigen Ausnahmen seine Kampfgefährten von 1917, fast die gesamte militärische Führung und, wie erwähnt, zahllose Angehörige der Verfolgungsapparate selbst ermorden ließ.39
Die Sowjetgesellschaft nach Stalin – und auch die anderen Staaten des „sozialistischen Lagers“ – waren von zweierlei geprägt: Die Partei nahm den Terror als allgegenwärtiges Instrument der Gesellschaftspolitik zurück, ließ aber wesentliche Institutionen dieser gewaltsamen sozialen Umwälzung bestehen: ihr nicht demokratisch legitimiertes Machtmonopol selbst, die zentralistische Planökonomie, den exorbitanten inneren und äußeren Sicherheitsapparat und anderes. Trotz des Abbaus der terroristischen Elemente und den Bemühungen, zu einem anderen Modus der Machtlegitimation in den sozialen Beziehungen zu gelangen, blieben also Kernelemente des stalinistischen Politikkonzepts erhalten, das deshalb als „poststalinistisch“ charakterisiert werden kann. Für die DDR-Staatssicherheit war das stalinistische Programm der Diktatur des Proletariats als „Revolution von oben“ der Kern ihrer ideologischen Legitimation. Erich Mielke machte zumindest intern auch keinen Hehl daraus, daß er selbst von tiefer Bewunderung für Stalin erfüllt war und dessen Anschauungen den Fluchtpunkt seiner geistigen Welt darstellten.
Neben dem Begriffspaar „Stalinismus“ und „Poststalinismus“ zur inhaltlichen Charakterisierung von Rolle und Funktion der Staatssicherheit wird im folgenden der mittlerweile recht gängige Begriff des „Staatssozialismus“ verwendet. Dieser Begriff ist durchaus nicht unproblematisch, weil er den Staat in den Mittelpunkt stellt, der doch aber wiederum ein „Parteistaat“ war, also nur „Hülle“ der monopolistischen Herrschaft der Kommunistischen Partei.40 Wenn der Begriff hier verwendet wird, dann also in diesem eher umschreibenden als definitorischen Sinne. Er dient unter anderem zur Unterscheidung von anderen Formen, die die sozialistische Arbeiterbewegung als historische Kraft angenommen hat. Wie etwa auch die Bezeichnung „Systeme sowjetischen Typs“ umgeht der Begriff die inhaltliche Charakterisierung der Basisprinzipien dieser historischen Formation, die bislang nicht abschließend geklärt sind.41
Sozialgeschichte der DDR
In der Erkundung der DDR-Geschichte hat sich im Kontext vergleichender Diktaturforschung ein gesellschaftshistorischer Zugriff als fruchtbar erwiesen. Die Politikgeschichte, wie sie bis 1989 dominant war, wurde durch sozial-, erfahrungs- und mentalitätshistorische Perspektiven ergänzt und der Widerstreit von totalitärem Gestaltungsanspruch und gesellschaftlicher Realität in das Zentrum der Analyse gestellt. Dabei geht es vor allem darum, die Möglichkeiten und Grenzen der SED-Herrschaft, ihre sozialen Voraussetzungen und beabsichtigten wie unbeabsichtigten Folgen in den Blick zu nehmen. Gegenstand solcher Forschungen waren zunächst eher herrschaftsferne Felder „subsystemischen Eigensinns“, die sich in den Mikroräumen der Gesellschaft konstituierten42, die Beharrungskraft traditioneller, zum Beispiel kirchlicher oder akademischer Milieus, Verhaltensspielräume der Industriearbeiter usw. Wesentliche Impulse bezieht dieser Zugriff aus dem Bemühen, die DDR stärker in den Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert zu rücken und Kontinuitäten über die Epochenzäsur des Jahres 1945 hinweg herauszuarbeiten.43 Während das Sowjetisierungs-Paradigma dazu neigen ließ, solche Aspekte zu vernachlässigen, eröffnete sich damit unter anderem die Möglichkeit, das Zusammenwirken russisch-sowjetischer und deutscher Traditionen politischer Kultur in der DDR zu untersuchen.44
Zunächst wurden auf diesem Weg (als Antithese zu einer reinen politischen Herrschaftsgeschichte) die „Grenzen der Diktatur“ und die jenseits dieser Grenzen liegenden Felder beleuchtet, doch rückt mittlerweile die Interdependenz von Herrschaft und „Eigen-Sinn“ als allgegenwärtiger Faktor in den Blick:
„Das Spektrum der als ‚eigen-sinnig‘ zu charakterisierenden Verhaltensweisen und Motive ist […] breit angelegt. Es reicht vom Übereifer des glühenden Idealisten und der egoistischen Nutzung der Möglichkeiten einer aktiven Mitarbeit über äußerlich loyales, aber innerlich distanziertes Verhältnis bis hin zu passiven Formen der Verweigerung, zu offener Dissidenz und Gegenwehr. […] Es geht nicht um eine simplifizierende Gegenüberstellung von ‚der‘ SED-Herrschaft und ‚dem‘ Eigen-Sinn, etwa in dem Sinne, daß bei ‚viel‘ Herrschaft ‚wenig‘ Eigensinn anzutreffen sei und umgekehrt.“45
Historische Gesellschaftsanalyse der DDR ist mithin nicht als herrschaftsfernes Arbeitsfeld zu begreifen, sondern als Untersuchung von Herrschaft als sozialer Praxis. Daraus ergibt sich eine zweite Konsequenz: Eigensinn spielte nicht nur an der gesellschaftlichen Basis eine Rolle, sondern prinzipiell gleichermaßen auf seiten der Akteure im Herrschaftsapparat.46 Anknüpfungspunkte und Diskussionsfelder der DDR-Gesellschaftsgeschichte ergeben sich auch aus der maßgeblich von Soziologinnen angestoßenen Debatte um die soziale Struktur und Schichtung der DDR-Gesellschaft, in denen die Renaissance eines Klassenmodells den einen, die Annahme einer „entdifferenzierten“ und insofern nicht-modernen Gesellschaft den anderen Pol des Spektrums bilden.47 Daraus ergibt sich die Herausforderung, jenseits der Polarität von „Staat“ und „Gesellschaft“ die Akteure des Herrschaftsapparates aus ihrer gleichsam sozial und lebensweltlich sterilen und entsubjektivierten Rolle eines personifizierten Totalitätsanspruchs zu lösen und sie gesellschaftlich zu verorten.
3. Zu den Untersuchungsebenen
Die Studie folgt drei Untersuchungssträngen: erstens einer „politischen Demographie“ des MfS-Personals, also Rekonstruktion und Interpretation der quantitativen Entwicklung des Mitarbeiterbestandes, zweitens einer Strukturanalyse anhand von Basiskriterien wie sozialem Hintergrund, Bildung, Generationen- und Geschlechterverteilung, politischer und weltanschaulicher Bindung usw. und drittens einer Annäherung an Selbstverständnis, Mentalität und Lebenswelt der MfS-Mitarbeiter. Eine solche mehrgleisige Untersuchungsführung trägt den gegenwärtigen Bedingungen der historischen DDR-Forschung sowie speziell der MfS-Forschung Rechnung, die ja aufgrund der schlagartig verbreiterten Quellenlage vor der Aufgabe stehen, auf Feldern wie der Politikgeschichte, der sozialen Strukturgeschichte und der Alltagsgeschichte gleichermaßen „nachholend“ zu arbeiten und die daraus erwachsenden Chancen integrativer Methodenpluralität zu nutzen.48
Entwicklung des Personalbestandes
Der personelle Umfang des Ministeriums für Staatssicherheit zählte zu den am besten gehüteten Geheimnissen der DDR und war 1989/90 ein Politikum ersten Ranges. Nach Wochen des Mauerns gab am 5. Januar 1990 der Regierungsbeauftragte für die Auflösung der Staatssicherheit, Peter Koch, in der Nachrichtensendung „AK-2“ bekannt, die Staatssicherheit habe zuletzt 85.000 hauptamtliche Mitarbeiter auf der Gehaltsliste gehabt.49 Wie sich später zeigen sollte, waren es noch ein paar Tausend mehr, doch selbst diese erste Offenbarung übertraf alle Erwartungen um ein Mehrfaches. Es war dann nach Öffnung der MfS-Archive relativ schnell und unkompliziert möglich, die quantitative Entwicklung des Personalbestandes der Staatssicherheit zu rekonstruieren bzw. (für die Jahre bis 1953) wenigstens recht präzise abzuschätzen.50 Bereits im Frühjahr 1990 wurde eine Reihe von Daten veröffentlicht, vornehmlich aus den siebziger Jahren, die zu ersten Hypothesen anregten. Die dabei offenkundig werdende expansive Dynamik warf Fragen auf nach den Triebkräften dieses Wachstums und nach dessen Binnenwirkungen auf den Personalbestand selbst. Eine nähere Rekonstruktion des politischen Kontextes sowie eine differenziertere Analyse des Personalausbaus bilden deshalb die Grundlage aller weiterführenden Untersuchungen.
Die noch von der scheidenden AfNS-Führung in die Welt gesetzte Behauptung, seit 1983 habe der Personalbestand auf dem Stand von rund 85.000 Mitarbeitern stagniert, wurde schon früh in Zweifel gezogen. Daraufhin angestellte Hochrechnungen der Wachstumsraten seit 1973 ergaben Schätzungen, das MfS habe zuletzt tatsächlich etwa 99.000 Mitarbeiter beschäftigt, und schienen einen engen Zusammenhang zwischen dem Wachstum des oppositionellen Potentials, das schließlich in der Erhebung des Herbstes 1989 kulminierte, und der MfS-Expansion zu belegen. Die Anzahl der potentiellen Gegner der offiziellen Politik sei in den Augen der Parteiführer ständig gewachsen, und darauf hätten sie mit dem Ausbau des Apparates reagiert.51 Auch die Ausdehnung des Überwachungssystems auf „weite Teile der gesamten Gesellschaft“ wurde in diesem Zusammenhang in die Mitte der achtziger Jahre datiert.52
Die Hypothesenbildung ging weiter: Armin Mitter und Stefan Wolle vertraten ausgehend von ihrer These des „Untergangs auf Raten“ die Position, die Staatssicherheit sei jeweils als unmittelbare Reaktion auf akute Systemkrisen ausgebaut worden, beginnend mit der Neuorganisation des inneren Sicherheitsapparates nach dem 17. Juni 1953 im Zuge der „inneren Staatsgründung“, später dann nach dem Mauerbau 1961, dem Prager Frühling 1968 usw. Dabei sei der Macht- und Disziplinierungsapparat nach einer Neuorganisation im Juli/August 1953 nur „immer weiter verfeinert“ worden.53 Dem steht die Hypothese entgegen, das expandierte MfS der Ära Honecker hebe sich von den frühen Jahren als Ausdruck einer „historisch neue[n] Form von Herrschaftsausübung“ ab, die neben dem hergebrachten Instrumentarium moderner Diktaturen von einer „bis dato unbekannten ‚umfassenden verdeckten Steuerungs- und Manipulationsfunktion‘“ der Staatssicherheit (Henke) geprägt sei.54 Daran schließt eine weitere Hypothese an: Der mit dem Bemühen um außenpolitische Anerkennung und Reputation einhergehende Wandel der MfS-Methoden im Zuge der Entspannungspolitik, also die Abschwächung offener Repression und der stärkere Einsatz verdeckter Einflußnahme und Überwachung, habe für die Staatssicherheit einen höheren Aufwand in der praktischen Arbeit bedeutet, und deshalb hätte sie personell weiter verstärkt werden müssen.55
Neben solche Ansätze, die von einer immanenten Funktionalität der Expansion ausgehen, treten Interpretationen, die sie als „absurde Wucherung“ (Niethammer), als Produkt einer hypertrophen Eigendynamik der Sicherheitsbürokratie begreifen, deren Repression nur eine „notwendige Randbedingung“ der Diktatur gewesen sei. Diese Hypothese fußt unter anderem auf der Beobachtung, daß es „keinerlei Korrelation zwischen der Größe des MfS und der Größe der Opposition“ gegeben habe. Der Ausbau des MfS-Gewaltapparates sei möglicherweise eine kompensierende Reaktion auf die „Ermattung ideologischer Herrschaft“ – also ein Zeichen der Schwäche – gewesen.56
Um diesen Hypothesen nachzugehen, bedarf es der Untersuchung von Entscheidungsprozessen und Kräftekonstellationen: Wie waren SED-Parteiführung, sowjetische Sicherheitsorgane (und gegebenenfalls die Führung der KPdSU) sowie MfS-Leitung an der Definition von Zielvorgaben der Personalbestandspolitik beteiligt? Wer formulierte die jeweils gültige sicherheitspolitische Generallinie und setzte sie in ein praktisches Konzept zur Ausrichtung der Staatssicherheit um? Welche Prozesse prägten die apparatinterne Auseinandersetzung um personelle Ressourcen? Wenn hier auch keine umfassende Entwicklungsgeschichte des MfS ausgearbeitet werden kann, so soll doch die Entwicklung des hauptamtlichen Personalbestandes als wesentlicher Langzeitindikator für die Beantwortung dieser Fragen nachgezeichnet werden. Aufschluß über die allgemeine Rolle des Sicherheitsapparates im Staatssozialismus und die Besonderheiten der DDR gibt in diesem Zusammenhang der Vergleich mit der Entwicklungsdynamik anderer Geheimpolizeien der sowjetischen Hegemonialsphäre. Außerdem liefert die Betrachtung der Binnenverteilung und der Wachstumsschwerpunkte innerhalb des MfS wichtige Hinweise. Sie zeigen den Grad der Zentralisierung und Bürokratisierung und ermöglichen es, die Impulse zu verfolgen, mit denen das Aufgabenspektrum des MfS als Herrschaftsinstrument ausgerichtet wurde. Neben dieser eher politikgeschichtlichen Dimension bilden die Determinanten und Konjunkturen der Personalentwicklung zugleich den „demographischen“ Rahmen für die nähere Untersuchung der Rekrutierungspolitik im Spannungsfeld von avantgardistischer Strenge und „Kaderhunger“. Aus der Größe und Wachstumsdynamik des Personalbestandes ergeben sich Konsequenzen für seine innere Struktur und nicht zuletzt für die Selbstverortung der Mitarbeiter in der normativen Werthierarchie des Parteistaates.
Kaderpolitik und Personalstruktur
Noch immer steht die Sozialstrukturanalyse der staatssozialistischen Gesellschaft vor grundlegenden kategorialen Schwierigkeiten. Vor allem modernisierungstheoretisch argumentierende Sozialforscher wie Sigrid Meuschel und Rainer Lepsius betonen das hohe Maß an Homogenität und materieller Egalität, die Entdifferenzierung sozialer Sphären, den Rückbau intermediärer Institutionen, die nach eigenen Rationalitätskriterien funktionieren.57 Dem hat Heike Solga entgegengehalten, daß die sozialistische Gesellschaft nach einer Phase hoher Mobilität mit egalisierenden Effekten wieder von einer starken Tendenz zur Verfestigung differenzierter sozialer Lagen geprägt war. Sie überträgt in diesem Zusammenhang sogar ein (marxistisch definiertes) Klassenmodell auf die DDR. So strittig eine solche Klassifikation bleibt, da die Kriterien dieses Modells, insbesondere die Verfügungsgewalt über Produktionsmittel, in der von einem „property vacuum“ geprägten sozialistischen Gesellschaft nicht ohne weiteres greifen, hat Solga mit ihrer Studie erneut den Blick auf soziale Ungleichheit im Staatssozialismus gelenkt.58 Neuere empirische Studien unterstreichen, daß es trotz der relativ geringen Einkommensunterschiede sowie der schwachen Ausprägung intermediärer Institutionen durchaus markante horizontale und vertikale Differenzierungen in der DDR-Gesellschaft gab.59 In der „durchherrschten“, von einer monopolistischen Machtstruktur geprägten Gesellschaft waren dabei politische und soziale Ungleichheit unmittelbar verknüpft. Die soziale Position war wesentlich durch das Maß an politischer Systemloyalität bestimmt, das der einzelne aufbrachte.60 Während die monetären Einkommensunterschiede relativ gering blieben, stellte sich Ungleichheit über diese Zugänge zur Machtteilhabe her und beinhaltete materiell vor allem die Möglichkeit, knappe Waren und Dienstleistungen bevorzugt beziehen zu können.61
Für die hier verfolgte Fragestellung sind vor allem die oberen Lagen dieser soziopolitischen Schichtung von Belang, für die sich mittlerweile (neben der kleinen Spitze der Staats- und Parteiführung) die Bezeichnung als „sozialistische Dienstklasse“ ausgeprägt hat. Aufgrund der Gemengelage sozialer und politischer Statusmerkmale ergeben sich dabei zwei mögliche Definitionswege: Zum einen läßt sich der unter diesem Begriff subsumierte Personenkreis streng positionsanalytisch fassen. Grob gesprochen handelt es sich dabei um die (hauptamtlichen) Angehörigen der verschiedenen „Apparate“, die sich in drei Säulen gruppierten: erstens die politischen Organisationen, allen voran die Sozialistische Einheitspartei, daneben die sogenannten Blockparteien sowie die „gesellschaftlichen“ Organisationen (Gewerkschaft, Jugendverband etc.); zweitens die Planungs- und Leitungsinstitutionen der Wirtschaft, von der Staatlichen Plankommission über die Branchenministerien bis hin zu den Leitungsebenen der Kombinate und Betriebe; drittens schließlich der Staatsapparat im engeren Sinne auf Zentral-, Bezirks- und Kreisebene.62 Eine solche positionsanalytische Definition korrespondiert explizit oder implizit weitgehend mit jenen Funktionen, über deren Besetzung die SED selbst sich nach dem Prinzip der Kadernomenklaturen die Entscheidung vorbehielt.63 Zu dieser staatlichen Exekutive zählt auch der innere und äußere Sicherheitsapparat der „bewaffneten Organe“, den man aufgrund seiner Spezifika in Abgrenzung zum zivilen Staatsapparat als eigenständige vierte Säule fassen kann. Auf diesen Bereich wird zurückzukommen sein.
Der zweite Zugriff folgt nicht primär den beruflichen Positionen, sondern der zentralen Rolle der kommunistischen Partei als „allgegenwärtigem Herrschaftsstab, der die Entscheidungen der Führungselite umzusetzen hatte“.64 Diese Aufgabe galt prinzipiell für alle ihrer zuletzt 2,3 Millionen Mitglieder und Kandidaten: „Mit dem Beitritt zur SED bekundete man nicht nur die Zugehörigkeit zu einer politischen Gesinnungsgemeinschaft, sondern trat zugleich in eine der Herrschaftselite durch ein besonderes Disziplinar- und Loyalitätsverhältnis verbundene Dienstklasse ein.“65 Zu beachten ist freilich die interne Differenzierung, die sich aus dem Doppelcharakter der SED ergab: Einerseits war sie Massenpartei, die etwa 20 Prozent der erwachsenen DDR-Bevölkerung umfaßte, andererseits bildete sie einen engeren Kern von „Berufskadern“, der ganz wesentliche Teile des Personals der oben skizzierten Apparate stellte.66
Empirisch unterscheiden sich die durch diese definitorischen Filter erfaßten Angehörigen der sozialistischen Dienstklasse im Kern kaum voneinander. Die Gruppe umfaßte mehrere hunderttausend Personen.67 Aufgrund der unterschiedlichen Kriterien stehen freilich im zweiten Ansatz der hauptamtliche Parteiapparat als eigentlicher Ort des Machtmonopols und die „parteiliche“ Bindung als inneres geistiges Band der Systemloyalität im Vordergrund. Die herrschaftstechnische Nachordnung der anderen Apparate in Staat, Wirtschaft usw. ist damit deutlicher markiert.
Für die positionsanalytische Verortung der MfS-Mitarbeiter gilt es, sich näher dem bereits angesprochenen Sektor der bewaffneten Organe zuzuwenden. Das Ministerium für Staatssicherheit zählte zu diesem besonderen Teil des Staatsapparates, neben Polizei und Armee sowie den kleineren bzw. halbprofessionalisierten Institutionen wie der Zollverwaltung und den Kampfgruppen der Arbeiterklasse.68 Wegen der direkten Verfügungsgewalt über physische Gewaltmittel genossen die bewaffneten Organe immer besondere Aufmerksamkeit im Staatssozialismus, der sich nach innen wie außen als im „kalten Bürgerkrieg“ (Fulbrook69) stehend und deshalb immer mindestens latent bedroht verstand. Die Ansprüche an die Systemloyalität seiner Angehörigen waren in den einzelnen Institutionen graduell unterschiedlich, aber insgesamt höher als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ihre normative Position resultierte aus der Bedrohungsperzeption und der kampforientierten Weltsicht der Parteiführung, die als gesellschaftliche Militarisierung weit über diese Apparate ausstrahlte.70 Hauptamtlich tätig waren in den bewaffneten Organen zuletzt etwa 4.00.000 Personen.71 Die Binnenverhältnisse in ihnen waren einerseits durch die enge Parteibindung sowie durch starke Hierarchisierung, Prinzipien von Befehl und Gehorsam usw. geprägt; auf der anderen Seite honorierte die Parteiführung die Loyalität und Dienstbereitschaft mit überdurchschnittlichen materiellen Leistungen.72 Als Kern besonders abzusichernder Staatsexekutive zählten die bewaffneten Organe zusammen mit den Zentralinstitutionen wie Staatsrat, Ministerrat und Parteiorganisationen sowie militärisch relevanten Wirtschaftssektoren zum geheimen „X-Bereich“, der zum Beispiel in der veröffentlichten Statistik der DDR grundsätzlich ausgespart blieb.73 Unter anderem aufgrund der bis 1989 geltenden besonderen Geheimhaltung steckt die Forschung zum Personal der bewaffneten Organe noch in den Anfängen. Während zur Nationalen Volksarmee, insbesondere seinem Offizierskorps, bereits einige Studien vorliegen,74 steht die Analyse des Personals der Volkspolizei noch ganz am Anfang, von anderen Institutionen nicht zu reden.75
Während die (männlichen) SED-Mitglieder in allen bewaffneten Organen die Mehrheit und zum Beispiel fast alle NVA-Offiziere stellten, reichte die Parteibindung im Fall der Staatssicherheit noch weiter. Die besondere Funktion des MfS als Schutzmacht der „Diktatur des Proletariats“ hob seine Mitarbeiter gegenüber allen anderen Teilen des Staatsapparates einschließlich der anderen bewaffneten Organe heraus und ließ sie neben den hauptamtlichen Parteifunktionären und -arbeitern zum innersten Kreis gesellschaftlicher Machtausübung und -sicherung zählen. Praktisch spielten sie die Rolle hauptamtlicher Parteiarbeiter in der dienstrechtlichen Hülle des (mit physischen Gewaltmitteln ausgestatteten) Staatsangestellten und bildeten damit eine Art „Avantgarde der Avantgarde“76. Diese exklusive Rolle als „Schildträger“ und „Schwertführer“ der Partei wurde durch die militärische Dienstverfassung (dienstrechtliche Verpflichtung als Berufssoldat, Disziplinarrecht usw.) unterstrichen und durch die besonderen geheimdienstlichen Verhaltensregeln noch verschärft.
Um das Personal der Staatssicherheit in diesem Gefüge strukturell zu verorten, ist nicht nur nach den praktischen Konsequenzen des Parteisoldatentums in der Rekrutierungspolitik, dem politischen Hintergrund usw. zu fragen, sondern auch eine breitere Analyse der sozialen Basis, der Bildungsvoraussetzungen sowie der Aus- und Weiterbildungsmechanismen, der Generationen- und Geschlechterstrukturen vorzunehmen. Kaderpolitik und Kaderarbeit sind in diesem Zusammenhang nicht nur als Abgleichgrößen von Norm und Realität zu behandeln, sondern als Faktoren, die selbst im Wechselspiel mit den vorgefundenen personellen Ressourcen veränderlich waren. Zu klären ist, auf welcher soziopolitischen Basis sich die Staatssicherheit im Gründungsprozeß konstitutierte und wie sich Rekrutierung und innere Zusammensetzung im Laufe der Jahrzehnte wandelten. Welche Rolle spielte die normativ hoch bewertete „Wissenschaftlichkeit“, welche Bildungsvoraussetzungen hatten die MfS-Mitarbeiter, und was tat das MfS, um diese zu optimieren? Welchen Stellenwert und welchen Charakter nahmen unter den besonderen Bedingungen der Staatssicherheit Bildung und Fachqualifikation für die Herausbildung einer institutionellen Eigenlogik ein? Welche generationellen Erfahrungsgemeinschaften prägten die Binnenwelt der Staatssicherheit? Welche Geschlechterverhältnisse brachte die Staatssicherheit unter den Bedingungen nomineller Gleichstellungspolitik und fortwirkenden Patriarchalismus in der militarisierten Geheimbürokratie hervor? Zur näheren Analyse dieser Probleme wird ein Set von Basisdaten zusammengetragen, das Grundtatbestände und Wandlungsprozesse im Personalbestand nachzuzeichnen ermöglicht und zugleich für Vergleiche mit den Verhältnissen in anderen Institutionen zur Verfügung steht.
Die Staatssicherheit als Lebenswelt
Über die Analyse der MfS-Mitarbeiter als gesellschaftlicher Gruppe anhand „harter“ Daten hinaus bildet die Kenntnis der Strukturen eine Grundlage für das dritte Untersuchungsfeld – die subjektive Lebens- und Wertewelt des MfS-Personals. Diese Welt konstituierte sich im Spannungsfeld von offiziellem Selbstverständnis und Alltagspraxis. Anschließend an seine bereits zitierten Überlegungen hat Thomas Lindenberger unterstrichen, daß sich das Spannungsverhältnis von Herrschaft und Eigensinn im „soziale[n] Kosmos der hauptamtlichen Herrschaftsträger“ reproduzierte:
„In der Binnenwelt der hauptamtlichen Ausübung von Herrschaft im weitesten Sinne, also in der Welt der Stäbe, der Kader und Intellektuellen auf Kreis-, Bezirks-, und Republikebene, wirkte ebenfalls das Prinzip der kleinen überschaubaren Gesellschaftsausschnitte mit ihrer Abgrenzbarkeit von einer Sphäre der ‚eigentlichen‘ politischen Herrschaft, mit Aufpassern und Vermittlern im Grenzbereich. […] Damit ist nicht gesagt, daß die aktive Teilhabe an dieser ihrer Lebenswelt den Kadern und Bürokraten dasselbe bedeutete wie den gewöhnlichen Sterblichen an der Basis der Gesellschaft, eher im Gegenteil: Konnte von letzteren im Wege des beiderseitigen Stillhaltens und des Arrangements in der Regel nur Loyalität zum politischen System erkauft werden, verbürgte den im Apparat eingebundenen Kadern die aus der Vogelperspektive wahrgenommene und zugleich an sich selbst erfahrene Allgemeingültigkeit dieser Vergesellschaftungsform die Legitimität des politischen Systems als Ganzem, insbesondere seinen egalitären Charakter, durften sie sich doch selbst immer noch als ‚Arbeiter‘ in einem ‚Betrieb‘ wähnen. […] Der Eigen-Sinn dieser Idealisten/Karrieristen von Amts wegen nährte sich aus etwas anderem: ihren Spezialkenntnissen und der Eigenlogik einer Wissenschaft, einer Branche, eines Projekts, dem sie sich verschrieben hatten, ihrem Aufstiegs- und Machtwillen. Auch und gerade dies war eine Quelle fortwährender Reibereien und ‚Grenzkonflikte‘ mit den nächsthöheren Arkanbereichen der Herrschaftsausübung.“77
Polizeisoziologisch läßt sich dieses Spannungsfeld anschließend an anglo-amerikanische Konzepte in der Unterscheidung von offizieller Polizeikultur und „cop culture“, also „Polizistenkultur“ fassen.78 Von Interesse sind dabei einerseits Einflüsse normativer Leitbilder auf die Selbstsicht der Polizisten, andererseits dagegen resistente oder unabhängig davon existierende Elemente des Werthaushalts der einzelnen Mitarbeiter, die aus der alltäglichen Dienstpraxis oder anderen Einflüssen resultierten. Schon in der rechtsstaatlich verfaßten und öffentlicher Beobachtung unterliegenden Polizei beinhaltet die „Polizistenkultur“ prekäre Züge, die sich periodisch in Skandalen niederschlagen (Übergriffe gegen Bürger, Diskriminierung von Polizistinnen, abgesprochene Falschaussagen vor Gericht etc.). Für die Staatssicherheit als Geheimpolizei in der Diktatur galten von vornherein diametral andere Verhältnisse: Opportunität und Allmacht anstelle gesetzlicher Bindung und Beschränkung, radikale Abschottung anstelle öffentlicher Kritik sowie ein politischer Auftrag, der seine bedingungslose Erfüllung an erste Stelle setzte, bestimmten die Leitbilder der offiziellen „Polizeikultur“ in den Farben der Staatssicherheit. Daraus resultierten gänzlich andere normative Impulse für das Alltagsverständnis der MfS-Mitarbeiter. Im Ergebnis konstituierte sich, so die hier verfolgte Hypothese, in den Reihen der Staatssicherheit eine spezifische Sicht auf sich und die Umwelt, eine „Weltanschauung“ als Alltagsideologie – kein abstraktes Ideengebäude ideologischer „Hochkultur“, sondern „eine durch prägendes Erleben und generationelle Erfahrung dominant gewordene ‚Haltung zur Welt‘“.79 Die Beziehungen zwischen offizieller Normenwelt und Alltagswerten der MfS-Mitarbeiter lassen sich anhand konkreter Inhalte näher ausleuchten, die sich ergeben aus der Selbstverortung in der soziopolitischen Schichtung, den Verhaltensmaßgaben des Apparates, den daraus erwachsenden praktischen Konsequenzen alltäglicher Dienst- und Lebensführung sowie den besonderen Methoden und Befugnissen, mit denen die Staatssicherheit agieren durfte.
Einen Ansatzpunkt hierzu liefert wiederum die neuere Forschung zur sozialistischen Dienstklasse im allgemeinen. Über eine strukturell-funktionalistische Positionsbeschreibung hinaus hat sie das Tor zur Analyse des Selbstverständnisses und der Werthaltungen dieser Schicht aufgestoßen und die Frage aufgeworfen, ob und inwiefern ihre Angehörigen sich selbst als Elite verstanden. Dabei ist der Elitenbegriff für die DDR durchaus umstritten: Einige Beobachter (vornehmlich Repräsentanten klassischer bürgerlicher Eliten) sind der Ansicht, daß alle Menschen, die über die dafür als notwendig erachteten Ressourcen an Bildung und Haltung verfügt hätten, von der SED systematisch an den Rand bzw. in den Westen gedrängt worden seien. Es habe deshalb in der DDR keine Elite im eigentlichen, wertbezogenen Sinne gegeben.80 Dieser These folgte mit umgekehrter Wertung auch die offizielle DDR-Position, da der Elitebegriff dem Egalitarismus kommunistischer Politik widersprach und deshalb – für die eigene Gesellschaft – tabuisiert war.81Waren also die Angehörigen der sozialistischen Dienstklasse „Eliten, die keine sein wollten“82, oder war die demonstrative Abwehr des Begriffs bereits Bestandteil eines spezifischen Selbstverständnisses als „sozialistische Elite“ mit eigener distinguierender Weltsicht?83
Für die Untersuchung dieser Frage spielt einerseits die normative Verankerung eine Rolle: Entgegen dem „arbeitertümelnden“ Egalitarismus zeigt die Selbstwahrnehmung der SED-Mitglieder als „Avantgarde“ durchaus eine Verwandtschaft mit dem Elitegedanken. Daran anknüpfend enthält auch der Begriff des „Kaders“ als Bezeichnung aller im Parteiauftrag hauptberuflich tätigen Kräfte deutlich auf Herausgehobenheit und besondere Verantwortung abhebende Aspekte.84 Welche Bedeutung dieser Kaderbegriff hatte, belegt nicht zuletzt der vielzitierte Ausspruch Stalins „Die Kader entscheiden alles“ als personalpolitisches Credo einer Bewegungspartei, die aus einer gesellschaftlichen Minderheitenposition heraus die Hebel der Staatsmacht für eine tiefgreifende soziale Umwälzung in Bewegung setzen wollte und zu diesem Zweck mit dem System der Kadernomenklaturen ein extrem elaboriertes, „planwirtschaftliches“ Instrumentarium schuf.85 Als Prinzipien konstituierten Avantgardeidee und Kaderbegriff ganz wesentlich Gestalt und Stellung der sozialistischen Dienstklasse im „Nomenklatura-Sozialismus“86. Es wird zu untersuchen sein, in welcher Weise sie das Selbstverständnis der Staatssicherheit prägten und Spuren im Werthorizont der Mitarbeiter hinterließen.
Zum anderen sind die ganz praktischen Strategien der Lebensführung auf Elemente elitärer Selbstsicht zu prüfen. Hierunter fällt etwa ihr Auftreten gegenüber anderen Herrschaftsträgern (Volkspolizisten, Parteifunktionäre usw.), „normalen“ Bürgern und schließlich den direkt von der Staatssicherheit Verfolgten, aber auch das Streben nach gesteigerten materiellen Leistungen und deren Legitimation. Gerade letzterer Aspekt spielte in der Sicht der Bevölkerung auf die sozialistische Dienstklasse immer eine zentrale Rolle. Zwar waren die realen Einkommensdifferenzen erheblich geringer als in kapitalistischen Gesellschaften, doch widersprachen auch mäßige Besserstellungen der Selbststilisierung als selbstlose „Diener der Arbeiterklasse“. Zudem entwickelte sich eine ausgeprägte Kultur der „Privilegien“ in Form von Verfügungsrechten über besondere Leistungen, ohne daß damit eine Anhäufung von persönlichem Eigentum verbunden sein mußte. Vor allem der Zugang zu Importgütern aus dem verteufelten Westen gegen DDR-Währung empörte wegen der darin zum Ausdruck kommenden Doppelmoral. Gerade in der Überläuferliteratur aus staatssozialistischen Geheimpolizeien haben entsprechende Schilderungen ihren festen Platz. Die realen Formen und Dimensionen dieser Kultur werden zu untersuchen sein.87
Ein weiterer Komplex ergibt sich aus der bereits angesprochenen Militarisierung, die sich für die Staatssicherheit nicht nur in der Dienstverfassung, sondern auch im offiziellen Selbstbild als „Kämpfer an der unsichtbaren Front“ niederschlug.88 Die Konsequenzen dieses militanten, kampfbetonten Weltbildes für die innere Verfassung des Apparates und für den Blick der Mitarbeiter auf ihre Umwelt sind zu beleuchten. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Mythos um die von Feliks Dzierzynski begründete sowjetische Geheimpolizei als Vorbild der deutschen „Tschekisten“ und die daran anschließende Selbstdeutung ihres Aufgabenhorizonts und ihres „Berufs“-Verständnisses. Andererseits sind gerade die durch diese historische Selbstlegitimation in den Hintergrund rükkenden Traditionsbestände deutscher politischer Kultur zu untersuchen, die MfS-Mitarbeiter aus der Zeit vor 1945 mitbrachten. Konkret zu fragen ist etwa nach der Rolle physischer Gewaltanwendung und deren Wurzeln – im Marxismus-Leninismus, im Antifaschismus als (heute retrospektiv vorherrschendem) Legitimationsmuster, in der Verrohung durch Krieg und nationalsozialistischen Terror, in der Straßenkampfatmosphäre des kommunistischen Milieus der Weimarer Republik – um Ansatzpunkte zu nennen.89
Zugleich ist nach den langfristigen Wandlungen zu fragen, denen das Personal der Staatssicherheit als geistiges Kollektiv unterworfen war. Führten Personalwachstum, Status und Abschottung zur Bildung eines eigenen sozialen Milieus, dessen Angehörige „ähnliche Lebenslagen mit ähnlichen Ethiken alltäglicher Lebensführung bewältigen“90? Welche Konsequenzen hatte eine lebensweltliche Homogenisierung für die Art und Weise, in der die Staatssicherheit ihre politisch zugewiesene Funktion erfüllte? Wie verarbeitete das MfS-Personal unter diesen Bedingungen Veränderungen im politischen Umfeld, die ihr Selbstverständnis und ihren Auftrag in Frage zu stellen drohten? Daran schließt ein letzter Problemkomplex an – nämlich die Frage nach inneren Ursachen dafür, daß der personal- und waffenstarke Gewaltapparat Staatssicherheit, dessen Aufgabe es gewesen wäre, die Macht der SED und damit die Existenz der DDR zu sichern und zu verteidigen, in der entscheidenden Situation 1989 in wenigen Wochen der totalen Desintegration anheim fiel und seiner Entmachtung und Auflösung kaum etwas entgegenzusetzen hatte.91 Es geht mithin darum, innere Prozesse als Erklärung für die vierzigjährige Stabilität der Staatssicherheit und ihr jähes Ende aufzudecken.
Angelegt ist die Studie als Längsschnitt durch die vier Jahrzehnte der Existenz von DDR und Ministerium für Staatssicherheit. Im Zentrum stehen die Kontinuitäten und langfristigen Wandlungen im MfS-Apparat, ohne daß einzelne historische Kulminationspunkte oder die Spezifika einzelner Phasen bis ins Detail ausgeleuchtet werden könnten. Abstand genommen wurde von einer näheren Eingrenzung bzw. systematischen Differenzierung der Untersuchungsgruppe. Denkbar gewesen wäre zum Beispiel auch eine Kollektivbiographie des sehr viel kleineren Kreises der MfS-Generalität bzw. obersten Führungsebene; ein solcher Ansatz hätte jedoch den Charakter und die Reichweite der Befunde erheblich verändert. Andere Begrenzungen, etwa die auf die „operativen Mitarbeiter“, erwiesen sich als wenig praktikabel. Eine solche Suche nach den „echten“ Geheimpolizisten ist durchaus berechtigt und notwendig, etwa um ein schärferes Profil der direkt mit Repressionsakten betrauten Kräfte zeichnen oder zum Beispiel den Umfang des bürokratischen „Wasserkopfes“ bestimmen zu können. Doch wird ein solcher Definitionsversuch dem Charakter des Ministeriums für Staatssicherheit nicht gerecht: Den Mitarbeiterbestand band nicht nur ein dezidiertes gemeinsames Selbstverständnis, sondern auch eine hochgradige interne Arbeitsteilung unterschiedlicher Dienstzweige und Tätigkeitsprofile. So zählten in den achtziger Jahren nur etwa 15 Prozent der MfS-Mitarbeiter zu den „politisch-operativen“ Mitarbeitern im engeren Sinne, die freilich ihre Aufgaben nicht hätten erfüllen können ohne die Führung durch Leitungskader sowie durch Unterstützung und im Zusammenspiel mit „operativ-technischem“ Personal, militärisch ausgebildeten Spezialkräften, Grenzkontrolleuren, Fahndern und „sonstigen“ geheimdienstlich tätigen Mitarbeitern. Hinzu kamen Wachkräfte und Rückwärtiger Dienst, medizinische Betreuung, Kader- und Parteiinstrukteure sowie schließlich eine Anzahl von Kräften, die zur Ausbildung abgeordnet waren.92 Über diese komplexe Arbeitsteiligkeit läßt sich nicht hinweggehen – sie selbst, ihre Ursachen und ihre Folgen sind vielmehr Gegenstand der Analyse. Zudem hätte eine solche Eingrenzung erhebliche Schwierigkeiten in der Quellenarbeit verursacht, da zum Beispiel die MfS-interne Statistik diesen Kategorien nur ausnahmsweise folgt. Auch die in der Militärsoziologie gängige Unterscheidung von Offiziers- und Unteroffizierskorps greift beim MfS nicht, da die tatsächlichen Tätigkeiten nur mittelbar mit dem Dienstgradgefüge korrespondierten. Sondergruppen wie die (wenigen) Zivilbeschäftigten sowie die Zeitsoldaten, die ihren zwei- bzw. dreijährigen Wehrdienst im Wachregiment oder anderen Wacheinheiten ableisteten, sind in die Untersuchung prinzipiell einbezogen, werden jedoch getrennt behandelt, wo dies sachlich geboten ist. Außerhalb der Betrachtung bleiben die in den fünfziger Jahren zeitweilig dem Ministerium bzw. Staatssekretariat unterstellten Angehörigen der Deutschen Grenzpolizei und der Transportpolizei. Die Personalstärke dieser „bewaffneten Organe“ überstieg die damalige Zahl der eigentlichen MfS-Mitarbeiter bei weitem, sie blieben aber vom geheimpolizeilichen und geheimdienstlichen Apparat immer separiert, unterlagen der Überwachung durch MfS-Diensteinheiten und verfügten über eigene Kaderabteilungen.
4. Forschungsstand und Quellenlage
Bedingt durch die strikte Geheimhaltung gab es bis 1989 weder in der DDR noch in der Bundesrepublik veröffentlichte spezielle Forschungen über die personelle Zusammensetzung des Ministeriums für Staatssicherheit. Mit dem MfS beschäftigte sich systematisch nur Karl Wilhelm Fricke, der seine Ergebnisse in zahlreichen Publikationen präsentierte.93 Besonders im Standardwerk „Die DDR-Staatssicherheit“ arbeitete er noch heute gültige Befunde zum „tschekistischen“ Selbstverständnis, den sozialen und politischen Auslesekriterien der Rekrutierung sowie dem wachsenden Stellenwert „fachlicher“ Fähigkeiten, aber auch der privilegierten Einkommenslage und den institutionellen Zwängen für die Mitarbeiter heraus, soweit es die Materiallage zuließ.94 Abgesehen von einigen biographischen Daten des Leitungspersonals, vor allem hinsichtlich ihres Lebensweges vor 1945, war darüber hinaus wenig bekannt.
In den fünfziger und sechziger Jahren sind daneben einige Broschüren über das MfS entstanden, die offenbar überwiegend auf Ergebnissen westlicher Geheimdienste bzw. Informationen von ehemaligen DDR-Bürgern, insbesondere Überläufern aus dem MfS, beruhen.95 Diese Broschüren konzentrieren sich ganz auf die Repressionsfunktion des MfS, über die hauptamtlichen Mitarbeiter sind nur beiläufig Informationen enthalten. In anderen publizistischen Werken finden sich einige Hinweise zu MfS-Mitarbeitern, etwa ihrer vermeintlichen NS-Vergangenheit oder ihrer Karriere als kommunistische Kader, die aber aufgrund der dubiosen Quellenbasis nur sehr bedingt zur Grundlage wissenschaftlicher Analysen gemacht werden können und einer Überprüfung am Archivmaterial nicht immer standhalten.96
Alle diese im Westen erschienenen Arbeiten mußten sich auf zwei Arten von Quellen stützen: zum einen auf die äußerst spärlichen in der DDR veröffentlichten Materialien, zum anderen auf Informationen von Überläufern, gefaßten Agenten und westlichen Geheimdiensten. Während in den fünfziger Jahren aufgrund der hohen Überläuferzahlen die Informationslage noch relativ dicht und detailliert war, blieb später das Innenleben des MfS in weit stärkerem Maße verschlossen. Diese extrem einseitige Quellensituation ist für Geheimdienstforschung nicht untypisch, verdeutlicht aber (gerade in der jetzt möglichen Gegenüberstellung mit Archivmaterial) die Besonderheiten und Grenzen der historiographischen Beurteilung von Geheimdiensten. Am deutlichsten treten die Lücken in den Informationen zur Personalstärke hervor: Während in den fünfziger Jahren Zahlen kursierten, die zwar sämtlich spekulativ waren, aber der Größenordnung nach richtig lagen, entging westlichen Beobachtern die spätere massive Expansion ganz. Selbst Karl Wilhelm Fricke als unangefochten bester Kenner der Materie und die von ihm zitierten „Experten“ lagen in ihren Schätzungen weit unter dem tatsächlich erreichten Umfang.97
In der DDR wurde das Personal der Staatssicherheit als Forschungsobjekt der veröffentlichten Historiographie ausgespart und tabuisiert. Im Gegensatz zu anderen „bewaffneten Organen“ der DDR wie der Volkspolizei und der NVA veröffentlichte das Ministerium auch keine offizielle historische Selbstpräsentation.98 Eine annähernd vergleichbare Darstellung verfaßte allerdings der Lehrstuhl „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und des MfS“ an der hauseigenen Hochschule des MfS in mehreren Versionen für die interne Aus- und Weiterbildung. Eine erste Fassung dieses als Vertrauliche Verschlußsache eingestuften „Studienmaterials“ erschien in mehreren Heften 1970; zum 30. Jahrestag der MfS-Gründung wurde 1980 dann eine erweiterte und revidierte Fassung vorgelegt, die die Entwicklung bis 1976 darzustellen beanspruchte.99 Substantielle Aussagen zum Personal enthält dieses Material nicht, gleichwohl liefert es eine Reihe mehr oder minder kryptischer Hinweise auf Entwicklungstendenzen und -probleme im Mitarbeiterbestand. Zudem trägt es für das Selbstverständnis der Staatssicherheit den Charakter einer Quelle. Dies gilt auch für die anderen Produkte der internen Traditionspflege, die praktisch keine Informationen über das Innenleben des MfS enthalten, in ihrer mehr oder minder lebendigen, vor allem aber ideologisch extrem stilisierten Schilderung von Episoden des „antifaschistischen Kampfes“ leitender MfS-Veteranen jedoch das Bemühen um historische Legitimation offenlegen.100
Mit der Öffnung der Archive der Staatssicherheit und der Partei sind seit 1990 zu einer Reihe von Aspekten erste Publikationen erschienen.101 Besondere Aufmerksamkeit erfuhr naturgemäß der langjährige „oberste Mitarbeiter“, Minister Erich Mielke, dem allein drei biographische Porträts sowie einige kleinere Arbeiten vor allem über seinen Lebensweg in jüngeren Jahren gewidmet sind. Vor allem die Arbeit von Wilfriede Otto eröffnet Einblicke in das Innere der kommunistischen Bewegung als prägendem Ort des späteren Ministers und ist das erste in den biographischen Fakten zuverlässige Lebensbild.102 Eine zum Teil eher spekulative Biographie liegt über Mielkes Vorgänger Ernst Wollweber vor103, während eine Studie zum ersten Minister für Staatssicherheit, Wilhelm Zaisser, bislang fehlt.104 Neben diesen drei Spitzenrepräsentanten fand nur eine spezielle Gruppe näheres Interesse: die wegen erfolgter oder versuchter Westflucht zum Tode verurteilten MfS-Mitarbeiter, denen Karl Wilhelm Fricke einen Aufsatz gewidmet hat.105 Die erste Welle der Publikationen nach 1990 enthielt zudem Grundinformationen zum Personal in den siebziger und achtziger Jahren sowie zur Auflösung und konzentrierte sich stark auf die bereits erwähnten Offiziere im besonderen Einsatz (OibE) und die ebenfalls geheimnisumwitterten „unbekannten Mitarbeiter“.106 Joachim Walthers Studie zur MfS-Einflußnahme auf den Literaturbetrieb der DDR enthält eine Kollektivbiographie, in der Herkunft und Karrierewege der verschiedenen Generationen von Mitarbeitern der zuständigen Diensteinheit (Abteilung 7 der Hauptabteilung XX) beleuchtet werden.107 Eine Strukturgeschichte der Hochschule des MfS Potsdam-Eiche mit Grundinformationen zur Aus- und Weiterbildung des MfS liegt aus der Feder von Günter Förster vor.108 Silke Schumann hat in ihrer Studie zur „Parteierziehung in der Geheimpolizei“ der fünfziger Jahre die Rollenfindung des MfS und seines Personals als Parteigeheimdienst herausgearbeitet.109Die umfangreiche Arbeit von Sonja Süß zum Verhältnis von Psychiatrie und Staatssicherheit stellt nicht nur eine aufschlußreiche Fallstudie zur Durchdringung und Indienstnahme des Gesundheitswesens der DDR durch das MfS dar, sondern enthält auch einen Abschnitt zu psychischen und psychisch relevanten Gesundheitsstörungen von MfS-Mitarbeitern und deren nervenärztlicher Betreuung bis hin zu Fragen des Alkoholmißbrauchs.110 Schließlich liegt von Jana Tschernatsch eine unveröffentlichte Fallstudie zur erinnerten Lebensgeschichte eines von ihr interviewten MfS-Mitarbeiters vor. Daran sollen in Zukunft weitere Interview-Studien anschließen.111 Der Verfasser selbst hat im Rahmen der Arbeiten zu der hier vorliegenden Studie mehrere Zwischenergebnisse vorgelegt.112
Vergleichsweise gut erforscht sind mittlerweile die Rolle der Staatssicherheit und das interne Geschehen während der Herbstrevolution 1989. Während frühe Studien zuweilen ein hohes Maß an Handlungsfähigkeit und strategischer Kompetenz unterstellten,113 hat die neuere Forschung die starke Desintegration in den Reihen des MfS im situativen Zerfall des Parteistaates herausgearbeitet. Grundlegend ist die auf den zentralen Herrschaftsapparat konzentrierte Analyse von Walter Süß; sie wird in ihren Befunden gestützt durch eine Reihe von Regionalstudien zur Auflösung der Staatssicherheit in Bezirken und Kreisen.114 Der innere Zustand verdichtet sich exemplarisch im zentralen Ereignis des Herbstes 1989, dem Fall der Mauer am 9. November. Die hilflose Hinnahme durch die darin involvierten MfS-Mitarbeiter, vor allem in den Paßkontrolleinheiten der Grenzübergangsstellen, hat Hans-Hermann Hertle in mehreren Studien analysiert.115
Zur Quellenlage: Der ganz überwiegende Teil des für diese Arbeit relevanten Materials findet sich im Archiv des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Wichtigste Quellengattung sind die Kaderunterlagen der MfS-Mitarbeiter. Sie sind weitgehend erhalten geblieben und stehen der Forschung zur Verfügung. Nicht überliefert sind unter anderem die Personalakten der 1989 aktiven Mitarbeiter der Auslandsspionage (Hauptverwaltung A). In diesen Akten ist die Vorgeschichte und Karriere umfänglich dokumentiert. Ergänzend stehen sogenannte „Dossiers“ (das sind beim Leiter der jeweiligen Diensteinheit geführte Extrakte der Personalakte) und Disziplinarakten zur Verfügung. Schließlich führte das MfS eine zentrale Kaderkartei, in der alle aktiven und ausgeschiedenen MfS-Mitarbeiter mit den wichtigsten persönlichen Daten, Karrierestationen, Auszeichnungen und ähnlichen verzeichnet sind. Diese Kartei ist praktisch vollständig überliefert (einschließlich der HVA-Mitarbeiter). Mit diesem Bestand an Kaderunterlagen steht der Forschung ein Fundus an Individualdaten zur Verfügung, der für die hier verfolgte Fragestellung, sowohl hinsichtlich der Recherche zu einzelnen Biographien als auch für die statistische Auswertung, von unschätzbarem Wert ist. Daß die Eigentümlichkeit dieser Quellengattung ein besonders waches Bewußtsein für ihr Verzerrungspotential erfordert, braucht hier nicht weiter betont zu werden. Auch aus diesen Quellen sprudelt nicht, jedenfalls nicht unmittelbar, die Wahrheit.