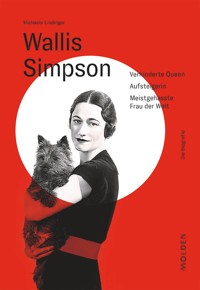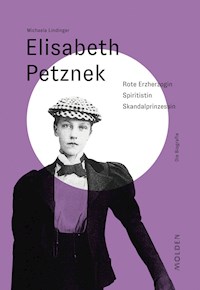Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wien – unzensiert Um 1900 lockte ein pornografischer Roman scharenweise Sextouristen nach Wien. Wer das Buch geschrieben hat, ist bis heute unklar. Josefine Mutzenbacher, die bekannteste Kinderprostituierte der Literaturgeschichte, ist am Ende der Geschichte gerade einmal 14 Jahre alt. Ein Wiener Schriftsteller erfand den weltweit ersten schwulen Kommissar. Wer war er? Und wie kam es, dass Erotikfilme aus Wien einmal international berühmt und begehrt waren – und auch immer wieder konfisziert wurden? Ein erotisch geschmückter Tanzsaal aus dem Mittelalter, eindeutig-zweideutige Briefe in der Hofburg und vieles andere mehr. Es wird klar, dass mit Paris in puncto Sex nur eine europäische Großstadt konkurrieren konnte: Wien. Mit zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHAELA LINDINGERDIE HAUPTSTADT DES SEX
MICHAELA LINDINGER
DIE HAUPTSTADTDESSEX
GESCHICHTE & GESCHICHTEN AUS WIEN
AMALTHEA
Besuchen Sie uns im Internet unteramalthea.at
© 2016 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagmotiv unter Verwendung eines Designs von Susanne Bisovsky
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: Gabi Adébisi-Schuster
Gesetzt aus der Sina Nova 10,3/13,5 pt
Printed in the EU
ISBN 978-3-99050-049-1
eISBN 978-3-903083-32-5
Gefördert von der Kulturabteilung der Stadt Wien,
Wissenschafts- und Forschungsförderung
Für Tobias
INHALT
BÄRTIGE IKONEN (GEGENWART)
Ein Boy-Girl-Conundrum
Die mexikanische Bartfrau in Wien
JENSEITS DER »WANDERHURE« (MITTELALTER)
Teufelsbräute
Tote & Tänze
Liebe oder Ehe?
Das »Älteste Gewerbe der Welt«
Frauensachen: Ein Blick 1000 Jahre zurück
»Frau und frei«
»ROKOKO-KOKOTTEN« (18. UND FRÜHES 19. JAHRHUNDERT)
»Madame Valmont«
Der Kaiser klärt auf
Deportationen
Make-up und Cross-Dressing
Auf dem Weg zum »Liebeskongress«
Wien erfindet die »Homo-Ehe«
»MODERNE AMORETTEN« (UM 1900)
Schwer hörig
Sonderzug ins Sanatorium
Freud? »Ein Trottel!«
Die neuen Hexen
»Fräulein Josefine«
»Andere« Blicke
Krankheiten und Kontrollen
Pariser Vorbilder
Schein-Welten
Königinnen der Nacht
Der letzte Glanz
NACKTE TATSACHEN
Eheberatung in Wien
»Probleme des Lebens«
Neue Ideale
»Miss Universe«
Das erste Opfer der Nationalsozialisten
Girls On Film
Saturn: »Pikante Herrenfilms«
»SCHMUTZ UND SCHUND«?
Teenager in den 1950er-Jahren
Chocolate, Girls & Uncle Sam
Der »Eiserne Besen«
»Erich währt am längsten!« (Wolfgang Benndorf)
SEX IN ÖSTERREICH: AM ENDE?
Literaturverzeichnis
Dank
Bildnachweis
Personenregister
SEX IN DER STADT
(AUSSCHNITTE)
Billig, mollig, willigBusenbomber, Linke WienzeileFranzösisch, LassallestraßeAlles außer griechisch, Hausbesuche, tiefe Kehle, TurmburggasseMercedes 230, Schiebedach, VollausstattungGeiles Ohne-ServiceKnabenhaftes Mädchen erduldet griechischÖffne nackt, TraumfigurWallensteinplatz, ServolenkungStrenge Kammer, Liebestanz, HausbesucheRund um die Uhr oben ohne
Sex in der Stadt,Sex in der Stadt Steht in jedem Blatt.Sex in der StadtSex in der Stadt ist, was keiner hat!
Peter Weibel & Hotel Morphila Orchester, 1979
(Aus moralischen Gründen durfte der Song nichtim Radio gespielt werden.)
BÄRTIGE IKONEN
(GEGENWART)
Conchita says: »Respect!«
Jean Paul nennt ihn »die junge Kaiserin«. Der französische Designer und Ruderleiberl-Träger Jean Paul Gaultier ist nicht der Einzige, der von ihm nicht genug bekommen kann. Designerkollege Karl Lagerfeld hat ihn fotografiert, und sogar im berühmten Pariser Etablissement »Crazy Horse« durfte er auftreten. Dort tanzt sonst Burlesque-Star Dita Von Teese.
Ein ganzes Rondo-Heft widmete die Wiener Tageszeitung Der Standard im Oktober 2014 dem Modeschul-Absolventen Tom Neuwirth, der neuen »Queen of Austria«. Die Song-Contest-Siegerin von 2014, die sich laut eigener Aussage gern als »moderne Sisi« darstellen lässt, hieß damals noch Conchita Wurst. Heute nennt sie sich fast nur noch Conchita – das kommt international einprägsamer. Der weibliche Vorname Conchita ist in Spanien recht geläufig, er leitet sich vom Wort »concepción« ab und bezieht sich auf die unbefleckte Empfängnis. »Conchita« ist aber auch ein spanisches Kosewort für die Vulva.
Und genau darum geht es der Künstlerin Conchita, die viel mehr ist als eine Travestie-Sängerin. Sie trägt lange Haare, gelegentlich einen Bob. Dieser galt in den 1920er-Jahren als Signal für Emanzipation und Eigensinn. Ausladende Haarflechten haben eine Karriere hinter sich, die vom früheren Kennzeichen männlicher Freiheit und männlichen Kriegertums bis zum Inbegriff weiblichen Daseins reicht.
Conchita (Wurst) ist ein Symbol für die Annäherung der Geschlechter. Schminken, Parfümieren, Tätowieren: All diesen Jahrtausende zurückreichenden Praxen wohnt ein geschlechtsverändernder Aspekt inne. Mittlerweile lassen sich Frauen häufiger tätowieren als Männer. Conchita schminkt sich für Fotos und TVKameras stärker als die Durchschnittsfrau, sie braucht dafür – unterstützt von Make-up-Artists – eine Stunde. Ihr Ziel definiert sie folgendermaßen: »Ich will, dass mich Frauen beneiden.« Conchita wirkt auf viele Frauen attraktiver als jede »echte« Frau – darin liegt ihre Anziehungskraft. Sie wird als fast unerreichbares Role Model wahrgenommen. Frauen wollen sein wie sie, denn sie ist ein Mann, der schöner ist als eine Frau. Das ist das verwirrend Spektakuläre an Conchitas Auftreten und ihrem Erscheinungsbild.
Rund um das Jahr 2010 hat Tom Neuwirth die Entscheidung getroffen, eine Frau mit Bart sein zu wollen. Journalisten fragen gern: Wie hält es Conchita mit der Rasur? Ganz echt ist die Barttracht jedenfalls nicht, sagt sie dann. Sprießen die Stoppeln an manchen Stellen unregelmäßig oder spärlich, hilft sie einfach mit dunklem Lidschatten nach.
Nach dem Song-Contest-Sieg in Kopenhagen war Conchitas Newswert so enorm wie ihre Vorbilder alt. Bärtige Frauen treiben sich in der Kulturgeschichte nämlich schon sehr lange herum. Kurz gesagt: die (Kunst-)Figur hat einen langen Bart.
EIN BOY-GIRL-CONUNDRUM
Ihr fast 1000 Jahre altes Urbild dürfte in der Toskana zu finden sein. Dort entdeckt man im Dom von Lucca den sogenannten »Volto Santo«. Das »heilige Antlitz« – mit Bart. Und prächtige Kleidung trägt diese Frau mit Gesichtsbehaarung auch noch! Oder ist es doch ein Mann im langen Kleid? Fummel, würde man im queeren Sprachgebrauch sagen.
Beim »Volto Santo« handelt es sich um ein hölzernes Kruzifix aus dem 12. Jahrhundert. Der gekreuzigte Christus wird hier nicht als leidender Mensch, sondern als triumphierender König dargestellt. Er trägt ein prächtiges langes Gewand und eine Krone auf dem Haupt. Auch in der sehr alten Martinskirche in Linz, die vermutlich auf das 10. Jahrhundert zurückgeht, findet man eine Wandmalerei mit dieser auf den ersten Blick weiblich aussehenden Figur. Doch hat auch sie einen Bart.
Nördlich der Alpen dürfte aufgrund der ungewöhnlichen Darstellung eines Mannes in langen Gewändern die Legende einer gekreuzigten jungen Frau in Umlauf gekommen sein. Sie ist keine kanonisierte Heilige, sondern eine im Volksglauben verhaftete Figur, deren Geschichte je nach Region variiert. Sie kann auch verschiedene Namen tragen, etwa »heilige Kümmernis« oder »heilige Wilgefortis«. Diese Frau mit Bart taucht erstmals um 1400 auf, besonders verehrt wurde sie bis in die Barockzeit. Im »Sankt-Wilgefortis-Triptychon« des genialen niederländischen Künstlers Hieronymus Bosch konnte jüngst der spontane Bartwuchs wieder sichtbar gemacht werden. Das Werk, das sich in der Galleria dell’Accademia in Venedig befindet, hatte unter einer Alterung der Farbschicht gelitten, sodass der Bart des langhaarigen Mädchens am Kreuz nur noch rudimentär zu sehen war. Für die große Bosch-Retrospektive 2016 in den Niederlanden war das Altarbild aufwendig restauriert worden. Es stammt in etwa aus den Jahren 1495 bis 1505.
Doch wer ist diese »heilige Conchita«? Möglicherweise war sie die fromme Tochter eines portugiesischen Königs, die den ihr zugedachten Prinzen aus religiösen Gründen nicht zu ehelichen gedachte. Sie betete zu Gott um eine Verunstaltung ihres Gesichts, sodass der Prinz das Interesse an ihr verlöre. Ihr Flehen wurde in Gestalt eines Bartwuchses erhört. Der erzürnte Vater ließ die bärtige Jungfrau ans Kreuz nageln. Sogar mit Musik hat diese Geschichte zu tun: Am Fuß des Kreuzes soll ein armer Spielmann für die Verurteilte gespielt haben. Sie warf ihm zum Dank ihren goldenen Schuh zu. Da diese Begebenheit eine gar so traurige war, trug die arme Jungfrau fortan den Namen »Kümmernis«.
Wie bei tradierten Legenden üblich, gibt es auch andere Versionen. In manchen Gegenden Mitteleuropas sprechen die Leute eher von einer »Wilgefortis« und weniger von der »Kümmernis«. »Die Leute« sind im Fall dieser Volkshelferin mehrheitlich die Frauen, die sich bei alltäglichen Leibes- und Seelennöten an die »Entkümmerin« wenden. »Wilgefortis« könnte ein Name sein, der auf den lateinischen Ausdruck »virgo fortis« hinweist: tapfere Jungfrau oder starke Frau. Auf jeden Fall eine weibliche Person, mit der die römische Amtskirche wenig anzufangen wusste. Bilder der »tapferen Jungfrau« beziehungsweise der »Kümmernis« wurden im Mittelalter gelegentlich verbrannt.
Die Bilderstürmereien hingen damit zusammen, dass alte Vorstellungen von »starken Frauen« im Volksglauben weiterlebten. Geschichten von Amazonen und Walküren finden sich in den Götter- und Heldensagen der Griechen und nordeuropäischen Völker. Diesen unchristlichen Traditionen wurde erst zu Beginn der Neuzeit in den Hexen- und Zaubererverfolgungen endgültig der Prozess gemacht. Im Mittelalter waren die Glaubensvorstellungen der verschiedenen germanischen und slawischen Völker noch durchaus sichtbar. So heißt es in der »Weltchronik« des deutschen Humanisten Hartmann Schedel aus dem Jahr 1493: »Frauen gibt es mit Bärten bis zur Brust.«
Eine »Transgender-Heilige« wäre demnach nichts Ungewöhnliches. Aus Kleinasien waren unterschiedliche hermaphroditische Kulte an den Nil und nach Europa gekommen und quasi »eingebürgert« worden, soll heißen, sie wurden mit den eigenen religiösen Vorstellungen verwoben. Im alten Ägypten und später in Griechenland tauchten sie vielerorts auf.
Androgyne Kultfiguren, also göttliche oder halbgöttliche Wesen mit männlichen und weiblichen Körpermerkmalen, findet man in allen vorchristlichen Religionen. Sie vereinen die menschlichen Gegensätze in sich und sind somit Symbole für überirdische Vollkommenheit.
Die »Kümmernis« verschwand im Lauf des 19. Jahrhunderts aus der Erinnerung der rechtgläubigen Katholiken. Die Bart-Frauen mussten sich nun mit neuen Bühnen zufriedengeben. Schaulustige zahlten Eintritt, um Frauen ohne Unterleib oder mit Bart in Freakshows und auf Jahrmarkt-Buden zu sehen. In Wien erreichte eine ursprünglich aus Mexiko stammende bärtige Tänzerin einen unerhörten Bekanntheitsgrad: Julia Pastrana. 1860 starb die zwergenhafte Schaustellerin im Alter von 26 Jahren. Begraben wurde sie jedoch erst 2013.
DIE MEXIKANISCHE BARTFRAU IN WIEN
Zeitlebens litt Julia Pastrana an Hypertrichose – übermäßigem Haarwuchs. Ein amerikanischer Impresario kaufte sie einst ihrer Mutter ab und ließ sie in seinen Shows amerikaweit, aber auch in Europa auftreten. Das behaarte Mädchen mit starkem Bartwuchs gelangte bis nach Wien und gastierte im Wiener Prater. Sie beherrschte drei Sprachen in Wort und Schrift, tanzte grandios und war 1858 die Pressesensation in Wien. Charles Darwin durfte sie gegen Entgelt untersuchen. Er war auf der Suche nach dem »Missing Link« zwischen Affen und Menschen.
Der Mensch in seinen verschiedenen Varianten gehörte im 19. Jahrhundert zum Grundinventar der international boomenden »Abnormitäten-Shows«: Groß- und Kleinwüchsige, Albinos, siamesische Zwillinge, »Bartweiber«, »frivole« Szenerien und andere bizarre Belustigungen bedienten die Sensationsgier der Besucher und sorgten für volle Zelte, auch im Wiener Prater.
Im Jahr 1884 kehrte Julia Pastrana wieder. Da war sie allerdings schon 24 Jahre tot. Ihr Impresario hatte sie während der erfolgreichen Welttournee nicht nur geheiratet und geschwängert. Als sie bei der Geburt des gemeinsamen, ebenso an Hypertrichose leidenden Kindes in Moskau starb, ließ der nicht gerade trauernde Witwer die beiden Leichen mumifizieren. Auch nach ihrem Ableben sollten sie als Schaustücke sein Auskommen sichern.
Im Prater gab es seit 1871 eine Attraktion, die als Mischung zwischen Schaubühne und Anatomie-Museum bezeichnet werden konnte: das »Präuscher’sche Panoptikum«. Der im deutschen Gotha geborene Hermann Präuscher zeigte Wachsfiguren und Präparate, die im Spannungsfeld zwischen Horror und Erotik einzuordnen waren und somit ein großes Publikum anzogen. 1884 waren dort die berühmten Körper von Julia Pastrana und ihrem Kind in einem gläsernen Schaukasten zu bewundern – gegen eine jährliche Rente von 320 Talern, die Präuscher an den Witwer nach der Künstlerin Pastrana abführte. Die Mumien waren somit immer noch im Besitz des Ehemannes der »Bart-Frau«. Dieser hatte drei Jahre nach Julia Pastranas Tod eine weitere behaarte Schausteller-Frau geheiratet, Maria Bartels. Auch sie war ihren Eltern abgekauft worden und musste als »Julia Pastranas Schwester« auftreten. Maria und Julia verband in Wirklichkeit keinerlei Verwandtschaft.
Die Wirkung der leichenkonservierenden Chemikalien ließ jedoch mit der Zeit nach und die Mumien von Julia Pastrana und ihrem Kind wurden in Stopfpräparate umgewandelt. Man zog ihnen die Haut vom Leib und stopfte sie aus. 1895 wurden sie auf einer Zirkusmesse in Wien nach München verkauft.
Der ruhelose Leichnam in seinem rotseidenen Flitterkleidchen erlebte auch noch das gesamte 20. Jahrhundert. 1921 tauchte die ausgestopfte bärtige Julia in einem norwegischen Zirkus auf – sie wurde weiterhin vorgeführt; bis in die 1970er-Jahre, als ein Erlass die Präsentation derartiger Schaustücke unter Strafe stellte. Die Präparate verschwanden in einem Depot für Rechtsmedizin. Dort wurden sie gestohlen, wobei das ausgestopfte Kind die Folgen des Raubes nicht überstand. Die Leiche ging verloren. Noch später fanden spielende Kinder einen Arm von Julia Pastrana auf einer norwegischen Mülldeponie. Der Initiative einer mexikanischen Künstlerin, Laura Anderson Barbata, die in Norwegen lebte, ist es zu verdanken, dass Julia Pastrana schließlich heimkehren konnte. Anfang 2013 wurde sie im Rahmen einer katholischen Zeremonie in Mexiko bestattet. Sie liegt auf dem Friedhof ihres Geburtsorts Sinaloa de Leyva.
Die Frau mit Bart hat Tradition. Abgesehen von einer Heiligen und einer verkauften Schausteller-Braut kommt vielen auch »Baba« in den Sinn. Sie ist die bärtige und temperamentvolle Türkin (»Türkenbab«) in Igor Strawinskys Oper The Rake’s Progress. Dass man an der Symbolfigur mit dunklem Bart nicht vorbeikommt, dachte sich wohl auch ein großes Kreditunternehmen. Seit 2014 ist Conchita dort als Testimonial tätig. Das Spektrum an Dragqueens hat sie ordentlich erweitert und jüngst wurde sie auch als Botschafterin von »It Gets Better« nominiert, einem Projekt, das Teenager beim Coming-out unterstützt. »Dragqueen« St. Kümmernis wäre vielleicht »amused« …
JENSEITS DER »WANDERHURE«
(MITTELALTER)
»Gatten, die sich beim Akt ergötzen,verkehren die richtige Ordnung.«
GREGOR I., PAPST (590–604) UND HEILIGER
Die spezielle Stadtführung zum Internationalen Hurentag (»Sex Workers’ Day«, alljährlich am 2. Juni) beginnt beim Stephansdom. Ausgerechnet, wundern sich manche Teilnehmer. Was soll die traditionell körperfeindliche katholische Kirche schon mit Sex in der Stadt am Hut haben? Doch kurz nach den ersten Worten der Stadthistorikerin Petra Unger schallen schon »Ahs« und »Ohs« durch die kleine Gruppe. Die meisten Zuhörer sind Wiener oder leben bereits lange in Wien. Trotzdem ist vielen bisher ein Detail an der Westfassade des Stephansdoms nicht aufgefallen, und nun werden sie gezielt darauf hingewiesen. Es geht um das Riesentor und die beiden Heidentürme. Diese spätromanischen Gebäudeteile entstanden in den Jahren um 1240. Vielleicht bezieht sich der Ausdruck »Heidentürme« auf die altrömischen Steine, die im Dom verbaut worden sind. Es kann aber auch sein, dass sie ein Hinweis auf jene vorchristlichen Fruchtbarkeitssymbole sind, die als Abschlüsse der beiden Blendsäulen unterhalb der Türme eingesetzt wurden. Links erkennt man einen Phallus und rechts eine Vulva.
Blendsäulen-Abschluss am Stephansdom: Penis [1]
Blendsäulen-Abschluss am Stephansdom: Vulva [2]
Wollten die christlichen Bauherren der Kirche die alten heidnischen Götter in Stein bannen und sie so ihrer Macht berauben? Oder waren die Darstellungen als apotropäische Symbole gedacht, die Unheil und Gefahr vom Bauwerk und seinen Insassen fernhalten sollten?
Beides zugleich ist ebenso möglich. Das Christentum des Mittelalters kann nicht mit den katholischen Glaubensgrundsätzen des 21. Jahrhunderts gleichgesetzt werden. Im 13. Jahrhundert war der Dom für die Wiener Bevölkerung viel mehr als nur ein Raum zur Gottesverehrung. Die große Kirche war der zentrale Versammlungsort der Stadt, nicht zuletzt auch der wichtigste Zufluchtsort in Zeiten von Krieg, Seuchengefahr oder Belagerung. Fruchtbarkeit garantierte das Überleben der Menschen, und Gottheiten der Fruchtbarkeit waren es, denen stets die größte Ehrerbietung entgegengebracht wurde. Dies galt seit den Tagen der Venus von Willendorf – also ein wenig länger als die manchen Zeitgenossen wenig glaubwürdig erscheinenden Lehren von Jesus Christus aus den Evangelien.
TEUFELSBRÄUTE
Dennoch: Der Teufel schlief im Mittelalter nicht. Vor allem die Frauen soll er im Visier haben – schrieben die Männer, die meist Kleriker waren. Wie Sexualität zu werten war, bestimmte als oberste moralische Instanz die Kirche. Ein ausschließlich männlicher Blickwinkel prägte den intimen Umgang zwischen den Geschlechtern. Da alle Frauen als Evas Töchter und somit Trägerinnen der Erbsünde angesehen wurden, sei ihr einziges Lebensziel die ununterbrochene Verführung der Männer. Frauen seien ständig von sexueller Begierde erfüllt, daher nähere sich ihnen der Teufel bevorzugt auf der sexuellen Ebene. »Das Weib ist das Einfallstor des Teufels« stand in einer theologischen Erörterung über das »Wesen des Weiblichen«. Dieses Frauenbild sagte zwar nichts über die Frauen selbst aus, dafür umso mehr über die Kirchenmänner, die es sich ausmalten. Das »Weib« wurde als »vir imperfectus« definiert, also als »fehlerhafter Mann«. Der Frau mangle es an Geist, daher müsse der Mann für sie entscheiden, was »richtig« oder »falsch« sei. Frauen seien »von Natur aus« geschwätzig, gehässig, willensschwach und scharfzüngig – alles negative Eigenschaften, die man später den Hexen zuschrieb.
Mode um 1300: »Teufelsfenster« [3]
In einer durchaus mit Wien vergleichbaren deutschen Stadt wetterte ein Priester, auf den langen Schleppen der Damen säße »eine große Zahl von Teufeln. Sie waren klein wie Haselmäuse (…), vollführten ein lautes Gelächter und klatschten in die Hände.« Grundsätzlich sei die »Putzsucht der Frauen ein Netz des Teufels«, schloss der Geistliche. Wobei das Wort »Putzsucht« auf den angeblich unersättlichen Drang der Frauen anspielte, sich modisch zu kleiden und zu schmücken. Heute würde man solche Frauen »Fashion Victims« nennen. Hätten sie ihre Neigungen auf die Sauberkeit der Wohnräume der Herren beschränkt, wären dem Mann Gottes die Manifestationen des Leibhaftigen vermutlich erspart geblieben.
»Teufelsfenster« nannte man übrigens die weiten seitlichen Öffnungen der Oberkleider, die vermögende Damen der Oberschicht im 14. Jahrhundert zu tragen pflegten. Die Unterkleider waren ziemlich eng, und so blickte man durch diese »Fenster« direkt auf den Körperbau der gut betuchten Dame. Zum Körperideal der Zeit gehörten eine enge Taille und schmale Hüften. Der Rücken sollte biegsam sein, der Bauch leicht gewölbt. Für die Frau als Mutter galten gerundete Hüften und straffe Schenkel als besonders erstrebenswert.
Und am Kopf, da spielte es sich erst richtig ab. Wer wissen will, wie die Frau »unter die Haube« kam, muss in der Bibel lesen. Da findet sich die Information, dass eine Frau sich entehre, wenn sie ohne Kopfbedeckung bete, und dass das bloße Haupt einer verheirateten Dame nichts an der frischen Luft verloren habe. Die Ehefrau »unter der Haube« war aber keineswegs vor Anfechtungen sicher, denn der Hennin, die heute bekannteste Kopfbedeckung der mittelalterlichen Frau, bot unzähligen Teufeln ein Versteck. Unter dem hohen, kegelförmigen Hut fanden sie genügend Platz – so die kirchlichen Beobachter.
Den Haaransatz sollte eine Frau nicht zeigen. Modern war eine möglichst hohe, am besten ausrasierte Stirn. Haarentfernung wurde zusätzlich mithilfe einer Schwefel- oder Kalkpaste praktiziert. Zur Verhinderung des Nachwuchses unschöner Stoppeln verwendeten die »Putzsüchtigen« des Mittelalters Fledermausoder Froschblut, Schierlingsextrakt oder aus Asche und Essig fabrizierte Tinkturen. Asche diente auch als Basis für Shampoo. Gemixt mit Eiklar hielt dieses Haarwaschmittel die vorzugsweise blonden Haare der Frauen sauber. Wer es sich leisten konnte, behandelte die Kopfhaut mit pulverisierten Bienen- oder Fliegenflügeln, gemahlenen gerösteten Nüssen oder der Asche von Igelstacheln.
Die recht umständlichen Frisuren wurden durch falsche Haarteile aus unterschiedlichen Materialien, hauptsächlich Rosshaar, verstärkt. Danach wurden Silber- und Goldfäden oder Perlenschnüre eingeflochten.
Von der Spitze des kopfbedeckenden Hennins fiel dann ein bodenlanger Schleier auf die Schleppe des Kleides herab. Und obwohl die Kirchenväter altrömische Sitten wie duftende Bäder und »bemalte Gesichter« – angeblich ein Anzeichen für Prostitution – verdammten, Luxus und Überheblichkeit auf dieselbe moralisch niedrige Stufe stellten: Kosmetische Prozeduren gehörten selbstverständlich zum Tagesablauf der Dame des Mittelalters. Der weibliche Hochadel puderte sich mit Schichten aus Bleiweiß, Essig und Eiweiß. Die Haut wurde mit Lotionen behandelt, die Wangen durch künstliches Rot aufgefrischt, die Augen schwarz betont. Das Gesicht glich einer Maske, an der man den sozialen Status ablesen konnte.
Jede wohlhabende Frau erledigte somit das Werk des Teufels und handelte gegen das natürliche Werk Gottes. Das aufgemalte Gesicht, drohten die Prediger, repräsentiere das Antlitz des Höllenfürsten. Es dürfe nicht die Stelle des gottgegebenen Gesichts einnehmen. Wer diese Warnungen zu Lebzeiten in den Wind schlage, werde am jüngsten Tag unzweifelhaft daran erinnert: denn Christus könne die geschminkte Person nicht erkennen und werde sie in die Tiefen der Hölle schicken.
In den medizinischen Codices des Mittelalters finden sich Rezepturen zur Aufhellung des Teints (»wie Schnee« oder »wie die Lilie«), zur Haarkoloration, gegen Pigmentflecken und gegen Falten. Zur attraktiven Erscheinung des 12. und 13. Jahrhunderts gehörte vor allem Jugendlichkeit: Als »ideale Schöne« galt ein Teenager von 15 Jahren. Mit 25 war eine Frau für gewöhnlich mehrfache Mutter und somit an der Schwelle zum Alter. Das »ideale« Haar sollte hell sein, sehr lang, hochgesteckt oder zu Zopffrisuren gelegt. Wangen und Lippen sollten als Sinnbilder der Gesundheit vor »natürlicher« Farbe strahlen. Zur Obsession der hohen Stirn gehörte die Gestaltung der Augenwimpern, die ein regelrechtes Kult-Dasein genossen und an denen sich Männerfantasien entzündeten. Sie sollten dunkelbraun sein und möglichst flattern – also einladend und verführerisch wirken. Um die Augen groß und glänzend erscheinen zu lassen, empfahlen Ratgeber einen Schuss Zitronensaft – eine zweifellos sehr unangenehme Behandlung. Als glücklich sollte sich ein Mädchen schätzen, das Kinngrübchen sein Eigen nennen konnte.
»Natürlichkeit« wurde als Synonym für Schönheit verwendet. Doch nicht anders als heute ging der erstrebten »natürlichen Schönheit« ein intensiver Transformationsprozess voraus, der als »teuflisch« gebrandmarkt wurde. In der bildenden Kunst oder der Literatur stand die weiße Haut für Reinheit und Schönheit genauso wie für die ewige Jugend im Paradies. Gebräunte, »schwarze« Haut hingegen stand für die ewige Verdammnis, genauso wie brüchige Zähne, schlechter Atem, graue Haare. Zusammen ergeben die letztgenannten Merkmale das tragische Abbild einer alten Frau, eine satanische Vorstellung, die in der mittelalterlichen Kunst mit abschreckenden Darstellungen der Verdammnis und der Apokalypse einhergeht.
TOTE & TÄNZE
Gegen die »schamlose« Mode und den ihr angeblich folgenden moralischen Verfall wetterten die Sittenwächter vergeblich. Als Grund für den Hedonismus im Mittelalter wird häufig die Pest genannt, die das 14. Jahrhundert dominierte. Der Schwarze Tod hatte Europa mit schier unvorstellbarer Wucht getroffen. Binnen weniger Jahre starben an die 25 Millionen Menschen – knapp ein Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung. Tiefgreifende soziale und politische Umwälzungen gingen mit den massiven demografischen Veränderungen Hand in Hand. Der verantwortliche Seuchenerreger wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt: das Bakterium Yersinia pestis. Wie genau sich dieses Bakterium über Jahrhunderte auf dem Kontinent halten und immer neue Epidemien auslösen konnte, ist eines der großen Rätsel der Medizingeschichte. Nach heutigem Wissensstand wurde der Krankheitserreger ab Mitte des 14. Jahrhunderts in immer neuen Seuchenzügen aus Mittelasien über Handelsrouten nach Europa eingeschleppt. Es könnten Läuse gewesen sein, in denen eine bestimmte Erregervariante so lange überlebt hat. Nachgewiesen ist diese Theorie allerdings noch nicht.
Im Schatten der sich stetig füllenden Massengräber und der sich im selben Maß leerenden Städte war es mit dem Vertrauen in Gott und Kirche jedenfalls vorbei. Geißlergruppen zogen umher und brachten die Pest bis in entlegene Dörfer. Da die Leute wie die Fliegen starben, schossen die Löhne in die Höhe. Arbeitskräfte wurden rar. Man suchte, das eigene Leben so lang wie möglich zu erhalten, und der Blick der Menschen richtete sich allmählich vom Himmel auf die Erde. Der italienische Dichter Giovanni Boccaccio brachte in seinem freizügigen Werk Il Decamerone die Stimmung der Zeit auf den Punkt: »Im Angesicht solcher Not und solchen Elends brach aller Respekt vor den Gesetzen Gottes und der Menschen (…) zusammen.«
Die Brandreden der Prediger, die die Inhaber verfaulender Leiber zur Rettung ihrer Seele aufriefen, fanden immer weniger Gehör. Viele zogen es vor, ihren Körper zu feiern, solange es noch ging. Das Morgen ist ungewiss – carpe diem! Wer es sich leisten konnte, gab sich dem Überfluss hin. Adelige und reiche Kaufleute trugen aufwendige Garderoben, veranstalteten Gelage und frönten dem Tanzvergnügen. Zum Beispiel an den Wiener Tuchlauben.
In dieser sehr alten Straße befand sich ein mittelalterlicher Tanzsaal, ausgeschmückt mit zahlreichen zweideutigen Bildmotiven. Man entdeckte den Raum erst 1979, als eine Wohnung im Haus mit der heutigen Nummer 19 umgebaut wurde. Was zum Vorschein kam, ist für Wien sensationell und einzigartig: Die Szenerien an den Wänden gehen zurück auf die Lieder des bekanntesten deutschsprachigen Sängers des Mittelalters – Neidhart von Reuental, der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts lebte.
Man kann ihn mit den Popstars von heute vergleichen. Zarte Poesie beherrschte er genauso wie derbe Direktheit. Seine Beliebtheit war enorm, und nach seinem Tod nannten sich viele Epigonen, die seine Dichtungen weiterhin vortrugen, ebenfalls Neidhart. Im 16. Jahrhundert wurde der »Liedermacher« sogar sprichwörtlich. Mit »nithart« bezeichnete man zu dieser Zeit einen Grobian.
Neidhart war schon über 150 Jahre tot, als der reiche Wiener Textilhändler und Ratsherr Michel Menschein seinen repräsentativen Festsaal mit den Neidhart-Motiven schmücken ließ. Zweifellos hat jeder seiner Gäste die farbenprächtigen Geschichten im ersten Stock – der »bel étage« – sogleich erkannt und den Hausherrn zu seinem Reichtum und seinem guten Geschmack beglückwünscht.
In den Bildern geht es um die Fruchtbarkeit. Für unsere Vorfahren war die Beobachtung des Himmels und die damit verbundene Abfolge der Jahreszeiten die Grundlage allen Lebens. Man feierte den Beginn des Frühlings, die Sonnenwenden, das Fest der Toten, das immer mit Licht verbunden war, und die ersten länger werdenden Tage mit großen Umzügen und Tänzen. Die Christen haben die meisten dieser Feiern übernommen: Ostern und Weihnachten weisen mit ihren alten Volksbräuchen wie dem Eiersuchen und dem immergrünen Nadelbaum auf die jahrtausendealten Traditionen hin. Auch die größte Katastrophe ihrer Epoche, die Pest, führten die Gelehrten des Mittelalters auf die Planeten und deren gelegentlich unheilvolle Konstellationen zurück.
Der Tod hatte die Welt beherrscht: Doch nun, Anfang des 15. Jahrhunderts, schien die Gefahr fürs Erste vorbei. In den Neidhart-Fresken, die um 1407 entstanden sind, begegnen wir dem Ablauf der Jahreszeiten. Den Meister, der den Zyklus geschaffen hat, kennen wir nicht. Es dürfte sich um einen in Wien ansässigen prominenten Künstler gehandelt haben, da Hausherr Menschein vermutlich weder einen durchziehenden Wandermaler noch einen Unbekannten ohne besondere Qualifikationen mit diesem Auftrag betraut hätte.