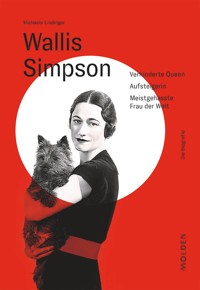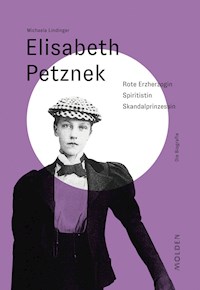Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Molden Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Hedy Lamarr (1914-2000): Ein Teenager aus Döbling wurde in den 1930er-Jahren durch „skandalöse“ Nacktszenen und die erste Darstellung eines weiblichen Orgasmus in der Filmgeschichte zum Arthouse-Filmstar. In Hollywood stieg sie kurzfristig zur größten Leinwandgöttin aller Zeiten auf. Als Jüdin und Hitler-Gegnerin erlebte sie die Zäsuren und Brüche fast des gesamten 20. Jahrhunderts. Heute gilt sie als „Mrs. Bluetooth“. Die Historikerin Michaela Lindinger entkräftet auf Basis neuer Quellen gängige Klischees und Falschinformationen, porträtiert eine Frau mit Ecken und Kanten und zeichnet so völlig neues Bild der ehemals „schönsten Frau der Welt“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michaela Lindinger
Hedy Lamarr
Filmgöttin Antifaschistin Erfinderin
Die Biografie
Für „Gina“ in liebender Erinnerung
Hedwig Kiesler (1914–1932)
Hedwig „Hedy“ Eva Maria Kiesler (1932–1933)
Hedwig Mandl (1933–1937)
Hedy Lamarr (1937–1938)
Hedy Kiesler Markey (1939–1941)
Hedy Lamarr (offiziell ab 1941)
Hedy Lamarr Loder (1943–1947)
Hedy Lamarr Stauffer (1951–1952)
Hedy Lamarr Lee (1953–1960)
Hedy Lamarr Boies (1963–1965)
Hedy Lamarr (1965–2000)
Vorspann
Der Tod und die Lady
I.Legenden aus dem World Wide Web
Graswurzeln
II.Telefone
Geheime Kommunikation
III.Homebase
Wien
IV.„A new Argentina“
Faschismen
V.Metro-Goldwyn-Mayer
Queen of Hollywood
VI.Amphetamine on Silver Screen
Wunsch-Vorstellungen
VII.Snow White and the Huntsmen
Abgesang
VIII. „Bombshell“
Vermächtnis
Abspann
Verwendete Literatur
Bildnachweis
Dank
Die Autorin
Vorspann
Der Tod und die Lady
In ihrem letzten Interview wurde die 84-jährige ehemalige Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr gefragt, mit welcher historischen Person sie sich am meisten identifiziere. Ihre Antwort lautete: Elisabeth von Österreich. Das Interview der einflussreichen US-Mode- und Lifestyle-Zeitschrift „Vanity Fair“ fand in Form eines „Proust“-Fragebogens im April 1999 statt. Benannt war diese Art von Fragebogen nach dem französischen Schriftsteller Marcel Proust (1871–1922), der seinen zahllosen berühmten Bekannten gern verschiedene persönliche Fragen stellte, um sie (und auch sich selbst) besser kennenzulernen. Das Beantworten von Fragebögen in illustrer Runde avancierte in den Jahren um 1900 zu einem beliebten Gesellschaftsspiel.
Eine weitere Frage, die „Vanity Fair“ Hedy Lamarr stellte, bezog sich auf ihre „größte Leistung im Leben“, die sie mit „Elternschaft“ beantwortete. Sie vermied offenbar absichtlich den Ausdruck „Mutter sein“, denn sie war in ihrem langen Leben fast immer Alleinerzieherin gewesen und musste ihren Kindern den Vater „ersetzen“.
Auf die Frage, wann sie in ihrem Leben am glücklichsten gewesen sei, meinte sie: „Zwischen den Ehen.“ Und auf die Frage, wer die Liebe ihres Lebens gewesen sei, antwortete die Ex-Ehefrau von sechs und Geliebte von – nach eigenen Angaben – über 100 Männern: „Mein Vater.“
Hätte Hedys Identifikationsfigur Kaiserin Sisi einen solchen Fragebogen ausgehändigt bekommen, hätte sie wohl ähnlich geantwortet. Die Ehe hatte Elisabeth als „widersinnige Einrichtung“ bezeichnet. Ihrem Vater, dem exzentrischen und freigeistigen Herzog Max in Bayern, eiferte sie in vielem nach, insbesondere in der Auswahl ihrer Hobbys – dem Reitsport, dem Reisen und Dichten – sowie in der hohen Kunst der Provokation.
Wie Elisabeth war auch Hedwig Kiesler ein Sonntagskind. Sie erblickte am 9. November 1914, einem Sonntag, in Döbling das Licht der Welt. Mit dem Leben der legendären Kaiserin Elisabeth kannte sich schon die junge Hedy Kiesler gut aus, spielte sie doch als auffallend schöne 18-Jährige (1933) in Fritz Kreislers Singspiel „Sissy“ die Titelrolle der jungen Herzogin in Bayern, die bald Kaiserin von Österreich werden sollte. Ihr erster Ehemann Fritz Mandl, den seine Zeitgenossen den „Kaufmann des Todes“ nannten, wurde auf Hedy als „Sissy“ aufmerksam und schickte ihr körbeweise Blumen in die Künstlergarderobe.
Seit 1998 wird in den deutschsprachigen Ländern Europas an jedem 9. November der Tag der Erfinderinnen und Erfinder gefeiert – Hedy Lamarr zu Ehren.
Ebenso im Jahr 1998 hätte die Schauspielerin noch nach Wien kommen sollen, um eine wichtige Auszeichnung entgegenzunehmen, die der Österreichische Innovatoren-, Patentinhaber- und Erfinderverband in unregelmäßigen Abständen für besonders innovative Leistungen auf unterschiedlichen technikbezogenen Gebieten vergibt. Doch die alte Dame in Florida hatte bereits seit längerer Zeit Probleme mit dem Herzen und es war ihr der lange Flug in ihre Heimatstadt nicht mehr zuzumuten. Ihr Sohn nahm die Viktor-Kaplan-Medaille, benannt nach dem steirischen Ingenieur und Erfinder der „Kaplan-Turbine“, an ihrer statt in Eisenstadt entgegen.
Hedwig Kiesler aus Wien, die in Hollywood als „schönste Frau der Welt“ vermarktet worden war und heute als Pionierin der gesicherten Funkübertragung gilt, schloss in der Nacht zum 19. Jänner 2000 ihre weltberühmten und mehrfach operierten Augen für immer. Ihr Nachbar fand sie vollständig geschminkt, geschmackvoll gekleidet und mit „Fendi“-Parfum beduftet auf ihrem Bett liegend vor. Sie trug eine Schlafmaske. Der Fernseher lief bei voller Lautstärke, denn Hedy war in ihren letzten Jahren schwerhörig geworden. Unterhalb der Leiche fand sich das Testament der Schauspielerin. Freunde, die Hedys Gewohnheiten kannten, wunderten sich nicht nur über den Fundort des Testaments, sondern auch über die so sorgfältig zurechtgemachte Tote, denn Hedy schminkte sich vor dem Zu-Bett-Gehen stets ab. Gut möglich, dass Hedy Lamarr ihr Lebensende nahen spürte. Sie war Zeugin des gesamten 20. Jahrhunderts geworden. Kurz vor ihrer Geburt 1914 in Wien hatte der Erste Weltkrieg begonnen; Franz Joseph I. regierte noch als Kaiser der österreichisch-ungarischen Monarchie. Als sie starb, hatte praktisch jeder ein Mobiltelefon, Internet und GPS erleichterten den Alltag der Menschen.
Hedys Tochter Denise („Deedee“, geb. 1945) kam aus Seattle und suchte die Begräbnisgarderobe für ihre Mutter aus. Sie wählte eher maskulin inspirierte Kleidung, wie Hosen-Fan Hedy sie auch im Leben bevorzugt hatte: Khakihosen, eine weiße Bluse, einen dunkelblauen Blazer und einen von Hedy gern getragenen Reithut aus Samt. Die blondierten Haare wurden wie in Hedys Alltag hinter den Ohren fixiert und sie trug ihre geliebte pinkfarbene Sonnenbrille.
Die ihr ganzes Leben den Blicken der Menschen so stark ausgesetzt gewesene Filmdiva durfte im Sarg nicht mehr fotografiert werden. Ihr Sohn Anthony („Tony“, geb. 1947) drohte jedem mit einer Gerichtsklage, der sich dem Kondukt mit einer Kamera nähern sollte.
Zur Feier der Jahrtausendwende hatte Hedy Lamarr eine Flasche Dom Pérignon gekauft, die sie jedoch bis zum 19. Jänner 2000 nicht geöffnet hatte. Die Trauergesellschaft, zu der auch Hedys Börsenmakler (sie hatte zum Beispiel in Microsoft-Aktien investiert) und ein Vertreter aus der „alten Heimat“ Österreich gehörten, stieß nun mit Champagner auf jene Hollywood-Ikone an, die sich immer als Wienerin gefühlt und sich im fortgeschrittenen Alter sogar einen „typisch“ österreichischen Spitznamen verpasst hatte: „A toast to Miss Hedelweiss!“
Sonntagskind
„Ich bin ein Sonntagskind, ein Kind der Sonne;Die goldnen Strahlen wand sie mir zum Throne,Mit ihrem Glanze flocht sie meine Krone,In ihrem Lichte ist es, dass ich wohne,Doch wenn sie je mir schwindet, muss ich sterben.“
Kaiserin Elisabeth von Österreich, Oktober 1887
ILegenden aus dem World Wide Web
Graswurzeln
„Ich hasse Konventionen.“
Statt „The ,Ecstasy‘-Girl“ nennt man sie heute „Mrs. Bluetooth“. (Fast) vergessen scheint der größte Sex-Skandal der Filmgeschichte, den Hedy Kiesler 1933 mit dem tschechischen, beinahe dialogfreien Arthouse-Streifen „Ekstase“ ausgelöst hatte. Doch begann die zweite Laufbahn der Schauspielerin erst mit sehr großer Verspätung. Und auch in diesem Fall half die Filmkarriere, denn jener Mann, der sich so stark für die Wahrnehmung und Anerkennung von Hedys Erfindung aus den 1940er-Jahren einsetzte, war in seiner Jugend ein großer Verehrer ihrer Kunst gewesen. Nun ist er weit über 80 und sitzt in typischer „Texas-Montur“ in einem Raum voller Computer. Er wird soeben für den Film „Calling Hedy Lamarr“ (Regie: Georg Misch) über Hedys Lebenswerk interviewt. Am Telefon erklärt er der kleinen Tochter aus Hedys ehemaliger Nachbarsfamilie das „Frequenzsprungverfahren“, das Hedy Lamarr erfunden hat:
„Was für ein brillanter Kopf Hedy war! Eine Methode zur Fernsteuerung von Torpedos, sodass sie vor Störungen sicher sind. Spreizband-Technologie und Frequenzsprung-Technik sind sehr kompliziert, schwierig zu verstehen. Es war ein Mittel zur geheimen militärischen Kommunikation. Früher wurde nur auf einer Frequenz gefunkt. Also: Wie hindert man den Feind daran, abzuhören, was gesagt wird? Und da kommt Hedy die Idee: Frequenzsprünge! Man verwendet einfach eine Vorrichtung, die das gewünschte Signal aufnimmt, von Frequenz zu Frequenz springt und in rascher Folge sendet. Und am anderen Ende hat man eine Vorrichtung mit demselben Code, die das Signal empfangen kann. Somit ist man nicht immer auf nur einer Frequenz. Das Signal kann nicht gestört oder unterbrochen werden. Dass man von einer Frequenz zur anderen springt, ist so revolutionär, dass einem die Spucke wegbleibt. Heute gibt es moderne Versionen. Die Japaner verglichen Hedy mit Mata Hari, der Spionin aus dem Zweiten [sic] Weltkrieg. Hedy hatte technisches Denkvermögen. Sie bekam zwar nie einen Oscar, aber plötzlich viele Wissenschaftspreise, unter anderen den Preis des amerikanischen Erfinderclubs. Auf ihrer Erfindung basiert eine milliardenschwere Technologie: Digital Spread Spectrum, Frequency Hopping, das ist alles ihre Idee. Schnurlostelefone, kabellose Lautsprechertelefone ebenfalls. Kabellose Headsets. Es ist überall. Die ganze Handyindustrie, das neue Bluetooth (der Film stammt aus dem Jahr 2004, Anm.), kabellose Satellitenverbindungen, das kabellose Internet, kabelloser Datenverkehr. Ein billionenschweres Business. Die schöne Helena ist jene Frau, deren Schönheit 1000 Schiffe in See stechen ließ. Doch Hedy Lamarr ließ Millionen Chips vom Stapel. Hedys Erfindung ist die Basis für GPS, sie steckt sogar im Lenksystem der Cruise Missile.“
Die niederländische Tänzerin Margaretha Geertruida Zelle, die sich Mata Hari nannte, war zwar Spionin im Ersten Weltkrieg und wurde aus diesem Grund bereits 1917 hingerichtet, aber das spielte für den US-Internet-Fan, der Hedys Erfindung aus dem Zweiten Weltkrieg publik machen wollte, vermutlich eine eher marginale Rolle … In einer weiteren Szene des Films erläutert ein US-Soldat, dass die Präzisionsbomben der US-Armee, die zum Beispiel im Irak-Krieg eingesetzt wurden, auch das von Lamarr entwickelte „geheime Kommunikationssystem“ verwendet hätten. „Hedy steckt in all dem“, meint der uniformierte Army-Angehörige voller Stolz.
„Missel-Gided Torpido“
Der eingangs erwähnte ältere Mann in seinem texanischen Outfit trägt anstatt einer Krawatte einen massigen Türkisklunker in Form von Stierhörnern am Hemdkragen und auf seinem Kopf sitzt ein enormer Cowboyhut. Er war viel in Sachen Hedy Lamarr unterwegs. Sein Name ist David R. Hughes, sein Beruf: Ex-Colonel der US-Armee. Schon als Bub war er in die Hollywood-Hedy verliebt. Nach seinem Ausscheiden aus der Armee begann er, sich für das soeben in größerem Ausmaß Platz greifende Internet zu interessieren. Seine Recherchen zu den Bereichen Funktechnologien und drahtlose Übertragungstechniken sowie seine Verbindungen zum US-Militär dürften dazu beigetragen haben, dass er eines Tages auf das US-Patent „No. 2292387“ vom 11. August 1942 gestoßen ist, ein „geheimes Kommunikationssystem“ („Secret Communication System“), eingereicht von Hedy Kiesler Markey und ihrem damaligen Erfindungskollegen, dem Musiker George Antheil.
Mr. Hughes begann, in den Vereinigten Staaten für Hedy Lamarr, die für ihn eine so große Bedeutung als Idol gehabt hatte, die Werbetrommel zu rühren. Viele Jahre lang betrieb er Lobbying für die „geniale Göttin“, die den Leuten in den 1980er-Jahren nur noch als abgetakelte Ex-Diva beziehungsweise durchgeknallte Ladendiebin, wenn überhaupt, geläufig war. Schließlich brachte „Forbes“, ein weltweit einflussreiches Wirtschaftsmagazin, im Jahr 1990 ein Telefoninterview – wohl noch am Festnetz – mit Hedy, von der man bald sagen sollte, sie habe unter anderem das Handy erfunden. Sie klang verbittert: „Ich verstehe nicht, warum es keine Namensnennung gibt, wenn das System weltweit verwendet wird. Kein Brief, kein Dank, kein Geld. Ich verstehe es nicht. Ich nehme an, sie nehmen es (= das Patent, Anm.) einfach und vergessen die Person, die es erfunden hat.“
Der pensionierte Ex-Colonel Hughes stand für das genaue Gegenteil von Hedys Äußerungen. Er tat alles, um Hedy als Erfinderin bekannt zu machen, nicht zuletzt wohl, um auch selbst eine Art früher Internet-Star zu werden und mit seiner Website, einer der ersten der USA, Geld zu verdienen. Den Co-Autor des Patents „No. 2292387“ erwähnte er hingegen kaum – wer kannte schon Georges Antheil. Der wilde surrealistische Komponist aus den 1920er-Jahren hätte auch kein werbewirksames Gesicht abgegeben, das man in Zeitschriften hätte abdrucken und in der Internet-Kommunikation verwenden können. Eher klein gewachsen und unscheinbar, wäre Antheil weder ausreichend attraktiv noch interessant genug gewesen. Genutzt hätte es ihm freilich auch nichts mehr, der Musiker war seit 1959 tot.
Folgt man dem US-Technologie-Magazin „Wired“, war David R. Hughes Mitte der 1990er-Jahre, als viele schon ein Handy besaßen und das Internet langsam, aber sicher Einzug in die Privathaushalte hielt, die bekannteste Online-Persönlichkeit der USA. Die amerikanische Technik-Auszeichnung, die Hedy Lamarr bald bekommen sollte, hatte Hughes im Jahr 1993 selbst erhalten. Sein Verdienst? Er war „Grassroots-Evangelist“ – also ein Mensch, der andere ohne finanzielle Interessen nur im persönlichen Gespräch von einer Idee oder Sache zu überzeugen sucht. Hughes plante beispielsweise, Schulen in ländlichen Bereichen der Vereinigten Staaten mit Computern auszustatten, um der offenbar rückständigen Landjugend Anschluss an die großen restlichen USA zu ermöglichen. Findet also ein solcher Evangelist durch seine mündliche Überzeugungskraft weitere „Evangelisten“, so tragen diese die Idee weiter und scharen so eine immer größere Anzahl von Anhängern um sich. Die weltweit bekannteste IT-Firma Apple soll ursprünglich auf solche Weise begonnen haben und der frühere dortige „Chef-Evangelist“ Guy Kawasaki meinte, es gehe bei jener Art Werbung darum, dass jeder Einzelne die Welt zu einem besseren Ort machen könne. Übrigens soll auch der Aufstieg des Kaffeeriesen Starbucks auf derartige „Evangelisten“ zurückzuführen sein. Ein paar wenige, die unbedingt Kaffee in Plastikbechern durch die Gegend tragen wollten, überzeugten andere, dass die Welt mit Kaffeebechern in der Hand erst lebenswert sei.
David R. Hughes arbeitete in den 1990ern also an der Computervernetzung „aller Menschen, die guten Willens sind“ und brachte so ganz nebenbei Hedy Lamarr noch einmal internationalen Ruhm, denn sein Einfluss in der stetig wachsenden Online-Community war nicht zu unterschätzen. Er besaß eine frühe Domain, die er „The Well“ genannt hatte, und steuerte über diese Community die Kampagne zur Bekanntmachung von Hedys Patent. Und so kam es, dass die vom Magazin „Playboy“ unter die „100 sexiest film stars of the 20th century“ gewählte Wienerin 1997 einen Technik-Oscar erhielt – denselben wie vier Jahre vorher ihr Propagandist David R. Hughes: den amerikanischen Electronic Frontier Foundation (EFF) Pioneer Award. Dieser Preis geht vor allem an Einzelpersonen, die sich um die individuelle Nutzung von Computern verdient gemacht haben. Als weiterer Österreicher wurde 2016 der Salzburger Datenschutzaktivist Max Schrems mit einem EFF Pioneer Award bedacht.
Wie die österreichische Kaplan-Medaille nahm auch den EFF-Preis Hedys Sohn Tony Loder entgegen. Er hatte seine Rede so choreografiert, dass während seiner Dankesworte sein Handy klingelte. Auf diese Weise wollte er erneut auf die Erfindung seiner Mutter aufmerksam machen. Außerdem spielte er anrührende Worte der alten Hedy („Ich bin froh, dass es nicht umsonst gewesen ist.“) ein, die er auf einem Diktiergerät aufgenommen hatte.
Nun behauptete allerdings Hedys Tochter Deedee, dass ihre Mutter „vollkommen untechnisch“ gewesen sei. Als ihr diese zum ersten Mal von ihrer patentierten Erfindung erzählt habe, habe Deedee nur abgewunken: „Yes yes, sure, Mum“, habe sie gesagt. Erst nachdem „Mum“ ihr das Patent unter die Nase gehalten habe, habe sie es glauben können. Dann sei sie aber ganz ehrfürchtig gewesen. Sie freue sich, wenn Hedys „Beitrag zur Wissenschaft“ (Zitat Deedee) zur Kenntnis genommen werde, aber ihre Mutter habe zum Schluss das Internet gehasst. Hedy Lamarr selbst fasste ihre Ansicht so zusammen: „Filme haben zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Platz. Aber Technologie ist für immer.“ Diese Aussage steht heute auf ihrem Grabstein auf dem Wiener Zentralfriedhof. Hedy Lamarr dürfte erst spät in ihrem Leben zu dieser Erkenntnis gelangt sein.
Als in den 1960er-Jahren von Filmstar-Ruhm und Traumgagen keine Rede mehr war, musste die Schauspielerin anderweitig Geld verdienen und beschloss, der Welt ihre Autobiografie vorzulegen. Ihre Lebenserinnerungen, die 1966 auf den Markt kamen, nannte sie „Ecstasy and Me“. Das Buch war ein Riesenerfolg und führte schon kurz nach seinem Erscheinen die Bestsellerlisten an. Ein Mitbegründer des amerikanischen Verlags Random House meinte einmal, wenn ein Hollywood-Buch alle Verkauferwartungen übertreffen könnte, dann wäre das „,My 39 Ways of Making Love‘ by Hedy Lamarr“. Er sollte recht behalten, brach das Werk doch alle Rekorde. Über weite Strecken liest sich der von zwei Ghostwritern verfasste Text wie „Mutzenbacher goes to Hollywood“ – was gut passt, hat doch der (vermutliche) Autor des Jahrhundertwende-Erotik-Klassikers „Josefine Mutzenbacher“, Felix Salten, auch die Geschichte vom Rehlein Bambi verfasst, das durch den US-Trickfilmgiganten Walt Disney auf der ganzen Welt bekannt wurde.
Indes haben Hedys Anstrengungen als Erfinderin keinen Eingang in ihre Memoiren gefunden. Sie berichtet zwar von ihrem Engagement für die US-Soldaten in der „Hollywood Canteen“, aber dass sie die US-Army mit einer von ihr und George Antheil entwickelten geheimen Kommunikationsmethode unterstützen wollte – darüber verliert sie kein einziges Wort. Erst im Jahr 1969 wandte sie sich in ihrem noch immer ausbaufähigen Englisch brieflich an einen Navy-Offizier, den sie von früher kannte: „Washington Patter (Patent, Anm.) Office has an Invention of mine. ,Missel-Gided Torpido‘ [sic]. Maybe you can get it.“ Später schrieb sie dem Bekannten: „Dearest Tom, I love you and think of you and would have liked to be married to you …“
Selbst wenn Hedy Lamarr dem neuen IT-Zeitgeist der ausgehenden 1990er-Jahre wenig abgewinnen konnte: Sie verdiente gut mit den neuen Möglichkeiten. 1998 klagte Hedy, die bereits Urgroßmutter war, die kanadische Softwarefirma Corel, weil diese für die Vermarktung ihres Grafikprogramms CorelDraw mit dem Gesicht der jugendlichen Hedy Lamarr geworben hatte. Dank David R. Hughes verfügte Hedy ja nun über den Ruf einer Computerpionierin und wurde daher von den Marketing-Leuten von Corel als ideale „Markenbotschafterin“ angesehen. Nur hatte man „vergessen“, die alte Lady um Erlaubnis zu fragen.
Kaum eine Schauspielerin hatte wohl so viel Zeit vor Gericht verbracht wie Hedy, aus unterschiedlichsten Gründen. Sie verklagte Regisseure, Produzenten, angebliche Juwelendiebe und vermeintliche Vergewaltiger; sie war Hauptdarstellerin zahlreicher Scheidungsprozesse; man beschuldigte sie mehrfach des Ladendiebstahls. Zum Spektakelregisseur Cecil B. DeMille („Samson und Delilah“) sagte sie selbstironisch, ihre befriedigendsten Auftritte habe sie in Gerichtssälen absolviert. Man spiele immer. Vor Gericht sei sie am natürlichsten und am überzeugendsten gewesen. Sie prozessierte hauptsächlich, um zu Geld zu kommen, gelegentlich nutzte sie ihre oft denkwürdigen Gerichtstermine auch für Publicity in eigener Sache – so schickte sie einmal ihr Film-Double zu einer Scheidungsverhandlung.
Jedenfalls führte der Prozess gegen Corel dazu, dass Hedys Vermögen sich um fünf Millionen Dollar vergrößerte. Sie hatte die Firma zwar auf 15 Millionen geklagt, aber für eine alte Frau, die nur noch knapp über ein Jahr zu leben hatte, waren auch fünf Millionen Dollar eine schöne Summe. Corel erhielt dafür das Recht, Hedy Lamarrs Konterfei fünf Jahre lang als Werbung für das Produkt CorelDraw einzusetzen. Die „Abfindung“ ging im November 1998 auf Hedys Konto ein. Sie war damals zwar nicht mittellos und pleite, wie sie gerne mitleidheischend in der Öffentlichkeit behauptete, aber definitiv war sie auch nicht mehr die Hollywood-Millionärin der 1940er-Jahre. Zweifellos konnte sie das Geld gut gebrauchen. Ihre Nachbarin hatte immerhin mitbekommen, dass Hedy sich auch im hohen Alter „die allerschönsten Kleider von Nordstrom und Neiman Marcus“ – großen amerikanischen Kaufhäusern mit bekannten Abteilungen für Designermode – kommen ließ, „viele Teile gleich in zwei- oder mehrfacher Ausfertigung“.
Ihr Testament machte sie ziemlich genau ein Jahr nach dem Corel-Prozess, im November 1999. Bei ihrem Ableben im Jänner 2000 waren noch etwa drei Millionen Dollar vorhanden. So konnten ihre Kinder zunächst einmal die noch ausständigen Anwaltshonorare der Mama begleichen. Es soll sich um eine sechsstellige Summe in beträchtlicher Höhe gehandelt haben.
Hedy heute
Die Ausstellung „Sex in Wien“, die 2016 im Wien Museum gezeigt wurde und in deren Räumen Ausschnitte aus Hedy Lamarrs Skandalfilm „Ekstase“ zu sehen waren, förderte im Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern interessante Ergebnisse zutage. Bei jungen Interessierten und/oder feministisch eingestellten Studierenden ist die Erfinderin Hedy Lamarr heutzutage fast bekannter als der Glamour-Star aus Hollywoods goldenen Jahren. Kaum jemand unter 30 konnte einen ihrer Filme nennen. Oft hingegen hörte man: Hat sie nicht das Handy erfunden? Oder gar das Internet?
Man könnte vielleicht sagen: Hedy Lamarr hat nicht das Internet erfunden; aber dank David R. Hughes hat das Internet die „Erfinderin Hedy Lamarr“ erfunden. Gerade im Internetzeitalter sind Gerüchte und Legenden schwer aufzuhalten.
An Hedy Lamarrs Wiener Grab wird an ihre beiden Tätigkeitsfelder erinnert: „Actress, Inventor“ liest man dort unter ihrem Namen und ihren Lebensdaten. Ein abstrakt gehaltenes Kunstwerk deutet ihr einst weltberühmtes Gesicht sowie das Frequenzsprungverfahren an. Man sollte sich daher die Frage stellen: Hat Hedy Lamarr nun tatsächlich etwas erfunden? Und wenn ja, worum hat es sich genau gehandelt? Welche Bedeutung könnte diese Erfindung heute haben?
IITelefone
Geheime Kommunikation
„Den Wert des Geldes habe ich erst erkannt, als ich keines hatte.“
Ein groß gewachsener Mann sitzt in einem großen amerikanischen Wagen und singt seinen selbst verfassten Song „I Wish I Was a Hollywood producer in the 1940s“: „I would play my guitar for Hedy Lamarr, I would sit on a table with Clark Gable. With sunglasses and a big cigar, I would swim in a pool with Betty Grable. Talking on a phone with C. B. DeMille …“ etc. usw. Er trägt seine groß geblümte Lieblingskleidung, ein Oversize-Hawaii-Hemd, und fährt durch die Straßen von Hollywood. Es ist Hedy Lamarrs Sohn Tony Loder; für den Film „Calling Hedy Lamarr“ versucht er, den Spuren seiner verstorbenen Mutter in der Traumfabrik zu folgen.
Tony ist die Hauptfigur des Films, es geht hauptsächlich um sein (Nicht-)Verhältnis zu und seine Verehrung für Hedy und weniger um Hedy Lamarr selbst. Er habe in die Fußstapfen der berühmten Mutter treten wollen und sei einmal Schauspieler gewesen, kurzfristig, erzählt er. Er war auf verschiedenen Theaterbühnen zu sehen, nahm Schauspielunterricht, befasste sich aber nach eigenen Aussagen hauptsächlich mit Sinnsuche. Als Sohn einer Göttin hat man es nicht leicht. Buddhismus und Scientology sollten bei der Bewältigung des Alltags helfen, diverse obskure Lehren zogen Tony magisch an. Bald realisierte er, dass er von der Schauspielerei nicht leben konnte, daher strich er Wohnungen, verlegte Fliesen und verdingte sich als Taxifahrer.
Doch jetzt steht er vor einem kleinen Geschäftslokal voller Werbeschilder, die größte Aufschrift verkündet: „Phones USA.“ Er sei nämlich nun im Telefon-Business tätig, so Tony Loder. Es sei für ihn tragisch, Telefone und Telefonsysteme zu verkaufen. Das alles würde ihm gar nichts bedeuten. Tony will Filme machen und er hofft, dass er es schafft. Er ist allerdings bereits über 60. In seinem Telefongeschäft zeigt er auf die gut bestückten Regale voller neuester Kommunikationstechnik: Tastentelefone, Handys, Schnurlostelefone, kabellose Lautsprechertelefone, kabellose Headsets. Er erwähnt das kabellose Internet und die digitalen Satellitenverbindungen. Das alles basiere auf der Erfindung seiner Mutter Hedy Lamarr. „Sie hat es verschenkt“, sagt Tony Loder. „Sie hat nichts damit verdient.“ Ihr ganzes Leben lang sei sie ungerecht behandelt worden. Hätte sie die ihr zustehende Anerkennung erhalten, so Tony, wäre sie die reichste Frau der Welt gewesen.
Tony Loder muss es wissen, lebt er doch in seinem mittelmäßig erfolgreichen Telefonladen zwischen unzähligen, bis zum Rand vollgestopften Kunststoff-Kisten, die das Leben seiner Mutter enthalten: Fotos, Briefe, Zeitschriften. Ihre Filme bewahrt er in Form von Videokassetten im Kühlschrank auf, wie sich das gehört. Er macht den Eindruck eines fanatischen Lamarr-Fans, doch erklärt er, er müsse seine „Mum“ für sich selbst rekonstruieren. Denn er kenne sie ja kaum.
Zu seinen Erinnerungen an die meist abwesende Mutter gehören die vielen Telefongespräche, die sie zeit ihres Lebens geführt hat. Sie telefonierte gern mitten in der Nacht und schüttete dann ihren Bekannten das Herz aus. Ob der Gesprächspartner am anderen Ende Zeit oder Lust hatte – solche Skrupel tangierten Hedy nicht. Der frühere Diplomat und USA-Korrespondent des österreichischen Massenblatts „Kronen Zeitung“, Hans Janitschek, sprach oft mit ihr am Telefon. Er sei nie mit ihr in einem Raum gewesen, aber man habe sie in endlos langen Telefongesprächen gut kennenlernen können. Er habe sie mit „Miss Lamarr“ oder mit dem typisch Wienerischen „Gnädige Frau“ angesprochen. „Bis sie einmal sagte: ,Warum nennen Sie mich nicht Hedy?‘ – Von da an sind wir wirklich gute Freunde geworden.“
Ihre Nachbarsfamilie in Florida rief sie immer dann an, wenn sie irgendetwas benötigte. Und das kam häufig vor. Sie sei sehr fordernd gewesen. Dann verlangte sie in gebieterischem Tonfall, dass der Nachbar einen Schaden in ihrem Apartment reparierte, ihr Cranberrysaft brachte oder dass er mit ihr zum nächsten Drive-in auf einen Milkshake fahre. Hedys Tochter Deedee berichtet, sie wüsste nicht mehr genau, wie oft ihre Mutter sie anrief. Aber wenn es so weit war, wollte sie mindestens eine Stunde lang reden. Hans Janitschek bestätigt Hedys Telefoniersucht. Sie sprach oft mehr als zwei Stunden mit ihm, „sie war nicht zu stoppen“. Der kleinen Tochter von Hedys Nachbarsfamilie kam es vor, als rede sie 16 oder 18 Stunden lang, ununterbrochen. Eine Freundin aus Hedys Jugendjahren in den USA erinnerte sich, dass die Schauspielerin vormittags sogleich nach dem Aufwachen im Bett zu telefonieren begann. Bis es „dann so weit kam“, dass sie um drei oder vier Uhr morgens anrief. Oder dass sie wütend wurde, wenn Tochter Deedee sie unterbrach und sagte, sie müsse zur Arbeit. „Ja, da wurde es schlimm. Sie sagte: ,Du hast keine Zeit für deine Mutter.‘ Und knallte den Hörer auf. – Ja, sie war diese Art Mutter.“
Der mittlerweile verstorbene Journalist Janitschek hatte im Jahr 2004 noch die vielen Telefonbücher vor Augen, die Hedy besaß und von denen sie ihm erzählte. Es handelte sich dabei um kleine Notizbücher voller berühmter Namen, von „Playboy“-Gründer Hugh Hefner, den sie als „Heffner“ notiert hatte, bis zu längst verstorbenen Größen wie Orson Welles und JFK, den Schauspielkolleginnen und -kollegen Bette Davis, Charlie Chaplin oder Bob Hope. Als Hedy starb, hatte sie den Telefonhörer neben sich im Bett und eines ihrer Telefonnummernbücher lag auf ihrem Bauch. Ihr Telefon war mit Kurzwahlnummern ausgestattet, sodass die sehbehinderte und schwerhörige Ex-Diva ihre Nachbarn und ihre Kinder, die sie alle mehr oder weniger als Dienstboten betrachtete, rasch mit einem Knopfdruck erreichen konnte. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie praktisch am Telefon und vor dem Fernseher. Sie besaß einen Videorekorder, bei dem die Aufnahmetaste mit rotem Nagellack markiert war, damit sie sie schneller finden konnte. Diese Geräte waren die ihr verbliebenen „Fenster zur Welt“. Sie sah bis tief in die Nacht fern, schlief sehr spät ein und wachte gegen Mittag auf – um den täglichen Telefonmarathon zu beginnen.
Erst in Amerika hatte Hedy angefangen, regelmäßig zu telefonieren. Ende der 1930er-Jahre versuchte sie auf Geheiß ihres Arbeitgebers, des Filmmoguls Louis B. Mayer, die Angewohnheiten typisch amerikanischer Mädchen und junger Frauen anzunehmen. Als Erstes schwor sie dem in Europa unter der fortschrittlich eingestellten weiblichen Jugend so populären Bubikopf ab und ließ die Haare wachsen. Bei jungen Amerikanerinnen auf Männerfang war ein eher konservativer Look gefragt. Dazu gehörte – wie übrigens bis heute – längeres Haar. Weiters trug sie in Hollywood weniger Schmuck als im eleganten Wien – „casual“ hieß das Zauberwort; sie lernte die amerikanische „soft ice cream“ lieben und führte lange Telefongespräche, wie es unter den „young girls“ üblich war. Denn in Amerika hatte zu dieser Zeit praktisch jeder Privathaushalt bereits einen Telefonanschluss.
„Heureka!“
Wie sich das Radio, die Schallplatte oder das Telefonieren hierzulande entwickelt hat, kann man im Wiener Phonomuseum nachvollziehen. Der 2016 verstorbene Schauspieler Gerhard Tötschinger präsentierte dort für die ORF-Fernsehsendung „Heureka!“ die Erfindung des Frequenzsprungverfahrens. Zu diesem Zweck steht er vor einer Wiener Telefonzelle aus den 1930er-Jahren, hält ein Smartphone in die Kamera und meint, dass auch die Filmdiva Hedy Lamarr einst – wie Archimedes in Syrakus – „Heureka“ hätte ausrufen können, als sie gewissermaßen „ihr Prinzip“ gefunden hatte. Das von ihr mitentwickelte Frequenzsprungverfahren sei essenziell für viele technische Geräte, die uns heute im Alltag umgeben. Wichtig sei es für das GPS – die Navigationssysteme; in der Telefonie; auch WLAN funktioniere mit diesem Frequenzsprungverfahren. Und eben auch im Smartphone finde diese Technik gegenwärtig Verwendung. Somit wird landläufig gern behauptet, Hedy Lamarr sei die Erfinderin des Handys.
Doch worum ging es genau im Kriegsjahr 1941, als sie die heute als „Frequenzsprungverfahren“ bezeichnete, damals von ihr selbst „Geheimes Kommunikationssystem“ genannte Erfindung zusammen mit dem Musiker George Antheil beim US-Patentamt einreichte?
Als die USA im Dezember 1941 nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor dem Kaiserreich Japan den Krieg erklärten und somit in den Zweiten Weltkrieg eintraten, hatte Hedy Lamarr von Hollywood aus den Krieg in Europa schon lange in den Medien mitverfolgt. Die Horrormeldungen überschlugen sich beinahe täglich. Hedy zitterte um ihr altes Heimatland, das seit 1938 nicht mehr existierte. Jüdische Nachbarn und Freunde aus ihrer Jugend waren verschwunden. Eine Schauspielerin, die als Double mit der jungen Hedy in Berlin zusammengearbeitet hatte, war von den Nationalsozialisten hingerichtet worden. In den US-Zeitungen las sie Berichte über das Novemberpogrom („Reichskristallnacht“), vom Überfall der Deutschen auf Polen, von den Konzentrationslagern. Gerade in Hollywood lebte sie in engem Kontakt mit vielen deutschen und österreichischen „Emigranten“ – wie man sie euphemistisch genannt hat und teilweise noch immer nennt: Lotte Lenya, Kurt Weill, Fritz Lang, Billy Wilder, Peter Lorre, Otto Preminger und Lilli Palmer wohnten in Hedys nächster Nachbarschaft. Die Frau des Wiener Komponisten Erich Wolfgang Korngold, Luzi, formulierte es so: „Wir dachten, wir sind Wiener. Hitler machte uns zu Juden.“
Ausgewandert waren die Emigranten nie aus freien Stücken; sie wurden von den Nationalsozialisten vertrieben. In fremde Länder gezwungen, unter anderem in die USA, deren Sprache sie nicht verstanden, deren Kultur ihnen teilweise lebenslang fremd blieb, in denen sie keine Arbeit oder nie Anerkennung fanden. „Zwischen unserem Heute, unserem Gestern und Vorgestern sind alle Brücken abgebrochen“, schilderte Stefan Zweig sein Gefühl der Wurzel- und Heimatlosigkeit im brasilianischen Exil. Der Wiener mit jahrelangem Domizil in Salzburg gehörte zu den auflagenstärksten und meistübersetzten Autoren seiner Zeit. Sogar in Brasilien kannte man die populären erotischen Novellen und inszenierten historischen Ereignisse dieses Superstars der Weltliteratur. Zweig hatte bereits 1936 vorübergehend in dem südamerikanischen Land gewohnt. In Rio de Janeiro stellte man ihn den führenden Politikern vor, er besuchte das (mittlerweile zu einem großen Teil abgebrannte) Nationalmuseum und hielt seine Eindrücke folgendermaßen fest: „In Rio bin ich sechs Tage lang Marlene Dietrich gewesen.“ Dem manischen Vielschreiber diente das Tagewerk des Schreibens als Therapie gegen die Verzweiflung. Seine Depression, die ihm schon jahrzehntelang zu schaffen machte, verstärkte sich in der von deutschen Einwanderern erbauten kaiserlichen Sommerfrische Petrópolis, wo er seit 1941 in einem kleinen Bungalow mit schöner Aussichtsterrasse lebte. Die heute gerade in den USA wegen vieler Parallelen zu aktuellen Ereignissen wieder viel gelesene, berühmte „Welt von Gestern“ verfasste er dort in nur einem Monat. Doch längerfristig kam Zweig im tropischen Paradies in Südamerika nicht zurecht, sein Erfolg stagnierte und er beging zusammen mit seiner jungen Frau Lotte Selbstmord – ein gar nicht so seltenes Emigrantenschicksal.
In den USA Fuß zu fassen war für jede und jeden enorm schwierig, gerade im Filmbusiness, da der deutsche Akzent für fast alle Rollen ein kaum zu bewältigendes Hindernis darstellte. Hedy Lamarr gehörte zu den ganz wenigen, die „es“ nicht nur schafften, sondern denen die neue Heimat kollektiv zu Füßen lag. Trotzdem: In den Werken über die zahlreichen Emigranten in Amerika fehlt der Name Hedy Lamarr zumeist. Denn die Schauspielerin erreichte New York bereits im September 1937. Sie dürfte wohl geahnt haben, was auf Österreich zukommen sollte. Dennoch floh sie damals hauptsächlich vor ihrem ersten Ehemann Fritz Mandl und nicht vor einem Regime, das sie aufgrund ihrer „rassischen“ Herkunft bald verfolgen würde.
Obwohl sie sich bis zu ihrem Lebensende nach eigener Aussage nie als Amerikanerin gefühlt hat, war sie dem Land unendlich dankbar, das ihr nicht nur ein gesichertes freies Leben, sondern eine geradezu astronomische Karriere ermöglicht und auch ihrer Mutter Trude – der Vater war bereits 1935 gestorben – eine zweite Heimat geboten hatte. Jahrelang war eine von Hedys schlimmsten Belastungen das ungewisse Schicksal ihrer Mutter gewesen, die aus einer jüdischen Familie in Budapest stammte. Hedy versuchte alles, um ihr eine Einreise in die USA zu ermöglichen, doch dauerte es vier Jahre, bis Trude Kiesler endlich ihre lange Flucht aus Wien bei ihrer Tochter in Los Angeles beenden konnte. Das Wiedersehen der beiden Frauen nach fünf Jahren Trennung ließ Hedy von einer Schar von Fotografen und Journalisten dokumentieren. „Family Life“ spielte sich bei Hedy hauptsächlich vor Pressekameras ab. In Wahrheit pflegte sie weder zu ihrer Mutter noch später zu ihren Kindern enge und liebevolle Beziehungen. Hedys Mutter hatte viel Zeit im von den Deutschen bombardierten London zubringen müssen und wartete schließlich in Kanada auf die ersehnte Einreise in die USA. Im Februar 1942 wohnte sie kurze Zeit bei Hedy, nahm sich aber bald ein eigenes Apartment.
Hedys Mission
Hedy selbst wurde in den Jahren 1942 bis 1945 nicht müde, auf die Geschehnisse im „Dritten Reich“ hinzuweisen. Als Wienerin sei ihr die Bedeutung von Freiheit viel klarer als fast allen in Amerika geborenen Menschen, sagte sie vor amerikanischen Soldaten, die in den Krieg zogen. Amerikaner würden ihre Freiheit als verbrieftes Recht, als eine Selbstverständlichkeit ansehen. Doch sie habe in Europa genug erlebt, um zu wissen, dass Freiheit keineswegs selbstverständlich sei. Im Jahr 1931 war Hedy nach Berlin gegangen, um im Zentrum des deutschsprachigen Films ihre Karriere als Jungschauspielerin voranzutreiben. Zweifellos erlebte sie zwei Jahre vor Hitlers „Machtergreifung“ die aggressiven Aufmärsche der nationalsozialistischen Verbände in den Straßen und auf den Plätzen der zukünftigen „Reichshauptstadt“. Auf dem „Ku’damm“ etwa lief man Gefahr, von einer SA-Horde verprügelt zu werden, der man nicht „arisch“ genug aussah. Tagtäglich mussten Hedy und ihre Kolleginnen und Kollegen antisemitische Parolen in der NS-Presse lesen und waren als Schauspielerinnen und Schauspieler den ständigen Angriffen auf das „jüdisch dominierte“ Film- und Kulturleben der Weimarer Republik ausgesetzt. Sie hatte nichts davon vergessen.
Für die Freiheit müsse man kämpfen, sagte sie in den USA, man müsse sie erringen und dann müsse man sie verteidigen. Sie wisse um die Politik der Nationalsozialisten und sie werde alle Bemühungen unterstützen, das NS-Regime aus der Welt zu schaffen. Dementsprechend berichtete die Zeitschrift „Hollywood Citizen-News“ bereits 1941 über Hedys Anstrengungen, den USA bei der Verteidigung der Freiheit zur Seite zu stehen. Aufmerksam verfolgte die Ex-Gattin des bedeutendsten Waffenhändlers im Europa der 1930er-Jahre die Entwicklung des Atlantikkrieges. Die europäischen Alliierten waren dringend auf Nahrungsmittellieferungen, Waffen und Soldaten aus den USA angewiesen. Im Winter 1942 standen deutsche U-Boote kurz davor, die Lebenslinien zwischen Großbritannien und den USA zu durchtrennen. Die Torpedos der deutschen U-Boote versenkten Tausende Handelsschiffe. 75.000 Mann starben, Millionen Tonnen an Lebensmitteln versanken auf dem Meeresgrund. Churchill wird später sagen, seine größte Sorge seien die Angriffe der deutschen U-Boote gewesen. Für den Gegenangriff entwickelten die Alliierten möglichst präzise Torpedos, doch nach dem Abschuss war der Kurs eines Torpedos kaum mehr veränderbar. Eine Möglichkeit zur Lenkung des Torpedos erkannte man in einem auf Funk basierenden Leitsystem, das sich jedoch der Störung durch den Feind entziehen musste. Hedy war der Ansicht, sie habe eine Lösung für die US-Militärs gefunden. Sie begab sich auf die Suche nach einer Person, die ihr bei der Umsetzung ihres Gedankens behilflich sein könnte.
Wild Child
Vor Kurzem hatte Hedy den selbst ernannten ehemaligen „Bad Boy of Music“, George Antheil, kennengelernt. Der in den USA geborene Musiker hatte in Europa studiert, seine Eltern waren deutsche Einwanderer gewesen. Das spektakuläre Werk „Ballet Mécanique“ wurde in mehreren Städten Europas aufgeführt und machte den schillernden Komponisten und Konzertpianisten schlagartig berühmt. Es war nicht als Tanz für Menschen, sondern für selbstspielende Klavierautomaten (Pianolas) gedacht. Ähnlich wie Hedys Film „Ekstase“ führte Antheils etwa 30-minütige atonale Komposition zu einem Aufruhr in der Kulturszene. Das von Igor Strawinskys „Le sacre du printemps“ inspirierte Stück für 16 automatische Pianolas wurde von Blechblasinstrumenten ergänzt, fiel aber vor allem durch den „Begleitlärm“ von Propellern, Ventilatoren, später sogar Düsenjägern auf. Die Kakophonie wurde gelegentlich von 20 Sekunden Totenstille unterbrochen. Als das „Ballet Mécanique“ 1926 in Paris vor großem Publikum seine Premiere feierte, brach mehr oder weniger die Hölle los. Antheils Unterstützer aus der Surrealistenszene wie Marcel Duchamp oder gute Bekannte wie James Joyce, T. S. Eliot oder Ezra Pound versuchten, die Unmutsbekundungen von anderen Konzertbesuchern zu übertönen. Zischen, Buhen, Pfeifen und Johlen sowie wilder Applaus beherrschten die Szenerie. Die Aufführung ging trotz Streitereien zwischen Freund und Feind munter weiter, und als die Propeller einsetzten, spannten Leute im Publikum Schirme auf und stellten ihre Krägen hoch. Manche waren der Ansicht, dass ihr Gehör durch den noch nie da gewesenen Krach dauerhaft Schaden nehmen könnte, und versuchten, die Vorstellung zu verlassen. Das Toupet eines Herrn flog wegen des Propellerluftzugs durch den Raum. Der Tumult hatte bald saalschlachtartigen Charakter erreicht und führte dazu, dass der Amerikaner Antheil bei seinen späteren Konzerten immer eine Pistole auf seinem Flügel liegen hatte, um sich gegebenenfalls den Weg nach draußen freischießen zu können, sollte man ihn wegen seiner Kompositionen angreifen. Jedenfalls war er bald das Stadtgespräch von Paris und das Publikum erwartete mit gespannter Vorfreude den nächsten Skandal.