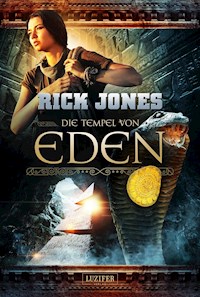Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ritter des Vatikan
- Sprache: Deutsch
Sie sind Elitesoldaten der ganz besonderen Art, denn sie stehen allein im Dienste Gottes: DIE RITTER DES VATIKAN In Washington, D.C. werden die verstümmelten und mit dem Kopf nach unten gekreuzigten Leichen dreier Priester aufgefunden. Die einzige Spur führt zu einem fünfhundert Jahre alten Orden, den Heiligen der Nacht, die sich als Richter über Verfehlungen gegenüber den fundamentalen katholischen Lehren der Kirche sehen. Shari Cohen, die wieder für das FBI tätig ist, wird mit den Ermittlungen betraut und darin von einem Team von Vatikanrittern unterstützt. Doch als selbst der Papst ins Visier der Heiligen der Nacht gerät, ist es an Kimball Hayden, sich dem gesichtslosen Feind entgegenzustellen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Heiligen der Nacht
Die Ritter des Vatikan – Band 13
Rick Jones
This Translation is published by arrangement with Rick JonesTitle: NOCTURNAL SAINTS. All rights reserved. First published 2020.Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: NOCTURNAL SAINTS Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-789-1
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Washington, D.C. 21:47 Uhr
Da Pater O’Brien schon immer den Verlockungen des Fleisches erlegen war, hatte er bereits vor Jahren diese Schwäche für sich gerechtfertigt und betrachtete das Zölibat eher als eine Empfehlung denn als ein Gebot. Er diente nun schon länger als ein Jahrzehnt als katholischer Priester der Cathedral of the Sacraments in Washington, und dieser dunkle Fleck der Schande war zu einer Art offenem Geheimnis geworden.
Über Monate hinweg hatte er seine Fleischeslust mit einer jungen Frau namens Lashonda Jackson gestillt und sie für sexuelle Handlung mit Geld bezahlt, welches er dem Opferstock entnommen hatte – Geld, das eigentlich für die Armen gespendet worden war. Sie stammte aus Baltimore, eine verlorene Seele, deren Unterarme seit ihrem achtzehnten Lebensjahr die Spuren ihrer Heroinsucht trugen.
Wie so oft stattete ihr Pater O’Brien einen regelmäßigen Besuch ab, gab Lashonda das Geld, welches eigentlich für die Armen bestimmt war, und ließ sich seine Bedürfnisse befriedigen. Danach blickte Pater O’Brien auf Lashonda hinab und verfluchte sie als »Hure« und »Sukkubus des Satans«. Dabei klang er wie ein Prediger, riss die Fäuste in die Höhe und sein Zorn spiegelte sich in den Venen an seinem Hals wider, die wie dicke Seile hervortraten, während er sie verfluchte, sie wegen ihrer Sündhaftigkeit als Dirne beschimpfte und ihr die Schuld für das gab, was gerade passiert war. Nachdem er seine Handlungen auf diese Weise gerechtfertigt und Lashonda Jackson alle Schuld zugeschoben hatte, legte er eine Fünfzig-Dollar-Note auf den Nachttisch, neben ihren Kochlöffel und die Nadel – etwas, das er stets nach seiner tadelnden Ansprache tat.
Danach schlug Pater O’Brien den Kragen seiner Jacke hoch, verließ das zweistöckige Appartementgebäude und wanderte in die angrenzende Gasse. Dort zündete er sich eine Zigarette an, nahm einen Zug, und begab sich dann durch die Gasse in Richtung des Pfarrhauses, welches weniger als eine Meile entfernt lag.
Die ganze Zeit über brabbelte er wütend in sich hinein, verfluchte die »Hure« und rechtfertigte sich, ihrem lasziven Zauber wehrlos ausgeliefert gewesen zu sein. Aber er würde trotzdem für sie beten.
Eine Katze, die in einem Mülleimer gewühlt hatte, verschwand zischend in den Schatten, so sehr von dem Priester erschreckt, wie dieser sich vor ihr erschrocken hatte. Pater O’Brien legte sich die Hand mit der Zigarette an die Brust und atmete erleichtert auf, bevor er weiterlief.
Da hörte er ein Flüstern aus dem Dunkel, kaum vernehmbar. »Du hättest sie retten sollen, Pater.«
Pater O’Brien drehte sich um, konnte aber außer dem Mantel der Dunkelheit nichts erkennen.
»Hallo? Ist da jemand?«
Stille.
Pater O’Brien wich ein paar Schritte zurück, bevor er sich wieder umdrehte und die Gasse entlangeilte.
»Du hättest sie erretten sollen, Paaaateeeeer.«
Wieder dieses Flüstern, doch dieses Mal lauter.
Wieder drehte sich Pater O’Brien zu den dunklen Schatten um, die ihn zu verfolgen und näherzukommen schienen. »Ist da jemand?«, rief er erneut, und seine Anspannung war ihm deutlich anzuhören. »Ist da jemand?«
Nichts.
Eigenartigerweise aber trat er einen Schritt weiter in die Dunkelheit, anstatt vor ihr zurückzuweichen. »Ich bin ein Priester«, sagte er. »Ich kann Ihnen helfen! Ist jemand hier?«
Nichts.
Doch einen Moment später hörte er die Stimme wieder, klar und deutlich, aber aufgrund der sanften Aussprache der Worte eher an den Dampf erinnernd, der zischend aus einem Rohr entwich. »Du hättest sie erreeeeeeetten können, Paaaateeeeer.«
»Wer ist da?«
»Du hättest sie erreeeeeeetten können … Paaaateeeeer … O'Brieeeeeeen.«
Der Priester taumelte zurück.
Und dann regten sich die Schatten, verwandelten sich zu unzähligen Gliedmaßen mit ausgebreiteten Fingern, die nach ihm griffen und ihn zu sich ziehen wollten. Aber die Silhouette wirkte gleichzeitig wie eine zusammenhängende Masse, die sich wie Zellen unter dem Mikroskop teilten, um sich kurz darauf wieder zusammenzufinden. Eine dunkle Wesenheit.
»Du hättest sie erreeeeeeetten können … Paaaateeeeer … O'Brieeeeeeen«, sagte das Wesen. »Und nicht ihr die Hilfe verweeeeeeehren, die sie brauuuuuuuchte.«
»Wer sind Sie?«, rief der Priester voller Angst. »Was wollen Sie von mir?«
Die sich bewegenden Gliedmaßen kamen näher, streckten ihre schattenhaften, wurmähnlichen Finger nach ihm aus.
»Neeeeiiiin!« Als Pater O’Brien herumwirbelte, um der herannahenden Welle aus Dunkelheit zu entkommen, wurde er von einem anderen Umriss umfangen, der sich hinter ihm befunden hatte. Er war groß und auf geradezu obszöne Weise kräftig, mit vielen Armen, die ihn zu Boden zerrten. »Neeeeiiiin!«
»Du hättest sie erreeeeeeetten können … Paaaateeeeer … O'Brieeeeeeen. Du hättest ihr nicht die Hilfe verweeeeeeehren dürfen, die sie brauuuuuuuchte.«
Hände hielten ihn am Boden fest. Über ihm waberten unzählige Umrisse, die sich mal in eine, mal in viele Formen teilten oder verschmolzen, von denen aber keine eine erkennbare Form bildete.
Pater O’Brien versuchte, sich zu wehren, doch es war hoffnungslos. »Wer seid ihr?«, schrie er. Aber sein Verstand dachte eigentlich: Was seid Ihr?
»Duuuuuu wirst in die Hölle faaaahren, Paaaateeeeer … auf Menschen wie dich waaaartet dort ein gaaaaanz besonderer Ooooort.«
Und dann begriff Pater O’Brien. Es war ein Dämon mit vielen Armen, der gekommen war, um sich seine Seele zu holen, die sich über viele Jahre hinweg, und während er den geistlichen Kragen eines katholischen Priesters getragen hatte, einer ganzen Reihe von Sünden schuldig gemacht hatte.
»Nein!« Pater O’Brien schrie, versuchte, nach dem Schemen über ihm zu schlagen, aber dieser presste seine Arme zu Boden.
»Die Stange«, rief jemand. »Wer hat die Stange?«
Diese Stimme hörte sich für Pater O’Brien so gar nicht nach einem Dämon an, sondern eher nach einem Menschen.
»Ich habe sie«, meldete sich eine andere Stimme. Aus der Gasse trat ein Umriss in Pater O’Briens Sichtfeld, dessen Gesichtszüge aber vom Schein einer entfernten Straßenlaterne, der ihn wie einen Heiligenschein umgab, verborgen wurde. In seiner Hand hielt er eine Art Stab. »Dreht ihn auf den Bauch«, befahl er.
Viele Hände zwangen den Priester, sich auf den Bauch zu drehen, und trotz seiner schwachen Gegenwehr legte ihm jemand die Stange auf den Rücken und begann, seine Arme daran festzubinden.
»Was tun Sie da?« Panik hatte Pater O’Brien ergriffen.
»Seiiiii … stiiiiill.« Da war wieder diese dämonische Stimme, die sich von den anderen unterschied.
»Bitte, jemand muss mir helfen!«
Dann schlug jemand Pater O’Brien kräftig genug gegen den Kopf, dass ihm schwarz vor Augen wurde.
Einen Augenblick später, als er wieder zur Besinnung kam, sah er, dass einer der Umrisse etwas in der Hand hielt. Es war ein Messer, mit einer besonders scharfen Spitze.
»Du hättest sie erretten sollen, Pater«, sagte die Stimme, »anstatt sie zu missbrauchen. Das hätte deine Lebensaufgabe sein sollen: Den Verlorenen zu helfen, anstatt sie noch tiefer in die Dunkelheit zu führen. Du hast nicht nur deinen Glauben, sondern auch dein Amt innerhalb der Kirche verraten.«
Pater O’Brien versuchte nach dem Schlag seine Gedanken zu ordnen. Die Stimme, die zuvor noch dämonisch geklungen hatte, hörte sich nun normal und unverzerrt an. Dann wurde ihm klar, dass er sich das Zischen in der Stimme nur eingebildet haben musste, so wie einem in kritischen Momenten das Ticken einer Uhr lauter erschien. Vielmehr war es das Produkt seiner inneren Dämonen, das zu ihm gesprochen hatte, als jene, die ihn nun an dieser Stange festbanden.
»Wieso tun Sie mir das an?«, fragte der Priester.
Nachdem man ihn festgezurrt und wieder auf den Rücken gedreht hatte, erklärte ihm der Mann mit dem Messer: »Weil dir die Gabe verliehen wurde, durch die Macht deiner Worte und die Kunst der Predigt den Menschen den Weg in Gottes Arme zu weisen. Aber du hast diese Gabe missbraucht und bist zu einem Schandfleck für deinen Glauben geworden. Und das darf sich nicht wiederholen, Pater. Nie wieder.«
»Wer seid ihr?«
Viele Schatten und Umrisse ragten nun drohend über ihm auf, blickten auf ihn herab, aber jedes der Gesichter blieb im Dunkeln verborgen. Keine Umrisse, keine Gesichtszüge, gar nichts.
»Was werdet ihr mit mir tun?«, fragte der Priester.
Der Mann mit dem Messer antwortete: »Du bist deines Amtes unwürdig, Pater. Eine verdorbene Seele. Die Kirche ist ohne dich besser dran.« Der Umriss führte das Messer an Pater O’Brien heran, und dieser begann zu schreien, als sich die Klinge tief in ihn hineinbohrte. Dann legte ihm jemand eine Hand auf den Mund, und der Umriss mit dem Messer fuhr damit fort, die Klinge in ihn hineinzustoßen.
Kapitel 1
Washington, D.C. Am nächsten Morgen
Als Spezialagentin Shari Cohen von einem Scharfschützen lebensgefährlich verletzt worden war, was darin resultierte, dass sie einen Teil ihres linken Lungenflügels verlor, bot ihr das Department eine volle Rente an, die sie jedoch ablehnte. Stattdessen ließ sie sich zur Ermittlerin herunterstufen, jedoch mit ihrem ursprünglichen Gehalt. Nun war sie Teil der Untersuchungseinheit des FBI, und einer ihrer Aufgabenbereiche lag in der Untersuchung von Serienmorden.
Noch bevor sie an diesem Morgen das J.-Edgar-Hoover-Building erreichen konnte, wurde sie bereits zu einem Tatort eine Meile nördlich gerufen, in ein Gebiet, das sie nur allzu gut kannte. Es war der zwielichtige Teil Washingtons, mit heruntergekommenen Wohnhäusern, deren Wände mit Graffiti beschmiert waren, bekannt dafür, ein Sammelplatz für Drogendealer und Prostituierte zu sein.
Shari fuhr bis zu dem gelben DO-NOT-CROSS-Absperrband heraus, stieg aus ihrem Wagen, zeigte ihre Dienstmarke vor und wurde in den abgesperrten Bereich vorgelassen, der von Detective Darce Earl vom Metropolitan Police Department geleitet wurde.
Er kam auf sie zu, um sie zu begrüßen. »Das liegt eigentlich nicht in der Zuständigkeit des FBI … zumindest noch nicht.«
Sie lächelte. »Wie geht es Ihnen, Darce?«
»Das sollte ich eigentlich Sie fragen«, antwortete er und lächelte ebenfalls. Shari Cohen hatte etwas an sich, das ihm gefiel. Vielleicht waren es ihre Augen, die wie Edelsteine funkelten, oder ihr rabenschwarzes Haar oder ihre karamellfarbene Haut. In seinen Augen gab es kaum eine schönere Frau. »Ich bin froh, dass es Ihnen wieder besser geht«, ließ er sie wissen. »Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben.«
Es war knapp, sagte sie zu sich selbst. Wäre da nicht die Stimme eines Mannes am anderen Ende der Welt gewesen, eines Mannes, der mit ihr durch die Dunkelheit und ins Licht gegangen war, hätte ich aufgegeben. Selbst, als ich im Koma lag, war er bei mir, hielt meine Hand und führte mich aus der Dunkelheit, die er wie kein Zweiter kannte. Und erst, als ich das Licht erreichte, ließ er mich los. Als ich mich umdrehte, um ihm zu danken, war mein Retter wieder in den Schatten verschwunden, in denen er sich am wohlsten fühlte.
»Ich bin froh, wieder im Dienst zu sein.«
»Aber so gerne ich Sie auch wiedersehe, bleibt es dabei: Das FBI hat hier keine Zuständigkeit.«
»Nun, die Entscheider sehen das offenbar anders«, erwiderte sie, »sonst hätten sie mich wohl kaum hierher zitiert.«
»Zwei Morde lassen wohl kaum auf das Werk eines Serienmörders schließen«, sagte er. Ein paar Tage zuvor war bereits ein anderer Priester am Stadtrand von D.C. ermordet aufgefunden worden.
»Nein, aber es war höchstwahrscheinlich der gleiche Täter«, antwortete sie. »Und da wir hier in D.C. sind …« Sie ließ den Rest unausgesprochen, und dann fragte sie: »Also, wo ist das Opfer, Darce?«
Der Detective deutete nach oben.
Über ihnen schwang Pater O’Brien in einer leichten Schaukelbewegung hin und her. Der Priester hing in der Pose eines Gekreuzigten mit dem Kopf nach unten von einer Kette. Die Kette war um seine Knöchel geschlungen und an einer schmiedeeisernen Feuerleiter befestigt. Seine Hose fehlte, zusammen mit seinen Genitalien.
»Verstümmelung«, kommentierte sie den Anblick.
Darce Earl nickte. »Die Genitalien konnten bis jetzt noch nicht gefunden werden.«
»Aber wir wissen sicher, dass es sich um die gleichen Leute – oder die gleiche Person – handelt?«
»Ganz sicher sogar.« Er gab ihr ein Zeichen, ihm zu folgen. »Hier entlang.« Sie umrundeten einen Müllcontainer. Dahinter war mit dem Blut Pater O’Briens an die Ziegelwand gekritzelt worden:
DIE
HEILIGEN
DER
NACHT
»Die Heiligen der Nacht«, las sie vor.
»Das Gleiche wie letzte Woche, als wir den anderen Priester fanden, der ebenfalls verkehrt herum gekreuzigt worden war. Auch bei ihm waren diese Worte mit seinem Blut an die Wand geschmiert worden.«
»Die Heiligen der Nacht.« Sie sah ihn an. »Sagt Ihnen das irgendetwas?«
»Gar nichts«, antwortete er. »Wir haben die Datenbanken nach Banden, extremistischen Vereinigungen und Personen mit Verbindungen zu Terrororganisationen abgesucht – aber nichts gefunden. Wir glauben daher, es mit einem aufstrebenden Kult zu tun zu haben. Vielleicht ein Orden, den es bislang noch nicht gab.«
»Möglich«, sagte sie. »Was können Sie mir über den Priester sagen?«
»Sein Name lautet Stephen James O’Brien. Er arbeitete seit über einem Jahrzehnt in der Cathedral of the Sacraments. Obwohl er in seiner Gemeinde hoch angesehen war, schien der gute Pater eine Schwäche für die Sünden des Fleisches zu haben.«
»Die Sünden des Fleisches?«
»Er verbrachte gern Zeit bei Prostituierten. Tatsächlich wurde sein Fall sogar von einem offiziellen Kirchenanwalt des Vatikan untersucht, etwa seit dem Zeitpunkt, als der erste Priester ermordet wurde, Pater McKenzie.«
»Ein Zufall?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich das noch nicht sagen.« Dann deutete er auf Pater O’Briens sanft schwingende Leiche. »Aber nach diesem Vorfall und diesem Gekritzel«, dabei deutete er auf die blutige Handschrift an der Wand, »hat der Vatikan großes Interesse an beiden Fällen gezeigt.«
»Wirklich?«
»So wurde es mir zumindest erzählt.«
»Vielleicht ist das auch der Grund, wieso ich hier bin«, sagte sie zu Darce. »Vielleicht steckt noch mehr hinter dieser Sache, als es den Anschein hat.«
Darce Earl sah sie an. »Haben Sie nicht Beziehungen in den Vatikan?«
»Das hatte ich«, antwortete sie. Und für einen kurzen Moment, nur eine Sekunde lang, sah sie Kimball Hayden vor ihrem inneren Auge. »Aber das ist schon eine ganze Weile her.«
Während das CSI den Tatort weiter untersuchte und Spuren sicherte, verbrachte Shari Cohen die nächsten drei Stunden am Tatort damit, Informationen über Pater O’Briens Gewohnheiten zu sammeln, über seine Freunde, seine möglichen Feinde und jene Personen, die ihn zuletzt noch lebend gesehen hatten. Nachdem sie davon erfahren hatte, dass Pater O’Brien eine besondere Vorliebe für eine Prostituierte in der Innenstadt hegte, beschloss Shari, dieser Spur als Erstes nachzugehen.
Als Darce Earl sie auf dem Weg zu ihrem Wagen auf einen Kaffee einlud, irgendwann, lächelte sie und lehnte dankend ab, was diesen dazu veranlasste, mit der Hand nach seinem Herzen zu greifen, als wäre er gerade tödlich verwundet worden.
Sie stieg in ihren Wagen und machte sich mit dem Bild von Darce Earl in ihrem Rückspiegel daran, eine Frau namens Lashonda Jackson aufzusuchen.
Kapitel 2
Das Büro des Monsignore Dom Giammacio Vatikan-Stadt
Kimball Hayden saß dem Monsignore gegenüber auf einem Stuhl. Auf Drängen von Bonasero Vessucci, dem vorherigen Papst und einem Mann, der für Kimball weit mehr als nur ein Geistlicher gewesen war, war entschieden worden, dass Kimball in Gesprächen mit dem Psychologen seine tiefsten Gedanken erkunden sollte. Obwohl Kimballs Versuche, sein inneres Licht zu finden, kaum mehr als eine erstickende Flamme und ein müdes Flackern zutage zu fördern schienen, spürte er gleichzeitig ein fürchterliches Gefühl innerer Leere.
Auf einem Beistelltisch zwischen den beiden Männern befanden sich zwei Dinge: Das weiße Band eines katholischen Kollars und ein Aschenbecher, der von Zigarettenstummeln bereits überquoll.
Nachdem der Monsignore seine Zigarette ausgedrückt hatte, zündete er sich sofort eine weitere an. Dann, und mit der Zigarette zwischen Zeigefinger und Mittelfinger geklemmt, deutete er auf das weiße Band auf dem Tisch. »Haben Sie schon eine Entscheidung getroffen?«, fragte der Monsignore.
»Worüber?«
»Sie wissen, wovon ich spreche, Kimball. Sie haben das Kollar auf meinen Tisch gelegt.«
Kimball starrte das blütenweiße Band an. Zögerte. Seufzte.
»Wo liegt das Problem, Kimball?«, bohrte der Monsignore schließlich nach.
»Ich legte es an, als ich mein Quartier besuchte«, antwortete Kimball.
»Und?«
»Es fühlte sich richtig an. Es fühlte sich … gut an.«
Der Monsignore beugte sich zu Kimball heran. »Aber?«
Als Kimball ihm nicht antwortete, sagte der Monsignore: »Ich bin nicht Ihr Feind, Kimball, das wissen Sie. Reden Sie mit mir.«
»Sie wissen, wie sehr ich diese Sitzungen hasse«, erklärte Kimball.
»Das tue ich«, gab der Monsignore zu. »Aber es waren Sie, der zu mir kam.«
Kimball nahm das Band vom Tisch und hielt es vor sich, als würde er es aufmerksam studieren wollen. Es hatte eine Zeit gegeben, da war es sein wertvollster Besitz als Vatikanritter gewesen, eine ständige Erinnerung an sein Ziel, das Licht zu finden. Nun aber war es zu einer ständigen Erinnerung an sein Scheitern in diesem Unterfangen geworden. Das Licht schien nicht mehr als eine Verlockung zu sein, die unerreichbar für ihn blieb.
»Kimball?«
Kimball ließ das weiße Band sinken, spielte aber weiter damit, indem er mit Daumen und Zeigefinger daran rieb.
»Wieso sind Sie hier?«
Kimball Hayden schloss die Augen, seufzte und sagte: »Erinnern Sie sich noch an den Tag, als Sie nach Venedig kamen – in diese Bar, um mich zu sehen?«
Der Monsignore nickte. »Natürlich.«
»Sie legten den geistlichen Kragen vor mir ab, und ich wies ihn zurück.«
»Ich erinnere mich.«
Kimball hielt das weiße Band so, dass der Monsignore es sehen konnte. »Ich habe es in meiner Kammer gefunden«, erzählte er. »In einer Schublade in meinem Nachttischschränkchen.«
»Es lag dort, wo Sie es zurückließen, Kimball. Man ließ Ihr Quartier unangetastet, in der Hoffnung, dass Sie eines Tages zu uns zurückkehren würden.«
Dann sah der Monsignore, wie sich das Weiße in Kimballs Augen rot zu färben begann. Sein Adamsapfel hüpfte auf und ab, als versuchte er, einen Kloß im Hals hinunterzuschlucken.
»Geht es Ihnen gut, Kimball? Brauchen Sie eine Pause?«
Kimball schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er. »Mir geht es gut.«
»Dann reden Sie mit mir.«
Kimball wedelte mit dem Kollar, um seiner Wichtigkeit Ausdruck zu verleihen. »Wissen Sie, was es einst für mich repräsentierte?«, fragte er den Monsignore.
Dom Giammacio nickte. »Hoffnung.«
»Genau … Hoffnung.« Er legte das Kollar zurück auf den Tisch, aber weit von dem Aschenbecher entfernt, damit seine Makellosigkeit nicht von der Asche beschmutzt wurde.
»Und nun haben Sie das Gefühl, dass Ihre Suche nach dem Licht hoffnungslos ist, nicht wahr? Dass es Ihnen nicht möglich sein wird, aus dem Grau treten? Oder dass die Dunkelheit schon zu sehr von Ihnen Besitz ergriffen hat, um ihr zu entkommen? Ist es das, was Sie glauben, Kimball?«
Kimball schwieg.
»So, wie ich Sie kenne, Kimball, resultiert Ihr Schweigen aus Wut und Frustration … und nicht aus Bedauern.«
»Jedes Mal, wenn ich einen Schritt auf das Licht zutrete, tue ich gleichzeitig etwas, das mich wieder zwei Schritte zurückwirft. Ja, ich bin wütend, sehr sogar. Aufgrund der Entscheidungen, die ich treffe, werde ich niemals erlöst werden. Ich war immer schon jemand, der zu Kurzschlussreaktionen neigte. Wenn ich eine Bedrohung sehe, haben die Regeln der Kirche für mich keine Bedeutung mehr. Ich sehe es als meine Verpflichtung an … und umgehe bewusst die Gebote der Kirche, auch wenn ich weiß, dass dafür kein Licht am Ende des Tunnels auf mich warten wird.«
»Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, dass Gott uns zugesteht, jemanden zu töten, um damit sein eigenes Leben retten zu können? Oder das Leben eines Menschen, der sich nicht selbst schützen kann?«
»Dann rechtfertigen Sie also Mord, Monsignore?«
»Sollte ich das?«
»Genau das meine ich. Es scheint keine wirkliche Antwort auf diese Frage zu geben.«
Der Monsignore drückte seine Zigarette in dem Aschenbecher aus. »Sie sollten nicht einen vorsätzlichen Mord mit der Rettung anderer gleichsetzen, Kimball.« Nachdem er sich eine weitere Zigarette angezündet hatte, ließ sich der Monsignore in seinen Sessel zurücksinken und schlug die Beine übereinander. »Es gab eine Zeit, in der Sie aus einem Pflichtgefühl heraus als Auftragsmörder für Ihre Regierung töteten. Etwas, von dem Sie glaubten, dass es gerecht sei. Aber dann hatten Sie eine Offenbarung, die Ihnen die Augen öffnete, nicht wahr? Im Irak. Kurz, nachdem Sie diese beiden Jungen töteten.«
Kimball konnte sich noch gut an diesen Zwischenfall erinnern. Während seiner Mission, Saddam Hussein aufzuspüren und zu ermorden, war er von zwei jungen Schafhirten entdeckt worden, was Kimball veranlasste, sie beide umzubringen. Danach hatte er eine göttliche Wiedererweckung seines Gewissens erfahren. Anstatt mit der Mission fortzufahren, hatte er sie abgebrochen, nachdem er die beiden Jungen im Wüstensand begraben hatte. Dann war er schließlich in einer kleinen Bar in Venedig gelandet, wo er Bonasero Vessucci getroffen hatte, seinen Retter, der ihm eine Chance geboten hatte, das Licht zu erreichen. Und Kimball hatte sie dankend angenommen.
Aber nun, wo Bonasero von ihnen gegangen war, ein Mann, den er wie seinen eigenen Vater geliebt hatte, überkam Kimball das Gefühl, ihn auf vielerlei Arten enttäuscht zu haben. Ich töte Menschen, dachte er bei sich. Das ist es, was ich tue, worin ich gut bin. Und aus diesem Grund würde er immer an der Grenze zwischen der Dunkelheit und den Grauzonen gefangen bleiben.
»Ich sehe sie«, sagte Kimball schließlich.
»Sie sehen wen?«
»Diese Jungen. Zehn, maximal zwölf Jahre alt. Ich sehe deutlich vor mir, wie die Kugeln sie niederstrecken. Beides saubere Schüsse. Jede Nacht suchen sie mich in meinen Träumen heim, mit qualvoll verzerrten Gesichtern, und rufen nach mir mit geisterhaftem, verwünschtem Kreischen.«
»Jede Nacht?«
Kimball nickte. »Zusammen mit all den anderen, die ich über die Jahre tötete – sie alle verfolgen mich durch den Sand, der mich an meiner Reise zur Sonne, ins Licht hindert.«
»Und diese Sonne ist das Licht, nach dem Sie suchen?«
»Sie ist das Licht. Und mit jedem Schritt, mit dem ich mich ihr nähere, und den Toten, die mich verfolgen, geht sie weiter unter, bis ich komplett in Dunkelheit versinke … das Licht lässt mich im Stich.«
»Das Licht, von dem wir sprechen, Kimball, ist nicht das Licht aus Ihren Träumen … sondern das Licht in uns selbst. Es ist ein Funke, den jeder von uns besitzt. Erst müssen Sie diesen Funken in eine Flamme verwandeln, und dann müssen Sie ihr Raum zum Atmen geben. Und mit diesem Atem wird das Licht wachsen. Aber in Ihnen, Kimball, spüre ich einen ersterbenden Funken.«
Kimball blickte auf den Kragen auf dem Tisch zwischen ihnen hinunter.
»Nehmen Sie ihn«, ermutigte ihn der Monsignore. »Legen Sie ihn an. Er gab ihnen schon einmal den nötigen Atem, Ihren Funken in wahres Leuchtfeuer zu verwandeln. Er kann ihn wieder zum Lodern bringen.«
Kimball nahm das Kollar zwischen die Finger. Es fühlte sich gut an, glatt und weich.
»Na los, Kimball. Was gibt es da nachzudenken? Sie waren ein wertvolles Instrument der Kirche. Und wann immer Sie ein Leben nahmen, retteten Sie dafür das Leben hunderter anderer. Das bloße Bemühen, ein Retter für andere zu sein, hat die Flamme der Erlösung ganz sicher wieder entfacht.« Dann deutete der Monsignore auf Kimballs Hemdkragen. »Legen Sie ihn an«, wiederholte er. »Bitte.«
Kimball seufzte gedehnt, aber dann steckte er sich das Band schließlich in den Kragen. Es fühlte sich nicht nur gut, sondern ganz natürlich an.
»Das ist, wer Sie sind«, erklärte der Monsignore. »Kein Zweifel.«
Kimball bedachte den Geistlichen mit einem gespielten Lächeln. Das hoffe ich.
Aber er spürte keine Funken in sich oder dessen Wiederbelebung. Der Monsignore musste ihm die Zweifel angesehen haben.
»Es wird Zeit brauchen, Kimball«, erklärte er ihm. »Dieser Funke ist genau das, nur ein winziges Glimmen, das erst wachsen muss. Jetzt müssen Sie es zum Lodern bringen und in den innigen Wunsch verwandeln, dem Lichte zu dienen … was schon die ganze Zeit in Ihnen schlummerte.«
Kimball fuhr mit seinen Fingerspitzen über das glatte Kollar. Dann ließ er die Hand sinken.
»Es ist schön, wieder zurück zu sein.«
Monsignore Dom Giammacio lächelte bei diesen Worten, vielleicht sogar ein wenig triumphierend, denn er wusste, dass der Pontifex sehr glücklich sein würde, zu hören, dass Kimball Hayden wieder zu den Vatikanrittern zurückgefunden hatte.
Kapitel 3
Lashonda Jackson war achtzehn Jahre alt und sehr hübsch, auch wenn sie sich bereits auf einem Lebensweg befand, der sie vorzeitig altern lassen würde. Als sich Spezialagentin Shari Cohen ihr vorstellte, versuchte sie sofort, ihr die Tür vor der Nase zuzuschlagen, aber Shari hinderte sie daran und stemmte ihre Hand gegen Tür.
»Sie haben nichts zu befürchten, Ms. Jackson. Ich möchte nur mit Ihnen reden.«
»Ich werde nicht mehr nach Hause zurückkehren«, stieß sie beharrlich hervor. »Ich werde nicht zulassen, dass dieser Mann noch einmal Hand an mich legt.«
Shari war nicht sicher, wovon sie sprach, vermutete aber, dass sie sich auf jemand in ihrer Familie oder einen übergriffigen Freund bezog.
»Bitte, Ms. Jackson. Ich bin wegen Pater O’Brien hier.«
»Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
»Wussten Sie, dass er ermordet wurde?«
Der Druck gegen die Tür ließ nach.
»Letzte Nacht, in einer Gasse – nicht einmal eine halbe Meile von hier entfernt«, fügte sie hinzu.
Schließlich ließ Lashonda von der Tür ab und öffnete sie für Shari, wenn auch zögerlich. Nachdem Shari eingetreten war, fiel die Tür mit einem sanften Klicken ins Schloss.
Der Raum war ein einziges Durcheinander wild angeordneter Möbel. Schubladen hingen aus Kommoden, über die schmutzige Wäsche geworfen worden war; Müll lag zusammen mit zahlreichen leeren Limonadendosen auf dem Boden; eine geöffnete Pizzaschachtel zeigte ein verbliebenes Dreiecksstück, dessen Käsebelag bereits grau geworden war; die Fenster waren mit schmutzigen Vorhängen zugezogen, um die Sonne fernzuhalten, und in der gesamten Wohnung roch es nach schmutziger Wäsche. Auf dem Nachttisch lagen neben einem dünnen Taschenbuch die Werkzeuge der Selbstzerstörung – eine Nadel, ein Löffel und ein Gummiband, welche Lashonda mit einer hastigen Bewegung in die darunter befindliche Schublade schob und darin verschwinden ließ.
Trotz ihrer achtzehn Jahre und ihrem jugendlichen Äußeren mit ihren rotbraunen Haaren und den smaragdgrünen Augen entging Shari nicht, wie dünn sie bereits war. Nachdem sie sich intensiv mit ihrem Knöchel an einem Punkt unter ihrer Nase rieb, setzte sich Lashonda auf die Kante ihres ungemachten Bettes und schlug die Augen nieder.
»Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen«, sagte Shari. »Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen über Pater O’Brien stellen.« Da keines der Möbel den Eindruck erweckte, darauf Platz nehmen zu können, blieb Shari weiter stehen. »Mir wurde erzählt, dass Pater O’Brien Sie häufig besuchte, Lashonda. Stimmt das?«
Lashonda nickte, wobei ihr Blick an einen bestimmten Punkt auf dem Boden geheftet blieb. »Er kam hin und wieder vorbei, ja.«
»Lashonda … könnten Sie mich bitte ansehen?«
Die junge Frau hob langsam den Kopf, bis sich ihre Blicke trafen. Shari lächelte sie warmherzig und ermutigend an. »Danke«, sagte sie und trat einen Schritt auf das Bett zu. »Sie sind sehr hübsch, Lashonda. Ist das der Grund, wieso Pater O’Brien Sie besuchte? Weil Sie so hübsch sind?«
»Er kam oft hierher.«
»War er letzte Nacht hier?«
»Sie wissen doch bereits die Antwort darauf.«
»Aber ich möchte es von Ihnen hören, Lashonda. War Pater O’Brien letzte Nacht hier?«
Sie nickte.
»Um welche Zeit?«
Lashonda zuckte mit den Schultern. »Um neun? Oder zehn?«
»Ist das eine Frage oder wissen Sie es genau?«
»Irgendwann zwischen neun und zehn Uhr abends.«
Shari trat einen weiteren Schritt auf Lashonda zu, nicht, um sie zu bedrängen, sondern um auf subtile Weise einen Zugang zu ihr zu finden. »Sie sollten wissen, dass ich nicht hier bin, um über Sie zu urteilen, Lashonda. Aber ich müsste Ihnen einige persönliche Fragen stellen, wenn ich darf.«
»Schießen Sie los.«
Shari zögerte einen Moment, dann fragte sie: »Aus welchem Grund kam Pater O’Brien Sie besuchen?«
»Ich bin sein Spielzeug«, sagte sie.
»Sein Spielzeug?«
»Ja, Sie wissen schon. Ich mache ihn glücklich.«
»Ich verstehe. Und wie oft?«
»Drei, manchmal vier Abende in der Woche.«
Shari war einigermaßen verblüfft. Pater O’Briens Keuschheitsgelübde schien ihm offenbar wenig zu bedeuten. »Und er bezahlt Sie dafür?«
Lashonda nickte. »Er bezahlt mich … und dann hält er Predigten, nennt mich eine lästerliche Hure und Heidin und behauptet, ich sei es, die ihn verderben würde.«
»Ich verstehe. Demnach … tut Pater O’Brien, was er immer bei Ihnen tut, danach bezahlt er Sie, und dann gibt er Ihnen für alles die Schuld?«
»Ja.«
Shari kannte ein solches Verhalten aus ihren früheren psychologischen Studien. Pater O’Brien wälzte seine Sünden auf sie ab, um sein Gewissen zu befreien. Das ganze Ritual diente der Rechtfertigung vor sich selbst. »Tat er das jedes Mal? Seine Ansprachen halten?«
»Ja.«
»Wieso ließen Sie das zu?«
»Weil er mich gut bezahlte.«
Shari betrachtete die Einstichstellen an Lashondas Unterarmen, welche Lashonda unterbewusst mit ihren Händen zu verbergen versuchte.
»Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Lashonda. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, wenn Sie mich lassen.«
»Ich werde nicht wieder in ein Frauenhaus gehen, und ich werde auch nicht nach Hause zurückkehren. Ich kann auf mich selbst aufpassen.«
Für Shari war offensichtlich, dass das nicht stimmte. »Hat Pater O’Brien Ihnen gegenüber je irgendwelche Sorgen oder Ängste geäußert?«
»Nein. Er sah mich immer so an, als wäre ich der Leibhaftige. Dann wies er mich an, mich auszuziehen, was ich tat. Wenn wir fertig waren, legte er das Geld auf den Tisch, zog sich an, und dann hielt er seine Predigten, spie Gift und Galle dabei.«
»Aber er hat sich Ihnen nie mit persönlichen Ängsten anvertraut? Nichts dergleichen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Wenn er zu mir sprach, dann nur, um mich wissen zu lassen, dass meine Seele verdammt sei. Kein ›Hallo‹, kein ›auf Wiedersehen‹. Es hieß immer nur, dass ich ein Dämon des Teufels sei und die Macht besäße, ihn zu verführen.«
»Und Sie sind sicher, dass er nie etwas anderes außer seinen Predigten erwähnte?«
»Ja, ganz sicher.«
»Nicht einmal eine Gruppe, die sich die ›Heiligen der Nacht‹ nennt?«
»Von denen habe ich noch nie etwas gehört.«
Shari kaute einen Moment lang auf ihrer Unterlippe herum. Sofern sich Pater O’Brien in irgendeiner Weise von den Heiligen der Nacht bedroht fühlte, hatte er dies vor Lashonda nicht erwähnt. Sie griff in ihre Tasche, zog eine Visitenkarte daraus hervor und reichte sie Lashonda. »Das ist meine Nummer«, erklärte sie ihr. »Rufen Sie mich an, falls Sie irgendetwas brauchen. Wie gesagt, ich bin nicht hier, um über Sie zu urteilen, aber ich möchte Ihnen helfen.«
»Sie werden mich nicht in eine Notunterkunft stecken?«
»Wieso? Damit sie zehn Minuten später wieder weglaufen können? Nein. Aber das«, Shari deutete auf die Schublade, welche die Hilfsmittel ihrer Heroinsucht verbarg, »ist nicht der richtige Weg. Ich kann Ihnen andere Wege aufzeigen, wenn Sie das möchten.«
»Und wie?«
»Ich bitte Sie nur darum, mir zu vertrauen. Aber erst, wenn Sie dafür wirklich bereit sind.«
»Und woher weiß ich, wann ich bereit dafür bin?«
»Auf die gleiche Weise, wie es andere Menschen wie Sie herausfinden«, sagte Shari. »Wenn Sie ganz unten angekommen sind. Und wenn dieser Tag gekommen ist, möchte ich, dass Sie mich anrufen, Lashonda.«
»Ich bin volljährig«, wiederholte Lashonda mit Nachdruck. »Ich bin achtzehn Jahre alt. Sie können mich also zu gar nichts zwingen.«
Shari zwang sich zu einem Lächeln. »Jeder von uns braucht an irgendeinem Punkt einmal Hilfe, Lashonda.« Sie deutete auf die Visitenkarte in Lashondas Hand. »Also verlieren Sie sie bitte nicht. Sie können mich Tag und Nacht anrufen, es spielt keine Rolle. Ich werde für Sie da sein, wenn Sie mich brauchen.«
Lashondas Augen begannen, sich mit Tränen zu füllen. »Sie sind sehr nett, Special Agent Cohen. Niemand war je wirklich nett zu mir.« Sie hob die Karte. »Ich werde sie auf meinem Nachttisch aufbewahren. Immer. Das verspreche ich.«
»Tag und Nacht, Lashonda.«
»Tag und Nacht«, wiederholte sie.