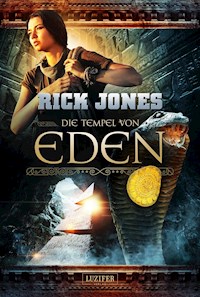Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ritter des Vatikan
- Sprache: Deutsch
Sie sind Elitesoldaten der ganz besonderen Art, denn sie stehen allein im Dienste Gottes: DIE RITTER DES VATIKAN Wann immer die Grundfesten der Welt oder das Leben gottesfürchtiger Menschen in Gefahr ist, wird diese geheime, unter dem Zeichen des Tatzenkreuzes vereinte Spezialeinheit ausgesandt, die Ordnung wiederherzustellen. Bewaffnet mit dem modernsten Waffenarsenal und verborgen vor der Öffentlichkeit stellen sich die Ritter des Vatikan unermüdlich den zerstörerischen Kräften dieser Welt entgegen. "Rick Jones ist die Zukunft des Thrillers." - Richard Doetsch (Bestseller-Autor von THE THIEVES OF FAITH und THE 13th HOUR) Während eines Besuches in den Vereinigten Staaten wird Papst Pius XIII von einer Terrorgruppe entführt, die sich selbst ›Soldiers of Islam‹ nennt. Man droht, den Papst hinzurichten, wenn die USA deren Forderungen nicht erfüllen. Als FBI-Spezialistin Shari Cohen den Auftrag erhält, die Terrorgruppe aufzuspüren, muss sie feststellen, dass sie damit nicht allein ist. Denn der Vatikan entsendet sein eigenes geheimes Elitekommando – die Ritter des Vatikan. Deren Mission lautet: Den Papst lebend zurückbringen. Gemeinsam stoßen Cohen und die Ritter auf eine Verschwörung innerhalb des Weißen Hauses, die bis in höchste Regierungskreise reicht. Als Shari Cohen kurz davor steht, die Wahrheit über die Entführung des Papstes herauszufinden, wird sie zur Zielscheibe von Mächten im eigenen Land, die dieses Geheimnis um jeden Preis bewahren wollen. Doch wer ihrer habhaft werden will, muss erst an den Rittern des Vatikan vorbei … DIE RITTER DES VATIKAN ist der Auftakt der actiongeladenen Bestseller-Reihe um das schlagkräftige Elitekommando des Vatikan und ihrem charismatischen Anführer Kimball Hayden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ritter des Vatikan
Rick Jones
This Translation is published by arrangement with Rick Jones Title: The Vatican Knights. All rights reserved. First published 2012.
Diese Geschichte ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Orte, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE VATICAN KNIGHTS Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-186-8
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Um keine Aktion, News oder Angebote zu verpassen,empfehlen wir dir unseren Newsletter.
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Prolog
Washington, D.C. | Vor fünfzehn Jahren
Zu jener Zeit, als Shari Cohens Großmutter in Auschwitz inhaftiert war, regnete es unablässig Asche vom Himmel.
Auf dem Höhepunkt seiner Existenz wurden in dem Konzentrationslager täglich über 20.000 Juden umgebracht und in den Verbrennungsöfen eingeäschert. Eine Tragödie, an welche die vielen Fotos an den Wänden und die Galerien von Schaukästen im Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. erinnerten.
In ehrfurchtsvoller Stille wanderten die Besucher von einem Schaukasten zum nächsten durch die große Halle, vorbei an Eisernen Kreuzen und deutschen Luger-Pistolen. Unter vertäfelten Lampen hingen deutsche und jüdische Flaggen sowie gerahmte Gemälde, welche das Nazi-Regime von den vorherigen jüdischen Eigentümern beschlagnahmt hatte.
Am Ende des Korridors lief Shari an einer Gedenkwand voller unzähliger Schwarz-Weiß-Aufnahmen entlang und studierte jede Einzelne von ihnen sorgfältig.
Und dann fand sie es – ein schwarz-weißes Foto einer Gruppe von Häftlingen, die beieinanderstanden, in Kleidungsstücken, unter denen sich ihre spindeldürren Arme und Beine abzeichneten. Die Verzweiflung in ihren Gesichtern war offenkundig und ihre von unendlicher Trauer überquellenden Augen sprachen Bände.
Vorsichtig fuhr Shari mit dem Finger die Konturen einer jungen Frau ab, die stolz ihren Kopf erhoben hatte. Ihre hervorstehenden Schultern und Wangen, ihre bleiche Haut und die tiefen Augenringe zeugten von ihrem Willen und ihrem Mut im Angesicht der Not. Das Foto zeigte Sharis Großmutter.
Unwillkürlich spürte sie, wie Tränen in ihren Augen brannten, und ihr Kummer und ihr Mitgefühl mischten sich mit dem überwältigenden Stolz, den sie empfand.
Ohne Eile lief sie die Exponate ab, studierte jedes Foto und versuchte sich die Gräuel vorzustellen, die sie abbildeten. Eines der Bilder zeigte leblose Körper, die von Galgen herabhingen. Shari erinnerte sich, wie ihre Großmutter erzählt hatte, dass man die Leichen dort oft für Tage hängen ließ, um den anderen Juden im Lager ihr drohendes Schicksal vor Augen zu führen.
Wer dem jüdischen Glauben angehörte, so berichtete ihre Großmutter, sah sich dem sicheren Tod gegenüber. Ohne Ausnahme.
Selbst jetzt noch, in diesem Augenblick, konnte Shari den leichten, liebenswerten Akzent ihrer Großmutter hören. Die Art, wie sie von diesen Dingen sprach, mit jenem Mut und dem Stolz, eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte überlebt zu haben, war für sich allein schon ein Beweis für die ungeheure innere Willensstärke dieser alten Frau.
Damals, als Shari noch zu jung war, um die Tragweite des Leids ihrer Großmutter wirklich verstehen zu können, aber gleichzeitig an der Schwelle stand, etwas darüber zu lernen, hatte ihre Großmutter ihr die schablonenhaften Nummern auf ihrem Unterarm gezeigt. Las man sie von der einen Seite, stand dort 100681, betrachtete man den Unterarm jedoch von der anderen Seite, wurden die Ziffern 189001 daraus. Die gleiche Tätowierung, aber unterschiedliche Nummern. Ihre Großmutter nannte sie immer ihre magischen Zahlen.
Shari lächelte. In Gedanken sah sie, wie ihre Großmutter ebenfalls lächelte, amüsiert von Sharis erstauntem Gesicht, als sich die Nummern vor ihren Augen veränderten.
Dann verschwand Sharis Lächeln. Ihre Lippen formten wieder eine gerade Linie. Jene Frau, die ihr schweres Schicksal in Auschwitz so mutig und standhaft ertrug, war vor einer Woche im Alter von neunundsiebzig Jahren in einem Krankenhaus in D.C. an Herzversagen gestorben. Shari vermisste sie unendlich.
Sie lief weiter an den Displays entlang und betrachtete noch andere Aufnahmen, darunter Fotos von verkohlten und gebrochenen Knochen aus den Verbrennungsöfen.
Wie es ihrer Großmutter gelungen war, bei Verstand zu bleiben, war Shari unbegreiflich. Wie konnte überhaupt jemand unter dieser Wolkendecke von Auschwitz leben, wo man sich täglich fragen musste, wann es die eigene Asche sein würde, die vom Himmel fiel und das Land mit einem grässlichen Grauschleier überzog?
Noch nicht einmal ansatzweise konnte sie sich dieses Martyrium ausmalen.
Beim Betrachten der Fotos erkannte Shari eine zeitliche Abfolge der Ereignisse in ihnen, die sie daran erinnerte, dass das tolerante Land, in dem sie als Jüdin lebte, auch nicht frei von Vorurteilen war. Sie musste an die Worte ihrer Großmutter zwei Jahre zuvor denken, als Shari gerade sechzehn geworden war.
»Du bist jetzt eine junge Frau«, hatte sie ihr erklärt. »Alt genug, um die Dinge zu verstehen, die eine junge Frau wissen sollte. Was ich dir jetzt also mit auf den Weg geben werde, meine Kleine, ist die wundervollste Gabe von allen. Die Gabe der Erkenntnis und der Weisheit.« Dann hatte sich ihre Großmutter näher zu ihr herübergebeugt und sie zu sich gewunken, ganz so, als würde man das Folgende nur flüsternd weitergeben können. »Ich gehöre dem jüdischen Glauben an«, fuhr sie fort. »Genau wie du. Aber ich war stolz und lehnte es ab, ihm zu entsagen. Als Jude in Auschwitz inhaftiert zu sein, bedeutete den sicheren Tod. Doch wenn man damit kämpft«, sagte sie und legte sich ihre flache Hand auf die Stelle über ihrem Herzen, »wenn man wirklich stolz darauf ist, wer man ist, dann wird man überleben. Aber du darfst eine Sache nie vergessen: Dort draußen in der Welt gibt es furchtbare Menschen, die nur deshalb danach trachten, dich zu zerstören, um das Werk des Bösen verrichten zu können. Wenn du zulassen möchtest, dass das Böse die Oberhand gewinnt, dann sieh einfach nur dabei zu. Aber wenn du etwas verändern möchtest, dann kämpfe, damit wir alle im Licht leben können. Verstehst du irgendetwas von dem, was ich dir sage?«
Shari erinnerte sich noch an das verwirrte Gesicht, das sie zog. Deshalb streckte ihre Großmutter ihren Unterarm aus, wo die Tinte der magischen Zahlen zu einem Olivgrün verblasst war.
»Weil ich Jüdin war, gab man mir dieses Zeichen – und das, obwohl ich ein liebes Mädchen war, das niemals jemandem etwas zuleide tat. Meine Eltern, deine Urgroßeltern, waren gute Menschen, die dieses Zeichen nicht bekamen, aber nur deshalb, weil man ihnen befahl, sich links einzureihen. In Auschwitz bedeutete das den schnellen Tod in den Gaskammern. Ich sah sie nie wieder.« Sie lächelte. Ihr Gesicht wurde dadurch noch faltiger, doch jede Falte strahlte eine ungeheure Wärme und Schönheit aus. Die Falten einer Frau, die das Leben über alle Maßen liebte.
Dann griff sie nach Sharis Hand und umfing sie mit mütterlicher Güte. »Da ist viel Gutes in dir«, erklärte sie. »Ich kann es spüren. Es sind Menschen wie du, die etwas für das Leben aller verändern können, ganz egal, ob es sich dabei um Juden handelt oder nicht. Dieses Zeichen an meinem Arm erinnerte mich immer wieder daran, dass es Menschen gab, die in der dunkelsten Zeit des Lebens wegschauten und nichts taten, um mir oder den anderen zu helfen. Deshalb mussten Unzählige sinnlos ihr Leben lassen – weil man dem Bösen erlaubte, zu obsiegen. Aber in dir, meine Kleine, lodert ein Feuer, das so heiß brennt, dass ich es in deinen Augen sehen kann. Du möchtest Gutes für die tun, die sich nicht selbst beschützen können, nicht wahr?«
In diesem Moment wurde Shari klar, dass sie das tatsächlich wollte, auch wenn ihr neuentdeckter Eifer mindestens genauso sehr von dem Wunsch genährt wurde, ihre Großmutter glücklich zu machen, wie durch den Entschluss, die Wehrlosen zu schützen. Dieses Gefühl war neu für sie, denn trotz allem war sie erst sechzehn Jahre alt gewesen, und ihre größten Sorgen hatten bisher nur Jungen gegolten.
Das Lächeln ihrer Großmutter wurde breiter. »Mach dir keine Gedanken«, beruhigte sie das Mädchen. »Merke dir nur, dass eine Zeit kommen wird, in der es Widrigkeiten geben wird. Aber gib nicht auf. Entschlossenheit und Beharrlichkeit werden dich stets ans Ziel bringen. Ich war entschlossen, Auschwitz zu überleben. Und das tat ich. Nun liegt es an dir, dafür zu sorgen, dass das, was mir geschah, niemals wieder geschehen darf.«
Shari hob den Arm ihrer Großmutter, drehte ihn herum und strich mit ihren Fingern sanft über die ausgeblichene Tätowierung. »Niemand sollte so leiden müssen, wie du es getan hast, Großmutter. Und ich werde dafür sorgen, dass es niemandem wieder so ergehen wird.«
Ihre Großmutter lächelte sie weiter gütig an.
Shari fragte sich oft, ob ihre Großmutter der Ansicht war, dass ihre Versprechen nur die leichtfertigen Versprechungen einer Sechzehnjährigen waren, die einer alten Frau genau das versprach, was diese hören wollte, oder ob sie tatsächlich glaubte, dass Shari von ihren Worten überzeugt war. Denn das war sie. Die Liebe zu ihrer Großmutter war nie so groß gewesen wie zu jenem Zeitpunkt, auch wenn sie erst sechzehn und viel zu sehr mit Jungs beschäftigt war. Gute Menschen wie ihre Großmutter verdienten einfach etwas Besseres.
»Dann ist das mein Geschenk an dich, mein Liebling. Manchmal sind Ratschläge die besten Geschenke. Also nutze sie weise.«
Shari hatte die Lektion ihrer Großmutter zu ihrem sechzehnten Geburtstag nie vergessen können.
Nun, zwei Jahre später und achtzehn Jahre alt, hatte Shari ein Stipendium an der Georgetown Universität erhalten. Weniger an Jungs und mehr an ihrer Karriere interessiert, arbeitete Shari auf ihr Ziel hin, niemals wieder zuzulassen, dass jenen solche Gräueltaten widerfuhren, die »sich nicht selbst beschützen konnten«, indem sie sich für Kurse in Strafrecht einschrieb, dabei aber größeres im Auge hatte.
Rechts von ihr bemerkte Shari drei Teenager in ungefähr ihrem Alter, schwarz gekleidet, mit dazu passendem schwarzen Lippenstift und Nagellack, kohlrabenschwarz gefärbten Haaren und gespenstisch weiß gepuderten Gesichtern. Sie unterhielten sich lautstark und kommentierten die Fotografien mit Adjektiven wie geil, abgefahren oder cool. Worte, die sie tief verletzten.
Und Shari wunderte sich. Ob sie es wohl immer noch geil, abgefahren und cool gefunden hätten, wenn man sie den gleichen Torturen und dem gleichen Leid wie in den Aufnahmen ausgesetzt hätte?
Sicherlich nicht.
Während sie weiterschritt und die unaufgeklärten Gleichaltrigen hinter sich ließ, dachte Shari erneut über ihre Großmutter nach und die Art, wie sie couragiert ihr restliches Leben bestritten hatte. Indem sie Auschwitz überlebte, konnte ihre Abstammungslinie fortgeführt werden. Ihre Großmutter gebar drei Kinder, die der Familie weitere sieben Enkel schenkten. Shari war die Jüngste von ihnen. Ohne den Willen ihrer Großmutter, eines der schändlichsten Kapitel der Geschichte zu überleben, wäre keiner von ihnen heute am Leben.
Danke, Großmutter.
Shari beugte sich über eine Glasvitrine, und ihr Spiegelbild starrte zu ihr zurück. Sie war attraktiv, mit einer störrischen Haarlocke, die ihr wie ein umgekehrtes Fragezeichen über der linken Augenbraue hing. Ihre Augen – von einem geradezu umwerfenden Braun, die wie frisch geprägte Kupfermünzen funkelten – sahen fragend zu ihr auf. Woher kam dieser Fanatismus, der die Ermordung von über sechs Millionen Juden rechtfertigte? Für Shari war es kaum begreiflich, dass die Menschheit nicht erwachsen genug gewesen war, um den eigenen Niedergang zu bemerken.
Seufzend sah sie an ihrem Spiegelbild vorbei und erblickte die Nazi-Flagge, die in dem Schaukasten ruhte. Das Rot und Weiß des Fahnenstoffes strahlte hell, beinahe wie neu, und das Hakenkreuz als Symbol der Intoleranz starrte sie unverwandt an.
»Man wird dich immer verfolgen, nur weil du Jüdin bist«, hatte ihre Großmutter erklärt. »Aber du darfst nie vergessen, wer du bist, und musst stolz darauf sein, denn eines Tages wirst du daran erinnert werden, wer du bist, und du wirst kämpfen müssen, um am Leben zu bleiben. Vergiss das nie, meine Kleine.«
»Das werde ich nicht, Großmutter.«
Shari lächelte ein wenig, ein sanftes Kräuseln ihrer Lippen in Erinnerung an eine bemerkenswerte Frau. Das Holocaust-Museum zu besuchen war nicht nur eine Geste für das Gedenken an ihre Großmutter, sondern auch eine Erinnerung an das, was ihre Großmutter Shari eingeschärft hatte – stolz und unerschrocken zu sein, nie zu vergessen, woher man stammte, und immer jenen zu gedenken, die ihr Leben ließen. Doch was noch wichtiger war: In schlechten Zeiten, die es immer geben würde, standhaft zu bleiben.
»Erinnere dich an meine Worte, meine Kleine. Die Zeit wird kommen. Glaube mir.«
Shari bezweifelte, dass es in einem Land, in dem die freie Religionsausübung von der Verfassung geschützt wurde, zu irgendeiner Form von Ausgrenzung kommen würde, nur weil man Jude war. Aber so ganz ließ es sich auch nicht ausschließen.
Sollte es sich einmal als Problem herausstellen, wäre es nur ein weiteres Hindernis, welches sie für das Wohl vieler überwinden würde, dachte sie bei sich. Sie wusste, dass sie ihren Weg stets beharrlich weiterverfolgen würde, denn Beharrlichkeit war ein Teil ihrer Großmutter gewesen, und damit auch ein Teil von ihr, sowohl genetisch als auch aus Überzeugung.
Während sie weiter von einem Ausstellungsstück zum nächsten schritt, verbrachte Shari die meiste Zeit damit, über all die mutigen Menschen nachzusinnen, die diese Lager überlebten, und für jene zu beten, die sie nicht überlebten.
Kapitel 1
Sechs Meilen nordwestlich von Mesquite, Nevada | 18. September, 14:16 Uhr
Zwei Humvees und ein Lastwagen mit Plane in den Farben der Wüstenlandschaft durchquerten zügig die Wüste und zogen eine Wolke aus Staub und Sand hinter sich her. Der vorderste Humvee, der für diese Umgebung wie geschaffen war, eskortierte den M-Series-Lastwagen tiefer in die Talsenke hinein, während der hintere Humvee das gleiche Tempo hielt und dafür sorgte, dass die Gefangenen im Inneren des Lastwagens nicht entflohen.
Die Humvees federten die Unebenheiten des Wüstenbodens mühelos ab, der Lastwagen aber, dem einige Eigenschaften für dieses Terrain fehlten, verhielt sich dabei weniger kooperativ. Nur mit Mühe gelang es dem Truppenführer im Inneren des Trucks, mit seiner MP5 die acht Araber in Schach zu halten, die nebeneinander mit Plastikfesseln um den Handgelenken auf den Bänken saßen.
Je weiter sie in die Wüste vordrangen, umso karger und menschenfeindlicher wurde die Landschaft.
Gewaltige Felsformationen ragten aus dem ausgedörrten Boden, über den der windgepeitschte Staub wie Meereswellen brandete. An der Oberfläche war dieser brüchig und lose geworden, wo der lehmartige Sandboden den Elementen, dem schneidenden Wind und der unnachgiebigen Hitze ausgesetzt war. Und die wenigen Bewohner – die Schlangen, Skorpione und Echsen, die sich an diese Wüstenei, die wenig mehr als kaum Regen und sengende Hitze bot, angepasst hatten – bevölkerten ein Königreich, über das niemand herrschen wollte.
Ein unbarmherziger Ort.
Nachdem die Fahrzeuge mehrere Meilen des unwegsamen Geländes bezwungen hatten und die Topografie sich allmählich ebnete, hielt der vorderste Humvee an. Die beiden Fahrzeuge hinter ihm folgten seinem Beispiel. Der Staub setzte sich. Dann entstiegen neun Angehörige des Spezialtrupps dem ersten Humvee, bekleidet mit Wüstentarnkleidung, Schutzbrillen und Helmen, und schoben Magazine in ihre Sturmgewehre.
Ein Soldat mit einem Laser YardagePro kletterte durch das offene Dach auf den Geschützturm. Der klobige Entfernungsmesser ließ das Fernglas so schwer werden, dass der Mann beide Hände benutzen musste, um damit in Ruhe den Horizont absuchen zu können. Nachdem er keine Hinweise auf Bewegungen gefunden hatte, nahm er das Fernglas wieder herunter. »Sauber!«
Daraufhin schlug der Teamführer, der im hinteren Teil des Lastwagens saß, die Plane zurück, wies mit dem Lauf seiner MP5 auf den Flecken Wüste hinter der Heckklappe und brüllte die gefesselten Insassen an, das Fahrzeug zu verlassen. Er sprach dabei in fließendem Arabisch, einer Sprache, an die er sich gewöhnt hatte. Schließlich lebte er schon fast sein gesamtes Leben im Mittleren Osten.
Ein Gefangener nach dem anderen sprang von der Laderampe und blinzelte gegen das grelle, gnadenlose Sonnenlicht an, während die übrigen Soldaten auf Englisch Befehle bellten, von denen sie wussten, dass die Gefangenen sie kaum verstehen würden. Doch die Mündungen ihrer Waffen, mit denen sie sie immer wieder anstießen und die Araber auf diese Weise zu einem Wüstenabschnitt mit ein paar toten Büschen und ausgedörrtem Lehm geleiteten, waren allgemeinverständlich genug. Vom Ende des Frachtraumes aus sah der Teamführer unbeeindruckt dabei zu, wie seine Einheit die Geiseln zu einer Steinstruktur in der Form einer halben Muschel führte, deren Oberfläche von den Winden glatt geschmirgelt worden war. Dann wandte er sich den beiden Arabern zu, die noch immer auf den Holzbänken saßen. Ihre Fußgelenke waren an einen mit dem Boden verschweißten Stahlring gekettet. Ungerührt richtete der Teamführer seine Waffe auf sie.
»Heute ist der Anfang vom Ende«, erklärte er ihnen. Dann neigte er kurz den Kopf in die Richtung, wo die Brüder der beiden vor der halben Muschel aufgereiht standen. »Deshalb können sich die dort glücklich schätzen.« Mit mechanischer Langsamkeit wies er mit seiner Waffe gen Himmel. »Ich fürchte jedoch, dass Allah euch beiden ein großartigeres Schicksal zugedacht hat, weshalb das Paradies noch etwas auf euch warten muss.« In seinem Tonfall lag keine Spur von Zynismus. Es war einfach nur die simple Feststellung, dass für jeden der Tod seine Zeit hatte und ihre Zeit einfach noch nicht gekommen war.
Dann besann er sich auf die Heilige Schrift des Islam und der bislang noch so selbstbeherrschte Teamführer klang plötzlich aufgebrachter.
»Wenn Allah wirklich eure Gebete erhört, dann solltet ihr ihn jetzt besser um eurer Brüder Willen um göttliche Intervention bitten. Und wenn er wirklich eurer Erlöser ist, dann soll er mich mit seiner unendlichen Macht jetzt und hier vor euch niederstrecken. Ich gebe ihm dafür eine Minute.« Dann hob er den Zeigefinger. »Er hat eine Minute. Keine Sekunde mehr.«
Als Nächstes sprang er unvermittelt aus dem Lastwagen und schlug als Zeichen seiner Verbitterung die Ladeklappe zu. Er lief zu der halben Muschel, musterte dabei unentwegt die Araber und gab seinen Männern dann das Zeichen, die Gefangenen in die Knie zu zwingen.
Als er sich wieder einigermaßen in der Gewalt hatte, packte der Teamführer seine Waffe fester und ließ den Blick über seine Feinde schweifen, zeigte aber wenig Mitleid mit den Männern, die um Gnade flehten. Ihr Flehen schien auf taube Ohren zu stoßen, was ihm ein kurzer prüfender Blick in den Himmel bestätigte.
Weniger als eine Minute, Allah.
Die Araber vor ihm flehten ihn inständig an, entweder um Gnade oder um sie endlich ins Paradies zu entlassen.
Er nahm seine Brille und seinen Helm ab, dann legte er seinen Kopf in den Nacken und ließ warmes Sonnenlicht auf sein Gesicht, das seine bleichen Gesichtszüge erhellte, die in starkem Kontrast zu seinem rabenschwarzen Haar und seinen noch schwärzeren Augen stand. Am unteren Ende seines Kinns war eine keilförmige Narbe zu sehen – ein Andenken an einen Selbstmordattentäter, der sich ein paar Jahre zuvor in Ramallah vor ihm in die Luft gesprengt hatte. Die Narbe diente ihm als tägliche Erinnerung an seinen immerwährenden Kampf.
Nachdem er sich den Helm wieder auf den Kopf gesetzt und die Brille unter seinen Schulterriemen geklemmt hatte, legte der Teamführer seine Waffe für den tödlichen Schuss an, woraufhin er hysterisches Betteln von zweien der Araber erntete, die ihn um Vergebung anflehten. Der Wunsch, das Paradies zu betreten, hatte sie wohl verlassen.
Als die Minute verstrichen und Allah noch immer nicht erschienen war, schwenkte er den Lauf seiner MP5 langsam von einem Araber zum nächsten, so als müsse er sich erst noch entscheiden, wen von ihnen er als Erstes ins Paradies entsenden würde, und sprach sie auf flache und gefühllose Weise an.
»Wenn Ihr Allah seht, dann richtet ihm aus, dass Yahweh euch geschickt hat«, sagte er. Dann betätigte der Teamführer ohne zu zögern oder einer Spur von Reue den Abzug.
Als alles vorbei war, hallten die Gewehrschüsse noch durch die Talsenke, bis sich ihr Echo in der Ferne verlor und nichts weiter außer dem sanften Rauschen des Wüstenwindes zu hören war.
Der Teamführer schloss seine Augen, sog tief den Geruch von Kordit, der schwer und metallisch in der Luft hing, durch die Nase ein und genoss den Moment.
Der jedoch nicht lange andauerte, denn die Stimme einer seiner Männer rüttelte ihn auf.
»Sollen wir sie begraben?«
Der Teamführer öffnete die Augen. Der Moment war verflogen. »Nehmen Sie sich zwei Männer und verteilen Sie die Leichen«, befahl er mit einem leichten Akzent in der Stimme. »Und dann begraben Sie sie tief. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, sind Kojoten, die die Leichen wieder ausbuddeln.«
»Jawohl, Sir.«
Der Teamführer trat einen Schritt auf die Leichen zu und musterte den Ausdruck auf ihren Gesichtern. Nicht ein Einziger von ihnen schien in Frieden zu ruhen. Stattdessen schien sich auf jedem Gesicht etwas abzuzeichnen, was der Teamführer als Überraschung angesichts der eigenen Sterblichkeit deutete. Oder war es die plötzliche Offenbarung, dem jüngsten Gericht gegenüber zu stehen? Während er darüber nachsann, sah er noch einmal zum Himmel hinauf, als würde er dort Antworten suchen. Doch alles, was er bekam, war ein Streifen abnehmender Wärme, als die Sonnenstrahlen plötzlich von einer vorbeitreibenden Wolke verdunkelt wurden.
Er widmete sich wieder den Leichen der Araber und konnte sich nur fragen, ob sie wirklich glaubten, dass ihre von Gott befohlenen Handlungen mit einem Himmel voller Jungfrauen belohnt wurden.
Das war eine Vorstellung, die der Teamführer noch nie so richtig verstanden hatte. Seiner Ansicht nach hatte der Mensch von dem Moment an, da er der Ursuppe entstiegen war und aufrecht gehen konnte, auch das Selbsterhaltungsprinzip für sich entdeckt. Und doch waren diese Splittergruppen von einer selbstmörderischen Faszination getrieben, welche ganz eindeutig ihren Willen zum Überleben vernebelte. Für eine Sache zu kämpfen war das Eine; dafür zu sterben etwas anderes.
Mit dem Lauf seiner Waffe stieß der Teamführer einen der Araber an. Der Stoß ließ dessen Kopf zur Seite fallen.
»Jetzt hat die Schlacht begonnen«, raunte er dem toten Mann auf Arabisch zu. »Und jetzt verrate mir, welcher Gott wird der stärkere sein? Allah oder Yahweh?« Da er keine Antwort von dem Toten erwartete, drehte sich der Mann mit der Narbe um und lief zurück zu dem Heck des Lastwagens, in dessen Inneren er wieder die lange Rückfahrt zubringen würde.
Mit der MP5 auf seine menschliche Fracht gerichtet und während Al-Hashrie und Al-Bashrah mit neuentdeckter Dringlichkeit ihr Mantra vor sich herbeteten, sann der Teamführer über das Schicksal der beiden Männer vor ihm nach und versuchte vorauszuahnen, welchen Effekt sie auf das künftige Schicksal der zivilisierten Welt haben würden.
Ja, überlegte der Teamführer. Diesen beiden war eine weitaus größere Rolle in den Augen Allahs zugedacht.
Kapitel 2
Irgendwo über dem Atlantik | 22. September, morgens
Die Shepherd One ist die vatikanische Ausgabe der Air Force One, jedoch ohne das luxuriöse Drumherum der Privatmaschine des amerikanischen Präsidenten wie etwa einer Bar oder teuren Ledersesseln. Tatsächlich ist die Shepherd One ein gewöhnlicher Jetliner der Alitalia Airlines, der für päpstliche Reisen zur Verfügung gestellt wird. Die einzigen wirklichen Umbauten der Maschine beschränkten sich auf Sicherheitsmaßnahmen, um feindlichen Angriffen standzuhalten. Das Flugzeug verfügte über ein Ablenksystem gegen Wärmesuchraketen, Abfanggeschosse gegen Boden-Luft-Raketen und einen Laser-Jammer, mit dessen Hilfe sich besonders lasergelenkte Raketen stören ließen. Nach einem Anschlag auf das Leben von Papst Johannes Paul II. willigte der Vatikan ein, künftig für die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu sorgen, die Alitalia Airlines natürlich nur allzu bereitwillig erfüllte.
Papst Pius XIII. saß im vorderen Teil der beinahe leeren 747 auf ihrem westlichen Kurs von Rom nach Dulles und studierte noch einmal den Reiseplan für seinen zweiwöchigen Besuch auf amerikanischem Boden. Immer wieder sah er dabei von seinen Aufzeichnungen auf, schaute aus dem Fenster auf die wie Glas und Lametta glitzernde Meeresoberfläche hinaus und dachte über die schwierige Aufgabe nach, die vor ihm lag.
Er hatte lernen müssen, dass Religion ein Geschäft war, das Glauben verkaufte. Und seitdem Politik und Banken den Kern und Rückhalt des Vatikans bildeten, dem er als Staatsoberhaupt diente, lag es in seiner Verantwortung, für Nachfrage nach dem Glauben unter den Menschen zu sorgen. Papst Pius musste die immer größer werdende Kluft zwischen der Kirche und den Menschen schließen, denn aufgrund des aufkeimenden Liberalismus und der Weigerung der Kirche, mit ihren konservativen Werten zu brechen, blieben immer mehr den Gottesdiensten fern, und überall auf der Welt lichteten sich die Kirchenbänke.
Dafür wollte und musste Pius in die Fußstapfen seines Vorgängers treten und das Verlangen nach Religiosität neu entfachen.
Es war nicht sein Bestreben, das Wort Gottes zu kommerzialisieren, sondern den Menschen zu versichern, dass Gott seine Kinder nicht im Stich gelassen hatte und sie immer noch uneingeschränkt liebte. Weder wollte er das Fegefeuer predigen, noch lag es in seinem Interesse, Moralpredigten zu halten, wie: »Gott liebt dich. Aber er würde dich noch viel mehr lieben, wenn du zur Kirche gehen und die alten Sitten und Gebräuche befolgen würdest.«
Er wollte nicht maßregeln oder Vorwürfe predigen.
Der Papst rieb sich die Augen, dann seufzte er, als wäre ihm urplötzlich klar geworden, dass dieses Unterfangen eine zu große Aufgabe für einen Mann seines Alters darstellte. Doch obwohl er sich erschöpft und gelegentlich auch entmutigt fühlte, trieb ihn doch die tiefverwurzelte Entschlossenheit an, die Menschen wieder für den Katholizismus gewinnen zu können und dem schwindenden Glauben entgegenzuwirken. Diesem Ziel war er treu ergeben, ganz egal, wie viel es ihm abverlangen oder welche Anstrengungen es kosten würde.
Seine Herausforderung bestand darin, die Relevanz jahrhundertealter christlicher Regeln einer Welt nahezubringen, die nach Evolution gierte. Die Kirche hatte auch in der Vergangenheit schon schwierige Zeiten überstanden, und deshalb wusste der Papst, dass sie auch in der Zukunft ihren Platz haben würde. Die schwierige Frage war jedoch, wie sich Einigkeit erreichen ließ. Während sich Papst Pius XIII. wieder seinem Reiseplan und den vorgeschriebenen Reden widmete, kam er zu dem Schluss, dass es am Ende wohl auf überzeugende Worthülsen hinauslaufen würde, um die Massen zurückzugewinnen. Fünf seiner besten Redner, allesamt Bischöfe des Heiligen Stuhls, dem administrativen Arm des Vatikans, würden ihn dabei unterstützen. Die Bischöfe wurden extra für solche Aufgaben vorbereitet. Sie würden ihm als Ratgeber dienen und verschiedene Szenarien durchspielen, die sich jeder Einzelne von ihnen ähnlich einem Hollywood-Regisseur ausdachte.
Dann traf ihn jedoch die Tragweite seiner Gedanken. War es wirklich das, was aus seiner Religion geworden war? Ein Schmierentheater?
Der Papst weigerte sich, diese entmutigende Feststellung anzuerkennen und lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Zeitpläne und die Ansprachen, die ihm seine Berater vorbereitet hatten. Als er die Augen schloss und das Abbild der Dokumente sah, das sich scheinbar auf das Innere seiner Augenlider eingebrannt hatte, entschied Papst Pius XIII., lieber aus seinem Herzen zu sprechen, als sich auf die Effekthascherei der päpstlichen Volksreden zu verlassen.
Er würde seine Seele sprechen lassen.
»Eure Heiligkeit?« Die Worte waren viel zu leise gesprochen, als würde die Person bereits nur den Umstand bereuen, die Ruhe des Pontifex gestört zu haben.
Pius öffnete die Augen und sah, dass Bischof Angelo vor ihm Platz genommen hatte. Der Mann besaß ein engelsgleiches Äußeres, mit teigig-weichen Gesichtszügen, die ihm ein kindliches Aussehen verliehen, und wenn er lächelte, offenbarte er dabei eine Reihe kerzengerader und blütenweißer Zähne.
»Es tut mir sehr leid«, begann er entschuldigend. »Sie haben geschlafen, oder?«
Der Papst schüttelte den Kopf. »Ich habe nur nachgedacht.« Dann, nach kurzer Überlegung, fügte er hinzu: »Die breite Masse zurückzugewinnen wird keine leichte Aufgabe, Gennaro, das weiß ich. Aber das hier …« Er hob die Dokumente auf, die vor ihm lagen. »Das klingt alles ein wenig zu vorbereitet. Ich weiß natürlich, dass der Heilige Stuhl es nur gut damit meint, aber diese Dokumente scheinen mir ohne Tiefgang zu sein.« Der Papst lehnte sich nach vorn und tätschelte mit einem gewinnenden Lächeln Bischof Angelos Unterarm. »Und bitte, mein lieber Freund, nehmen Sie es nicht persönlich. Ihre Reden sind von großem Wert, aber für dieses Unterfangen braucht es mehr. Es braucht Wahrhaftigkeit. Um den Menschen ihren verlorenen Glauben zurückzugeben, darf ich in ihnen nicht das Gefühl erzeugen, dass ich ihnen nur etwas verkaufen will.«
»Dann dürften diese Dokumente vielleicht eher Ihren Wünschen entsprechen, Eure Heiligkeit.« Der Bischof nahm einen dünnen Stapel Papier aus seinem Koffer und reichte ihn dem Papst.
»Was ist das?«
»Sagen wir einfach, es ist ein direkterer Ansatz, den derzeitigen Sorgen der Menschen und der Kirche zu begegnen … und vielleicht weniger der Versuch, etwas zu verkaufen.«
Der Papst machte große Augen. »Sie wussten schon immer genau, was ich will, Gennaro. Ich danke Ihnen. Ich werde sie mir mit dem größten Vergnügen ansehen.«
»Ich hoffe, sie finden Ihre Zustimmung, Eure Heiligkeit.«
»Hoffen wir es. Denn uns trennt nur noch eine Stunde von Amerika und ich muss gut vorbereitet sein.«
Bischof Angelo verbeugte sich und zog sich zu den Sitzreihen hinter dem Papst zurück, wo die Bischöfe des Heiligen Stuhls bedächtig über den bestmöglichen Umgang mit den Medien debattierten. Hin und wieder erhoben sie bei Uneinigkeiten die Stimmen, doch die meiste Zeit über einte sie tiefe Verbundenheit.
Der Papst ließ seine Augen über den aktuellen Stapel an Dokumenten schweifen und begann erneut seine Studien.
Es war 10:47 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Kapitel 3
Flughafen Dulles, Washington, D.C. | 22. September, später Nachmittag
Unter den wachsamen Augen tausender Schaulustiger, die hinter den abgesperrten Bereichen des Terminals ausharrten, um einen Blick auf den Pontifex zu erhaschen, setzte die Shepherd One zur Landung an. Handgemalte Plakate wurden geschwungen, die Menschen jubelten, und die Luft schien beinahe elektrisiert zu sein, als der Papst schließlich dem Flugzeug entstieg und in vollem Ornat den Durchgang zur Haupthalle passierte. Nachdem er das Terminal erreichte und die Menschenmenge mit dem Kreuzzeichen segnete, bot er den politischen Würdenträgern seine Hand an, die zur Begrüßung entweder seinen Fischerring küssten oder sie einfach nur schüttelten.
In einem eigens für die Medien eingerichteten Bereich zeichneten die Kameras und Nachrichtenkanäle die Ankunft des Papstes und damit seinen ersten umjubelten Besuch auf amerikanischem Boden auf, während sich der Pontifex und seine Gefolgschaft auf eine Reihe von Limousinen zubewegten.
Zuletzt hob Papst Pius XIII. noch einmal die Hand und winkte den versammelten Menschen zu, was einen Jubelsturm auslöste, bevor er geduckt im Wagen des Gouverneurs verschwand.
Ein Mann schien jedoch von all dem unbeeindruckt zu sein.
Der blasse Mann, der in der vordersten Reihe der Schaulustigen stand, lächelte nicht und zeigte auch keine andere Gemütsregung, während er den Papst mit den Augen fixierte. Er machte den Eindruck, als wäre er in Gedanken versunken, was noch dadurch verstärkt wurde, dass er mit seinen Fingern wie geistesabwesend über die Narbe an seinem Kinn strich.
Erst kurz vor der Ankunft des Papstes hatte den Teamführer die Geheiminformation erreicht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein hochqualifiziertes Team aus vier kampferprobten Agenten abgestellt hatte, um zusammen mit den üblichen Sicherheitskräften der Polizei das Anwesen des Gouverneurs zu bewachen, in dem der Papst residieren würde.
Doch die Einheit des Teamführers war ebenfalls auf das Niveau einer Elitetruppe geschliffen worden. Und trotz des Vertrauens, welches der Präsident in die Fähigkeiten seiner Agenten setzte, wusste der Teamführer, dass der Überfall auf den Wohnsitz des Gouverneurs einer besseren Übung gleichkam, mit kaum nennenswertem Risiko. Am Morgen des kommenden Tages würde sich Papst Pius XIII. bereits in seiner Gewalt befinden, während die Agenten des Präsidenten allerhöchstens noch Erwähnung in den Todesanzeigen der morgendlichen Zeitung finden würden.
Voller innerer Vorfreude stellte sich der Teamführer vor, wie sich seine Einheit lautlos und überaus präzise durch die Hallen der Gouverneursvilla bewegen würde. Er hatte sein Team für verschiedene Einsätze trainiert, solange, bis ihnen ihre Bewegungen in Fleisch und Blut übergangen waren und ohne nachzudenken abgerufen werden konnten. Diese Operation aber bedurfte eines höheren Maßes an Entscheidungsfindung, denn hier würde es auf Nanosekunden anstatt eines Augenblickes ankommen. Dieser Sekundenbruchteil konnte in einer solchen Operation den Unterschied zwischen Erfolg oder Fehlschlag ausmachen.
Als sich die Limousine zusammen mit der restlichen Autokolonne in Richtung der Flughafenausfahrt in Bewegung setzte, bahnte sich der Teamführer seinen Weg durch die Menge und hielt auf die Türen des Terminals zu.
Kapitel 4
Annapolis, Maryland | 22. September, früher Abend
Üblicherweise residierten hochrangige Würdenträger im Blair House, dem offiziellen Quartier für Gäste des amerikanischen Präsidenten. Da die Residenz jedoch von chinesischen Delegierten in Beschlag genommen wurde, die ihre wirtschaftlichen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten zu vertiefen suchten, wurde der Papst in der Villa des Gouverneurs in Annapolis untergebracht, welche sich etwa vierzig Meilen von dem Anwesen des Vizepräsidenten entfernt auf dem Gelände des Naval Observatory befand.
Als klar wurde, dass das Blair House während der Tage des Papstbesuches nicht zur Verfügung stehen würde, schlug der Gouverneur von Maryland vor, mit zwischenzeitlich verschärften Sicherheitsvorkehrungen durch den Präsidenten den Papst in seiner Villa zu beherbergen. Dieses Angebot war jedoch keine reine Geste des guten Willens. Vielmehr bot es für Gouverneur Steele die Gelegenheit, für seinen Versuch zu werben, bei den anstehenden Wahlen einen Sitz im Senat zu ergattern. Da der Besuch des Papstes sein Image als konservativer Christ festigen würde, konnte ihm das in den kommenden Monaten viele wichtige Stimmen an der Basis einbringen.
Darlene Steele, mit der er seit elf Jahren verheiratet war, stand ihm im Wahlkampf zur Seite. Mit azurblauen Augen, einer Haut wie Porzellan und ihren anmutigen Bewegungen verkörperte sie den Inbegriff viktorianischer Unschuld. Doch hinter der grazilen Person verbarg sich gleichzeitig die Quintessenz einer Klette, die sich an den politischen Erfolg ihres Mannes klammerte und von all dem zehrte, dessen sie in seinem Schatten habhaft werden konnte. Geld, Macht und Status waren die Lockmittel, die sie ihre lieblose Ehe aufrechterhalten ließen.
Im Speisesaal der Villa hielt Gouverneur Jonathan Steele ein prächtiges förmliches Dinner mit politischen Koryphäen wie dem Vizegouverneur, zwei Senatoren und einem Abgeordneten des Repräsentantenhauses ab. Zusammen mit dem Papst und den Bischöfen des Heiligen Stuhls war der Saal bis auf den letzten Platz besetzt.
Drei Stunden lang saßen die Gäste an der Tafel, die das Zentrum des Saals dominierte, tranken Wein oder Likör oder beides und aßen von einem reichen und vielfältigen Menü, welches für jeden Geschmack etwas bereithielt.
Als stumme Zeugen jener heiteren Zusammenkunft säumten Ölgemälde früherer Gouverneure die mit Kirschholz vertäfelte Wand der östlichen Seite. Ihre für alle Zeit unbeweglichen Gesichter schienen das Geschehen mit quecksilberblauen Augen interessiert oder auch ablehnend zu verfolgen. Von der Kassettendecke hing ein prachtvoller Kronleuchter, dessen unzählige wie Tränen geformte Kristalle schillernd das Licht reflektierten. Und gegenüber der Galerie, auf der Westseite, bestanden die Wände vom Boden bis zur Decke aus Glas und gaben so einen beeindruckenden Blick auf den Horizont frei, wo im Verlauf des Mahls das schwindende Tageslicht einmal das gesamte Farbspektrum durchlief.
Ein Ereignis, wie es perfekter nicht sein konnte.
Zu vorgerückter Stunde, als sich der Zeitunterschied zwischen Rom und Washington für den Papst zu sehr bemerkbar machte, schlug Pius vor, den Abend ausklingen zu lassen. Er segnete alle Gäste, bevor er sich in seine Räumlichkeiten zurückzog.
Alle Anwesenden, auch jene, die keiner Religion angehörten oder einem bestimmten Glauben folgten, empfanden überwältigende Ehrfurcht vor diesem König, der ein Reich aus über einer Milliarde Menschen regierte.
Nachdem sich die Würdenträger wenig später ebenfalls verabschiedet hatten, herrschte bald wieder eine unheimliche Stille in dem Saal. Nur die Gesichter der Ahnengalerie blieben zurück, um über den Raum zu wachen.
Bald schon würden sie in der gleichen unbewegten Pose einem entsetzlichen Schauspiel beiwohnen, und ihre Augen, so tot und blass wie Murmeln, würden nichts von den Dingen preisgeben, derer sie Zeuge werden würden.
Nach dem Essen führte Bischof Angelo den Papst in sein Schlafzimmer und hängte dessen Ornat in dem begehbaren Kleiderschrank auf, während sich Pius für die Nachtruhe vorbereitete und seine heilige Unterwäsche anlegte – einen baumwollenen Umhang, der ihm vom Hals bis zu den Knöcheln reichte.
Nachdem sich der Papst schwerfällig auf dem Rand der Matratze niedergelassen hatte, half Bischof Angelo dem älteren Mann unter die Bettdecke und deckte ihn zu.
»Ist es bequem so?«, fragte er.
Der Papst rutschte mit den Schultern und dem Rücken ein wenig auf der Matratze hin und her, um eine angenehme Position zu finden. »Na ja, es ist eben nicht wie zu Hause«, sagte er, »aber es wird schon gehen.«
Angelo legte eine Hand auf die Schulter des Pontifex und spürte die knochigen Wölbungen eines von fortgeschrittenem Alter gezeichneten Mannes. »Vielleicht möchten Sie vor Ihrer Nachtruhe noch etwas lesen?«
Der Papst schüttelte den Kopf. »Nicht heute, Gennaro. Morgen wird für uns alle ein großer Tag werden. Wir müssen ausgeruht sein.«
»Dann schlafen Sie gut.«
Auf seinem Weg hinaus blieb Bischof Angelo noch einmal stehen, um die perlweiße Mitra, die Krone eines Königs, auf der Kommode glatt zu streichen, dann schloss er leise hinter sich die Tür, bis er das Türschloss einrasten hörte.
An den meisten Abenden las Papst Pius XIII. entweder noch aus der Bibel oder verlor sich in Passagen aus John Miltons Das verlorene Paradies, dessen Sprache und Versmaß er meisterhaft fand und das Gedicht für eine Bestätigung hielt, dass die Kirche stets durch die kritischen Augen ihrer Jünger betrachtet werden würde.
Doch an diesem Abend war er selbst zu müde, um den Umschlag des ledergebundenen Buches aufzuschlagen, und schaltete stattdessen die Nachttischlampe aus. Einen Augenblick später war der Raum in völlige Dunkelheit gehüllt.
Papst Pius faltete die Hände zu einem Gebet und dankte seinem Gott dafür, ihn aus der Bedeutungslosigkeit ins Rampenlicht geleitet zu haben.
Er entstammte einer elfköpfigen Familie, in der jeder arm, manche auch krank, aber niemand ohne Glaube oder Hoffnung war. Er hatte keine Kriege, Hungersnöte oder Heimsuchungen erlebt, außer denen, die einen in einem kleinen Dorf sechzig Kilometer westlich von Florenz in Italien ereilen konnten. Auch erfuhr er nie die Erleuchtung, dem Weg Gottes zu folgen. Als Junge war Amerigo einfach nur fasziniert von Gott und allem, wofür er stand: Das Gute, die Geborgenheit und die Fähigkeit, über andere zu herrschen und sie ins Licht führen zu können.
Außerdem träumte er davon, Predigten zu halten und das Word Gottes zu verkünden.
Seinem Vater waren diese Wünsche fremd, und deshalb zwang er seinen Sohn, zusammen mit seinen Brüdern auf den Feldern ihres Hofes zu arbeiten. Er wusste, dass sich der wahre Wert eines Mannes eher an der Menge des Getreides bemaß, die er einbringen konnte, und weniger an akademischem Wissen, welches einen Mann in ihrem Dorf nirgendwohin brachte.
Und so war aus Amerigo Giovanni Anzalone, der Zuhause von seiner Mutter unterrichtet worden war, alle Passagen der Bibel gelesen und auswendig gelernt hatte, die Grundlagen der Mathematik studierte und über ein Jahrzehnt zusammen mit seinen Geschwistern auf den Ackern arbeitete, ein gebildeter Mann mit schwieligen Händen geworden. Und er kam zu dem Schluss, dass es nicht seine Berufung war, Felder zu bestellen.
Jeden Sonntag ging er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in die Kirche. Und in den Tagen dazwischen, wenn er unter der brennenden Sonne den Ackerboden bearbeitete, träumte er davon, das Ornat eines Priesters zu tragen und Predigten zu halten. Wonach Amerigo suchte und was er brauchte, war der Zuspruch der Kirche, ihm dafür den richtigen Weg zu weisen.
Nach seinem achtzehnten Geburtstag und entgegen dem Willen seines Vaters – aber mit Unterstützung des Dorfpfarrers, gegen den sein Vater nicht aufbegehren wollte – gab Amerigo das Landleben auf und besuchte die theologische Universität in Florenz. Sein erster Schritt auf dem Weg nach Rom.
In den folgenden Jahren wurde Amerigo zum Kardinal ernannt und ein angesehenes Mitglied der Kurie, was schließlich dazu führte, dass ihn das Kardinalskollegium als Nachfolger für Johannes Paul den Zweiten vorschlug. Mit seiner Zustimmung nahm Amerigo den Namen Papst Pius XIII. an.
Und genau wie sein Vorgänger wollte Amerigo jeder Rasse und jeder Religion die Hand reichen, niemanden auslassen, niemanden allein lassen. Er wollte die Welt in Liebe und Toleranz umarmen und mit den Vereinigten Staaten den Anfang machen.
Mit diesen Gedanken schlief Papst Pius XIII. ein. Seine Hände glitten langsam auseinander und an der Bettdecke hinab.
Kapitel 5
Er war neun Jahre alt gewesen, als er seine Mutter und seine Schwester durch einen Selbstmordattentäter auf dem Weg nach Ramalla verloren hatte. Nachdem sie den Markt besucht hatten, stiegen der Junge, seine Mutter und seine zwölf Jahre alte Schwester in den Bus nach Hause ein.
Selbst bis zu diesem Tag waren seine Erinnerungen an den Schmerz und die Verwirrung nach der Explosion überaus lebendig geblieben, so als hätte sich das Unglück erst gestern ereignet.
Es war heiß in Ramallah. Seine Mutter hatte ihre Schuhe ausgezogen, um ihren Fuß zu massieren, uns seine Schwester saß schweigend neben ihr. Vom hinteren Ende des Busses aus beobachtete der Junge, wie ein Mann diesen betrat, in einem weiten Mantel, der viel zu warm für solch einen heißen Tag anmutete, und sich auf einen freien Platz ein paar Reihen vor ihnen setzte. Während der Bus seine Route abfuhr und auf dem Weg immer mehr Passagiere aufnahm, konnte er seine Augen nicht von diesem Mann abwenden.
Der Mann wirkte unruhig und angespannt. Als er sich ein paar Mal umsah und schließlich den Jungen erblickte, der ihn von hinten musterte, konnte man die Schweißperlen in seinen Augenbrauen glänzen sehen. Ihre Blicke trafen sich und irgendwie schien der Mann zu bemerken, dass er dem Jungen aufgefallen war, während all die anderen um ihn herum keine Ahnung von dem hatten, was er plante.
Mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln schien ihm der Mann freundlich zuzunicken, dann hob er die Hand. Darin hielt er eine Art Druckknopf, den man mit dem Daumen auslösen musste. »Das ist für die Besatzer der Nation des Islam. Allah ist groß!«
Als der Junge sich zu seiner Mutter umdrehen und sie fragen wollte, wer dieser Allah sei, drückte der Mann auf den Knopf.
In der Langsamkeit eines schlechten Traumes sah der Junge zu, wie der Mann in unzählige Stücke zerrissen wurde. Flammen und der Druck der Explosion ließen die Fenster des Busses zerbersten. Menschen, die neben ihm saßen, verschwanden in dem Feuer und der Asche. Gellende Schreie erfüllten die Luft, genauso wie dicker, beißender Rauch. Und von der Wucht der Detonation angetrieben traf den Jungen ein Metallsplitter am Kinn und zerschnitt das Fleisch zu einem grauenhaften zweiten Mund, der vor Verwirrung weit aufzustehen schien.
Danach erinnerte er sich nur noch an den Anblick eines Stücks blauen Himmels mit dichtem schwarzen Rauch davor und das Gefühl der Hitze von einem Feuer in seiner Nähe.
Erst als er mehrere Tage später erwachte und in das ausgezehrte Gesicht seines Vaters blickte, mit einer Haut, die wie eine lose Gummimaske an ihm hing, spürte er die unsäglichen Qualen. Mit Verbrennungen zweiten Grades an über dreißig Prozent seines Körpers und dem tiefen Schnitt an seinem Kinn hatte der Junge noch unglaubliches Glück gehabt. Der wahre Schmerz setzte erst ein, als er erfuhr, dass seine Mutter und seine Schwester bei der Explosion gestorben waren.
Als er seinen Vater fragte, warum der Mann in dem Bus das getan hatte, erklärte er es ihm.
An jenem Tag lernte er, wie sich ein Leben für einen Juden in einem Land voller unverhohlener Feindseligkeiten anfühlte.
Er holte tief Luft. Als die Bilder seiner Kindheit verblassten, öffnete der Teamführer seine Augen und erblickte die Mitglieder seiner Einheit, die meditierten, während sich der Van dem Anwesen des Gouverneurs näherte. Jeder Soldat, jedes Mitglied der Eliteeinheit stellte sich in diesem Moment bis ins Detail jede einzelne seiner Bewegungen vor, um sicherzustellen, dass es im späteren wirklichen Gefecht keinen Platz mehr für Fehler gab. So hatte er es ihnen beim Training immer wieder eingeschärft.
Jeder von ihnen war mit einem kompakten israelischen Sturmgewehr ausgestattet – ein Produkt israelischer Entwickler mit verheerenden Eigenschaften – und identisch bekleidet, angefangen von dem schwarzen Kampfanzug bis hin zu den Ski-Masken und dem Nachtsichtgerät über einem Auge. Keiner in seinem Team unterschied sich von den anderen.
Er selbst lehnte es ab, ein Kurzgewehr zu benutzen, und hatte sich daher für eine Sig Sauer P220, Kaliber .40, mit Schalldämpfer und am Griff befestigtem Laservisier entschieden. Das war die Waffe seiner Wahl – eine Waffe, an die er sich als Auftragsmörder gewöhnt hatte.
Auf dem Boden zwischen ihnen lagen Al-Hashrie und Al-Bashrah, gefesselt und in militärischer Tarnkleidung. Die beiden Männer beteten leise auf Arabisch vor sich hin, was der Teamführer ohne strafende Reaktionen aus seinem Team gewähren ließ.
Zum dritten Mal in den letzten fünf Minuten sah der Teamführer auf seine Uhr und musste feststellen, dass die Monate der Vorbereitung nun endlich Früchte tragen würden. Dann schloss er noch einmal die Augen, und die Bilder jenes Tages in Ramallah erinnerten ihn wieder daran, wieso er in den Krieg zog.
Es war 01:28 Uhr.
Kapitel 6
Annapolis, Maryland | 23. September, frühmorgens
Die zweistöckige Gouverneursvilla im Kolonialstil lag auf einer gepflegten Anhöhe. Säulen und aufwendige Faszien prägten das Bild des Hauses, an dessen Ziegelwänden unbekümmert wilder Wein emporrankte.
Auf der Kieseinfahrt, die vor der Villa endete, parkten in einigem Abstand zwei Polizeifahrzeuge mit jeweils einem Beamten in jedem Wagen. Für den Aufklärungstrupp des Teamführers stellten sie jedoch keinerlei Bedrohung dar. Sie wurden aus dem Weg geräumt, schnell und lautlos.
Von der Veranda, die um die Villa herumführte, hatte Agent Nedza einen guten Überblick und ließ sein Fernglas mit Nachtsichtfunktion langsam über das Gelände gleiten. Nachdem ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen war, nahm er das Gerät wieder herunter und begab sich zur Südseite der Veranda. Sobald er außer Sicht war, erklomm der Einsatztrupp des Teamführers die Mauer und landete hinter einer gestutzten Hecke.
Der Scharfschütze des Teams nahm das vielleicht präziseste Scharfschützengewehr der Welt, die Barrett M82A1, von seinem Rücken, spähte durch das Visier der smaragdgrünen Linse, zielte, verlangsamte seine Atmung und betätigte den Abzug. Ein gedämpfter Schuss war zu hören. Agent Nedzas Kopf schnellte durch die Wucht der Kugel nach vorn, dann brach er zusammen.
Das Licht in dem Gang wirkte gedämpft, als einer der Agenten des Präsidenten die dunkle Bibliothek des Gouverneurs betrat und lauschend als Schattenriss im Türrahmen stehen blieb. In dem Moment, als er nach dem Lichtschalter greifen wollte, ertönten drei dumpfe Schüsse in kurzer Reihenfolge, begleitet von unterbrochenem Mündungsfeuer, welches aus der dunkelsten Ecke des Raumes aufblitzte. Mit kühler Präzision bildeten die Kugeln ein enges Dreiecksmuster in der Brust des Agenten und ließen ihn so schnell zu Boden sinken, wie es die Schwerkraft erlaubte.
Im zweiten Stock, wo sich die Schlafzimmer befanden, hielten zwei Agenten jeweils am Ende des Korridors Wache. Als einer von ihnen an seinem Ohrhörer herumspielte, schlich sich ein katzenhafter dunkler Umriss an der Wand entlang, legte dem Agenten eine Schlinge um den Hals und zog ihn ins Dunkel zurück. Dort erdrosselte er ihn mit einer chirurgischen Präzision, dass es dem Agenten bis zu seinem Todeszeitpunkt nicht gelang, auch nur einen Laut von sich zu geben.
Agent Cross stand nun allein am gegenüberliegenden Ende des Korridors, ohne zu ahnen, dass er von einer Gruppe von Feinden umgeben war. Als er das Mikrofon vor seinem Mund richten wollte, wurde er unschädlich gemacht. Das geschah so schnell und geübt, dass er davon völlig überrumpelt wurde.
Nun, da die vorderste Verteidigungslinie ausgeschaltet worden war, blieb nur noch die Aufgabe, die Zielpersonen zu sichern.
Darlene Steele konnte nicht schlafen. Das Rauschen der Blätter im Wind hörte sich für sie wie eine Sinfonie weit entfernt klingender Schellen an. Selbst von ihrem Bett aus konnte sie hören, wie der Wind das bereits gefallene Laub über den Kies der Einfahrt trieb, was an das Prasseln von Feuer erinnerte.
Sie stieß einen kaum hörbaren Seufzer aus und drehte sich zu ihrem Ehemann, der neben ihr lag. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem langsamen, stetigen Rhythmus. Der rauschende Herbstwind wirkte auf ihn wohl eher einschläfernd als störend. Seit Stunden lag sie schon so da und sah den sich verändernden Mustern an der Decke zu, während sie auf den Schlaf wartete. Ihre Augen wollten nicht zufallen und immer wieder gab sie entnervte Seufzer von sich. Doch selbst ihre rastlosen Bewegungen lösten keinen einzigen mürrischen Kommentar ihres Ehemannes aus, der ungestört von ihren Aktionen schlummerte. Nach einer Weile schlug sie die Bettdecke zurück, stieg aus dem Bett und schlang die Arme um sich, um sich vor der Kälte zu schützen. Dann zog sie ihren Morgenmantel von dem Bettpfosten, verließ das Schlafzimmer und schloss hinter sich die Tür.
Im Flur drehte sie noch schnell den Thermostat auf, bevor sie die Wendeltreppe ihres 650.000 Dollar teuren, vom Staat finanzierten Anwesens hinunterstieg – eine der vielen Zulagen aus dem Beruf ihres Mannes, die ihre Ehe erträglich machten. Als Frau eines bekannten Gouverneurs hatte sie Trost in dem Ansehen und den materiellen Werten gefunden, welche die Position ihres Ehemannes mit sich brachten. Sie wusste, dass sie keine Liebesehe führten. Vielmehr handelte es sich um ein Geschäftsabkommen. Ihre Aufgabe war es, die pflichtbewusste First Lady zu mimen und der Öffentlichkeit ein Bild der Anmut, Schönheit und Eleganz zu vermitteln. Währenddessen aalte sich ihr Ehemann in unzähligen Affären, was für sie jedoch akzeptabel erschien, da sie ohnehin keinerlei Bedürfnis mehr empfand, mit ihm zu schlafen. Sie würde seine Fehltritte so lange tolerieren, wie sie eine Gegenleistung dafür bekam – den Status der Gattin eines Senators.
Während sie durch das Wohnzimmer lief, den Morgenmantel eng um sich geschlungen, freute sich Darlene bereits auf ein Glas warmer Milch, um die Kälte aus ihren Gliedern zu vertreiben.
In der Küche angekommen tastete sie nach der Kochinsel, fand sie und arbeitete sich von dort zum Kühlschrank aus Edelstahl weiter, der in einer der Wände eingebaut war. Als sie die Tür öffnete, fiel ein schwacher Lichtstrahl in die Küche, der es kaum bis in die hintersten Ecken des Raumes schaffte. Erst als sie die Milch auf der Kücheninsel abstellte, bemerkte sie etwas Schwarzes, Amöbenhaftes vor der hinteren Wand. Etwas, das schließlich die Form eines Mannes mit einer Waffe annahm.
Noch bevor ihr Verstand begriff, dass sie nicht allein war, entfuhr ihr ein leises Keuchen. Und als sie begann, den Ernst der Lage zu erkennen, schälte sich der Umriss aus der Dunkelheit. Er trug eine Kampfuniform, schwarz, mit dazu passenden Stiefeln. Sein Gesicht war zum Teil hinter einem Nachtsichtgerät verborgen. In der Hand des Eindringlings, die er für den tödlichen Schuss erhoben hatte, befand sich eine Sig Sauer Kaliber .40 mit Schalldämpfer und Laserzielvorrichtung.
»Es tut mir leid«, flüsterte der Mann und ließ den roten Punkt des Lasers erst über ihre Brust, dann über ihre Augenbrauen wandern. »Aber ich fürchte, Sie sind ein Opfer der Umstände geworden.« Dann drückte er ab. Der gedämpfte Schuss, mit dem die Kugel in ihre Stirn schlug und am Hinterkopf wieder austrat, war kaum zu hören. Blut und Gewebe aus der fleischigen Öffnung der Austrittswunde hinterließen hinter ihr einen Fleck an der Wand, der an ein Gemälde von Jackson Pollock erinnerte. Während Darlene noch lautlos und in einer Pirouette zusammenbrach, war der Attentäter bereits aus dem Raum verschwunden.
Jonathan Steele erwachte aus einem unguten, zähen Traum und bemerkte, dass seine Frau nicht neben ihm lag. Seine Hand suchte die warme Stelle auf ihrer Seite des Bettes ab, als er die phosphorgrünen Punkte bemerkte, die sein Bett wie Glühwürmchen umkreisten. Mit der seltenen Gabe einer kräftigen Stimme ausgestattet forderte er die lebenden Schatten in seinem Zimmer heraus.
Die sich bewegenden Kreise erstarrten.
Dann drang aus der Tiefe der Schatten eine emotionslose Stimme zu ihm heran. »Gouverneur Steele.« Ein bedrohlicher Umriss bewegte sich näher auf das Bett zu. »Sie wurden als moralisches Opfer auserkoren.«
Der Gouverneur sah sich zum Handeln veranlasst und warf die Decke zurück. Das Geräusch, das er von sich gab, als ihn mehrere Hände wieder zurück auf die Matratze drückten, erinnerte nun kaum noch an sein eben noch unter Beweis gestelltes Selbstbewusstsein. »Was soll das? Sie haben kein Recht, das zu tun! Lassen Sie mich los!«
Steele sah, wie sich die phosphorgrünen Augen bewegten und spürte die Stärke seiner Angreifer, als einer der Eindringlinge den Ärmel seines Schlafanzuges nach oben schob und ihm die Nadel einer Spritze in den Arm stach. Sofort verschwamm das Licht vor seinen Augen. Er bemerkte noch, wie sich sein Verstand immer mehr verlangsamte, dann fiel er in eine tiefe und vollständige Dunkelheit.
Das Geräusch kam von fern, doch es genügte, um Papst Pius XIII. aus einem undeutlichen Traum zu reißen, an den er sich kaum erinnern konnte. Er lag da und lauschte, hörte aber nichts weiter als die Blätter, welche der Wind gegen sein Fenster wehte.
Als er sich in eine sitzende Position gebracht hatte, glaubte er, die schattenhafte Bewegung von Füßen hinter dem Spalt unter seiner Schlafzimmertür gesehen zu haben.
»Hallo?«
Obwohl sich nun nichts mehr regte, wusste Pius doch genau, dass hinter der Tür jemand stand.
In einem etwas besonnenerem Ton schob er nach: »Gouverneur?«
Die Tür öffnete sich langsam und offenbarte zwei Männer in militärischer Kleidung, die sich vor dem Flur abzeichneten. Das einzige Licht stammte von dem fahlen, bläulich wirkenden Mondlicht, das zum Fenster hereinfiel. Einer der Männer hob die Hand, betätigte einen Schalter an seinem Sichtgerät und aktivierte ein phosphorgrünes Licht, welches ihm den Vorteil der Nachtsicht verschaffte.
»Eure Heiligkeit«, sprach ihn einer der Männer an, doch der Papst konnte nicht zuordnen, welcher der beiden zu ihm sprach. »Wir werden Ihnen nichts tun.«
Die Stimme des Pontifex blieb gefasst. »Was wollen Sie?«
»Ihre Kooperation.«
»Wozu?«
Die uniformierten Männer sahen einander kurz an, bevor sie sich wieder dem Pontifex zuwandten.
»Bitte, Eure Heiligkeit, machen Sie die Dinge nicht unnötig kompliziert.«
»Kompliziert? Ich habe lediglich eine Frage gestellt.«
Dann wurde eine der Stimmen weniger freundlich. »Rollen Sie Ihr Gewand nach oben.«
Beide Männer liefen gleichzeitig auf ihn zu. Derjenige mit dem Nachtsichtgerät hielt eine Spritze in der Hand, der andere ein Sturmgewehr. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, presste der Soldat mit dem Kurzgewehr dem Papst die Mündung der Waffe an die Schläfe. »Rollen Sie Ihr Gewand nach oben … und zwar sofort.«
»Ich verstehe nicht …«
»Das müssen Sie auch nicht. Rollen Sie das Gewand nach oben.« Der Soldat presste den Lauf nun noch etwas fester in das weiche Fleisch.
Der Papst folgte der Aufforderung. Er spürte den Stich der Nadel und ergab sich der Wirkung ihres Inhalts.
Kapitel 7
Der Teamführer war überaus zufrieden, dass die gesamte Operation weniger als zehn Minuten gedauert hatte und es unter seinen Leuten keine Opfer zu verzeichnen gab. Die Verluste der Gegenseite waren schnell und leidenschaftslos erfolgt.
Während er die Operation in den von kaltem blauen Licht beschienenen Speisesaal verlegte, welches durch die Fenster der Westseite fiel, kostete der Teamführer seinen Sieg aus. Hinter ihm betrachteten die Augen der toten Gouverneure das Treiben mit stummer Distanziertheit.
Am Ende des Esstisches und unter der breiten Krempe seines Hutes verborgen, die sein Gesicht noch tiefer im Schatten liegen ließen, saß ein Mann mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen. »Ihr Team war gut«, sagte er. »Sehr viel besser, als ich es erwartet hätte.«
Der Teamführer lief auf den Mann zu, wobei ihm sein Nachtsichtgerät gute Dienste leistete, und blieb vor ihm stehen. »Ihr Job hier ist erledigt, Judas. Ihre Dienste werden nicht weiter benötigt.«
»Und damit die Schlussszene dieses großartigen Schauspiels verpassen? Das glaube ich eher weniger«, antwortete der Mann regungslos und mit einer Stimme, die sich so kalt wie der Fliesenboden unter seinen Füßen anhörte.
Der Teamführer verbeugte sich knapp. »Wie Sie wünschen.«
»Dann legen wir mal los.«
Al-Bashrah und Al-Hashrie wurden in den Speisesaal geführt und auf die Knie gezwungen. Auf beide Hinterköpfe war der Lauf eines Sturmgewehrs gerichtet. Keiner der beiden Gefangenen war bereit, Angst zu zeigen. Sie hatten beschlossen, ihrem Schicksal erhobenen Hauptes zu begegnen.
Bewundernd lief der Teamführer um die beiden herum und fragte sich, was diese Männer dazu bewog, ihr Leben für ein Jenseits zu opfern, welches er selbst für mehr als unwahrscheinlich hielt. Dann sprach der Teamführer sie auf Arabisch an, damit nur sie ihn verstehen konnten.