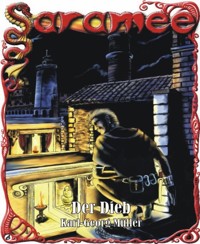6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ashera Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Morna LeFay steht mit der mythischen Anderswelt in Verbindung, doch ihre magischen Fähigkeiten locken die Mächte aus dem Land Mercia an. Sie wird verschleppt und in die Dienste von Cwen Godiva gezwungen, an deren Hofe sie ihre Ausbildung erhält. Bald strömen unter Schmerz und Pein die „Schwarzen Schmetterlingen“ aus ihr, der Jungbrunnen für die Adligen. Aber längst schleichen dunkle Schatten durch das Schloss. Und Morna hofft, zwischen Ränkespiel und Intrigen ihre große Liebe gefunden zu haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Impressum
Widmung
Die Herrin der Dornen
Epilog
Zwei Jahre später
DER AUTOR
Die Herrin der Dornen
BDSM-Erotik
Karl-Georg Müller
Ashera Verlag
Das RosenRote Schlüsselloch
Band 3
Impressum
2. Auflage 2019
Copyright © 2019 dieser Ausgabe by Ashera Verlag
Hauptstr. 9
55592 Desloch
www.ashera-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder andere Verwertungen – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung des Verlags.
Covergrafik: iStock
Innengrafiken: Fotolia
Szenntrenner: Fotolia
Coverlayout: Atelier Bonzai
Redaktion: Alisha Bionda
Lektorat & Satz: TTT
Vermittelt über die Agentur Ashera (www.agentur-ashera.net)
ISBN: 978-3-948592-07-3
Petra
Für alles. Und noch viel mehr.
Ein Glitzern stahl sich in ihre Augen. Nur kurz, dann tauchte es weg, wie die kleine Fee, die sich im Schilf versteckte. Wassertropfen sprühten hoch und benetzten ihr Gesicht, das seinen winterblassen Teint in den letzten Tagen verloren hatte. Morna nutzte jeden Sonnentag aus, um ihrem Elternhaus zu entfliehen, und sich am See, nahe des Wasserfalls, in ihren Tagträumen treibenzulassen. Und das Spiel mit ihrer Fee zu genießen, die ...
»Hörst du auf!« Morna lachte, als die nächste Wasserkaskade ihre Haare in ein nasses Bündel verwandelte. Der Zopf wedelte vor ihrem Gesicht, was den Versuch, ihre Spielgefährtin zu entdecken, nicht leichter machte. Da, kaum fünf Schritte von ihr im dichten Schilf, funkelten die Augen von Nindé. Na warte, du Biest! Morna legte zwei kurze Armzüge zurück. Schon tauchte die Kleine wieder ab. Das Mädchen schwamm im Kreis und lugte zwischen die Pflanzen, die Fee blieb jedoch verborgen.
»Du erwischst mich nicht«, stichelte die dünne Stimme hinter ihr. Morna fuhr herum – und griff ins Leere. Nindé flatterte hoch zu einem ins Wasser hängenden Ast und setzte sich darauf. Sie begutachtete ihre schmalen Finger und schaute traurig drein. »Wegen dir hab ich mir einen Fingernagel eingerissen«, jammerte sie und hielt Morna die Hand hin. Dann hüpfte sie herab und landete auf dem Mädchen. Wie ein Flügelpaar hing sie auf dessen Schultern. Bevor Morna die federleichte Last abschütteln konnte, krochen zehn flinke Finger über das dunkle Muttermal hinweg zu ihren Brustwarzen und zwickten sie. Morna staunte nicht zum ersten Mal darüber, wie frech diese zerbrechliche Fee war. Mit ihrem niedlichen, blassen Gesicht sah sie rein wie eine Schneeflocke aus. Als ob das nicht unschuldig genug wirkte, bedeckte eine goldene Lockenpracht, die bis zu ihren Knien wehte, ihre Augen. Manchmal wischte sie sich die Haare aus der Stirn, worauf der Schalk aus den rehbraunen Augen blitzte.
Jetzt störte es Morna, dass Nindé mit ihren Zärtlichkeiten begann. Obwohl sie sonst das Spiel der kleinen, flinken Feenfinger liebte, die in manche unbekannte Grotte vorgedrungen waren und ihr nicht wenige Seufzer entlockt hatten, war ihr nicht danach zumute. So früh am Morgen war sie nicht in der Stimmung. Zudem spürte sie eine Veränderung.
Seit einigen Minuten beobachtete sie jemand.
Sie waren nicht allein am See.
Ein Sonnenstrahl stahl sich durch das Blätterdach der Bäume und blendete Morna. Sie sah kaum noch die kleine Fee, dafür etwas am nahen Ufer, eingehüllt in dicht gewachsene Büsche. Wieder war da ein Glitzern, vermutlich rührte es von einem Gegenstand aus Silber, auf dem sich die Sonnenstrahlen brachen. Doch am See gab es nichts, was Morna nicht kannte; keinen noch so kleinen Ast, den sie nicht mit eigenen Augen gesehen, keinen Stein, den sie nicht berührt hatte. Das Glitzern wanderte, verschwand, wurde für einen Moment abermals sichtbar. Und kam näher.
Nindé spürte Mornas Unbehagen, denn wie weicher Regen tropften die Gefühle des Mädchens zu der kleinen Fee.
Sie sprang zurück auf den Ast. »Ich sehe einen Menschen«, wisperte sie, entfaltete ihre Flügel und segelte wie eine Feder in den See. Die glatte Wasseroberfläche wurde nur unmerklich zerrissen, als sich das Wesen den Blicken entzog. Morna achtete nicht länger auf sie. Da war wirklich jemand.
Sie atmete tief ein und tat es Nindé gleich. Knapp über dem schlickigen Boden paddelte sie zum Ufer. Sie musste an ihre Kleidung gelangen, denn nackt konnte sie nicht weglaufen. Und nach Weglaufen war ihr jetzt zumute. Noch nie war ihr an diesem verwunschenen Ort eine Menschenseele begegnet. Tiere – ja, die kreuzten häufig auf; Rehe tranken vom kühlen Nass, und vor dem letzten Winter glaubte Morna sogar, einen Bären durchs Unterholz brechen zu hören. Sie hatte Reißaus genommen. Aber ein Mensch? Menschen waren gefährlich, schließlich konnten sie entdecken, was sie hier tat, und unangenehme Fragen stellen. Und wenn herauskam, warum sie den entlegenen See liebte, würde sie sich zu Hause und im Dorf gehörigen Ärger einhandeln. Niemand durfte erfahren, dass die artige Morna LeFay Wesen aus der Anderswelt beschwören konnte. Erst recht musste es ihr Geheimnis bleiben, was sie mit Nindé trieb.
Erneut knackte es im Unterholz, Schritte, die kleine Äste brachen und sich näherten. Hastig sprang Morna ans Ufer. Rutschte aus, landete auf Händen und Knien. Das nasse Haar klatschte ihr ins Gesicht. Sie atmete einmal tief durch. Ihr Kleid lag gleich hinter dem Busch auf dem knorrigen Ast, den sie immer als Ablage wählte.
»Wen haben wir denn da?« Die Stille zersprang unter der scharfen Stimme.
Sie hatte sich also nicht getäuscht, sie war nicht allein. Morna schaute nicht auf. Sie zitterte, Kälte zog durch ihre Glieder. Dann erst wagte sie den nächsten Atemzug. Eine Hand griff in ihre Haare, nicht brutal, aber energisch.
»Sieh mich an, Kleine, wenn ich mit dir rede.« Er hob ihren Kopf an. Das tropfende Haar fiel ihr wie ein Gespinst vor die Augen. Ein Mann ragte vor ihr auf. Ihr Blick streifte über die schwarzen Lederstiefel, die an den Knien in eine elegante Schnürhose übergingen. Am Gürtel pendelte eine Peitsche. Das fiel ihr sofort auf. Jemand vielleicht, der Tiere abrichtet, schoss es Morna durch den Kopf. Doch dazu war die Kleidung eigentlich zu vornehm und die Sprache des Mannes zu ungewöhnlich. Er betonte jede Silbe, als ob er ein dummes Ding vor sich hätte, dem er etwas erklären musste. Sie ließ sich nicht gerne mit den jungen Mädchen aus der Stadt auf eine Stufe stellen, die strohdumm waren und nichts anderes als Jungs im Kopf hatten.
»Du bist reizend. Der Blick deiner Augen springt munter umher wie die Stichlinge im See. Aber du wirst dich verkühlen, die Sonne neigt sich dem Horizont zu.« Er fasste Mornas Zopf fester. Das Mädchen kniff die Lippen zusammen und ruckte zurück. Es schmerzte, aber sie wollte diesem Mann zeigen, dass sie nicht ohne Gegenwehr machte, was er wollte.
Er lachte schallend. »Du gefällst mir, meine Hübsche. Störrisch wie eine Stute vor dem Zureiten. Dabei will ich dir doch nichts. Weißt du was, ich drehe mich um, und du ziehst dir dein Kleid über. Danach sehen wir weiter.« Er zwinkerte ihr zu, als sei es eine ausgemachte Sache. Und das war es auch, denn Morna blieb keine andere Wahl. Sie berappelte sich eilig, sprang zu ihrem Baumstamm, zerrte ihre Unterhose hoch und schlüpfte in das Kleid, nicht ohne dem Mann ein ums andere Mal einen Blick zuzuwerfen. Der drehte sich wirklich nicht um. Das beruhigte sie nicht, aber wenigstens wusste sie nun, dass er sich an seine Versprechen hielt.
War das nicht die Gelegenheit, sich auf und davon zu machen? Sie kannte verwinkelte Pfade im Wald, auf denen sie dem Unbekannten leicht entkommen konnte. Aber wenn er nicht alleine war? Vielleicht warteten hinter dem nächsten Baum andere, die sie viel grober behandeln würden. Was war denn passiert? Nichts! Sicher, es war seltsam, am See einem Menschen zu begegnen. Aber war dieses eigenartige Zusammentreffen nicht ein Wink? Sie schaute hinüber, aber so, dass der Mann ihre Neugierde nicht bemerkte. Er kehrte ihr den Rücken zu. Schnell huschte sie den Weg zurück, auf dem ihre Füße in den letzten Tagen Spuren hinterlassen hatten. Sie roch den Frühling. Und dann ihn, je mehr sie sich ihm näherte. Er verlieh der Luft um ihn herum eine Würze, die sie aus der Dorfschänke kannte. Dorthin hatte sie sich ein einziges Mal getraut – als sie ihren Vater vom Zechen abholen musste. Sie hatte ihn sturzbetrunken mitten zwischen grölenden Kumpanen gefunden. Einen Becher hielt er in der Hand, aus dem das Bier schwappte, und ein dümmliches Grinsen machte aus seinem Gesicht eine Fratze, als er sie sah. Die Männer hatten anders gerochen als sonst, nach Schnaps und Rauchwerk. Genauso roch auch der Unbekannte.
Sie knickte mit dem Arm einen Ast ab. Der Mann drehte sich um. Seine Blicke wanderten ihren Körper wie zwei glühende Sternschnuppen entlang und hefteten sich an ihre Brüste, die sich unter der Anspannung hoben und senkten. Mornas Wangen färbten sich in ein sanftes Rot – wie die Abendsonne, die über den Weiden stand.
»Komm näher, ich beiße nicht«, sagte der Mann.
Morna zögerte. Noch konnte sie davonlaufen. Und das tat sie auch. Im Nu wirbelten ihre Füße über den weichen Laubboden, als liefe sie um ihr Leben. Sie kurvte um den ersten, den zweiten, dann den dritten Baum, sprang über ein hohes Gebüsch, blieb mit dem Kleid in den dornigen Zweigen hängen und strauchelte. Zwei Hände packten zu und hielten sie fest.
Der Mann hatte sie vor dem Sturz in die Rosenhecke bewahrt. Er keuchte nicht weniger als sie, doch seine Augen verrieten, dass er sie nicht entkommen lassen würde. Also gehorchte sie nun. Was hatte sie ihm auch entgegenzusetzen?
Seine Hand berührte ihre Wange. Weich wie Samt war sie und dennoch kalt wie der Morgenwind. Widerstrebend sog sie den herben Duft ein und schaute auf, sah in Augen blau wie der Nachthimmel. Ihr Herz klopfte heftiger. Sie schlug die Hand beiseite, aber seine Finger schlossen sich wie Bänder um ihren Oberarm, trieben ihr den Schmerz in die Augen.
»Lasst mich gehen, Ihr tut mir weh!«, rief sie und sah ihn an, die Augen nass von Tränen. »Bitte.«
Er gab ihr nur ein raues Lachen, das seine Wangen mit schmalen Furchen zeichnete. »Lauf nicht weg, Mädchen, du hast nur vor dir selbst Angst. Was soll denn geschehen? Glaubst du etwa, ich mache die weite Reise, um ein junges Ding wie dich zu ...« Er legte eine Pause ein.
Morna schluckte.
»Was sollte ich mit dir wohl anfangen? Siehst du, du weißt es selbst nicht. Also, wovor hast du Angst?« Die Finger packten weniger fest zu. »Wie heißt du überhaupt? Und was machst du an einem einsamen Ort wie diesem?«
»Was geht es Euch an, wie ich heiße?« Morna spitzte die Lippen. Sollte sie ihm wirklich ihren Namen verraten? Durch ihre magischen Spielereien wusste sie nur zu gut, dass man seinen Namen nicht ohne einen guten Grund ausplauderte.
»Ich bin Nygel«, nahm der Mann ihren Gedanken auf. »Syre Nygel.«
Beim Wort Syre hob er eine Augenbraue. Doch auch so hatte Morna gewusst, dass es mit dem Titel etwas Besonderes auf sich hatte. Denn dumm war sie ja nicht, im Gegenteil, ihre Mutter hatte ihr vieles beigebracht. Sie konnte ihrem Vater Briefe vorlesen, die er von weit entfernten Kunden erhielt, oder kleine Nachrichten als Erwiderung niederschreiben, die er ihr diktierte. Sie wusste viel über die Pflanzen, die rund um ihr Dorf Athna Sceire auf den Wiesen wuchsen. Zudem hatte sie die zahlreichen Tiere, die durch Gebüsch oder Wald streiften, mit eigenen Augen gesehen. Und bereits in ihren frühen Kindertagen drang sie in die Anderswelt ein, unwissentlich angeleitet von ihrer Mutter.
Sie zwinkerte. Der Syre wartete geduldig. Ja, von Syres und von feinen Ladys erzählte ihre Mutter des Abends, wenn das Kaminfeuer die letzte Wärme aus dem Holz sog. Kurz vor dem Zubettgehen, sie beide alleine und aneinander in eine Decke gekuschelt. Dann berichtete ihre Mutter von dem fernen Land, das sie Mercia nannte. Sie sprach den Namen mit Ehrfurcht aus. Und bei den Geschichten über Schlösser, deren Türme in den Himmel greifen, und den riesigen Zimmern, in denen sich die Herrschaften zu den Klängen von Lauten und Harfen versammeln, glänzten die Augen der Mutter. Sie drehen sich im Kreis, sagte sie, tanzen von der Stunde an, wenn die Sonne die Säle in Dunkelheit hüllt und die prunkenden Leuchter ihre tausend kleinen Strahlen werfen, bis zum Morgengrauen. Sklaven löschen danach die Kerzen, indem sie auf die Schultern eines Anderen steigen, denn die Leuchter hängen so hoch, dass niemand vom Boden aus heranreichen kann.
»Mädchen, du träumst«, sagte der Mann.
Sie kannte zwar seinen Namen, aber nicht den Grund, warum er aus dem fernen Land gekommen war. Morna zwinkerte, um die Geschichten der Mutter wegzuscheuchen. Denn neben allem Prunk, den sie mit Worten in das warme Zimmer gemalt hatte, berichtete sie auch – wobei sie flüsterte und ihre Tochter verpflichtete, nie etwas davon Anderen preiszugeben – von grausamen Geschehnissen. Nie machte sie mehr als vage Andeutungen. Morna hakte nach, doch der Mund der Mutter blieb verschlossen. Und jetzt stand ein Herr vor ihr, der aus Mercia gekommen war. Mercia, das fremde Land. Morna spürte etwas wie Abenteuerlust in sich keimen, das Gefühl, etwas Neuem auf den Grund gehen zu können. Dieselbe Neugierde, die sie damals auch in die Anderswelt gelockt hatte.
»Entschuldigt, ich ...«
Er unterbrach sie mit einem Fingerzeig. »Syre! Hast du das schon vergessen?«
Sie sah ihn mit großen Augen an. Dann verstand sie. »Entschuldigt, Syre, aber ich dachte an meine Mutter. Sie verbot mir, mich mit Fremden zu unterhalten.« Das war nicht einmal gelogen, wenn ihre Mutter auch nie daran gedacht hatte, dass sich Morna weiter als bis zum Dorfrand trauen würde.
»Also werde ich besser mit deiner Mutter sprechen, sobald sich die Gelegenheit ergibt«, sagte Syre Nygel. Wie zur Beruhigung strich sein Handrücken über ihre Wange. Der mit einem Edelstein verzierte Goldring streifte dabei scharf über ihre Haut.
»Ihr tut mir weh, Syre«, begehrte Morna auf, der tadelnde Blick des Mannes duldete jedoch keine Widerworte. Die buschigen Brauen wölbten sich wie unheilvolle Wolken über seinen Augen. Er war kein hübscher Mann; selbst im Dorf gab es Kerle, die ansehnlicher waren. Sie konnte sogar seine Haare an einer Hand abzählen, so wenige hatte er.
Aber es ging etwas Unnachgiebiges von ihm aus; weniger die Art von Strenge, die sie von ihrem Vater kannte. Und die sie fürchtete, wenn er betrunken durch die Zimmer stampfte und sie suchte, damit sie ihm die Stiefel auszog. Bei dem Mann lagen eine Stärke und eine Macht in der Stimme und in den Augen, die ihr in dieser Intensität noch nie begegnet waren.
Wieder schaute sie sich um, eine Flucht war auch jetzt noch möglich. Selbst auf die Gefahr hin, dass er sie ein zweites Mal erwischen würde, konnte sie ihr Glück versuchen. Wobei, ihr fiel mit Schreck ein, dass sie Nindé völlig aus den Augen verloren hatte. Wie konnte sie nur ihre Freundin vergessen? Sie spähte zum Wasser. Dort regte sich nichts. Sicher war ihre kleine Fee in die Anderswelt zurückgekehrt. Ein nicht ungefährlicher Umstand. Weil sie das Wesen herbeigerufen hatte, war sie verpflichtet, es zurück in seine Heimat, die Anderswelt, zu bringen. Sie musste Nindé bald locken, um zu sehen, ob sie unversehrt war. Solange würde sie dem Syre Antworten geben, bis er endlich seiner Wege ging.
»Morna heiße ich, Syre. Morna LeFay.« Sie betonte LeFay wie er seinen Titel. Dabei grinste sie frech. Er lächelte. Ein Stein fiel ihr vom Herzen, denn solange er ihr wohlgesonnen war, würde er sie sicher in Ruhe lassen. »Meine Mutter weiß genau, wo ich bin«, fügte sie hinzu. »Und meine Brüder können mit dem Schwert umgehen wie sonst keiner.« Die Worte flogen aus ihrem Mund. Der Mann durfte nicht merken, dass keines davon stimmte.
»Dann ist es dir sicher recht, wenn ich dich zu deiner Mutter begleite und mich ihr vorstelle.«
Morna verspürte ein Gefühl, als würde ein Stein in ihren Bauch plumpsen. Genau das durfte nicht geschehen, denn würde die Mutter von ihren Ausflügen an den See erfahren, dürfte sie zwei Wochen oder länger keinen Fuß vor die Tür setzen.
»Nein, es ist nicht nötig, Syre, dass ihr mich nach Hause bringt. Ich gehe den Weg jeden Tag, ich kenne alle Steine und jede Wurzel.« Ihre Augen flackerten vor Angst.
»Ach, es ist kein Umstand, Morna. Ich benötige für zwei oder drei Nächte ein Obdach, bevor ich meine Heimreise antrete. Deine Mutter wird wissen, wo ich unterkommen kann, wie es sich für einen Syre gehört.«
Morna brummte der Kopf. Auf keinen Fall durfte er mit ihrer Mutter sprechen. »Syre, so glaubt mir doch, ich brauche Eure Hilfe nicht.« Wenn nur Nindé bei ihr wäre, sie würde ihr den richtigen Rat ins Ohr flüstern. Nur durch ihre verflixte Unachtsamkeit hatte sie die Fee vertrieben.
Syre Nygel packte diesmal fester zu. Morna schrie vor Schmerz. Er grollte: »Mädchen, dein Dickschädel hilft dir bei den Dorfjungen weiter, aber nicht bei mir. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder gehen wir zu deiner Mutter, und ich rede mit ihr. Oder ...« Er schwieg und starrte sie an. Morna zitterte wie die Äste hinter dem Syre, in denen sie ein weißes Wesen ausmachte.
Nindé! Die Kleine war nicht in die Anderswelt zurückgekehrt, sondern beobachtete sie.
Syre Nygel fuhr fort: »Oder du wirst mir am Abend Gesellschaft leisten, wenn ich eine Bleibe gefunden habe.«
Morna riss die Augen auf. Was sagte der Syre, er wolle sie abends bei sich haben? Was das hieß, wusste sie nur zu genau. Das war nicht anders als mit Kevin im letzten Mond, der sie nach dem Dorffest ins nasse Gras zog und ihr die Unschuld nehmen wollte. Der Syre war nicht besser als die jungen Kerle aus ihrem Dorf. Sie riss sich los, doch seine Hand packte sofort wieder zu. Mit der Linken griff er in seine Tasche und zog ein Fläschchen heraus. Er entkorkte es mit den Zähnen und hielt es ihr unter die Nase. Sie schüttelte abwehrend den Kopf. Es half nichts. Aus dem Glas entströmte ein klebriger Schwall. Sie atmete ihn ein. Der Geruch war süß, so wie der von Rosen, und schwer. Unglaublich schwer. Zuletzt sah sie die goldene Kette, die sich um Syre Nygels Hals wand und die ihm gerade jetzt aus dem halb offenen Hemd baumelte. Dann fielen ihr die Augen zu. Ihre Beine wurden leicht, so leicht wie Federn. Sie sank in die Arme des mysteriösen Mannes.
Rion war es recht, dass der vergangene Tag ereignislos verlaufen war. Die Begegnung mit dem Jungbären hatte ihn nicht nur Kraft gekostet, sondern auch eine schmerzende Wunde hinterlassen. Sie nässte sein zerrissenes Hemd seit Tagen ein. Da half auch die Versorgung durch die bucklige Alte wenig, die ihn etliche Tage in ihrer Hütte gepflegt hatte. Womöglich musste er in Alnburgh einen Wundheiler aufsuchen. Vorsorglich klopfte er auf den Geldbeutel unter seiner Jacke, es hörte sich jämmerlich an. Die wenigen Pening reichten noch für eine Mahlzeit oder eine Unterkunft im Pferdestall – wie damals in seinen jungen Jahren, als er sein Leben im Norden durch eine kopflose Flucht nach Mercia beendete. Er dachte selten an die Zeit zurück, als er und Kayla noch nicht zusammen waren. Bis nach Alnburgh war er gewandert, genau wie jetzt, nur geschah das damals unter anderen Vorzeichen. Er hatte sein Leben selbst in die Hand nehmen und das ärmliche Vegetieren in den Bergen gegen ein besseres Leben eintauschen wollen. Das bessere Leben hatte er gefunden, es hatte sich ihm aufgedrängt, und dennoch war es unerreichbar für ihn gewesen. Er landete im Hafenviertel, wo er eine schlecht bezahlte Arbeit als Handlanger annahm. Sein Geld war er regelmäßig nach dem Zahltag wieder los, er versoff es in der nächsten Schänke. Ein halbes Jahr brachte er durch, dann wachte er eines Morgens nackt und mit seinem Erbrochenen besudelt in einer Gosse auf. Die Arbeit schmiss er hin. Wie ein getretener Hund kehrte er in seine Heimat zurück. Mit niemandem sprach er darüber, was er in der Nacht wirklich erlebt hatte.
Nach all den Jahren bauten sich die Häuser von Alnburgh heute ein zweites Mal vor ihm auf. Er stützte sich müde auf den Stock, als drücke die vergangene Zeit schwer auf seine Schultern. Eine junge Frau schob ihren Karren schnaufend an ihm vorbei. Vorhin hatte er sie überholt.
»Warte, überlass mir den Karren«, bot er an. Die Frau nickte augenblicklich. Auf dem Karren häuften sich Kohlköpfe. Rion warf den Rucksack auf die Ladung und schob das Gefährt an. Leicht war es nicht, weshalb er über die Kraft der Frau insgeheim staunte.
»Ist heute Markttag?«, versuchte sich Rion mit einem Gespräch, wieder erntete er nicht mehr als ein Nicken. Na gut, dann würden sie halt stumm die Stadt betreten, jedenfalls war nach der Einsamkeit der letzten Tage eine wortlose Begleitung besser als gar keine.
Alnburgh schützte seine Einwohner durch eine gut drei Meter hohe Stadtmauer. Zwar musste die Stadt, obwohl sie am Meer lag, keine Angriffe von See und erst recht nicht vom Land fürchten, doch eine Mauer diente oft noch anderen Zwecken: Wegezoll einfordern zu können und die Bürger vor Gesindel wie fahrendem Volk schützen. Im Zweifelsfall zählte er zum Gesindel, nicht nur wegen seiner Herkunft, sondern auch angesichts seines jämmerlichen Äußeren. Seine Jacke war steif vom Dreck, die Hose an beiden Beinen eingerissen und die Schuhe waren im Spann aufgesprungen. Er machte wirklich keinen guten Eindruck. Vorsichtig schielte er zu der jungen Frau. Kein Wunder, dass sie mit ihm nicht reden wollte.
Charme war ihm zwar fremd, aber bevor die Torwachen von Alnburgh unangenehme Fragen stellten, musste er ihr Vertrauen gewonnen haben, damit sie ihn hineinschleuste.
»Du hast keine Hilfe?« Eine blöde Frage. Sie blickte ihn aus den Augenwinkeln an. Jetzt sag schon was, dachte er, aber sie starrte wieder verbissen auf den Weg.
»Nein.« Na, wenigstens eine Antwort, wenn auch arg kurz. »Und ich brauche niemanden.«
Hoppla, das klang bissig. Aber er gab nicht auf. »Gefährliche Zeiten, Mädchen, um so alleine auf der Straße unterwegs zu sein. Schnell ist mal einer hinter dir her.«
»So wie du?« Sie grinste.
Na also, es ging doch. Der Schalk sprühte in ihren Augen, genau wie bei Kayla, wenn sie einen ihrer Scherze mit ihm trieb. Er schob den Karren schnell voran. Zwei Kohlköpfe kullerten vom Gemüseberg auf die Straße.
»Gib acht«, sagte sie nur. Gleichzeitig bückten sie sich und ihre Köpfe stießen zusammen. Vor Schreck fuhren beide hoch – und hielten beide einen der Kohlköpfe in den Händen. Wieder das schelmische Lächeln, das ihr blasses Gesicht mit einer sanften Röte überzog und eine dunkle, kreuzförmige Narbe über ihren Augen betonte.
»Da waren wohl vier Kohlköpfe auf einem Fleck.«
»Drei Kohlköpfe und ein Dickschädel.« Rion grinste und rieb sich die Stirn. Das würde eine mächtige Beule geben. »Dann nenn mir jetzt wenigstens deinen Namen, damit ich weiß, von wem ich mir die Kopfnuss eingehandelt habe.«
Die junge Frau legte den Kopf schief, als überlege sie, ob der Kerl vor ihr etwas im Schilde führte. Es mochte sein, dass Rions Erscheinung nicht abstoßend wirkte, es mochte auch sein, dass sie ebenso wie er Gesellschaft suchte. »Riamon. Vom Wolfshof.« Sie betonte den Wolfshof, als ob es mit ihm etwas Besonderes auf sich hätte. Mehr sagte sie nicht, dafür nickte sie ihm auffordernd zu. »Was ist mit deinen Blessuren? Bist du unter die Räder gekommen?«
Rion schüttelte den Kopf. Erst wollte er nichts erzählen, aber dann sprudelte es aus ihm heraus. Einsamkeit kann schweigsam machen, oder einen Damm öffnen. Und Rion traute der jungen Frau.
Also berichtete er in hastigen Worten von Kaylas Entführung. Wie ein Syre aus Mercia seine Liebste geraubt hatte. Riamon nickte mehrmals. Als er von seinem Zweikampf mit dem Jungbären erzählte, der ihn fast das Leben gekostet hatte, schlug sie die Hand vor den Mund und machte große Augen.
»Wie hast du ihn besiegt?«
»Mit mehr Glück als Verstand. Der Bär stapfte heran, als ich mitten im Wald gerade auf der Suche nach einem Schlafplatz war. Ich hörte ihn, weil Äste unter seinen gewaltigen Tatzen brachen und der Schnee knirschte. Bevor ich wusste, wie mir geschah, war er über mir. Seine linke Pranke schlug wie ein Hammer auf mich ein, erwischte mich an der Schulter und schleuderte mich zu Boden. Aber ich zog meinen Dolch schnell genug und stieß zu. Wie das Vieh dann verreckte, weiß ich nicht.« Rion schob den Karren mit Wucht weiter. »Jedenfalls warf ich mich auf seinen Rücken und durchschnitt ihm Kehle und Schlagader. Der Bär fauchte abermals, dann war es vorbei.«
Riamon beäugte ihn. »Du redest so gelassen, als ob du nicht auf Leben und Tod gekämpft hättest. Kelby wird die Geschichte todsicher gefallen.«
»Kelby – dein Mann, oder was?«
Von Westen wehte ein graues Wolkenknäuel heran, die ersten Tropfen nieselten auf sie herab. Alnburgh würde ihm die nasskalte Schulter zeigen, was natürlich auch gut zu dem trostlosen Ort passte.
»Ja, Kelby ist mein bestes Stück. Aber du weißt jetzt meinen Namen und seinen und bist mir deinen noch immer schuldig.« Sie zwinkerte ihm aufmunternd zu.
Während er den Karren um die letzte Kehre manövrierte, antwortete er: »Ich bin Rion. Und wie du bestimmt an meiner Sprache erkennst, stamme ich aus Dál Riada.« Nachdem sie sich nicht abfällig äußerte, fuhr er fort: »Ich bin auf der Durchreise.« Er suchte die richtigen Worte, zu viel verraten durfte er nicht. »Irgendwo im Süden will ich mein Glück versuchen. Aber ein paar Münzen muss ich mir vorher dazuverdienen, sonst komme ich nicht weit. Du verstehst sicher.«
»Natürlich verstehe ich, ich bin ja keine Wilde.« Jetzt spielte sie doch auf seine Herkunft an. Für die Menschen in Mercia waren die Bewohner des Nordlands ein minderwertiger Menschenschlag, wobei – je weiter man nach Süden vordrang, umso weniger galten sie als Menschen, mehr als Wilde eben. Riamon würzte ihre Spitze mit einem Lächeln, bei dem sich Rion langsam wünschte, dass sie es sein ließ. Es machte sie Kayla so ähnlich, nur dass ihre Körperhaltung anders als die seiner Liebsten war.
Vielleicht war er auch nur zu lange ohne Frau. Er hustete. Riamon schaute ihn aufmerksam an, ihr Blick tastete seinen Leib ab, der muskulös genug war, um Jacke und Hose ordentlich auszufüllen. Besonders im Schritt, wo ihr Blick wie Honig kleben blieb. Der Karren wurde schwer.
»Soso, Geld verdienen. Wenn ich dich so betrachte, wirst du gute Arbeit finden, kräftige Männer werden in Alnburgh gebraucht.« Langsam taute sie auf. Sie warf ihren leichten Umhang auf den Gemüseberg und löste die Bänder ihrer Bluse, als ob sie sich an diesem Tag Kühle verschaffen musste. Es war kalt, wie Rion befand.
»Ich bring dich in die Stadt«, säuselte Riamon. Sie tänzelte jetzt neben ihm. Ungemein behände für eine Bäuerin, fast wie eines der Tanzmädchen, die er in seinen jungen Jahren in Alnburgh mit gutem Geld für ihre Künste belohnt hatte. Damals warf er mit Münzen um sich, als gäbe es keinen nächsten Tag.
Riamon hakte sich bei ihm ein. »Und dafür gibst du gut auf mich acht.« Sie bedachte ihn mit ihrem goldigen Lächeln. Rion zählte langsam bis fünf. Trotz der kalten Luft schwitzte er fürchterlich, und sein Schwanz hämmerte gegen die dünne Hose. Riamon musste die Beule doch auch bemerken. Das Bild von Kayla tauchte vor ihm auf und verschwand wieder, kam erneut ...
Riamon legte ihren Kopf an seinen Arm, während er den Karren schob.
Endlich tauchte das Stadttor auf.
Davor lungerten zwei Wachposten. Sie winkten die Reisenden nach kurzer Begutachtung durch. Ein zu klein geratener Kerl, gekleidet in ein rotes Wams und bewaffnet mit einem Schwert, das locker an seiner Seite hing, inspizierte Riamons Wagen und warf ein paar Kohlköpfe mit gelangweiltem Gesicht durcheinander. »Ihr schmuggelt nichts rein?«, knurrte er dabei.
Riamon beeilte sich, die Antwort selbst zu geben, bevor noch Rions harter Akzent zu weiteren Fragen führte. »Wir schmuggeln nichts rein, wir schmuggeln nichts raus. Wie an jedem Markttag. Aber Ihr seid neu, wie mir scheint.« Sie zwinkerte dem älteren Posten zu.
»Lass die beiden durch, die Kleine kenne ich. Sie ist sauber.«
Sie hatten kaum das Stadttor passiert, da fand sich Rion mitten im geschäftigen Treiben wieder. Ihm war, als habe er diese Stadt erst gestern verlassen, zu nachhaltig hatten sich die Erinnerungen eingegraben. Zur linken Hand schob sich das Rathaus in die breite Straße hinein, zur anderen Seite kroch die Wassergasse hinunter zum Hafen. Riamon zeigte dorthin. Sie drängten sich an Gestalten vorbei, die nicht weniger heruntergekommen aussahen als sie, ausgerüstet einzig mit einem hungrigen oder verstörten Blick und mit nichts außer Lumpen am Leib. Viele starrten stumpf vor sich hin. Gescheiterte Gestalten, aus denen die Stadt ihren Lebenssaft gepresst hatte. Viel hatte damals nicht gefehlt, und er hätte zu ihnen gehört.
Einen handfesten Streit zwischen zwei Matrosen ignorierte er; es war schlauer, schnell ans Ziel zu gelangen, um dort … ja, was eigentlich?
Seine alte Stelle würde ihm der Kerl von damals nicht mehr geben. Talbot hieß er. Vielleicht lebte er längst nicht mehr. Talbot hatte nicht weniger gesoffen als er, stand aber auf der glücklichen Seite des Lebens – er vergab Arbeitsaufträge, während Rion für ein paar Pening schuftete. Er schielte zu Riamon hinüber. Die junge Frau sah nicht nach nützlichen Beziehungen aus. Sie war sicher auch nicht die Richtige, um ihm fürs Hin- und Herschieben der Karre einen Pening zu geben. Seine einzige Hoffnung war der Hafen. Das Beste wäre wohl, er heuerte gleich auf einem Schiff an, das Tintagel als Ziel hatte. Überhaupt hatte er nicht vor, den Rest des Weges zu Fuß auf sich zu nehmen. Das war zwar die billige Variante, aber auch die mit dem größten Zeitaufwand. Und Zeit, die hatte er nicht, denn Kayla brauchte ihn.
»In den Hof«, holte ihn Riamon in die Gegenwart zurück. Er quetschte das Gefährt durch den engen Torbogen, dass der Karren am Gemäuer entlangriss. Damit handelte er sich Riamons vorwurfsvollen Blick ein. Meckern sollte sie besser nicht, immerhin ersparte er ihr eine Menge Arbeit.
»Stell den Karren ab, Kelby wird sich drum kümmern. Ich suche ihn, warte du derweil.«
Freches Luder, so weit waren sie also schon. Sie gab die Anweisungen, und er musste gehorchen. Vorhin war sie noch die Unschuld vom Lande, zaghaft und schüchtern. Er lehnte sich an die Hauswand. Ihm ging die Kleine nicht aus dem Sinn. Und Kayla auch nicht. Ihre Gesichter wirbelten durcheinander, bis sie eins wurden. Rion kickte einen Stein quer durch den Hof und fluchte.
»Aufwachen«, säuselte Riamon ihm ins Ohr. Er war fast eingedöst. Die vergangenen Tage hatte er immer dort geschlafen, wo seine Beine ihren Dienst versagten. Jeder Tag ohne richtigen Schlaf zehrte mehr an seinen Kräften. Er war müde und ausgelaugt.
»Komm schon, es gibt Eintopf.« Sein Blick brachte ihm einen Knuff in die Seite ein. »Kohl natürlich. Kelbys Mutter kocht ihn. Ist sicher wieder eine stinkige Brühe, aber sie macht satt.« Sie sprach munter auf ihn ein, als ob das Leben in den Straßen ihre Zunge lockerte.
Er musste mehr über sie erfahren. Sein Blick streifte über ihren Hintern, der in dem engen Wollkleid bei jedem Schritt wie ein Boot in der Dünung schaukelte. Sich wundervoll wölbte. Sie war seltsam und sehr eigenwillig und auf eine verlockende Weise anders als die scheuen Mädchen aus seinem Dorf, die kokett ihre Augen niederschlugen, sich aber zierten, sobald es ans Eingemachte ging.
Er musste sich bücken, damit er sich beim Eintreten nicht den Kopf stieß. Die Häuser waren niedrig, sie duckten sich tief und nutzten jeden noch so kleinen Platz. Dementsprechend eng war es im Haus. Der kurze Flur war mit Körben vollgestellt, an denen vorbei es in die dampfgeschwängerte Küche ging. Eine alte Vettel rührte in einem Topf, stickige Schwaden kräuselten heraus und dickten das Zimmer mit ihrem Dampf ein. Riamon stellte sie als Kelbys Mutter Blithe vor. Am Tisch saß Kelby. Sein Hemd spannte sich über seinen dicken Oberarmen. Riamons Freund war nicht einfach kräftig, er war ein Bär. Zumindest deuteten die stark behaarten Arme an, dass er im Winter auf ein wärmendes Fell verzichten konnte. Kelbys Nase schnupperte über einem Holzteller, als würde eine Delikatesse aufgetischt. Der Teller schwappte randvoll mit Suppe auf einem wackligen Tisch. Riamon küsste die Glatze des Kohlkopfs. Kelby grinste sie dämlich an und schlürfte am Suppenlöffel. Am liebsten hätte Rion auf der Stelle kehrtgemacht, aber sein Magen knurrte.
Kaum saß er, wurde ihm ein voller Teller unter die Nase geschoben, ein Löffel in die Hand gedrückt und ein aufforderndes Nicken geschenkt. Sein Hunger gewann die Oberhand und trieb das dicke Zeug in seinen Mund. Rion verzog angewidert das Gesicht, schluckte aber alles hinunter. Sein Magen dankte es ihm, vorerst jedenfalls.
Riamon schickte ihm ein Lächeln über den Tisch, während sie es ihm gleichtat. »Kelby lädt uns in die Schänke ein«, sagte sie dann. »Nicht wahr, Kelby?«
Der Angesprochene knurrte, was wohl wie eine Zustimmung klingen sollte.
»Das macht er immer, wenn ich eine Fuhre anliefere.« Das Mädchen zwinkerte ihm zu, als ob mit dem Besuch der Schänke noch etwas anderes verbunden wäre. Bei ihr schien Rion alles möglich. Nach dieser Suppe war jeder andere Ort verlockend. Aber dadurch war für ihn keine seiner Fragen gelöst: Eine Arbeit hatte er nicht, und selbst die nächste Übernachtung war nicht gesichert. Er würde sich in die Gosse legen müssen, bis die Nachtwachen ihn mit ihren Spießen vertrieben oder mit Fußtritten vor sich hertrieben und dann einsperrten. Schon schmeckte ihm die Suppe noch weniger. Den Rest der Brühe schob er von sich, ihm war der Hunger vollends vergangen.
Er musterte Riamon in aller Ruhe. Erschien sie ihm auf der kurzen Reise noch wie ein junges Ding, fielen ihm jetzt, auch wenn er sie nur von der Seite und unauffällig abschätzte, die Grübchen auf, die sich in ihre Gesichtszüge stahlen. Die Wangenknochen stachen hervor, mehr als bei anderen Frauen dieser Stadt. Die waren nämlich, so seine Erfahrung, meist gut genährt und neigten zur Fettleibigkeit. Und wie grazil Riamon die Hände bewegte. Seine Blicke tanzten mit, als der Löffel aus dem Teller in einer sanften Bahn nach oben geführt wurde. Sie schlürfte nicht einmal. Dafür tropfte ihr ein wenig in den Ausschnitt, der sich vor seinen Augen öffnete wie das Tor zu einem Obstgarten. Der Klecks wählte sich genau die Pforte zwischen ihren Brüsten, rosige reife Früchte, die sich herausschoben. Riamon tupfte den sämigen Fleck mit dem Finger ab und führte ihn an ihre Lippen. Rion konnte nicht anders, er musste sie dabei anstarren. Das Mädchen warf ihm ein Lächeln zu, aus dem alles sprach, was er sich wünschte. Jetzt und sofort.
»Lass uns gehen, Kelby«, zerschnitt ihre Stimme die Stille, »bevor unser Gast noch vor Hunger über mich herfällt.«
»Aber der ist doch satt«, kam die dümmliche Antwort.
Riamon verdrehte die Augen und grinste Rion verschwörerisch an. Stuhl und Mann ächzten, als Kelby seine Muskelmasse hochstemmte. Rion war der hastige Aufbruch recht, die Gesellschaft der Familie behagte ihm nicht. Im Freien sog er die Luft ein, die ihm trotz des dicken Brodems, der vom Fischhafen in den Innenhof wehte, frisch vorkam. Die Geschäftigkeit in der Gasse hatte nicht nachgelassen, wenngleich der Abend seine Schatten schon weit zwischen die Häuser warf; die Enge zwischen den Gebäuden sorgte dafür, dass das Licht früh am Tag verschwand. Bis zur Schänke war es ein Katzensprung. Über dem Eingang schaukelte ein Holzschild. Zwei betrunkene Grobiane machten sich gerade einen Spaß daraus, mit der Hand dagegenzuschlagen und dem Namen Zum tanzenden Seepferd gerecht zu werden.
Drinnen lungerten Gäste herum, die den beiden vor der Kneipe in nichts nachstanden. Obwohl sich der Abend gerade erst ankündigte, johlten und klatschten die Gesellen bereits, als ob sie den halben Tag mit Zechen verbracht hätten. Kein Wunder, denn auf einem Tisch, der provisorisch zur Bühne oder was auch immer umfirmiert worden war, tanzte ein Mädchen. Die Kleine war makellos gebaut, mit einer Haarpracht, die ungebändigt von einer Seite zur anderen flog, während sie den Kopf nach oben, nach hinten und überall hinwarf. Schnell und wild und auf das Publikum konzentriert. Die Hände stützte sie fest in die Hüften, ihr Hintern kreiste, rund und glänzend vom Öl, mit dem sie die Pobacken eingerieben hatte.
Sie war nackt.
Riamon deutete auf den letzten freien Tisch. Rion achtete darauf, nicht zu nahe bei Kelby zu sitzen, denn der dünstete den Kohl zusammen mit seinem Schweiß aus. Jede Bewegung rief neue Rinnsale auf dessen Gesicht hervor. Riamon machte das anscheinend nichts aus, denn sie stellte ihren Stuhl sogar dicht an den Kerl heran und legte eine Hand auf seinen Oberschenkel. »Kelby, hol uns zu trinken. Drei Gläser vom Besten, du weißt schon was.«
Der Kerl gaffte noch im Aufstehen zu der Schönheit auf dem Tisch, die aber nur Augen für Rion hatte. Sie warf ihm eine Kusshand zu. Ihr Becken kreiste, ihre Füße tippten sanft die Tischplatte an, um mit ihrem Hinterteil vor Rions Gesicht zu wackeln. Die Arschspalte funkelte Rion an; ein Diamant, groß wie sein Daumennagel, steckte in ihrem Hintern. Rion überlegte, ob der Stein falsch oder echt war.
»Du weißt schon was?«, fragte Rion, ohne seine Augen von dem Mädchen abzuwenden. »Hört sich wie etwas an, was ich besser nicht trinken sollte.«
Riamon lachte. Ob über seine Bemerkung oder darüber, dass er die Tänzerin gerade mit den Augen auffraß – egal, Rion faszinierte die Frivolität der Kleinen. Damals – während seiner ersten Zeit in Alnburgh – hatte er den Großteil seiner Münzen auf Schanktische wie diesen geworfen. Tagsüber hatte er geschuftet und nachts nur noch für seine Lust gelebt. Er war eine leere Hülle, wie ein Süchtiger darauf aus, die schnellen Freuden abzugreifen. Noch heute schauderte er, wenn er zurückdachte. Jeden Abend und jede Nacht hockte er bis in die frühen Stunden vor den Mädchen, schleppte sich in aller Frühe wieder zur Arbeit. Schwitzte, fluchte, bis abends derselbe Dämon ihn lockte, der seine Seele Stück für Stück beherrschte. Der Dorn der Lust hatte eine Schnepfe den Dämon genannt, die es, sagte sie, gut mit ihm meinte.