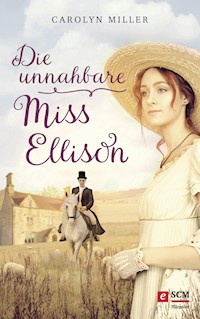Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Romantik
- Sprache: Deutsch
Charlotte ist jung, hübsch und begehrt - und auf der Suche nach der großen Liebe. Der wohlhabende Herzog William Hartwell ist der Wunschkandidat Ihres Vaters, doch er entspricht ganz und gar nicht ihren Vorstellungen. Und dann ist da noch seine Vergangenheit, die jeden Keim der Liebe zu ersticken droht. Die Autorin Carolyn Miller lebt in New South Wales in Australien. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder und liebt es zu lesen und Bücher zu schreiben. Ihre Romane handeln von Vergebung, Liebe und anderen Herausforderungen. Bei SCM Hänssler erschien bereits ihr Roman "Die unnahbare Miss Ellison". Carolyn Millers Lieblingsautorin ist natürlich Jane Austen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Die Personen und die Handlung des Werkes sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
ISBN 978-3-7751-7466-4 (E-Book)ISBN 978-3-7751-5971-5 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2019 SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: The Captivating Lady Charlotte© 2017 by Carolyn Miller. Originally published in the USA by Kregel Publications,Grand Rapids, Michigan. Translated and printed by permission. All rights reserved.
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:Neues Leben. Die Bibel,© der deutschen Ausgabe 2002 und 2006 SCM R.Brockhausin der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Übersetzung: SuNSiDe, ReutlingenUmschlaggestaltung: Nakischa Scheibe, Stuttgart | www.nakischascheibe.deTitelbild: © Lee Avison / Trevillion ImagesAutorenfoto: Jenny CollisonSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Für meine ElternDavid & Kay WeaverDanke!
Inhalt
Über die Autorin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
Carolyn Miller lebt in New South Wales in Australien. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder und liebt es, zu lesen und Bücher zu schreiben. Ihre Romane handeln von Vergebung, Liebe und anderen Herausforderungen. Carolyns Lieblingsautorin ist natürlich Jane Austen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 1
St James’s Palace, LondonApril 1814
Der weitläufige Saal glitzerte und funkelte von Tausenden strahlender Lichter. Kristalllüster ließen die perlen- und paillettenbesetzten Roben sprühen; ihr Licht wurde von den prachtvoll gerahmten Spiegeln zurückgeworfen und brach sich in der Beklommenheit, die in Dutzenden Augenpaaren schimmerte.
Lady Charlotte Featherington lächelte ihrer Mutter ermutigend zu. »Meine liebe Mama, es besteht keinerlei Grund, so ängstlich dreinzublicken. Wir werden dir ganz sicher keine Schande machen.«
Ihre Mutter richtete sich auf, als sei schon die bloße Vorstellung, sie könnte besorgt erscheinen, eine Beleidigung. »Ich mache mir keine Sorgen deinetwegen, mein liebes Mädchen, aber …« Mit einer hilflosen Handbewegung zeigte sie zu der jungen Dame hinüber, die sie begleitete.
»Liebe Tante Constance, ich habe ebenso wenig die Absicht, dir Schande zu bereiten«, versicherte Lavinia Stamford, Charlottes Cousine und seit Kurzem Gemahlin des siebten Grafen von Hawkesbury.
»Du weißt doch noch alles, was ich dir gesagt habe?«, erkundigte sich Mama dringlich.
»Ich kann dir nicht versprechen, dass ich mich an alles erinnere, Tante Constance, aber ich werde dir sicherlich keinerlei Verlegenheit bereiten – und meinem Mann auch nicht.« Bei den letzten Worten sah sie den Grafen an, Nicholas Stamford. Ihr Blick versetzte Charlotte einen Stich. Lavinia konnte sich glücklich schätzen, einen so wunderbaren Ehemann gefunden zu haben.
Dann musste sie lächeln, als sie sah, wie ihre Mutter sich auf die Lippen biss. Zweifellos war sie hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, wieder einmal ihrer oft wiederholten, nicht sehr schmeichelhaften Meinung über die Stamfords Ausdruck zu verleihen, und dem ebenso großen Wunsch, Lavinia an einem so wichtigen Tag nicht zu kränken.
Doch gleich darauf wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem vorderen Bereich des Saales zu, wo der Oberhofmarschall den Namen der nächsten Debütantin ausrief. Plötzlich tanzten Schmetterlinge in ihrem Bauch. Nur noch zwei junge Damen, dann war sie an der Reihe. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, um die ganz in Pink gekleidete Matrone vor sich herumzuspähen, deren lächerliches Exemplar von Hut nicht weniger als acht – oder waren es sogar neun? – Straußenfedern aufwies. Unwillkürlich fasste sie nach oben und zupfte an ihrer eigenen, sehr viel dezenteren Frisur mit den obligatorischen fünf Straußenfedern herum.
»Charlotte!«
»Ja, Mama.« Charlotte unterdrückte einen Seufzer und nahm wieder die korrekte Haltung einer wohlerzogenen jungen Dame ein.
»Ich bin gleich wieder bei euch, meine Liebe.« Mit einem Wangenkuss für Lavinia und einer Verbeugung vor Charlotte verabschiedete sich der Graf, um sich den anderen frischvermählten jungen Ehegatten und Vätern der Debütantinnen anzuschließen, die im Nebenzimmer warteten.
Charlotte bemerkte, wie Lavinia ihm nachsah. Was für ein attraktiver Mann! Der bestickte Samtfrack und die seidenen Kniehosen, welche die Hofetikette vorschrieb, standen ihm wirklich vorzüglich. Doch dann redete sie sich selbst gut zu. Sie würde ganz bestimmt einen Mann heiraten, der genauso gut aussah, vielleicht sogar noch in diesem Jahr! Hatte Mama nicht gesagt, dass ihr nach ihrer Präsentation bei Hofe die Türen sämtlicher Adelshäuser offenstünden? Sie hatte prophezeit, dass ihr Vater gar nicht wissen würde, wie er der zahllosen Heiratsanträge Herr werden sollte, die sie förmlich überschwemmen würden. Charlotte holte tief Luft und richtete sich auf. Wenn sie unter all den Heiratskandidaten doch nur ihre große Liebe finden könnte!
»Lady Anne Pennicooke«, näselte der Oberhofmarschall und bedeutete der nächsten jungen Dame vorzutreten.
»Amelia hat sich wirklich große Mühe mit dem Mädchen gegeben«, schnaubte Mama. »Die Größe der Diamanten grenzt in meinen Augen ans Vulgäre. Man darf Reichtum zart andeuten, aber man sollte ihn unter keinen Umständen dermaßen marktschreierisch hinaustrompeten.«
»Sehr bildhaft formuliert, Tante Constance«, sagte Lavinia und warf Charlotte einen amüsierten Blick zu.
Mama schnaubte erneut. »Ich bin sehr froh, dass du meinen Rat befolgt hast und das Diadem trägst, Lavinia. Deine Großmutter wäre entzückt, dass es endlich wieder zur Geltung kommt. Ein so elegantes Schmuckstück!«
»O ja, es ist sehr elegant«, sagte Lavinia und berührte den mit Perlen und Diamanten besetzten Reif auf ihren kupferblonden Locken. »Aber es handelt sich um das Hawkesbury-Diadem.«
»Bist du sicher?«, fragte Mama mit zusammengezogenen Augenbrauen und betrachtete sie misstrauisch.
»Sie sehen sich sehr ähnlich, aber ich bin tatsächlich sicher. Nicholas hat mir versichert, dies sei das Diadem, das jede neue Gräfin getragen hat.«
»Zuletzt also deine Schwiegermutter?«, murmelte Charlotte.
In Lavinias Augen flackerte etwas auf, doch sie blieb ganz ruhig. »Ja.«
Charlotte applaudierte ihrer Cousine innerlich für deren Fassung. Sie hatte einen hohen Preis für ihre Ehe bezahlt, indem sie eine zänkische, sich ständig einmischende ältere Frau mit in Kauf nahm, deren Liebe zu ihrem Sohn sich in Bitterkeit verwandelt hatte, als er darauf bestand, eine Frau zu heiraten, die sie verabscheute.
Bestimmt war es schwer zu ertragen, ständigen Sticheleien und Anfeindungen ausgesetzt zu sein, doch Lavinia ertrug sie anmutig. Sie besaß ein hohes Maß an persönlicher Würde, das sie befähigte, zu lächeln und die andere Wange hinzuhalten, auch wenn sie innerlich litt.
Charlotte strich ihre langen Handschuhe glatt und beobachtete verstohlen ihre Cousine, während sie weiter geduldig wartete, bis sie an die Reihe kam. Warum die verwitwete Gräfin sich für berechtigt hielt, sich dermaßen rüde gegenüber ihrer Schwiegertochter zu verhalten, war ihr ein Rätsel. Zumal ihr ältester Sohn für den Tod von Lavinias Mutter – jener Tante Grace, die Charlotte nie kennengelernt hatte – verantwortlich war. Die Schuld, die er auf sich geladen hatte, schien für die Gräfin allerdings keine Rolle zu spielen. Vielleicht war Charlottes Großmutter, die Herzogin von Salisbury, die Ursache ihrer Verbitterung. Sie war unverrückbar von der Minderwertigkeit der Familie Stamford überzeugt und ging ihnen in der Öffentlichkeit daher konsequent aus dem Weg.
Natürlich hatte Lavinia nie etwas darüber gesagt, doch die schwierige Beziehung war deutlich spürbar, etwa in den wenig feinfühligen Kommentaren ihrer Schwiegermutter und ihren erröteten Wangen und zornblitzenden Augen, wann immer sie Lavinia erblickte. Die Tatsache, dass Lavinia bei ihrer Präsentation bei Hofe von ihrer Tante und nicht, wie es bei jung verheirateten Frauen üblich war, von der Mutter ihres Ehemannes begleitet wurde, sagte alles. So sehr Charlotte ihre Cousine um ihren attraktiven Mann beneidete, um die Kosten ihres Glücks beneidete sie sie nicht. Eine Familie, welche der Braut, die der Sohn sich erwählt hatte, nicht mit Achtung begegnete, kam für sie nicht in Frage. Darauf würde sie mit aller Strenge achten, wenn ihr Vater ihr mögliche Heiratskandidaten vorstellte.
»Miss Emma Hammerson.«
Die üppige Dame in Pink schob ihren hübschen Schützling vor sich her. Jetzt stand Charlotte ganz vorn in der Reihe. Sie erhaschte einen Blick auf die Mitglieder der königlichen Familie – den Prinzregenten und seine Schwestern, die neben der Königin standen. Die Schmetterlinge in ihrem Bauch tanzten nun noch heftiger.
Sie wandte sich an Lavinia. »Möchtest du nicht lieber vorgehen?«
»Und deine Mutter auf den Augenblick des Triumphs angesichts ihrer schönen Tochter warten lassen? Auf keinen Fall! Lieber warte ich.«
»Sie sieht wirklich schön aus, nicht wahr?«
Bei dem Kompliment leuchteten Charlottes Augen auf. Einen so liebevollen Gesichtsausdruck hatte sie in der letzten Zeit nicht oft von ihrer Mutter zu sehen bekommen. Es war selten, dass Mama sich zu so etwas hinreißen ließ. Vielleicht lag es ja an dem Druck, so viele Dinge für ihre Vorstellung bei Hofe und für den bevorstehenden Ball organisieren zu müssen. Sie betrachtete Lavinias Kleid, das ihrem sehr ähnlich sah, bis auf die Farbe – ein hübscher Pfirsichton, während ihr eigenes Kleid weiß war. Doch die Reifröcke, die Glockenärmel und die obligatorischen Straußenfedern sah man bei praktisch allen anwesenden Damen. Auf ihren Einkaufstouren, auf denen sie all die unumgänglich nötigen Requisiten für diesen Anlass erworben hatten, hatte Lavinia immer wieder Anstoß daran genommen, dass sie Hunderte Pfund für ein Kleid ausgaben, das nur ein einziges Mal getragen wurde. Doch Lavinia war schließlich im ländlichen Gloucestershire aufgewachsen und hatte bis vor Kurzem keine Ahnung gehabt, wie diese Dinge in der Londoner Gesellschaft gehandhabt wurden.
»Ich glaube, du bist heute die Hübscheste hier«, fuhr ihre Cousine fort.
»Du übertreibst«, sagte Charlotte, die, was ihr Aussehen betraf, nie besonders selbstbewusst gewesen war.
»Nein, gar nicht. Du siehst wunderbar aus.«
Mama lächelte selbstgefällig und nickte dem dunkelhaarigen Oberhofmarschall zu, als erwarte sie, dass er zustimmte.
Nach ihrem Spiegelbild zu urteilen, sah sie tatsächlich gut aus, dachte Charlotte, trotz der lächerlichen Reifunterröcke, die nun wirklich keiner weiblichen Figur schmeichelten. Mamas Zofe Ellen, die in diesen Dingen weitaus geschickter war als Charlottes Mädchen, hatte ihr dunkelblondes Haar prachtvoll frisiert. Die Diamanttropfen an ihren Ohrläppchen, ein Geburtstagsgeschenk ihres Vaters, waren einzigartig schön geschliffen und blitzten und funkelten. Ihre Perlenkette war außerordentlich teuer gewesen, wirkte aber sehr dezent.
Ihr Kleid war dem Schnitt nach zwar vor fünfzig Jahren modern gewesen, doch es unterstrich ihre Rundungen und ihre schmale Taille besser als die Kleider, die sie sonst trug. Elegante, silberne Stickereien zierten ein Unterkleid aus Krepp, das mit Kränzen aus weißen Rosen besetzt war und am Saum einen doppelten Volant mit silbernen Fransen aufwies. Die Schleppe und das Mieder waren aus weißem Krepp und silbernem Oberstoff. Die kurzen, mit cremefarbener Spitze und Perlen besetzten Ärmel waren zweifach mit einem silbernen Band abgebunden. Eine Stola, ein silberner Gürtel und weiße, mit winzigen Röschen besetzte Ziegenlederschuhe vervollständigten ihre Garderobe. Bei dem langen Stehen erwies sich das Ensemble als sehr viel schwerer als erwartet. Doch alles sah noch immer tadellos aus, sodass sie – hoffentlich – vor den Augen der Königin bestehen konnte.
»Lady Charlotte Featherington«, rief der Oberhofmarschall unnötig laut angesichts der Tatsache, dass sie so dicht vor ihm standen.
Charlotte verbiss sich ein Lächeln, als Mama leise monierte, dass sie schließlich nicht taub seien, und erwiderte den sanften Druck von Lavinias Hand. Dann trat sie vor, wobei sie sorgfältig darauf achtete, nicht auf die üppigen Volants ihres weiten Unterkleids zu treten.
»Komm!«
Mamas Griff war überhaupt nicht sanft, sondern sehr resolut. Mit einem angestrengten Lächeln trat Charlotte vor den Thron, auf dem die betagte Königin Charlotte saß, umgeben vom Prinzen und den Prinzessinnen und mehreren Dienern. Charlottes Hände waren feucht geworden. Am liebsten hätte sie sie abgewischt; zum Glück trug sie Handschuhe. »Gleiten Sie wie ein Schwan«, hatte Lady Rosemond, die Spezialistin für Hofetikette, ihr eingeschärft und Charlotte hatte eifrig gleiten und knicksen geübt. Heute war nicht der Tag für ungraziöse Bewegungen!
Als sie nähertrat, sah sie die Falten im Gesicht der Königin und spürte plötzlich ein Aufwallen der Sympathie für die ältere Frau. Sie wirkte erschöpft, was kaum erstaunen konnte, nachdem ihr heute so viele junge Damen präsentiert worden waren. Hinzu kamen die Eskapaden ihres Sohnes, die Anlass zu so manchem Tratsch und Getuschel gaben, was sicher nicht leicht für sie war. Voller Mitgefühl trat Charlotte vor, blieb an der Markierung stehen und neigte den Kopf.
»Meine Tochter, Lady Charlotte Featherington«, intonierte Mama.
Das war ihr Stichwort. Charlotte hob den Kopf und blickte in die hellblauen Augen, die sie musterten. Sie lächelte, setzte das rechte Bein hinter das linke und beugte langsam und vorsichtig ihr linkes Bein so weit sie konnte, bis ihr rechtes Knie fast den Boden berührte. Dabei hielt sie ihren Oberkörper so gerade wie möglich. Dann richtete sie sich ganz langsam wieder auf und stand endlich aufrecht vor der Königin.
»Exeters Tochter?«
»Jawohl, Eure Majestät.«
Die Königin nickte und bewegte sich leicht auf ihrem Sitz. »Komm her, mein Kind.«
Charlotte trat näher und kniete nieder. Lady Rosemond hatte sie auch auf diesen nächsten Schritt vorbereitet. Sie beugte sich vor, neigte den Kopf und spürte die kühlen Lippen der Königin auf ihrer Stirn.
Ein Kuss auf die Stirn für die Töchter des Adels, eine zum Küssen ausgestreckte Hand für die anderen.
Nach angemessener Zeit trat Charlotte zurück und nahm die Haltung ein, die Lady Rosemond ihr eingeschärft hatte: gerader Rücken, Kinn hoch, aber auf keinen Fall aussehen wie ein Soldat bei einer Parade.
»Charlotte.« Die Königin sah sie an, ihr Akzent verriet ihre deutsche Herkunft. »Welch ein hübscher Name, nicht wahr?«
»Sehr wohl, Majestät.« Ihre Anspannung ließ etwas nach, als sie das Zwinkern in den blauen Augen der Königin entdeckte.
»Ihre Namensschwester, Majestät«, beeilte sich Mama anzumerken.
»Ich glaube eher, ich bin die ihre.«
Charlotte unterdrückte das in ihr aufsteigende Kichern angesichts des verdrießlichen Gesichtsausdrucks ihrer Mutter.
»Die einzige Tochter des Marquis?«
»Ja, Majestät.«
»Sehr hübsch.«
Charlotte spürte die Erleichterung ihrer Mutter über die positive Reaktion der Königin beinahe körperlich. Ihre Spannung ließ noch ein wenig mehr nach. Sie hatte nicht versagt. Sie war keine Enttäuschung.
Moment. Jetzt kam noch der Rückzug gemäß der Etikette.
Charlotte erkannte das kaum wahrnehmbare Nicken als Zeichen der Entlassung, machte abermals einen tiefen Knicks und trat rückwärts vom Thron zurück. Einen winzigen Schritt nach dem anderen, verzweifelt betend, dass sie sich nicht in ihrer lächerlich langen Schleppe verhedderte. Dabei durfte sie sich nicht umsehen. Der Königin den Rücken zuzuwenden, wäre ein Fauxpas gewesen, den die Gesellschaft ihr nie, nie, nie verziehen hätte.
Noch ein Schritt und noch einer, bis ein Page endlich auf die Tür zu ihrer Rechten deutete. Mit einem innerlichen Seufzer der Erlösung verließ Charlotte den Empfangssaal und stand schließlich vor einer Tür zu einem Raum voller Männer.
Lächelnd, mit klopfendem Herzen, betrachtete sie die künftigen Heiratskandidaten.
Nun, da sie bei Hofe präsentiert war, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie einen Mann finden würde – vielleicht sogar schon auf dem Ball morgen Abend?
Und mit einem schnellen Gebet: Lass ihn bitte jung und aufregend, attraktiv und mutig sein!, trat sie über die Schwelle.
Bishoplea Common, London
Der abendliche Nebel enthielt Tausende winziger Wassertröpfchen, eine Feuchtigkeit, die seine Lunge füllte und sich auf seine Haut legte. Vor ihm lag, unendlich weit, das leere, öde Feld, wie ein Echo seiner inneren Leere. Er sollte nicht hier sein, er hätte es besser wissen müssen. Es war falsch, auf diese Weise Rache zu üben. Sein einziger Trost war, dass die Abgelegenheit des Ortes eine Entdeckung höchst unwahrscheinlich machte. Gott, bewahre uns davor, entdeckt zu werden!
»Meine Herren? Bereit?«
»Ja«, murmelte William Hartwell, der neunte Herzog von Hartington, obwohl er sich alles andere als bereit fühlte. Sein Stolz gebot ihm, aufrecht zu stehen und keine Regung zu zeigen, vor allem keine Angst, auch wenn er die Dummheit, die ihn an diesen Ort und in diese Situation gebracht hatte, bereits zutiefst bereute.
Der Wahnsinn seines Schwurs vor vier Jahren stieg in seiner ganzen Widerwärtigkeit vor ihm auf. Warum hatte er nicht auf seinen Verstand gehört statt auf sein Herz? Warum hatte er den Beifall der Toten gesucht? Was für eine Dummheit! Eine Dummheit, deren Ursprung, wie er jetzt wusste, in einem Herzen lag, das der Schmerz verletzlich gemacht hatte, als er die Würde seiner Eltern gegen das Liebesgeflüster einer Ehebrecherin eingetauscht hatte. Wie hatte er den Lügen seiner Frau jemals Glauben schenken können? Sein Finger legte sich um den Abzug.
»Eins. Zwei …«
William zwang seine Beine dazu, sich zu bewegen und einen Schritt nach dem anderen zu tun.
»Vier. Fünf …«
Ihn würgte die Angst. Aus den Augenwinkeln nahm er Lord Ware wahr, seinen Schwager und widerwilligen Sekundanten, der ihn beklommen ansah.
»Sieben. Acht …«
Er knirschte mit den Zähnen. Die Ehre verlangte Gerechtigkeit. Sein Stolz verlangte die Wahrheit. Aber …
»Zehn.«
Er blieb stehen.
Aber was, wenn er doch einen Fehler gemacht hatte?
Er schüttelte den beunruhigenden Gedanken ab, drehte sich um und stellte sich seinem Gegner.
Übelkeit überkam ihn. Der große, blonde, blauäugige Lord Wrotham besaß genau das Aussehen, das sie immer bevorzugt hatte. Ekel mischte sich mit Zorn, der heiß in ihm aufstieg, bis er ihn zu ersticken drohte und seine Sicht getrübt war.
Langsam hob er die schimmernde Pistole, ein Relikt aus der Zeit seines Vaters, ein Ding, das er nie zu brauchen gehofft hatte. Doch leider irrte er sich oft. Was andere betraf, aber auch, was ihn selbst betraf.
In ihm brannte die Reue. Er sah dem anderen ins Gesicht. Überaus hübsch, doch der schweißige Schimmer auf der Stirn, die zusammengezogenen Brauen verrieten Angst. Überaus hübsch, aber von Grund auf verlogen. Er stritt noch immer alles ab, doch William hatte ihn selbst gesehen, hatte gesehen, wie er aus dem Schlafzimmer seiner Frau kam, zu einer Stunde, die nur eines bedeuten konnte.
Seine letzten Bedenken schwanden.
Auf das Zeichen hin schoss er.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 2
Exeter HouseGrosvenor Square, London
»Lady Charlotte, würden Sie mir die Ehre dieses Tanzes …?«
»Lady Charlotte, Sie sehen bezaubernd …«
»Sie sind so schön heute Abend, meine Dame!«
»Lady Charlotte! Bitte schenken Sie mir die Quadrille!«
Charlotte lachte über die Männer, die in Zweier-, nein, Dreierreihen vor ihr standen und um ihre Aufmerksamkeit buhlten. Ihr Herz schwoll an bei dem Gefühl, begehrt und bewundert zu werden. Da die Gäste so zahlreich waren, hatten die Begrüßungsformalitäten über eine Stunde in Anspruch genommen, bis Mama sie endlich energisch in den Ballsaal dirigierte. »Sie können erst anfangen, wenn du den ersten Tanz eröffnet hast.«
Der Eröffnungstanz gehörte Papa, und ihr Bruder Henry würde ebenfalls einen Pflichttanz mit ihr absolvieren müssen. Mama hatte zwar gesagt, sie müsste die Aufforderung jedes Mannes akzeptieren, der im Rang über ihr stand, doch soweit sie wusste, brauchte sie mit niemandem zu tanzen, der fürchterlich hässlich oder alt war.
Der Viscount Carmichael wand sich geschickt zwischen zwei Männern hindurch, die einander feindselig musterten. »Ich glaube, der Kotillon gehört mir, meine Dame.«
Sie sah in seine lachenden haselnussbraunen Augen und knickste. »Natürlich.«
Er verbeugte sich, dann grinste er zu den beiden Männern hinüber, die nun beide den Kürzeren gezogen hatten, als wollte er sagen: Seht ihr, so macht man das! Sie lächelte in sich hinein. Dass ausgerechnet einer der begehrtesten Junggesellen Londons sie um einen der ersten Tänze bat, würde Mama mehr als zufriedenstellen.
Die Klänge der Geigen wurden lauter. Ihr Vater kam auf sie zu und teilte dabei das Meer ihrer Verehrer.
»Meine Liebe.« Er bot ihr die Hand. Sie nahm sie und ließ sich in die Mitte des Saals führen. Sie hatte das Gefühl, als sähen tausend Augen zu, wie er sie zum ersten Tanz ihres Debütantinnenballs auf die Tanzfläche zog.
»Du scheinst ein ziemlicher Erfolg zu sein«, sagte ihr Vater, als sie endlich Gelegenheit hatten, ein paar Worte zu wechseln.
»Mama hat sich keine Zurückhaltung auferlegt, was die Einladungen betrifft.«
»Das sollte sie auch nicht. Nicht beim Debüt meiner Tochter.«
Ihr Lächeln versteifte sich, als sich die alte, bohrende Frage wieder meldete: Warum fiel es ihrem Vater nur so schwer, seine Zuneigung zu zeigen? Wie leicht wäre es, etwas Nettes über ihr Aussehen zu sagen und ihr zu versichern, wie stolz er auf sie war, vor allem heute Abend? Aber – nein. Wie üblich hatte die Aufforderung ihrer Mutter, ein bewunderndes Wort über die Erscheinung seiner Tochter an diesem festlichen Abend zu sagen, lediglich einen halbherzigen Seitenblick und ein wegwerfendes »Sehr hübsch« zur Folge gehabt – eine Gleichgültigkeit, deren Echo in den leeren Räumen ihres Herzens widerhallte. Sie blinzelte und schlug die Augen nieder. Vielleicht hatte Henry ja Recht und sie stellte zu hohe Ansprüche an den vielbeschäftigten Mann, der er war. Doch bei Lavinias Hochzeit hatte sie gesehen, wie liebevoll Mr. Ellison mit ihrer Cousine umging. Seitdem war ihr aufgefallen, dass nicht alle Väter so distanziert waren wie ihrer. Entschlossen hob sie den Kopf. Noch ein Punkt, den sie der Liste der Anforderungen an die Heiratskandidaten hinzufügen würde: Der Mann, den sie heiraten würde, musste bereit sein, seine Zuneigung und seine Gefühle ebenso freimütig zu zeigen wie sie selbst.
Auf den Eröffnungstanz folgte ein Kontertanz, dann der Kotillon. Lord Carmichael, der Erbe des Grafen von Bevington, brachte sie mit seinem lässigen Geplauder voller Komplimente und witziger Kommentare über die anderen Gäste fast so unentwegt zum Lachen wie ihre Füße tanzten.
»Schauen Sie nicht hin, aber ich sehe einen Drachen.«
»Einen Drachen, mein Herr?«
Die braunen Augen lächelten. »Der Drache, den ich sehe, hat zwar keinen langen Schwanz, aber seine Zunge ist wie eine versengende Flamme.«
»Und warum sollte er Sie versengen, mein Herr?«
»Oh – nein! Er will nicht mich auf dem Grund des Meeres sehen, sondern jede junge Dame, mit der ich heute Abend tanze. Der Drache – in diesem Fall ist es eine Sie – unterliegt dem Irrtum, dass ich ihrer Tochter einen Heiratsantrag machen werde – was nicht der Fall sein wird.«
»Nicht?«
»Können Sie sich einen Drachen als Schwiegermutter vorstellen? Das würde ich mir niemals antun.« Er lächelte. »Ich ziehe es bei Weitem vor, mit dem lieblichsten Geschöpf des heutigen Abends zu tanzen, auch wenn Ihr Vater mir einen Verweis erteilen wird.«
»Ach ja?«
»Er hat mich noch nicht verwarnt, aber nach diesem Tanz wird er es tun. Gott bewahre, dass man sieht, dass Sie meine Gesellschaft genießen, meine Dame.«
Es folgte ein wahrer Sturm von Schmeicheleien, der sie in beste Laune versetzte, bis es Zeit für den Tanz vor dem Dinner war. Lord Wilmington, ein Baron aus Bedfordshire, dessen bewundernde Worte für ihr Aussehen schon bald der langweiligen Beschreibung seiner ausgedehnten Ländereien und seines Reichtums Platz machten, führte sie hinauf in den Speisesaal, wo die köstlichsten Leckereien aufgebaut waren. Monsieur Robard hatte sich heute Abend selbst übertroffen.
Ohne sie nach ihren Wünschen zu fragen, eilte Lord Wilmington ans Buffet, füllte zwei Teller und brachte ihr einen; dann bat er ihre Mutter um die Erlaubnis, sich zu ihnen setzen zu dürfen.
Henry fing Charlottes flehenden Blick auf, verdrehte die Augen und verwickelte den Baron in ein Gespräch über Ascot und darüber, ob Pranks dieses Jahr wohl eine Chance hatte. So gelang es Charlotte, sich ohne großes Aufhebens einen Platz in der Nähe der sehr viel attraktiveren jungen Männer am anderen Ende des Tisches zu suchen. Nach einem höchst befriedigenden Maß an Bewunderungen und Gelächter wurden wieder Plätze getauscht; jetzt kamen Lavinia und Lord Hawkesbury zu ihr.
»Genießt du es, Charlotte?«, fragte ihre Cousine.
»Und wie!« Sie machte eine weitausholende Handbewegung. »Es ist einfach perfekt!«
Der Speisesaal war – wie der Ballsaal – erfüllt von Lachen und Rosen. Ihre Lieblingsblume schmückte jede verfügbare Oberfläche, allerdings mit geschmackvoller Zurückhaltung; darauf hatte ihre Mutter bestanden.
»Der Raum wirkt wie ein riesiger Garten«, sagte Lavinia. »Du bist wirklich gesegnet.«
»Jedenfalls ist es sehr viel hübscher als auf dem Ball, den wir letzte Woche besucht haben, bei dem Ägypten das Thema war«, sagte der Graf und sah seine Frau an. »Weißt du noch, die Krummsäbel?« Er grinste. »Eher nicht ägyptisch, meiner Meinung nach.«
Ihre Cousine lachte. »Und ganz und gar nicht passend für einen Debütantinnenball.«
Der zärtliche Blick, mit dem ihr Mann sie ansah, weckte wieder einmal Charlottes Neid. Oh, so bewundert zu werden …
Lavinia wandte sich wieder an Charlotte. »Nicholas und ich sprachen vorhin darüber, dass wir dich sehr gern zu uns einladen würden.«
»Das wäre wundervoll! Ich war noch nie in Gloucestershire.«
Wieder sahen die beiden einander an. Dann beugte der Graf sich vor. »Wir dachten eigentlich an Hawkesbury House in Lincolnshire.«
»Oh. Aber – das wäre auch ganz wunderbar, wirklich. Falls Mama es erlaubt«, fügte sie zweifelnd hinzu.
Lavinia tätschelte ihre Hand. »Ich rede mit Tante Constance.«
»Danke.«
Eine dunkelhaarige junge Dame sprach Lavinia an und Charlotte widmete sich ihrem Essen. Das Eiskonfekt, das Lord Wilmington ihr gebracht hatte, war bereits geschmolzen und bildete einen kleinen See auf ihrem Teller. Sie probierte trotzdem davon und hätte beinahe laut geseufzt, so gut schmeckte es noch immer.
Sie genoss den Augenblick; es war wie eine kleine, ruhige Oase inmitten all des Trubels. Lavinias Einladung hatte mehr als Vorfreude auf den versprochenen Besuch in ihr ausgelöst. Ja, sie war gesegnet, unermesslich sogar, mit ihrer Familie, ihren Freunden, dem Vermögen ihres Vaters, das ihr gestattete, sich fast jeden Wunsch zu erfüllen. Und jetzt eröffneten sich ihr noch so viele weitere Aussichten …
»Ich wette fünfundzwanzig Pfund, dass das Balg ein Mädel wird.”
»Fünfzig.”
»Hundert!”
Charlotte blickte auf ihren Teller, während sie sich anstrengte, auf das Gespräch am Tisch hinter sich zu lauschen. Wer wettete hier? Sie kannte die Stimmen nicht. Was für ein Unsinn, auf die Geburt eines Kindes zu wetten. Ob Papa davon wusste? Er war selbst einer Wette nie abgeneigt.
»Hartington braucht einen Erben.«
Hartington? Sprachen sie vom Herzog von Hartington?
»Wenn er es wirklich anerkennt.«
Sie runzelte die Stirn. Warum sollte ein Vater sein eigenes Kind nicht anerkennen?
Diese Frage stellte sich offenbar auch ein Mitglied der unsichtbaren Gruppe hinter ihr, denn sie hörte jemanden lachen. »Haben Sie es denn nicht gehört?« Es folgte ein kurzes Getuschel, dann allgemeines Gelächter.
Der gehässige Tratsch stimmte sie traurig. Der arme Herzog! Wie schrecklich, so zum Gespött zu werden und erleben zu müssen, wie ein Familiengeheimnis an die Öffentlichkeit gezerrt und genüsslich zerlegt wurde, wie von Hunden, die über einen saftigen Knochen herfielen. Sie stand kurz davor, sich einzumischen, obwohl sie genau wusste, dass ihre Mutter es nicht billigen würde.
»Lottie?«
Sie blickte auf und begegnete dem amüsierten Blick ihres Bruders.
»Ich glaube nicht, dass das Essen dich zu so verzückter Aufmerksamkeit verleitet, wie es den Anschein hat.«
»Entschuldige. Ich habe vor mich hin geträumt.«
»Ach ja? Warum überrascht mich das nicht?«
Sie verbiss sich eine scharfe Erwiderung. Immerhin hatte er sie von ihrem Tanzpartner erlöst. »Danke für … vorhin.«
»Daran muss ich mich wohl gewöhnen, nachdem du jetzt debütiert hast.« Seine Augen glitzerten. »Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, wie beliebt ich plötzlich bei den vielen Herren sein würde, die wünschen, meiner Schwester vorgestellt zu werden.«
»Vielleicht haben ein paar dieser Herren ja auch Schwestern.«
Er grinste. »Das hoffe ich sehr.«
Sie lachte und erregte damit die Aufmerksamkeit mehrerer vorübergehender möglicher Heiratskandidaten. Einer von ihnen war so kühn zu fragen, was sie so amüsierte. Nachdem sie ihm erfolgreich Paroli geboten hatte, drehte sie sich wieder zu ihrem Bruder um. Der sah sie neugierig an.
»Was ist, Henry?«
»Seltsam, meine kleine Schwester so kokett zu sehen.«
»Kokett?«
»Sei vorsichtig!« Er nickte zu ihrer Mutter hinüber, die ganz in der Nähe saß. »Ich weiß nicht so recht, wie ich es finde, dass das Mädchen, das eben noch mit Puppen gespielt hat, jetzt so selbstbewusst mit den Herzen so vieler junger Männer spielt.«
»Ich spiele nicht.«
»Pass auf, dass man dich nach heute Abend nicht für einen Flirt hält!«
Ihr blieb vor Überraschung der Mund offen stehen.
»Charlotte!«
Auf den flüsternden Zuruf ihrer Mutter hin schloss sie ihn rasch. Ihr Bruder lachte.
»Gib’s zu, ohne die vertraute brüderliche Mahnung wäre der Abend nicht vollkommen.«
Sie musste wider Willen lächeln. »Wir wüssten beide nicht, was wir ohne den anderen täten.«
»Genießt du dein Fest?«
»Du meinst, bis auf die Unverschämtheiten meines Bruders?«
»Bis auf die.«
»Natürlich. Der Abend ist wie ein Traum!« Ein schwindelerregender, herrlicher, wunderbarer Traum.
»Mama gefällt es auch, glaube ich.«
Charlotte folgte seinem Blick. Er schaute zu ihrer Mutter hinüber, die sich lautstark über Charlottes gestrigen Erfolg im Salon der Königin ausließ. »Zwei Minuten! Das ist bestimmt mehr, als sie jeder anderen jungen Dame dieses Jahr gewidmet hat.«
Mama sah äußerst selbstzufrieden aus, während sie sich vor einem Kreis von Witwen, die ihre Langeweile mit mäßigem Erfolg verbargen, weiter über ihr Thema ausließ.
»Zwei Minuten.« Henry stieß einen leisen Pfiff aus. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das alte Mädchen so lange an dir gefunden hat.«
»Nicht?« Charlotte kniff ihn in den Arm. »Du sollst sie nicht als altes Mädchen bezeichnen. Das ist respektlos.«
»Sie wird bestimmt noch ganz anders tituliert«, sagte ihr Bruder, rieb sich den Arm und stand auf. »Willst du wieder reingehen? Ich glaube, der nächste Tanz gehört mir.«
Sie nickte und erhob sich ebenfalls. Zusammen traten sie an die Balustrade, von der aus man einen wunderbaren Ausblick auf den ganzen Ballsaal hatte. Henry ließ den Blick über die Menschen schweifen. »Musstest du unbedingt so viele alte Schachteln einladen, Lottie?«
»Mama hat die Einladungen verschickt. Das weißt du doch.«
»Ich habe das Gefühl, meine Freunde unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eingeladen zu haben.«
»Und was für falsche Tatsachen wären das? Willst du damit sagen, du hast sie nicht darauf vorbereitet, dass sie mit deiner Schwester tanzen müssen? Das ist allerdings unerhört!«
»Ich gebe zu, dass ich mit dieser Möglichkeit nicht gerade geworben habe.« Er hustete. »Manche meiner Freunde sind absolut nicht der Typ, den ich als Tanzpartner meiner Schwester sehen möchte.«
»Da fragt man sich natürlich unwillkürlich, warum sie deine Freunde sind.« Sie sah ihn herausfordernd an.
Er wurde rot. »Vielleicht hat Mama Recht und du verbringst tatsächlich zu viel Zeit mit unserer lieben Cousine.« Er nickte zu Lavinia hinunter, die im Arm ihres Mannes über die Tanzfläche glitt. »Irgendwie schaffst du es immer, einen armen Kerl in Verlegenheit zu bringen. Das ist überhaupt nicht gut, hörst du? Nicht, wenn du auf der Jagd nach einem Ehemann bist.«
»Auf der Jagd nach einem Ehemann? Du glaubst nicht wirklich, dass ich mir einen Ehemann jagen muss, oder?«
Er drehte sich um, musterte sie von oben bis unten und schürzte dann anerkennend die Lippen. »Na ja, es geht so.«
Sie lachte, schob ihren Arm durch seinen und ging mit ihm die große Treppe hinunter. »Wenn du mal einer jungen Dame begegnest, die du beeindrucken möchtest, wirst du hoffentlich nicht mehr ganz so geizig mit deinem Lob sein.«
»Und ich hoffe, der Mann, den du beeindrucken willst, merkt rechtzeitig, dass er dir sein Leben lang schmeicheln muss, damit du glücklich bist.«
»Ich verlange überhaupt nicht, dass man mir schmeichelt, Henry«, murmelte sie, während sich der elegant gekleidete Lord Fanshawe näherte. Groß, attraktiv, in perfekt geschnittenem dunklem Frack, mit blütenweißer Halsbinde, in deren Falten ein Diamant funkelte, war dieser Mann über siebentausend Pfund im Jahr schwer und obendrein auf der Suche nach einer Braut – hatte Mama jedenfalls behauptet.
Er verbeugte sich. »Lady Charlotte, darf ich Sie um unseren Tanz bitten?«
»Mit Vergnügen.« Sie ließ den Arm ihres Bruders los und ergriff die ausgestreckte Hand des Grafen.
»Darf ich Ihnen sagen, dass Sie heute Abend der Inbegriff der Lieblichkeit des Frühlings sind?«
»Das dürfen Sie.« Sie lächelte, hielt ihren Bruder mit einer Bewegung ihrer weiß behandschuhten Hand zurück und sagte halblaut: »Ich verlange keine Komplimente, aber ich weiß sie durchaus zu schätzen.«
»Vorsicht, sonst wirst du noch zum heißesten Flirt diesseits von Paris.«
Er lachte und verbeugte sich, dann führte der Graf sie zum Tanz.
Welch ein Wirbel, welche eine Aufregung und Freude diese letzten Stunden waren! Sie drehte und drehte sich, der Ballsaal um sie herum war erfüllt vom Geräusch tanzender Füße und die Musiker spielten ein fröhliches Stück. Ihr Herz jauchzte, die Juwelen glitzerten, die Kerzen in den drei riesigen Kronleuchtern über ihr flackerten und sie war glücklich, einfach nur glücklich, während sie durch den Saal schwebte.
»Und deshalb finde ich, dass Kürbis am besten schmeckt.«
Sie blinzelte ihren Partner verwirrt an. Er lächelte.
»Ich muss zu meiner Schande feststellen, dass meine Ansichten über Gunter’s Eissorten meine schöne Begleiterin nicht zu interessieren scheinen.«
»Oh – verzeihen Sie! Mein Kopf ist heute Abend so durcheinander, ich kann gar nicht alles aufnehmen.«
»Dann werde ich mich also nicht länger schämen, sondern lieber nach einem Thema suchen, das mehr nach Ihrem Geschmack ist.«
»Sie machen sich über mich lustig.«
»Keineswegs.« Seine Augen funkelten. »Ich möchte Ihnen einfach nur sagen, wie wunderschön Sie heute Abend sind.«
Sie lächelte, auch wenn ein zynischer Kern tief in ihr überlegte, ob er dasselbe wohl zu einer jungen Dame sagen würde, die keine fünfzigtausend Pfund Mitgift mit in die Ehe bringen konnte. Wie konnte sie wissen, ob er es ernst meinte? Wie konnte sie wissen, ob überhaupt irgendein Mann es ernst meinte? Sie biss sich auf die Lippen.
»Verzeihen Sie, meine liebe Dame, aber Sie wirken ein wenig unzufrieden. Es liegt doch hoffentlich nicht an Ihrem Partner?«
»Nein.« Sie lächelte strahlend. »Ich habe mich nur gefragt, ob Sie auch noch irgendetwas anderes können, als Komplimente machen?«
Er schnappte in gespieltem Entsetzen nach Luft. »Solche Wunden werden von einer so jungen Frau geschlagen!«
Sie runzelte die Stirn.
»Jetzt habe ich Sie gekränkt. Ich entschuldige mich tausendmal.«
Sie neigte den Kopf und das Lächeln, mit dem er sie bedachte, ließ ihr Herz kurz aussetzen, doch dann führte der Tanz ihn von ihr fort. Der junge Mann, der seinen Platz einnahm, war sehr viel rundlicher, aber ein Marquis. Er besaß also einen höheren Rang und war deshalb sehr viel annehmbarer für ihre Mutter. Ihr mit lauter Stimme geäußerter Wunsch, Charlotte möge doch bitte mit ihm tanzen, wurde prompt durch seine Aufforderung zum Tanz erfüllt, die sie nicht hatte abweisen können.
Der Tanz selbst gestattete keine intensivere Konversation, was ihr gerade recht kam, da der Marquis als Tänzer nicht annähernd so gewandt war wie ihre vorigen Tanzpartner. Er war ein guter Freund ihres Vaters. Als Gesprächspartner hatte er nicht viel zu bieten, außer noch mehr Komplimente, die zwar nett anzuhören waren, aber nicht unbedingt Scharfsinn verrieten.
Sie versuchte, nicht zusammenzuzucken, als er ihr zum dritten Mal auf die Zehen trat.
»Entschuldigung!«
»Keine Ursache«, murmelte sie, während die Musik ihn entführte und sie am Ende der Reihe zurückblieb.
»Lady Charlotte?«
Sie blickte auf. Da stand der Mann ihrer Träume. Dunkelhaarig, Gesichtszüge wie gemeißelt, blaue Augen unter Brauen, die so glatt waren, dass sie wie aufgemalt wirkten. So überirdisch gutaussehend, so unerreichbar attraktiv – und doch erreichbar, denn er stand ja vor ihr.
»Ich … mein Herr, wir wurden einander noch nicht vorgestellt.«
»Ich kenne Henry von der Universität. Lord Markham. Zu Ihren Diensten.« Er verbeugte sich und ihr Herz flatterte schon wieder. »Ich wollte Sie nur vor Ihrem Partner retten.«
Sie sah zu dem rotgesichtigen Marquis hinüber, der auf sie zustolperte. »Oh, aber ich kann nicht …«
»… zulassen, dass ihre Zehen von einem solchen Langweiler zerquetscht werden. Sie haben recht.« Er griff nach ihrer behandschuhten Hand. »Wollen wir?«
Sie hörte ihre Antwort kaum, hörte auch den Protest des Marquis nicht, während sie in den Armen dieses neuen Lords entschwebte. Sie nahm überhaupt kaum mehr etwas wahr außer seinen dunkelblauen Augen, die sie in ihren Bann zogen und ihr das Gefühl gaben, durch die Luft zu tanzen.
»Wer sind Sie?«
»Außer einem Ritter in schimmernder Rüstung?«
Sie lachte. »Außer dem.«
»Außer einem Mann, der sich wünscht, ein Dichter zu sein, um Ihre Schönheit mit angemessenen Worten zu preisen?«
Sie blinzelte.
»Erlauben Sie, dass ich mir wenigstens die Worte eines Dichters borge? ›Um sie strahlte jene namenlose Bezauberung, ihr selbst allein ganz unbewusst – der Liebe Licht, der Anmut Reinheit, Gedankenfülle und Musik entatmend ihrem Gesicht …‹«
»Wer hat das geschrieben?«
»Byron.«
Sie senkte den Blick. Ihre Wangen wurden heiß. »Mama erlaubt mir nicht, seine Werke zu lesen.«
»Ich hoffe, sie hat nichts dagegen, dass Sie seine Werke hören.«
»Warum sagen Sie das?«
»Das werden Sie herausfinden müssen.«
Sie sah auf. Er lächelte, seine blauen Augen strahlten und ihr Herz fing an, heftig zu klopfen. Und während sie tanzten und plauderten und lachten – wobei er ihr nicht ein einziges Mal auf die Füße trat –, begann sie sich zu fragen, ob dies vielleicht der Mann war, der als ihr Ehemann taugen konnte. Markham. Warum war ihr der Name nicht aus den Seiten von Debrett’s Adelskalender, den sie hatte auswendig lernen müssen, entgegengesprungen?
Die Musik schwoll in einem Crescendo an. Zufällig erhaschte sie einen Blick auf ihren Vater, der neben dem indignierten Marquis stand, und verspürte einen Augenblick lang so etwas wie Reue.
Ihr Begleiter beugte sich zu ihr herunter und raunte: »Wetten, dass der Marquis das nächste Mal etwas besser aufpassen wird, wenn er mit einer solchen Schönheit tanzt?«
Sie lächelte, doch seine Worte erinnerten sie an das, was sie zuvor mit angehört hatte: Wetten auf das ungeborene Kind des Herzogs von Hartington. Die Geigen schienen mit einem Mal trauriger zu klingen und mitten im Ballsaal, mitten in ihrem überwältigenden Debüt in der Gesellschaft, spürte sie, wie ein leises Gebet in ihr aufstieg, dass alles gut gehen möge.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 3
Hartwell HouseHanover Square, London
Der Schrei zerriss die Nacht.
William Herzog von Hartington presste die Hände auf die Ohren und sackte an seinem Schreibtisch zusammen. Seine Lippen wollten ein Gebet flüstern, doch die Dunkelheit verschluckte es, noch bevor es hörbar wurde. Verflucht wollte er sein, wenn er für sie betete. Verflucht, wenn er sein Herz noch einmal von ihr berühren ließ. Hatte er nicht schon genug gebetet?
Hitze stieg in ihm auf, presste ihm die Brust zusammen, drohte ihn zu ersticken, bis der Drang nach frischer Luft übermächtig wurde. Er zwang sich einzuatmen, sich ein paar Minuten lang nur auf das Atmen zu konzentrieren: einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
Im Zimmer war es dunkel, nur vom Kamin her kam ein schwaches, rötliches Licht. Auch hinter seinen geschlossenen Augenlidern tanzte rotes Licht, ein Spiegelbild des Feuers, das seine Seele zu verzehren drohte. Seine Finger verkrampften sich. Mit größter Anstrengung löste er sie, streckte sie aus, nur um sich gleich darauf wie ein Verrückter die Haare zu raufen.
Ein Verrückter. Ein Lachen brach aus ihm heraus, erstarb wieder. Welche Ironie! Hatte der Vorstand des Bethlem Royal Hospital and Asylum erkannt, wie absurd es war, einem Mann wie ihm eine Position im Verwaltungsrat anzubieten? Verrückt? Die Hitze in ihm wurde unerträglich. Wie lange würde es dauern, bis er nicht mehr diese wahnsinnige Wut empfände?
Gott …
Er konnte nicht beten, ja er war nicht einmal mehr sicher, ob es Gott gab. In den letzten Monaten jedenfalls hatte er seine Gegenwart nicht gespürt.
Es kratzte an der Tür. Er hob den Kopf, sagte jedoch nichts, sondern wartete einfach, bis die Tür aufging, wie es immer geschah, auch wenn er Anweisung erteilt hatte, ihn nicht zu stören.
»Euer Hoheit?«
Jensens Stimme.
»Euer Hoheit, bitte kommen Sie.«
Sein Kammerdiener wusste alles und doch kam er mit dieser Bitte zu ihm? »Verschwinden Sie!«
»Aber …«
»Nein.«
»Ihre Frau fragt nach Ihnen. Sie braucht …«
»Meine Frau?« Er spie das Wort beinahe aus. »Sie hat schon vor langer Zeit klargemacht, dass sie mich für gar nichts braucht.«
Nicht seine Liebe, nicht seinen Samen. Nur seinen Namen.
»Wenn Sie nicht kommen, werden Sie es Ihr Leben lang bereuen …«
»Sie wagen es, mir zu sagen, was ich empfinden soll?« Er starrte auf den Schattenriss des Mannes im Türrahmen. »Sie haben ja keine Ahnung, was ich durchmache!«
Sein Kammerdiener antwortete nicht. Im Licht, das von der Lampe in der Halle hereinfiel, sah er, dass der Diener ihn anschaute.
Seine Pein steigerte sich weiter. Doch, Jensen wusste es. Er war der Einzige, den William ins Vertrauen gezogen hatte, der Einzige, der wusste, wie die Entdeckung ihrer Affäre ihn zerstört hatte. Der Einzige aus seinem Haushalt, der von der Ehrensache gestern Nacht wusste. Er hatte ihm ein königliches Schweigegeld gezahlt. Er war der Einzige, dem er vertrauen konnte.
Wieder lachte er dieses verrückte Lachen. Wie hatte es so weit kommen können, dass sein einziger Freund ein bezahlter Diener war?
»Euer Hoheit?«
Angesichts der Sorge in der Stimme seines Kammerdieners zwang er seine sich überschlagenden Gedanken zur Ruhe. Er holte tief Luft. »Ja?«
»Der Arzt … der Arzt sagt, es dauert nicht mehr lange.«
Der Widerwille sprengte ihm schier das Herz. »Bis der Bankert geboren ist?«
»Bis Ihre … bis die Herzogin nicht mehr ist.«
»Was?« Er fuhr in seinem Stuhl herum und sah den Kammerdiener voll an.
»Doktor Metcalfe sagt, es sei ein schwerer Fall, sie habe viel Blut verloren. Er glaubt, es könne sich nur noch um Stunden handeln.«
Auf dem sonst so ausdruckslosen Gesicht zeichnete sich fast so etwas wie Mitleid ab. William verhärtete sein Herz und sagte grob: »Und was kümmert mich das?«
»Wenn ich das sagen darf …«
»Ich habe Ihnen noch nie das Sprechen verboten, oder?«
»Wenn Sie nicht zu ihr gehen, werden Sie es immer bereuen, weil etwas Wichtiges ungeklärt bleibt.«
So wie bei seinen Eltern. Williams Hände verkrampften sich abermals ineinander. Er wollte das nicht noch einmal erleben, oder?
Nein. Das wollte er nicht.
Er stöhnte auf, erhob sich und folgte Jensen. Das helle Licht in der großen Halle ließ ihn blinzeln. Er blieb kurz stehen, während seine aufgewühlten, hilflosen Diener versuchten, ihre Gesichter rasch wieder in die gewohnte Ausdruckslosigkeit zu zwingen.
Kein Zweifel, sie wussten alle Bescheid. Sie konnten es kaum erwarten, über sein Unglück zu tratschen, wenn sie es nicht ohnehin schon taten. Heuchlerischer, hinterhältiger Klatsch, so widerwärtig wie das Geschwätz der sogenannten Damen der Gesellschaft, die sich hinter vorgehaltener Hand an jedem Skandal förmlich berauschten.
Er stapfte die Treppe hinauf; sein Herz hämmerte wild, als ein weiterer verzweifelter Schrei die Luft durchschnitt.
»Euer Hoheit?« Maria, die Zofe seiner Frau, eilte ihm entgegen; ihre Augen waren gerötet. »Oh mein Herr, die gnädige Frau braucht Sie! Sie …«
Er schnitt ihr mit einer ungeduldigen Handbewegung das Wort ab und betrat das Schlafzimmer.
Ein kollektiver Seufzer ging durch den Raum. Ein halbes Dutzend Menschen drückte sich hier drinnen herum, doch er sah nur die Gestalt, die sich auf dem riesigen Bett vor Schmerz krümmte. Das Entsetzen, das in ihm aufstieg, verjagte alle anderen Gefühle.
Die brünette Frau auf dem Bett knirschte mit den Zähnen, während ein heftiges Zittern ihren aufgetriebenen Leib packte und schüttelte wie ein unsichtbarer Riese. Eine grauhaarige Frau neben ihr hielt ihren einen Arm, mehrere Hausmädchen hinderten den anderen daran, um sich zu schlagen. Ihr Nachthemd war blutgetränkt, die Betttücher beschmutzt; es schien viel zu viel Blut für eine Person zu sein.
Ein weiteres leises Stöhnen schwoll zu einem gurgelnden Schrei an, der seine Seele durchbohrte.
Er wandte den Blick ab. Er musste etwas anderes sehen als ihr Gesicht, ihr angebetetes, einst so schönes Gesicht. So konzentrierte er sich auf die geschnitzten Bettpfosten, die sich in einem Gewirr ineinander verschlungener finsterer Wesen hoch in die Luft schraubten. Er hatte dieses Bett immer gehasst.
»Ist er hier?« Die Stimme, ein raues Flüstern, fing seine Aufmerksamkeit wieder ein und stahl sich hinter seine innere Schutzwehr.
»Ich bin hier, Pamela.«
»William?« Ihre blauen Augen, die er einst mit dem Licht des Mondes verglichen hatte, richteten sich auf ihn.
Für einen Augenblick war er wieder im Sommer des letzten Jahres. Damals hatte sie ihn zum letzten Mal mit so etwas wie Freundlichkeit angesehen, in jener Nacht, in der er versucht hatte, sie von seiner Liebe zu überzeugen. In dieser Nacht hatte er sein Elend verborgen und das letzte Mal versucht, einen Erben zu zeugen. Danach hatte sie das Verhältnis mit Lord Wrotham wieder aufgenommen.
Sein Herz verhärtete sich. »Was ist?«
Sie wimmerte, ihr Gesicht verkrampfte und verzerrte sich vor Schmerz, als ihr Leib sich in einer erneuten Schmerzwelle zu einem Bogen spannte. »Oh lieber Gott!«
Ihre Verzweiflung griff auf ihn über, längst erloschenes Mitleid stieg in ihm auf. Irgendwo tief in seinem Innern fand er die Kraft zu einem Gebet: Gott, hilf ihr, heile sie!
Sie keuchte, die Augen geschlossen, der Schmerz ebbte wieder ab. Der Geburtshelfer blickte zu ihm auf, die buschigen Brauen zusammengezogen.
»Das Kind?«
»Wir … wir können es nicht herausholen«, sagte Doktor Metcalfe leise.
»Aber …« Er deutete hilflos auf die blutverkrusteten medizinischen Instrumente. »Vielleicht jemand anderes?«
»Es ist keine Zeit mehr, mein Herr.« Maria blickte auf, ihr Blick war voller Anklage.
«Es tut mir leid, Euer Hoheit.«
Die Endgültigkeit der Worte war wie ein Schlag. Nein. Gott, nein! Wenn seine Verbitterung doch nicht verhindert hätte, dass er früher kam. Wenn er doch nur … wenn sie nur …
»William, bitte.« Pamela streckte ihm die Hand hin. »Bitte glaub mir, es tut mir so …« Ihre Worte mündeten abermals in einen lauten Schrei, dann fiel sie zurück und lag regungslos da.
Er stolperte vom Bett zurück, heraus aus dem Kreis der Frauen, die in hektische Aktivität verfallen waren.
Nein! Es durfte nicht so enden. Gott!
Wildes Entsetzen packte seine Seele, als sie sich nicht mehr rührte und Metcalfes fieberhafte Anstrengungen ohne Ergebnis blieben.
Herr Gott!
»Sie ist tot.«
»Nein!« Ein Klagelaut stieg von der anderen Seite des Bettes auf. »Nicht meine süße Herrin!«
Die Schreie, das Schluchzen, die verzweifelten Bemühungen des Arztes schienen sich zu entfernen; ein Gewicht, so schwer wie die Glocken von Westminster Abbey, legte sich auf Williams Brust. Ihm wurde übel. Tränen stiegen ihm in die Augen, seine Kehle zog sich zusammen. Nein …
»Sie! Sie haben ihr das angetan!« Maria stemmte sich aus ihrer knienden Haltung hoch und streckte anklagend den Finger gegen ihn aus. »Nie werde ich Ihnen vergeben, was Sie ihr angetan haben!« Sie spie vor ihm aus.
Er sprang zur Seite, aber nicht schnell genug; ihr Speichel landete auf seiner Jacke. Sie hob eine Hand, als wollte sie ihn schlagen, deshalb packte er ihren Arm und drehte sie herum, bis ihr Gesicht von ihm abgewandt war. Die ganze Zeit stieß sie schreckliche Flüche gegen ihn aus, denen die übrigen Anwesenden in entsetzter Faszination lauschten.
»Und ich werde dir deine Rolle bei all dem niemals vergeben.« Er schluckte seine Erschütterung hinunter und raunte ihr ins Ohr: »Du hast deine Herrin die Hure spielen lassen und jetzt gibst du mir die Schuld? Wie kannst du es wagen?«
»Euer Hoheit …«
William ignorierte den Arzt und schob die Französin zur Tür. »Hinaus! Verlass sofort mein Haus! Jensen!«
»Hier, Euer Hoheit.«
»Sorgen Sie dafür, dass der Schatten dieser Person nie mehr über die Schwelle meines Hauses fällt!«
»Selbstverständlich, mein Herr.«
»Euer Hoheit …«
»Das wird Ihnen noch leidtun, Herzog von Hartington!« Sie spie einen weiteren obszönen Fluch aus. »Es wird Ihnen noch leidtun, dass Sie atmen!«
»Das bezweifle ich.« Was sollte daran eine Drohung sein? So war es doch jetzt schon!
Jensen zerrte die schreiende Zofe mit Hilfe einiger Diener fort; ihre Flüche mischten sich mit vulgärem Französisch, das er gar nicht verstehen wollte.
»Euer Hoheit!«
Er fuhr zu dem Arzt herum. »Was?«
Der ältere Mann hielt ein kleines Bündel in den Händen. »Es ist ein Mädchen.«
»Was?«
Doktor Metcalfe trat näher und hielt ihm das Kind hin.
Das winzige Gesichtchen schien zu winzig, zu rot, zu still zu sein. »Ist sie …?«
»Sie lebt, ja. Wie lange noch, kann ich nicht sagen.«
Ein Krampf schnürte ihm die Kehle zu, doch dann schien irgendetwas in seinem Herzen zu schmelzen. Er berührte die winzigen Finger. »Wie? Ich dachte …«
»Manchmal, wenn ein Körper sich entspannt …«
Er schauderte. Seine Frau war nur noch ein Leichnam.
»Und wir besser ziehen können …«
Er ignorierte die Details und konzentrierte sich auf das stille Kind. Doch dann fiel ihm der Grund für dessen Existenz wieder ein. Seine Frau. Wrotham. Jene Nacht. Er schauderte erneut. »Nehmt es fort.«
»Aber …«
»Ich sagte, nehmt es fort!«
Und bevor jemand sah, dass seine Augen feucht wurden, ging er hinaus, in sein Zimmer, dessen Tür er hinter sich zuschlug, damit er ungestört weinen konnte.
Denn natürlich war das Kind ein Mädchen.
Kein Erbe.
Nicht einmal ein Kind, das er sein Eigen nennen konnte.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 4
Exeter HouseDrei Tage später
»Natürlich muss sie mitkommen.«
»Aber Mama …«
»Charlotte, unterbrich mich bitte nicht. Dein Vater und ich sind uns einig, dass es unhöflich wäre, nicht hinzugehen.«
Charlotte sah ihren Vater an, dessen Gesicht Ungeduld und nicht etwa Zustimmung ausdrückte.
»Jetzt beeil dich, Kind. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Halb London wird dort sein.«
»Aber warum?«
»Weil sie eine Herzogin ist, ich meine, war.«
»Aber warum muss ich mitkommen? Ich kenne sie doch beide überhaupt nicht!«
»Wofür wir dankbar sein sollten, wenn man den Gerüchten glauben darf«, murmelte Henry. Er stand bereits in der Tür und streifte seine schwarzen Handschuhe über.
»Wie bitte?« Als er den Kopf schüttelte, sah sie ihre Mutter an. »Woher weißt du, dass der Herzog überhaupt da sein wird?«
»Weil er den Gottesdienst immer besucht. Schluss jetzt, Charlotte! Mach dich fertig. In zehn Minuten bist du unten!«
Charlotte verbiss sich eine wenig damenhafte Erwiderung, mit der sie sich lediglich noch mehr Schwierigkeiten eingehandelt hätte, und überließ sich Ellens flinken Händen. Die waren nicht nur flink, sondern auch sehnig und stark.
Wenige Minuten später stand sie angemessen in schwarzen Krepp gekleidet, einen kleinen Schleierhut auf dem Kopf im Vestibül. Gleich darauf saßen sie im Landauer auf dem Weg zu Saint George’s, wo der Gottesdienst stattfand, der heute durch die vielen Leute, die dem Herzog ihr Beileid aussprechen wollten, sicherlich sehr gut besucht sein würde. Wie schrecklich, dass am Abend ihres Balls, dem glücklichsten Abend ihres Lebens, ganz in ihrer Nähe etwas so Trauriges geschehen war!
Sie betrachtete ihre schwarzen Handschuhe. Warum wollte Mama unbedingt, dass sie heute mitkam? Sonst besuchten sie bestenfalls sporadisch den Sonntagsgottesdienst. Aber Mama hatte nicht nur darauf bestanden, dass sie mitkam, sondern ihr auch noch ihre Zofe Ellen zur Verfügung gestellt, damit sie so gut wie möglich aussah; es hatte beinahe den Anschein, als läge ihr daran, dass Charlotte einen guten Eindruck machte. Sie wollte doch ganz bestimmt nicht, dass Charlotte sich einen trauernden Witwer angelte, auch wenn er ein Herzog war? Das konnte sie wohl kaum wollen. Oder etwa doch?
»Charlotte, hör auf, die Stirn zu runzeln.«
»Ja, Mama.«
Sie wechselte einen Blick mit Henry, dann schaute sie aus dem Fenster. Der Frühling hatte eine wahre Blütenpracht entfesselt, das helle Grün der jungen Blätter sah wunderhübsch aus. Ihre Stimmung besserte sich. Vielleicht würde Lord Markham, der seit dem Ballabend vor drei Tagen jeden Nachtmittag vorgesprochen hatte, sie auf eine Ausfahrt mitnehmen? »Meinst du, wir könnten gelegentlich einen Ausflug nach Richmond Park machen? Dort muss es um diese Jahreszeit ganz reizend sein.«
Mama zog die Brauen hoch. »Wie kannst du an einem so traurigen Tag einen solchen Vorschlag machen? Also wirklich, Charlotte!«
»Aber wir sind doch nicht traurig, oder? Du hast doch gestern selbst gesagt, dass wir die Leute kaum kennen …«
»Charlotte, das reicht!«
»Ja, Mama.«
Charlotte schaute wieder aus dem Fenster. Die Kutsche wurde langsamer, zweifellos wegen der vielen Fahrzeuge, die sich vor dem Hanover Square stauten.
Ein paar Minuten später wurden sie zu ihrem Kirchenstuhl weit vorn geleitet, für den Papa jedes Jahr eine hohe Summe zahlte, obwohl sie ihn kaum nutzten. Wenn sie doch einmal in den Gottesdienst gingen, beschwerte ihr Vater sich regelmäßig über das herablassende Verhalten des Geistlichen.
Charlotte schaute sich um. Es war zwar streng genommen keine Trauerfeier, doch die überwiegende Zahl der Gottesdienstbesucher war in schwarzen Bombasin gekleidet und wies sich damit als Trauergemeinde aus. Sie lächelte Lord Fanshawe zu, der auf der anderen Seite des Gangs saß und ihr Lächeln erwiderte.
»Charlotte, es ist unklug, einen jungen Mann in der Kirche zu grüßen.«
»Ja, Mama.«
Es scheint überhaupt unklug zu sein, einen jungen Mann zu grüßen, wo auch immer. Mama hatte es gar nicht gefallen, dass nach dem Ball so viele Herren, die sie für unbedeutende Eroberungen hielt, bei ihnen vorgesprochen hatten. Ihre Zustimmung zu einer sonntäglichen Ausfahrt mit Lord Markham musste sie sich schwer erkämpfen; ihre Mutter hatte nur nachgegeben, weil Henry sich zögernd bereit erklärt hatte mitzukommen. Egal – es war einfach herrlich gewesen und nachdem sie Henrys Freund ein wenig besser kennengelernt hatte, fühlte sie sich noch stärker zu ihm hingezogen. Er war ein so attraktiver, charmanter Mann, und so amüsant! Die Gespräche mit ihm entzückten sie; sie konnte nicht genug davon bekommen.
Das Gemurmel der Kirchgänger verstummte plötzlich. Dann flüsterte jemand: »Der Herzog!«
Um nicht Mamas Zorn zu erregen, blickte Charlotte sich so unauffällig wie möglich um. Er kam langsam das Mittelschiff herunter. Sie betrachtete ihn neugierig. Hager, mittelgroß und nicht besonders gutaussehend; elegant gekleidet, allerdings ganz in Schwarz, bis hin zu seinem schwarzen Halstuch. Das Auffallendste an seinem Gesicht waren die tiefschwarzen Augen unter dichten, dunklen Brauen, beides passte nicht so recht zu seinem hellbraunen Haar. Nein, man konnte ihn wahrlich nicht als attraktiv bezeichnen. Er hielt sich sehr steif, als sei er sich bewusst, dass alle ihn beobachteten. Irgendjemand sprach ihn kurz an: der Herzog von Sutherland, glaubte sie. Dann betrat er den Kirchenstuhl auf der anderen Seite des Gangs, eine Reihe vor ihnen.
Jetzt konnte sie ihn besser sehen – die Schatten unter seinen Augen und wie er die Lippen zusammenpresste, als eine Lady Sowieso sich umdrehte und ihm die Hand tätschelte. Plötzlich empfand sie mit ihm. Wie schrecklich, seine geliebte Frau und ein ersehntes Kind zu verlieren! Ihre Augen wurden feucht.
»Charlotte! Hör auf hinzustarren!«
Doch Mamas geflüsterter Verweis brachte sie nicht dazu, den Blick abzuwenden. Armer Mann! Er wirkte beinahe gehetzt. Sie wühlte in ihrem Täschchen, fand ein schwarz umrandetes Taschentuch und betupfte sich die Augen.
In diesem Augenblick drehte der Herzog sich um, als nähme er endlich die neugierige Menge wahr. Als sie seinen Gesichtsausdruck sah, überlief sie ein Schauer; es war ihm ganz klar, warum die Kirche heute so überfüllt war, und er verachtete die vielen, die aus reiner Sensationsgier gekommen waren. Voller Scham wollte sie den Blick abwenden, als ihr plötzlich bewusst wurde, dass er sie ansah.
Unter seinem kühlen, dunklen Blick wurde ihr kalt; gleichzeitig traten ihr erneut Tränen in die Augen. Der arme Mann! Einerseits wollte sie ihren Blick abwenden und so tun, als hätte sie ihn nie angesehen, andererseits war sie versucht, ihn weiter zu betrachten. Da spürte sie, wie ihr eine Träne über die Wange lief.
Seine zusammengekniffenen Augen wurden groß, er zog die schweren Brauen hoch.
»Charlotte!«
Mama kniff sie in den Arm. Der Bann war gebrochen. Ein wenig benommen blickte sie nach vorn und zwang sich zur Ruhe. Sie holte tief Luft und konzentrierte sich auf den Altar. Dieser Kirche fehlten der Schmuck und die schönen Buntglasfenster, die den Besuch von Westminster Abbey so interessant machten.
Der Pfarrer betrat die Kanzel. In seiner Predigt lobte er die Gemeinde für ihre zahlreiche Teilnahme in so schwerer Zeit. Charlotte errötete vor Verlegenheit. Wie traurig zu denken, dass die Menschen mehr aus Neugier als um der christlichen Unterweisung willen hier waren. Und sie war keinen Deut besser. Am liebsten wäre sie einfach gegangen, hätte diese Farce von einem Gottesdienst verlassen, auch auf die Gefahr hin, dass Mama einen Schlaganfall bekam.
Die Orgel setzte ein, die Gemeinde erhob sich. Beim Singen ließ ihr Unbehagen nach. Nur weil Mamas Motiv, heute den Gottesdienst zu besuchen, bestimmt nicht Frömmigkeit war, musste das nicht auch für sie, Charlotte, gelten. Der Pfarrer sprach ein Gebet. Tief in ihrem Herzen regte sich etwas und sie beschloss, nicht wie die anderen Gottesdienstbesucher zu sein.
Sie fing an, für den Mann auf der anderen Seite des Gangs zu beten, dessen Seele so düster wirkte wie seine Kleidung.
William bekam kaum ein Wort von der Predigt mit, war sich aber dessen, was ungesagt blieb, umso bewusster. Mechanisch folgte er der Liturgie: Aufstehen. Singen. Knien. Zuhören. Versuchen, nicht zu gähnen. Aufstehen. Singen. Hinsetzen. Beten.
Seine Haut prickelte unter den vielen Blicken, die sich in seinen Rücken zu bohren schienen. Er kannte das Gerede, den Tratsch. Er wusste, dass man sich in den Klubs über ihn lustig machte, über den gehörnten Herzog von Hartington mit dem Bastard. Tratsch, der nur durch die Tatsache, dass Wrotham wie versprochen das Land verlassen hatte, etwas gemildert wurde.
Seine Kehle war wie zugeschnürt. Er brachte es kaum über sich, an die Umstände zu denken, unter denen dieses außereheliche Kind entstanden war, aber es wäre ungerecht gewesen, ihm die Sünden seiner Eltern zuzurechnen. Diese Erkenntnis und Jensens Bitten hatten seine ursprüngliche Reaktion gemildert; er hatte gestattet, das Kind in dem Zimmer unterzubringen, das am weitesten von seinem entfernt lag, wo er es kaum zu hören oder zu sehen bekommen würde. Die Amme, die noch seine Frau eingestellt hatte, war ebenfalls dort untergebracht, und Jensen hatte ihm versichert, dass alles in Ordnung war. Er selbst hatte das Baby jedoch noch nicht wieder gesehen. Er ertrug es nicht; es erinnerte ihn an die Fehltritte seiner Frau – und an sein eigenes Versagen.
Gott?
Schweigen.
Er verzog die Lippen. Auch hier in der Kirche schien Gott unendlich fern zu sein.
Während er so tat, als singe er das letzte Lied mit, versuchte er, sich für den Ansturm der Leute zu wappnen. Eigentlich hatte er heute gar nicht kommen wollen, doch das Wissen, dass seine Abwesenheit dem Tratsch nur noch mehr Nahrung geben würde, hatte ihn umgestimmt.
Der Pfarrer betete, dann entließ er die Gemeinde mit einem Segen: »Gehet hin in Frieden, tut, was gut ist. Stärkt die Mutlosen, helft den Schwachen, tröstet die Trauernden, ehrt jedermann. Liebt Gott und dient ihm, freut euch an der Macht des Heiligen Geistes. Der Segen des Herrn begleite euch, jetzt und für immer.«
»Amen.«
Er sprach das Amen mit, auch wenn sein Herz zweifelte. Wie konnte er tun, was gut war, wie konnte er sich an der Macht des Heiligen Geistes freuen, wie konnte er irgendjemandem helfen?
Er brauchte selbst Hilfe; er war ein Trauernder, ein Bedrängter. Die nächsten Tage würden eine Qual sein; die vergangenen drei Tage waren die Hölle gewesen. So viele Entscheidungen mussten gefällt werden, nicht nur, was das Begräbnis seiner Frau betraf, sondern auch die Versorgung seines Londoner Stadthauses und die Reisevorbereitungen für die Rückfahrt nach Hartwell Abbey, ganz zu schweigen von den Vorkehrungen für das Kind, die zu treffen waren. All das türmte sich wie ein unüberwindbarer Berg vor ihm auf. Und dann die Besuche: die Besuche von den Wohlmeinenden, vom Leichenbestatter, vom Pfarrer und auch die Besuche von den wenigen, die sich für seine Freunde hielten.
Er hatte seit Donnerstag kaum geschlafen; der Schleier, der sich über seinen Verstand legte, wurde ständig undurchdringlicher, sodass Vernunft und klares Denken – seit jeher seine besten Freunde – inzwischen unendlich weit weg schienen. Manchmal wurde ihm regelrecht schwindelig. Jensen drängte ihn auszuruhen, doch das konnte er nicht. Er war zu aufgewühlt; zu viel gärte in ihm, drohte zu explodieren.
»Hartington?«
Er blinzelte. Zwang seine jagenden Gedanken zur Ruhe. Zwang sich, den Kopf zu wenden.
»Darf ich Ihnen sagen, wie leid mir Ihr Verlust tut?«
William zwang sich zu nicken. Wer war das? Pamela hatte sich stets jeden Namen merken können. Er ging hinter den anderen hinaus. Je mehr er sich beeilte, mit desto weniger Leuten würde er reden müssen.
»Herzog?«
Der Anstand ließ ihn innehalten und sich umdrehen.
»Wir möchten Ihnen unser Beileid aussprechen.«