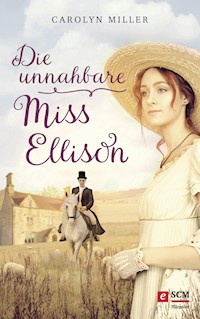Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SCM Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency-Romantik
- Sprache: Deutsch
Voller Verzweiflung verbringt Clara DeLancey ihre schlaflosen Nächte auf den gefährlichen Klippen. In ihrem dunkelsten Moment rettet ein Unbekannter sie vor dem sicheren Tod. Ben Kemsleys Karriere als Kapitän der britischen Seeflotte nimmt ein jähes Ende, als ihm sein Titel aufgrund eines Unfalls aberkannt wird. Als die Wege der beiden sich ein zweites Mal kreuzen, setzt Clara alles daran, nicht erkannt zu werden. Noch kann sie nicht glauben, dass Freundschaft und Barmherzigkeit über die Vergangenheit siegen könnten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
Dieses Buch ist ein historischer Roman, indem natürlich auch gewisse historischePersönlichkeiten auftreten. Alle anderen Personen entstammen jedoch der Fantasiedes Autors, und jedwede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personenist rein zufällig und nicht beabsichtigt.
ISBN 978-3-7751-5984-5 (E-Book)ISBN 978-3-7751-7486-2 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book:Satz & Medien Wieser, Stolberg
© der deutschen Ausgabe 2020SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de · E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: The Dishonorable Miss DeLancey© 2017 by Carolyn MillerPublished by Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan (USA). Translated andprinted by permission. All rights reserved.
Übersetzung: SuNSiDe, ReutlingenUmschlaggestaltung: Nakischa ScheibeTitelbild: Bildnachweise: © Magdalena Russocka (Frau), © Lee Avison (Mann),© Sandra Cunningham (Hintergrund) / Trevillion ImagesSatz: Satz & Medien Wieser, Stolberg
Für meine Schwester Roslyn:Danke, dass ich durch dich Georgette Heyer lieben gelernt habe.
Inhalt
Über die Autorin
Stammbaum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Nachwort der Autorin
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
Carolyn Miller lebt in New South Wales in Australien. Sie ist verheiratet, hat vier Kinder und liebt es, zu lesen und Bücher zu schreiben. Ihre Romane handeln von Vergebung, Liebe und anderen Herausforderungen. Carolyns Lieblingsautorin ist natürlich Jane Austen.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Stammbaum
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 1
Brighton Cliffs, EnglandApril 1815
Die Hochwohlgeborene Clara DeLancey stand auf den weißen Klippen. Hoch über ihr jagten schwere Wolken vor dem Mond vorbei, sodass die Szenerie unten abwechselnd hell beleuchtet wurde und in bedrohliches Dunkel sank.
Zu ihren Füßen glomm die Laterne, die sie für ihren nächtlichen Ausflug geborgt hatte. Tief unter ihr schäumten die aufgewühlten Wasser des englischen Kanals weiß und tödlich. Der Wind peitschte ihr die Kleider gegen den Körper und zerrte an ihr wie die Verzweiflung, die seit Monaten in ihr tobte und endlich herauswollte.
Sie beugte sich nach vorn in den Nachtwind. Sie schloss die Augen und atmete tief den salzigen Hauch ein, nur halbherzig hoffend, dass er seine wütende Kraft behalten möge. Die Gischt nässte ihr Gesicht. Sie atmete noch einmal ein und noch einmal. Seit Wochen hatte sie sich nicht mehr so lebendig gefühlt.
Der Wind wurde lauter. Er dröhnte ihr heulend und wild in den Ohren. Wie launisch die Natur doch sein konnte, wie grausam; sie konnte Schiffsunglücke verursachen, aber auch das Leben erhalten. Wie seltsam, dass etwas an einem Tag so sehr bewundert und am nächsten gefürchtet oder gar verachtet werden konnte. Sie lachte auf. Es war ein kurzes, abgehacktes Lachen. So war es ihr selbst ergangen. Sie war nun verachtet.
Ein Kaleidoskop von Bildern schoss ihr durch den Kopf: ein attraktiver Mann, eine schöne Dame, ein Ballsaal, vibrierend von den Erwartungen der feinen Gesellschaft. Ein gebrochenes Versprechen. Seelenzerfressende Scham.
Wieder kochte die Wut in ihr hoch. Wie konnte er nur? Sie rang nach Luft. Wie hatte er sie nur abweisen können?
Sie öffnete die Augen. Spähte durch die Düsternis nach unten, wo Schaumkronen auf den donnernden Wellen tanzten. Noch immer wehte der Wind gnadenlos und riss ihr die Kapuze des Überwurfs vom Haar. Würde er sie festhalten, wenn sie einen Schritt nach vorn trat? Wollte sie das überhaupt? Sie neigte sich noch etwas weiter vor. Das Tosen der Wellen wurde lauter, lauter. Sollte sie es wagen?
»Miss!«
Sie schrak zusammen und sprang vor Schreck hoch. Die Steinchen unter ihren Füßen rutschten weg. Sie verlor das Gleichgewicht und rutschte dichter an die heimtückische Kante heran.
In diesem Moment wusste sie, dass sie nicht sterben wollte.
Sie schrie auf.
Eine feste Hand packte ihre.
Sie klammerte sich verzweifelt fest. Ihre schwarzen Locken schlugen ihr ins Gesicht. Ein wildes Feuer kroch ihren rechten Arm hinauf, bis es sich anfühlte, als würde er brechen. Verzweifelt tastete sie zwischen den Felsen und dünnen Büscheln Gras nach Halt.
Ganz langsam wurde sie über die Felskuppe gehievt. Ein letzter Ruck riss sie nach vorn, dann brach sie auf dem grasbewachsenen Klippenrand zusammen. Ihr Herz raste schneller, als ihre Finger je auf dem Klavier gespielt hatten. Sie rang nach Atem und rieb sich den rechten Arm, der beinahe ausgekugelt worden wäre. Sie würde nie mehr Klavier spielen.
Beinahe hätte sie überhaupt nie mehr irgendetwas getan.
Schuldgefühle durchzuckten sie so heftig, dass es schmerzte. Wie hatte sie etwas so Törichtes tun können? Was hatte ihren Retter bewogen, sein Leben für sie aufs Spiel zu setzen?
Sie drehte den Kopf. Er lag neben ihr, keuchend, eine Hand über das Gesicht geschlagen. Ein Engel, von Gott gesandt? Wohl kaum. Es sei denn, Gott beschäftigte Engel, die aussahen wie abgetakelte Seefahrer, wie dieser in einen Robbenfellmantel gekleidete Mann mit einem ramponierten Dreispitz auf dem Kopf. Sie rückte ein Stückchen von ihm ab, stützte sich auf ihre abgeschürften Hände und Knie und rappelte sich leise stöhnend hoch. Dann strich sie sich das Haar zurück und zog die Kapuze bis fast zu den Augen herunter. Vielleicht hatte er sie ja noch gar nicht richtig gesehen und würde sie nicht wiedererkennen und ihrer bereits beeindruckenden Sammlung nicht noch einen Schandfleck mehr hinzufügen.
»Miss?«
Engel knurrten auch nicht, oder? Sie spähte zu ihm hinüber. Und ganz bestimmt besaßen sie keine leuchtend blauen Augen, die einen Menschen mit zornigen Blicken durchbohrten.
»Was um Himmels willen haben Sie sich dabei gedacht?«, schimpfte er überhaupt nicht engelhaft und stand ebenfalls auf.
Sie schrak zurück, kläglich wie ein Kaninchen, fort von dem trüben Schimmer der Laterne. »D…danke.« Ihre Stimme war zu leise, sie drang nicht durch das Tosen des Winds. Sie versuchte es noch einmal, etwas lauter: »Danke.«
Der Mann stand jetzt aufrecht und tat einen Schritt auf sie zu. Er hatte rotblondes Haar und war sehr viel größer, als sie anfangs hatte erkennen können. »Danke? Mehr haben Sie nicht zu sagen?« Was konnte sie denn noch sagen?
»Was um alles in der Welt haben Sie da getan?«
Sie trat zurück und hob das Kinn. »Danke, dass Sie mich gerettet haben«, jetzt war ihre Stimme eindeutig zu hoch und zu quiekend, »aber ich glaube nicht, dass ich Ihnen etwas so Persönliches sagen muss.«
»Etwas so Persönliches? Miss, wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass ich Ihnen gerade das Leben gerettet habe? Sie hätten sterben können. Ich hätte sterben können. Was war das für ein törichtes Spiel, das Sie da gespielt haben?«
Clara zog den Mantel enger um sich. Schauder krochen ihr den Rücken hinunter. Wie konnte sie ihm den Augenblick des Wahnsinns erklären? Es war kein Spiel gewesen; es war um Leben und Tod gegangen. Tränen traten ihr in die Augen. Gott sei Dank verbarg die Kapuze ihr Gesicht. Höchstwahrscheinlich würde er sie nicht wiedererkennen.
Er betrachtete sie einen Moment. Sein helles Haar leuchtete im launischen Mondlicht, die harten Konturen seines Gesichts wurden weicher. »Schauen Sie, Miss, es tut mir leid, dass ich Sie erschreckt habe. Aber Sie standen so dicht am Abgrund.« Er schüttelte den Kopf. Sein Stirnrunzeln kehrte zurück. »Was tun Sie überhaupt hier um diese nachtschlafende Zeit?«
Sie schüttelte ebenfalls den Kopf und trat einen Schritt zurück auf den Weg, weg vom Rand der Klippe.
Er schnaubte. »Einen Liebhaber treffen oder was?«
Wieder lachte sie hart und kurz auf. Es klang wie das Krächzen eines sterbenden Vogels. Wenn er wüsste! Er gehörte ganz offensichtlich nicht zur feinen Gesellschaft, sonst hätte er sie mit Sicherheit erkannt und mit ebensolcher Sicherheit gewusst, wie unwahrscheinlich das war. Sie schüttelte wieder den Kopf.
»Nein?« Er zog die Brauen hoch und sah sie neugierig an.
Clara trat abermals einen Schritt zurück. Sie hatte den Eindruck, wenn sie floh, würde er ihr nachsetzen, doch wenn sie noch etwas sagte, würde sie nicht unerkannt bleiben können. Wenn sie es schaffte, nach Hause zurückzugelangen, ohne dass eine dieser beiden Möglichkeiten eintrat, hatte sie eine Chance, ins Bett zu schlüpfen und so zu tun, als sei das Ganze ein Albtraum gewesen, den sie niemals wieder träumen würde.
»Haben Sie immer noch nichts zu sagen?« Er lachte. Es klang überraschend freundlich. »Hören Sie, sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen. Oder wo Sie leben. Es muss doch irgendwo irgendjemanden geben, der sich um Sie sorgt.«
Jemand, der sich um sie sorgte? Kummer stieg in ihr auf, so sicher und nie endend wie die Wellen da unten, die gegen die Felsen schlugen.
»Schauen Sie, Miss, ich verstehe ja, dass es Ihnen peinlich ist, aber ich verspreche Ihnen, Ihren Eltern nichts zu sagen.« Er machte eine kurze Pause. »Sie haben doch Eltern, oder nicht?«
Sie trat noch einen Schritt zurück. Er folgte ihr. Was für ein bizarrer Klippentanz im Mondlicht, den die Engel heute Nacht zu sehen bekamen. Die Engel, die ganz eindeutig nicht herabgestiegen waren, um ihr zu helfen, sondern sich das Schauspiel lieber von oben ansahen, wie die ärmeren Besucher im höchsten Rang des Theaters in Covent Garden. Warum sollte Gott auch Engel schicken, ihr zu helfen? Er sorgte sich mit Sicherheit nicht um sie.
Sie machte noch einen Schritt und noch einen. Als sie weit genug von ihm entfernt zu sein meinte, flüsterte sie ein letztes Dankeswort, drehte sich um und floh in die Dunkelheit.
Hinter sich hörte sie ihn rufen: »Hey!« Doch sie blieb nicht stehen. Sie konnte nicht stehen bleiben. Gott sei Dank konnte ihre Mutter sie nicht sehen. Gott sei Dank konnte Lady Osterley sie nicht sehen. Jegliche Hoffnung, ihren guten Ruf wiederzugewinnen, wäre für immer dahin. Sie raffte ihre Röcke und rannte schneller und schneller, doch plötzlich ließ ein Geräusch sie ruckartig innehalten: ein kurzer Schrei, dann ein dumpfer Aufschlag. Ihr Herz klopfte heftig. Er konnte doch nicht von den Klippen gestürzt sein? Sie drehte sich um und sah eine Gestalt am Boden liegen. Doch wenn sie zurücklief und nachschaute, ob er verletzt war, würde das ihre Flucht gefährden und ihre Chance, unerkannt zu bleiben. Sie lief schneller, keuchend, mit brennenden Lungen. Wenn jemand sie sah, musste er sie für eine Verrückte halten. Sie schluchzte auf. Wer sie kannte, würde dasselbe denken.
Endlich – ihre Lungen drohten zu platzen, sie schmeckte Blut im Mund, ihr Puls dröhnte ihr in den Ohren – sah sie, dass der Weg, den sie die letzten vierzehn Tage täglich gegangen war, in die Straße mündete, die von Brighton nach Rottingdean führte. Jetzt rannte sie nicht mehr, sondern verfiel ins Gehen, während sie sich dem sanften Halbrund fast neuer Häuser näherte, welche die äußersten Ausläufer Brightons bildeten. Natürlich war keins der bescheidenen Reihenhäuser groß genug, um den Ansprüchen ihrer Eltern zu genügen, doch das spielte keine Rolle. Lord und Lady Winpoole empfingen in diesen Tagen ohnehin kaum Besucher. Außerdem war es in der Welt ihrer Familie inzwischen unwichtig geworden, wieweit gewisse Ansprüche befriedigt wurden. Wichtiger war, was sie sich leisten konnten.
Sie hastete an dem zentral gelegenen kleinen Park mit seiner jämmerlichen Statue des Regenten vorbei. Der Künstler hatte sich zweifellos großen Ruhm davon versprochen, doch das Kunstwerk hatte ihm lediglich Verachtung eingetragen. Die Proportionen der Figur waren restlos missraten und inzwischen fehlte ihr sogar der rechte Arm. Die Flüchtende vermied es sorgfältig, die kiesbestreuten Wege zu betreten, und eilte zum Haus Nummer zehn. Zum Glück fiel aus dem Haus ihrer Nachbarn, älterer Leute, kaum Licht. Dann musste sie erst einmal ihren stoßweise gehenden Atem beruhigen, um so geräuschlos wie möglich ins Haus schlüpfen zu können. Sie stieg die Stufe zur Vordertür hinauf, die Gott sei Dank unverschlossen war. Mit einem Drehen des Griffs war sie drin. Einen Augenblick später hatte sie ihre Schuhe in der Hand und schlich die Treppe hinauf, indem sie die achte und neunte Stufe mied, die hässlich knarrten, wenn man darauftrat. Eine Minute später lag sie mit klopfendem Herzen im Bett; ihr pelzbesetzter, modischer Mantel hing zerknittert über einer Stuhllehne, der Überwurf lag als Häufchen auf dem Boden: Die Kleidungsstücke würde sie am Morgen in Ordnung bringen müssen.
Clara schlang einen Arm um ihr Kissen und schmiegte sich in die Wärme. Unten schlug die Uhr Mitternacht.
Sie schloss die Augen. Noch immer hämmerte ihr Herz in ihrer Brust, nicht zuletzt aus Angst vor möglicherweise drohenden Träumen.
»Benjamin Richard Kemsley!« Die Augen seiner Schwester wurden groß.
Ben stolperte mit ausgestreckten Händen zum Kamin. Wenn sie doch nur schneller warm werden würden! Er hatte Tausenden eisiger Nächte auf dem offenen Meer getrotzt, doch noch nie hatte er so gefroren wie heute Nacht. Verstohlen sah er zu seiner Schwester hinüber. Sie starrte ihn mit offenem Mund an.
Matilda klappte ihren Mund mit einem hörbaren Schnappen zu. »Was ist dir nur eingefallen, einfach so in die Kälte hinauszulaufen? Sieh dich doch an! Du siehst aus, als seist du ganz allein Napoleon entgegengetreten!«
Er unterdrückte ein leichtes Bedauern bei dem Gedanken, einen solchen Kampf verpasst zu haben, und nickte Matildas Mann zu. Hochwürden David McPhersons Sanftheit und Milde bildeten das perfekte Gegengewicht zu Matildas übersprudelnder Lebhaftigkeit, einem Charakterzug, den Bens ganze Familie zu besitzen schien.
Ein Geräusch ließ ihn zur Wohnzimmertür blicken, in der ein weiteres Mitglied des Haushalts erschienen war, die junge Tessa. Ihr rotes Haar war verstrubbelt, als sei sie gerade aufgewacht. »Benjie!«
»Warum bist du nicht im Bett, kleine Schwester?«
»Ich habe Geräusche gehört.« Sie runzelte die Stirn. »Und warum bist du nicht im Bett?«
»Weil ich nicht siebzehn bin.« Er wuschelte ihr durchs Haar und lächelte, als sie gegen diesen Beweis seiner Zuneigung protestierte.
»Was ist …« Sie betrachtete ihn genauer, ihre blauen Augen wurden groß. »Um Himmels willen!«
Sein Lächeln erlosch, als ihm die Ereignisse von vorhin wieder einfielen. Ja, er hatte heute Nacht die Stimme des Himmels gehört, die ihn hinausgerufen hatte. »Genau das.«
»Was ist passiert?« Matilda bedeutete ihm, sich zu setzen, und reichte ihm eine Tasse dampfenden Tee. »Wir haben uns Sorgen um dich gemacht.«
»Ich …« Er konnte es nicht erklären. Wie sollte er ihnen beschreiben, dass er plötzlich den Drang empfunden hatte, zur Felskuppe zu gehen, obwohl draußen beinahe Sturm herrschte? Unmöglich. »Ich musste ein Stückchen gehen.«
»Heute Nacht?«
Er nickte seiner Schwester zu und wechselte dabei einen raschen Blick mit dem Pfarrer. Vielleicht konnte er mit seinem Schwager über seinen Verdacht reden, aber das war nicht möglich, solange Tessa im Zimmer war.
Matilda machte ein ernstes Gesicht. Dann sagte sie leise etwas zu Tessa. Was es auch gewesen sein mochte, Tessa umarmte ihn und flüsterte: »Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist.« Dann verließ sie das Zimmer.
Blieb noch seine andere, nicht so leicht zufriedenzustellende Schwester. Sie zog die Brauen hoch. »Nun?«
Er zuckte die Achseln. »Ich hatte mir Tessas Fernrohr geholt und habe ein Licht gesehen.«
»Ein Licht?« Sie seufzte. »Soll das heißen, du warst mal wieder unterwegs, um die Welt zu retten?«
»Schon gut. Das will ich gar nicht.«
Sie schnaubte, aber es klang mehr wie ein Lachen. »Warum glaubst du nur immer, alles und jeden retten zu müssen. Ich werde das nie verstehen!«
»Mattie«, sagte ihr Mann leise.
Ben sah sie ruhig an. Hundert erbarmungslose Erinnerungsbilder stiegen in seiner Seele auf: der Himmel über Afrika, verzweifelte Kinder, haiverseuchte Gewässer, ein nicht gerettetes Leben.
Sie war rot geworden. »Stimmt doch!« Sie schüttelte den Kopf. »Mein Bruder, der Retter.«
»Nicht immer«, murmelte er. Seine Stimme klang belegt von Gefühlen. Er räusperte sich. »Ich habe ein Licht auf den Klippen gesehen.«
»Was? Bei dem Wetter war jemand da draußen?«
»Jawohl.«
»Wer war es? Jemand, den wir kennen?«
Er warf einen Seitenblick zu David hinüber, dann sah er in die blauen Augen seiner Schwester. »Ich kenne ja meinen neuen Schwager kaum, ganz zu schweigen von den vielen Leuten, mit denen du bekannt bist, liebe Schwester.«
Die Röte, die ihr Gesicht angenommen hatte, vertiefte sich, doch ihr Blick ließ ihn nicht los. »Was meinst du, warum war derjenige dort?«
»Ich weiß es nicht.«
Er dachte an das Mädchen. Er hatte einen Verdacht. Eine solche Handlung wäre jedoch so drastisch, dass er den Gedanken kaum zu denken, geschweige denn ihn laut auszusprechen wagte. Was brachte einen Menschen dazu, alle Hoffnung fahren zu lassen, Gottes Gesetze zu missachten und die Ewigkeit aufs Spiel zu setzen?
Der Schmerz, der schon die ganze Zeit an seinem Herzen nagte, wurde stärker. Er hatte gesehen, wie Männer aufgaben, Männer im Krieg, Männer, die ins Meer geschleudert worden waren, Männer, die keine Kraft mehr hatten, wenn Schmerzen oder schwere Wunden ihnen das Leben aussaugten. Aber er hatte nie jemanden aufgeben sehen, der gesund war. Nach der Schnelligkeit zu urteilen, mit der sie davongestürzt war, und nach der Kraft, die er gespürte hatte, als er sie vom Rand der Klippe zog, war dieses Mädchen ganz bestimmt gesund.
»Ben?«
Er blickte in Matties besorgtes Gesicht. Diese Besorgtheit nahm er schon all die Wochen seit seiner Rückkehr aus den Gewässern vor Cape St. Francis bei ihr wahr. Er versuchte, seinem Gesicht einen heiteren Ausdruck zu verleihen, und zwang sich zu lächeln. »Was muss man hier tun, um noch eine Tasse Tee zu bekommen?«
Mattie sah ihn still an. Dann stand sie auf und verließ das Zimmer.
Das Feuer knackte und spendete köstliche Wärme. Draußen heulte der Wind. Er presste die Lippen zusammen. Sein Knie klopfte noch immer vor Schmerz. Die Abwesenheit seiner Schwester mochte ein wenig Stille im Raum bringen, doch die Fragen in seinem Herzen schwiegen auch jetzt nicht. Warum hatte Gott ihn am Leben gelassen? Wegen Nächten wie dieser, in denen er vielleicht etwas Sinnvolles getan hatte?
Matilda kehrte mit einer frischen Kanne Tee und einer Tasse zurück. Sie schenkte ihm ein, er bedankte sich leise. Dann setzte sie sich wieder hin. »Hast du dich verletzt?« Sie nickte zu seinem schmutzverschmierten Bein hinunter. »Der Arzt hat dir doch gesagt, du sollst vorsichtig sein und nicht alles wieder schlimmer machen.«
Zu spät. Er versuchte, ihre Sorgen mit einem möglichst echt klingenden Lachen zu zerstreuen. »Du machst dir zu viele Gedanken, Mattie.« Er wandte sich an seinen Schwager: »Du wirst bald feststellen, dass meine Schwester dazu neigt, die Gabe des Mitgefühls, die sie besitzt, etwas überzustrapazieren.«
»Einer der Gründe, warum ich sie so liebe.«
Ben lächelte und hörte voll Freude das leise Aufseufzen seiner Schwester. Das Rot auf ihren Wangen hatte sich wieder vertieft. »Du machst dich nicht schlecht in deiner Rolle als Ehemann«, sagte er zu seinem Schwager und erhielt ein Grinsen und ein mildes »Das hoffe ich« zur Antwort.
Mattie setzte klirrend ihre Tasse ab. »Du weißt also nicht, wer es war?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nur, dass sie die Laterne stehen gelassen hat.« Er deutete auf die kleine Zinnlaterne auf dem Tisch neben der Tür.
»Sie?« Seine Schwester wechselte einen Blick mit ihrem Mann. »Benjie hat noch nie widerstehen können, wenn es darum ging, einem hübschen Mädchen in Not zu helfen.«
Sein Lächeln erstarb, als sie den lang vertrauten, oft belächelten Kosenamen gebrauchte. »Sie war nicht hübsch.« Das mochte gelogen sein, doch er hatte ihre Züge kaum erkennen können; sie hatten im Schatten der dunklen Kapuze gelegen. Er wusste nur, dass sie rabenschwarzes Haar hatte und eine hohe Stimme, die vermuten ließ, dass sie jünger war, als ihre Erscheinung und ihr Auftreten ahnen ließen.
Matilda lachte leise. »Vielleicht entpuppt sie sich ja als wunderschöne Prinzessin.«
»Das bezweifle ich.«
»Wie schade«, sagte Mattie. »Nun, jedenfalls brauchst du eine Frau. Vielleicht sollten wir diese geheimnisvolle Dame finden und ihr Geheimnis lüften.«
Er schob seinen Stuhl zurück und zwang sich aufzustehen, ohne zu stöhnen. Das arme Geschöpf, das er heute Nacht kaum richtig hatte wahrnehmen können, sollte sein Geheimnis preisgeben? »Viel Glück dabei.«
»Wir brauchen kein Glück dazu«, antwortete Mattie mit einem entschlossenen Glimmen in den Augen. »Wir brauchen nur Gottes Hilfe.«
Er nickte, sagte Gute Nacht und verließ das Zimmer, um die Treppe in seine Schlafkammer hinaufzusteigen. Sein Herz war schwer. Die Erfahrung sagte ihm, dass Matilda nicht ruhen würde, bis die geheimnisvolle Dame gefunden war.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 2
Das Klopfen drang in ihre Träume. Es waren wilde, erschreckende Träume. Träume vom Fallen und Stürzen, tief hinunter auf sich gierig emporreckende Felsen. Clara erwachte mit einem Keuchen, nach Luft ringend, und versuchte im selben Moment, sich zu beruhigen, da nach einem kurzen zweiten Klopfen sogleich das Mädchen eintrat.
»Verzeihung, Miss, aber die gnädige Frau wünscht Sie unten zu sehen.«
Sie blickte zum Fenster. Durch die Vorhänge drang helles Sonnenlicht. »Wie spät ist es?«
»Fast Mittag, Miss.«
Sie setzte sich hastig auf. »Ich hatte keine Ahnung, dass es schon so spät ist.«
»Sie haben heute den Gottesdienst verpasst.«
Sie verpassten den Gottesdienst an den meisten Sonntagen. Warum sollte es heute anders sein?
Meg stand noch immer in der Tür, offensichtlich unsicher, was von ihr erwartet wurde. Clara unterdrückte einen Anflug von Ärger. Wenn sie doch nur wieder eine richtige Zofe hätte, eine, die wartete, bis sie zum Eintreten aufgefordert wurde, eine, die frisieren und den Mund halten konnte.
Meg ging halbherzig einen Schritt auf den Stuhl zu, über dem der Mantel hing.
»Lass ihn bitte liegen. Ich kümmere mich später darum.«
»Ganz sicher, Miss?«
»Natürlich bin ich sicher.«
Der beschämte Gesichtsausdruck des jungen Mädchens ließ sie ihre Schroffheit sogleich bereuen, doch Meg wandte sich um und verließ das Zimmer, bevor Clara sich entschuldigen konnte. Seufzend schlug sie die Bettdecke zurück, trat ans Fenster und zog die Vorhänge auf. Dabei starrten sie die Zeugen ihres nächtlichen Ausflugs vorwurfsvoll an: der feuchte Überwurf, die schlammverkrusteten Stiefelchen. Sie hob den Überwurf auf und schüttelte ihn aus, um die schlimmsten Falten zu entfernen. Meg würde es Mutter sagen, wenn sie ihr Kleidungsstücke zum Reinigen gab, ohne ihr einen Grund zu nennen. Und Clara hatte seit Tagen keinen Grund gehabt, diesen Überwurf zu tragen. Jedenfalls keinen, den sie ihrer Mutter nennen konnte.
Sie zog ein schlichtes Morgenkleid an, dann ging sie zur Frisierkommode und versuchte, ihr Haar in Ordnung zu bringen. Doch so heftig sie auch bürstete, die dunklen Locken wollten sich nicht fügen. Wieder wünschte sie sich sehnlichst eine richtige Zofe, unterdrückte den Wunsch jedoch sogleich wieder. Solange sie nicht sicher sein konnten, sich mit dem Lohn auch das Schweigen der Dienerschaft zu erkaufen, hatte Vater beschlossen, keine zusätzlichen Leute einzustellen. Die wenigen, die sie im Moment hatten, dienten der Familie schon seit Jahren und hielten, wenn nicht aus Treue, so doch aus Gewohnheit, den Mund.
Das holzgerahmte Oval zeigte ihr Spiegelbild: strähniges Haar, zu blasse Haut, hellgrüne Augen mit tiefen Schatten darunter. Ihre Nase und ihre Wimpern waren ansehnlich, aber ihr Kinn wirkte in letzter Zeit zu spitz. Und was war das für ein Fleck? Sie sah genauer hin, verdrehte den Hals, um ihr Kinn besser sehen zu können, und stöhnte auf. Tatsächlich, da war ein Pickel. Aber warum sollte sie das stören, wenn es doch niemand anderen scherte?
Tränen traten ihr in die Augen. Ihr Schultern sackten nach vorn. Wie hatte das alles nur geschehen können? Wie kam es, dass sie, die Königin der Londoner Ballsäle, im winzigen Schlafzimmer eines hässlichen Hauses in einem Möchtegernbadeort saß und sich wegen eines Pickels aufregte?
Es war unwichtig. Alles war unwichtig. Auch sie selbst. Ihr Wert für ihre Eltern bemaß sich einzig und allein danach, ob sie eine gute Partie machte. Und da es ihr nicht gelungen war, den Grafen von Hawkesbury an Land zu ziehen, wie sie es sich so sehr gewünscht hatten – und wie sie selbst es sich erträumt hatte –, hatten sich ihre Heiratschancen trotz aller zunehmend verzweifelter Bemühungen ihrer Eltern, sie unter die Haube zu bringen, immer mehr verschlechtert. Sowohl die Quantität als auch die Qualität der infrage kommenden Kandidaten hatte stark abgenommen. Gott wusste – alle Welt wusste –, dass sie mit fünfundzwanzig unweigerlich eine alte Jungfer war. Irgendwann mussten das doch auch ihre Eltern akzeptieren!
Sie schüttelte den Kopf über ihre dummen Gedanken und blinzelte die Tränen fort. Aufgeben kam im Wortschatz ihrer Eltern nicht vor. Mutter schien wahrhaftig immer noch zu glauben, der Graf käme wieder »zur Vernunft«, wie sie zu sagen pflegte, und würde sich von seiner Frau scheiden lassen und Clara heiraten. Dabei konnte doch jeder Narr sehen, wie sehr er Lavinia, die Gräfin von Hawkesbury, verehrte. Das war schon an der tiefen Zuneigung ersichtlich, mit der er sie ansah, was er bei Clara nie getan hatte. Doch Mutter ließ sich nicht beirren. So waren die Winpooles eben. Auch was Richard betraf, hatten weder ihre Mutter noch ihr Vater je die Hoffnung aufgegeben.
»Miss?«
Meg unterbrach erneut ihre Tagträume. Sie schob ihre Erinnerungen beiseite, vermied es, einen weiteren Blick in den Spiegel zu werfen, und ging nach unten in das Zimmer, das als Wohn- und Frühstückszimmer diente.
»Stimmt etwas nicht, Clara?«, fragte Mutter sie mit gerunzelter Stirn. »Du warst doch noch nie eine Langschläferin.«
»Nein, ich bin nur ein wenig müde.«
»Müde?«, sagte Vater und faltete stirnrunzelnd seine Zeitung zusammen. »Du hast doch seit Tagen kaum das Haus verlassen.«
Außer nachts.
»Warum solltest du also müde sein?«
»Ach, lass sie doch, Philip«, meinte Mutter. »Alle jungen Damen sind manchmal ein bisschen unpässlich.«
»Ja, aber so geht das nun schon seit Monaten.« Seine dunklen Augen fixierten sie. Clara meinte sogar, eine Spur Mitleid darin zu entdecken. »Ich überlege nur, ob irgendetwas dafürspricht, dich für eine weitere Saison nach London gehen zu lassen.«
Eine Saison?
»Die letzten – ich weiß gar nicht mehr, wie viele es insgesamt waren – waren jedenfalls eine Enttäuschung. Gibt es denn heutzutage gar keine jungen Männer mehr, die ihre Pflicht kennen?«
»Wenn doch nur Hawkesbury …«
»Es reicht, Frederica! Ich will nichts mehr davon hören! Geschehen ist geschehen und kann nicht ungeschehen gemacht werden, deshalb wünsche ich, dass du mit diesem absurden Unsinn aufhörst und den armen Mann in Ruhe lässt.«
»Den armen Mann? Nach allem, was er unserem kleinen Mädchen angetan hat?«
Wieder zitterte sie vor Scham, während ihre Eltern den vertrauten Disput fortsetzten. Wie hatte sie nur so naiv sein können zu glauben, dass der Graf etwas für sie empfand? Sie hatte sich von einer Welle des Gefühls forttragen lassen, geschickt unterstützt von ihrer und seiner Mutter, der Gräfinwitwe. Diese konnte Lavinias zum Teil gesellschaftlich einflussreichen Verwandten nicht vergeben, dass sie vor langer Zeit Verleumdungen über die Hawkesburys in die Welt gesetzt hatten. Die Tatsache, dass ihr Sohn eine Frau heiratete, welche die Gräfinwitwe seit jeher verabscheute, hatte die Ehe stark belastet, wovon Clara sich mit eigenen Augen hatte überzeugen können. Ebendas war auch der Grund, warum ihre Mutter noch immer Hoffnungen hegte. Doch Clara konnte ihren Optimismus inzwischen nicht mehr teilen und wollte es auch gar nicht. Der Empfang, den die Frau des Grafen ihnen letztes Jahr hatte zuteilwerden lassen, hatte etwas ungemein Rührendes gehabt; ihre Anmut und Güte in einer für sie selbst so schweren Zeit waren ebenso unleugbar wie beunruhigend gewesen. Clara war noch nicht so weit, ihm Glück zu wünschen, doch sie wünschte den beiden auch nichts Böses mehr.
»Und – was sagst du dazu?«
Sie sah zwischen ihren Eltern hin und her. Was hatten sie gerade gesagt? »Bitte?«
Vater hustete. »Es hat wohl wenig Sinn, dich noch einmal hinzuschicken, wenn du nicht einmal zuhörst, wenn jemand spricht. Du musst dir wirklich mehr Mühe geben, interessiert zu wirken, meine Liebe, wenn du dir einen Mann angeln willst.«
»Ja, Vater.« Sie sahen sie noch immer erwartungsvoll an. »Oh, ich möchte wirklich gern wieder nach London.« Hoffnung stieg in ihr auf. Vielleicht wäre eine ihrer alten Freundinnen jetzt wieder gewillt, sie zu empfangen. Alles war besser als die tödliche Langeweile von Brighton. Für Leute, die genügend Mittel und Freunde hatten, mochte es eine wunderbare Spielwiese sein, doch wer keines von beidem besaß, befand sich hier auf einem einsamen Außenposten.
»Wir werden nur ein paar Wochen bleiben können. Und ich fürchte, wir werden auch nicht jede wichtige gesellschaftliche Veranstaltung besuchen können«, sagte Mutter mit einem Seufzen und einem Seitenblick auf Vater. »Die Kosten, du weißt ja.«
Und der Mangel an Einladungen. Ihre Finger verkrampften sich. Wie lange musste sie noch für die Sünden ihres Bruders bezahlen?
»Egal«, fuhr Vater fort. »An den wirklich wichtigen wird sie teilnehmen können. Aber ich will, dass du diese düstere Stimmung ablegst und dein Strahlen wiederfindest. Männer mögen kein mürrisches Gesicht, mein Mädchen.«
Männer mochten sie sowieso nicht, auch wenn sie nicht so verbittert wäre. Doch sie zwang folgsam ein Lächeln auf ihre Lippen. »Natürlich nicht.«
»Da! Das will ich sehen! Jetzt sei nur noch glücklich und alles wird gut. Du wirst schon sehen.«
Sie wahrte ihre Maske und lächelte. Nun gut, wenn Vater wollte, dass sie sich einen Mann angelte und die Reihen der alten Jungfern verließ, an ihr sollte es nicht liegen. Sie würde die beste Schauspielerin sein, die er je gesehen hatte.
Die Orgelmusik begleitete sie auf dem Weg aus der Kirche hinaus in den Sonnenschein. David, der noch seinen Talar trug, grüßte jedes Gemeindemitglied mit derselben Wärme und Offenheit. Tessa ließ Bens Arm los und ging zu ein paar jungen Frauen hinüber, um mit ihnen zu reden. Das heitere Plaudern, das bald darauf zu vernehmen war, ließ auf alte Freundschaften schließen. Ben beobachtete unterdessen die Leute. Er war froh, endlich Gelegenheit zu haben, sich die Anwesenden genauer anzusehen. Doch die Dame, die letzte Nacht seine Träume heimgesucht hatte, entdeckte er nirgends.
Dabei gab es keinen Mangel an jungen Damen, was zweifellos an Matildas gewinnender Art und ihrer einwandfreien Herkunft lag. Aber es war keine junge Dame mit rabenschwarzem Haar und blitzenden Augen darunter. Allerdings war eine Predigt über das dritte Buch Mose eher dazu geeignet, den Blick zu trüben, als ihn funkeln zu lassen, ungeachtet des Alters oder Geschlechts der Schäfchen. Ben schätzte seinen Schwager wirklich, doch die staubtrockene Predigt, die er heute gehalten hatte, hatte ihm nicht zugesagt.
»Hast du sie entdeckt?«
Er blickte auf Matilda herunter, die sich lebhaft umsah. »Wen entdeckt?«
»Deine geheimnisvolle Lady natürlich. Tu nicht so, als ob du nicht Ausschau nach ihr halten würdest.«
»Nein, habe ich nicht.«
»Hm. Vielleicht geht sie in der Chapel Royal zum Gottesdienst. Nächstes Mal kannst du es ja dort probieren.«
»Natürlich gehe ich da nicht hin, Mattie. Ich besuche den Gottesdienst, den mein Schwager hält.« Auch wenn die Predigten nicht nach seinem Geschmack waren. Er blickte zu ihr herunter und sah die Belustigung in ihren Augen.
»Ich rede mal mit ihm über die Predigten. Er glaubt, er müsse die Themen wählen, die der Bischof vorschreibt, aber wenn er das beibehält, werden die Kirchenbänke sich schneller leeren als eine Flasche Rum.«
Er lachte auf. »Ich weiß nicht, ob David solche freimütigen Ansichten zu schätzen weiß.«
»Nun, ich weiß jedenfalls, dass der Bischof es nicht schätzen wird, wenn seine Einnahmen sinken.« Sie sah ihn an; ihr Blick wanderte zu seinem linken Bein. »Wie geht es heute? Du schienst mir auf dem Weg hierher ein bisschen zu hinken.«
Er unterdrückte ein Seufzen. Sie merkte aber auch alles! »Es geht.«
»Aber nicht, wie es sollte. Solltest du nicht besser nachschauen lassen?«
»Mattie, ich sage doch, mein Knie ist in Ordnung. Es geht mir gut.«
»Nein, tut es nicht«, sagte sie unverblümt. »Wenn du doch nur einen Funken Verstand hättest und zu deinem Londoner Arzt gehen würdest! Du willst doch kein Krüppel werden, noch bevor du dreißig bist.«
Er war ein Krüppel, obwohl er noch keine dreißig war. Mattie wollte es nur nicht wahrhaben. »Geh mal zu der alten Dame da drüben. Sie sieht aus, als wüsste sie deine Ratschläge zu schätzen.«
Sie schnaubte und ging. Er blieb, wo er war, nickte den Leuten zu, die seinen Blick auffingen, und sprach mit denen, die sich trauten, mit ihm zu reden. Eigentlich hatte er gedacht, letzten Sonntag genug über seine Zeit in Afrika erzählt zu haben, doch offenbar nicht genug für manche Männer, die unbedingt noch mehr wissen wollten. Irgendwann gelang es ihm endlich, die Rede auf Napoleons jüngste Taten zu bringen.
Tessa kam zurück. Die Gemeinde löste sich allmählich auf und sie gingen zusammen über den Friedhofsrasen, der übersät war mit Glockenblumen und den ersten Butterblumen. Welch ein Kontrast zu den wilden, unbewohnten Küsten Afrikas, wo sein verzweifelter Marsch nur durch die sparsam wachsenden, robusten, kleinen weißen Blumen etwas erträglicher wurde, die ihn an winzige Gänseblümchen erinnerten. Er schüttelte die Erinnerungen ab und antwortete, wie es von ihm erwartet wurde, auf Tessas Bemerkungen über das Wetter, das sich doch sehr gebessert hatte.
Sie kamen am weitläufigen Wohnsitz des Gemeindepfarrers vorüber, der zurzeit leer stand, weil der Pfarrer sich für längere Zeit in Irland aufhielt. David hatte seine Stellvertretung inne. Das kleine, sehr viel bescheidenere Haus für den Vikar lag ein Stück weiter an derselben Straße. Auf dem Weg den Hügel hinauf fing sein Knie wieder an zu schmerzen. Er biss die Zähne zusammen. Wenn Davids und Matties Cottage nicht einen so wunderbaren Blick aufs Meer und die Klippen bis nach Rottingdean hätte, hätte er sich wohl eine Unterkunft gesucht, die für ihn leichter zu erreichen war. Nicht dass er es sich hätte leisten können oder – er grinste innerlich – dass Mattie es ihm erlaubt hätte. An der Türschwelle stolperte er und war froh, dass seine Schwestern so sehr in ihr Gespräch vertieft waren, dass es ihnen nicht auffiel. Nur David warf ihm einen Blick zu. Ben schüttelte angesichts der unausgesprochenen Frage seines Schwagers nur den Kopf und ließ sich aufs Sofa fallen, von dem aus er auf das schimmernde Meer hinaussehen konnte.
Das spiegelglatte Wasser schimmerte im Sonnenlicht. Welch ein Gegensatz zu den tosenden Wellen in der letzten Nacht! Er dachte daran, was Matilda vorhin gesagt hatte, und versuchte, das Pochen in seinem Knie zu verdrängen. Vielleicht sollte er doch noch einmal Dr. Townsend aufsuchen. Bei der Gelegenheit konnte er auch gleich Burford und Lancaster besuchen. Er konnte sie ja mal anschreiben und fragen, was sie von einem Besuch hielten. Ja, vielleicht war eine kleine Reise nach London doch gar keine so schlechte Idee.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 3
Zwei Tage später
Clara ging den knappen Kilometer die Marine Parade entlang zu Fuß. Sie war froh, Mutters ewiger Besorgnis entkommen zu sein, mit der jeder Raum wie mit einer schweren, dunklen Tapete ausgekleidet schien, wodurch ihr Haus sich noch winziger und beengter anfühlte, als es sowieso schon war. Sie wanderte nicht mehr auf die Klippen hinaus. Es machte ihr keine Freude mehr. Was, wenn der Mann zurückkam und sie wiedererkannte? Sie schauderte. Und dann? Und wenn sie ihn erkannte? Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, damit ihre Begleiterin nichts merkte.
Megs schlaffes, teigiges Gesicht wirkte so gleichgültig wie immer. Sie war mitgekommen, um ein paar Besorgungen zu machen, und fungierte gleichzeitig als Anstandsdame. Nicht dass Clara eine Anstandsdame benötigt hätte. Mit fünfundzwanzig brauchte sie sich über Fragen der Schicklichkeit keine Gedanken mehr zu machen. Doch Mutter tat es nach wie vor und Clara stritt nicht mit ihr.
Clara blieb an dem eisernen Geländer stehen, nicht zu dicht an den Badehäuschen, und wechselte die schwere Büchertasche in die andere Hand. Der leichte Wind, der zu Brighton dazuzugehören schien, hatte offenbar einen Anfall von schlechter Laune; er kam plötzlich in kleinen, wütenden Stößen, als wollte er die Fußgänger daran erinnern, wozu er fähig war. Sie atmete tief die salzige Luft ein. Sie war kühl und belebend. Man konnte verstehen, warum Dr. Russell seinen Patienten so lebhaft die Vorteile eines Aufenthalts an der Küste empfohlen hatte. Sie fühlte sich schon besser – irgendwie reiner –, wenn sie nur die frische Seeluft einatmete. Es fühlte sich an, als würden die Spinnweben aus ihrer Seele fortgeblasen werden.
Aber natürlich war das lächerlich. So hübsch Brighton auch sein mochte, außerhalb der Saison war es einfach nur ein gewöhnliches Fischerdorf. Hier mochte zwar der berühmte Marine Pavillon des Regenten stehen, doch der würde erst in einigen Monaten wieder zu Besuch kommen. Und bis dahin würde sich auch die feine Gesellschaft nicht hier zeigen, die sich in allem nach dem Thronerben richtete, wie Bienen, die um eine Rose summten. Brighton würde also trist und öde bleiben, bis der Regent Londons müde war. Ihr selbst war das im Moment gar nicht so unrecht. Brighton ohne die feine Gesellschaft hatte den Vorteil, dass keiner sie kannte. Es gab kein Gerede, niemanden, der über sie urteilte. Doch Brighton ohne die feine Gesellschaft hatte auch einen Nachteil. Zwar kannte sie keiner, doch umgekehrt kannte auch sie noch keinen Menschen, obwohl sie jetzt schon mehrere Monate hier waren.
Eine Möwe kreiste laut krächzend am Himmel, hoch über einem kleinen Fischerboot, als sähe sie etwas, das für immer unerreichbar für sie war. Plötzlich empfand sie einen Stich, so schmerzhaft, dass sie den Atem anhielt und ihr Tränen in die Augen schossen.
»Miss?«
Sie tauchte aus ihren Tagträumen auf und sah das Mädchen an, dessen Gesichtsausdruck unerträgliche Langeweile verriet. »Ja, Meg?«
»Ich könnte vorausgehen zum Markt, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Nein, natürlich nicht. Ich bringe inzwischen die Bücher zurück zu Donaldson. Es dauert nicht lange.« Sie sah das Mädchen bedeutsam an. »Deine Besorgungen werden wesentlich länger dauern.«
Meg blinzelte. »Ich … äh … natürlich, Miss.«
»Dann wünsche ich dir einen schönen Vormittag. Wir sehen uns zu Hause.«
»Jawohl, Miss.«
Clara eilte davon, bevor dem Mädchen Bedenken kommen konnten. Allein unterwegs zu sein, und sei es auch nur für eine kleine Besorgung, schenkte ihr ein köstliches Gefühl von Freiheit. Sie überquerte die Parade, lief an dem Karren eines Tuchhändlers vorbei, bog in die Manchester Street ein und ging die Steyne entlang bis zur Leihbücherei.
Zu dieser Tageszeit herrschte Ruhe in dem eleganten Gebäude, sodass die Rückgabe sehr viel schneller vonstattenging als zu einer beliebteren Zeit. Sie eilte an der Sitzecke vorbei, wo die Zeitungen auslagen, und hoffte, dass der allzu freundliche Mr Whitlam sie nicht sah. Er war ein korpulenter, gichtgeplagter älterer Herr, der anscheinend auf dem Sofa am Fenster Wurzeln geschlagen und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, jedes Mal wenn sie in die Bücherei kam, mit ihr zu plaudern. Als er aufblickte, duckte sie sich hinter ein großes Bücherregal. Sie mochte einsam sein und vielleicht sehnte sie sich ganz, ganz tief in ihrem Innern sogar nach einem Ehemann, aber so verzweifelt war sie denn doch noch nicht! Dann bog sie um die Ecke und stand vor den Romanen, ihrem – und ihrer Mutter – liebsten Lesestoff. Zwei junge Damen gingen durch die Reihen, die eine blond, die andere ein Rotschopf.
»Ich weiß nicht«, meinte die blonde Dame und betrachtete das Buch, das die Jüngere in der Hand hielt, »ich bin nicht sicher, ob es schicklich ist.« Sie sah auf, fing Claras Blick ein und lächelte. »Guten Morgen.«
Clara neigte den Kopf. »Guten Morgen.« Wie seltsam von dieser Dame, eine Fremde anzusprechen. Sie wandte den Blick ab und konzentrierte sich auf die Regale. Miss Burneys Romane sagten ihr immer zu, aber sie hatte sie schon mehrmals gelesen. Vielleicht konnte Donaldson auch den neuesten noch beschaffen?
»Entschuldigung.«
Clara drehte sich um. Die beiden Damen schauten sie an. Nach den gleichen strahlend blauen Augen und der Ähnlichkeit der Gesichtszüge zu urteilen, schienen sie Schwestern zu sein. Die Rothaarige lächelte etwas zögernder als die andere.
»Ich habe gerade überlegt, ob Sie Waverley kennen? Mein Bruder meinte, es enthielte ein paar sehr anschauliche Schlachtszenen.«
»Nein, ich kenne es nicht, aber ein paar von Walter Scotts Gedichten haben mir sehr gefallen.«
»Oh, ich liebe Marmion«, rief die Blonde. »Es ist mir ganz egal, was die Kritiker sagen. Ich mag beschädigte Helden. Das macht sie so viel glaubwürdiger, finden Sie nicht?«
»Äh …« Wer mochte diese seltsame Dame sein? Und was ihre Ansicht über beschädigte Helden betraf … »Ich … ja, ich nehme es an.«
»Wir wissen nur zu gut, dass Helden beschädigt sein können, nicht wahr, Tessa?«, wandte sie sich an den Rotschopf, in deren leuchtendem Haar Glanzlichter funkelten, als sie nickte. »Manche verstecken ihr gutes Herz hinter dicken Schichten von Humor und Neckereien.«
Clara dachte an den Mann, der sie vor drei Nächten gerettet hatte. »Oder Zorn.«
»Ganz genau! Oh, entschuldigen Sie bitte.« Die Blonde streckte die Hand aus. »Ich bin Mrs McPherson und das ist meine Schwester, Miss Kemsley.«
Clara gab ihnen die Hand. »Miss DeLancey.«
»Nun, Miss DeLancey, ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Kann es sein, dass wir uns schon einmal begegnet sind?«
»Ich, das heißt, meine Familie lebt erst seit einem knappen Jahr in Brighton.«
»Aber das ist ja wunderbar! Meine auch! Na ja, eigentlich erst seit sechs Monaten. Ich bin hierhergezogen, als ich geheiratet habe.« Mrs McPherson lächelte gewinnend. »Davor habe ich bei meinem Bruder in Kent gelebt, wissen Sie.«
Clara nickte leicht benommen, als wüsste sie es wirklich. War sie schon je einem solchen sprühenden Temperamentsbündel von Dame begegnet? Mutter würde einen Anfall bekommen! Und Vater würde Mrs McPherson zweifellos als vulgäres Gewächs bezeichnen. Doch irgendetwas ließ sie stehen bleiben und dieses keineswegs von ihr gewünschte Gespräch fortsetzen. »Ist das der Bruder, der Waverley gelesen hat?«
»George? Nein, ich glaube, er liest leider schon seit Jahren nur noch die Rennberichte. Nein, Benjie ist derjenige, der immer gern gelesen hat, was sich gut trifft, wenn man so viel Zeit auf See verbringt, nicht wahr?«
Benjie? Was für ein seltsamer Name; ein Name für einen Welpen. Er musste noch ziemlich jung sein. Andererseits war es recht altklug, in so jugendlichem Alter schon seine Ansichten über Scotts Romane zum Besten zu geben. Plötzlich wurde sie sich bewusst, dass die beiden Damen sie neugierig ansahen und offensichtlich auf eine Antwort warteten, und sagte: »Ich glaube schon.«
Die Blonde lachte ein warmes Lachen, das eine noch nicht lange zurückliegende Erinnerung wachrief, doch bevor Clara sich klar werden konnte, woran es sie erinnerte, sagte Mrs McPherson: »Also, Miss DeLancey, sollen wir es wagen?«
Sie hatte sich bei ihrer Schwester eingehängt und ging langsam los, sodass Clara ihr folgen musste.
»Was genau wagen?«, fragte Clara.
Mrs McPherson hielt das Buch hoch. »Sollen wir uns die Mühe machen zu prüfen, ob der Roman es wert ist, gelesen zu werden?«
»Nun, wenn er Ihnen nicht gefällt, können Sie ihn ja Ihrem Bruder zum nochmaligen Lesen geben. Vorausgesetzt, er ist nicht in der Schule.«
»Schule?« Die beiden Damen wechselten einen überraschten Blick.
Also war er vielleicht doch schon ein wenig älter? Ach ja, richtig, er war ja auf See. Sie lächelte ironisch. Mrs McPhersons Bruder war nicht der Einzige, der auf See war. Vielleicht hatte Vater recht und sie musste wirklich mehr darauf achten, was andere Leute erzählten. »Das Schöne an einer Leihbücherei ist ja, dass man ein Buch auch ungelesen zurückgeben kann. Also leihen Sie es ruhig aus.«
»Was meinst du, Tessa?«
Die kleine Rothaarige murmelte etwas Zustimmendes.
»Dann wäre das also erledigt.« Mrs McPherson lächelte strahlend, drehte sich um und trat an den Ausleihschalter. Clara blinzelte. Wie waren sie jetzt plötzlich zum Ausleihschalter gelangt? Verzauberte diese außergewöhnliche Frau die Menschen um sich herum?
Als sie fertig war, drehte sie sich wieder zu Clara um. »Miss DeLancey, ich hoffe sehr, dass Sie nun das andere Wagnis eingehen.«
»Welches andere Wagnis?«
»Dass wir Freundinnen werden.«
Vielleicht war es der offene Blick oder das freundliche Lächeln der Schwestern. Vielleicht lag es daran, dass sie das Gefühl hatte, sich diesem eisernen Willen beugen zu müssen. Vielleicht war es der Schmerz der Sehnsucht, den sie vorhin empfunden hatte, oder das leise Ziehen, das sie jetzt empfand. Was auch immer, es gab nur eine Antwort:
»Ja.«
Ben humpelte zum Pfarrhaus zurück. Die Antwort auf den Brief, den er gestern an Dr. Townsend abgeschickt hatte, konnte gar nicht früh genug kommen. Das Pochen in seinem Knie war heute Morgen stärker gewesen und die dumme Idee, eine Strandwanderung zu machen, hatte die Schmerzen noch einmal sehr verschlimmert. Warum machte Gott ihn nicht gesund? Wie für alle Angehörigen seiner Familie, bis auf seinen älteren Bruder, waren die Verheißungen der Bibel für Ben in seinem Leben so wahr wie seit Jahrhunderten. Er wappnete sich gegen die besorgten Fragen, die mit Sicherheit kommen würden, zwang sich, ganz normal zu gehen und zu lächeln, und ließ sich auf den nächsten Stuhl fallen.
»Benjie!«
»Hallo, Matilda. Na, was hast du heute Vormittag gemacht?«
»Ich habe es gerade David erzählt. Tessa und ich waren in der Leihbücherei. Sieh mal, was ich mir mitgebracht habe.« Sie schob ihm Waverley hin.
»Eine gute Wahl, wenn ich mich recht erinnere.«
»Und wir haben jemanden kennengelernt.«
Ben sah seinen Schwager mit hochgezogenen Brauen an. »Müssen wir uns Sorgen machen?«
Mattie lachte und strich ihrem Mann zärtlich über die Hand. »Ich glaube, mit David hat das nichts zu tun, außer vielleicht, was die Rettung ihrer Seele angeht.« Sie wandte sich wieder an Ben: »Aber mit dir …«
Er betrachtete sie stirnrunzelnd. Die Einmischung seiner Schwester in sein nicht existierendes Privatleben war wirklich das Letzte, was er brauchte.
»Sie war so seltsam. Sie hat mich angestarrt wie ein ausgestopftes Tier in Bullocks Museum.«
»Das klingt durchaus nachvollziehbar. Ich nehme an, du hattest dich nicht vorgestellt?«
Sie schnaubte. »Wir sind hier nicht in London. Hier schert man sich nicht um solche Dinge.«
»Du könntest überrascht sein. Nicht jeder schätzt diese Ungezwungenheit.«
»Wie George zum Beispiel.«
George, ihr Bruder, der zum großen Amüsement seiner Geschwister nach seinem kürzlichen Aufstieg in die Baronetswürde, die er von einem entfernten Cousin geerbt hatte, urplötzlich höchsten Wert darauf legte, korrekt angeredet zu werden.
»Sie war sehr nett«, sagte Tessa leise.
»Wer? Ach, die Dame, die ihr kennengelernt habt. Hat sie auch einen Namen?«
»Miss DeLancey.«
Er runzelte die Stirn. Warum meinte er sich an diesen Namen zu erinnern?
»Ben? Was machst du für ein Gesicht? Kennst du sie?«
»Der Name sagt mir etwas«, meinte er. Möglich, dass er ihr irgendwann mal begegnet war, vor langer Zeit, als er noch ein anderer Mann in einer anderen Welt war.
»Vielleicht hast du ja bald die Möglichkeit, es nachzuprüfen. Ich habe sie für Freitag eingeladen.«
»Diesen Freitag?«
»Ja.« Sie hob eine Braue. »Sag jetzt nicht, dass du nicht da bist.«
Er lehnte sich zurück, sein Lächeln wurde echt. »Ganz richtig, ich werde nicht da sein.«
»Aber Benjie! Sie macht so einen netten Eindruck und hat so ein liebes Lächeln.«
»Wie auch immer, ich möchte sie nicht kennenlernen.«
Mattie zog einen Schmollmund. »Wie kannst du nur so ungehobelt sein?«
»Du hast ihr doch hoffentlich nicht gesagt, ich wäre da.«
»Natürlich nicht.«
»Dann sehe ich überhaupt kein Problem. Und überhaupt solltest du dich mit deinen Kuppeleiversuchen lieber auf George konzentrieren. Er braucht weiß Gott jemand, der bereit ist, über seine Arroganz hinwegzusehen.«
Sie lachte, allerdings nur zögernd. »Du musst irgendwann heiraten, Benjie.«
»Eines Tages, Mattie. Vergiss nicht, ich lasse mich nicht zwingen.«
Sie griff nach seinem Arm und drückte ihn sanft. »Ich will doch nur, dass du glücklich bist.«
»Ich bin glücklich.«
Sie zog die Brauen hoch.
Er sah hinüber zu Tessa, die ein ebenso zweifelndes Gesicht wie Mattie machte. Sein Gewissen regte sich. Er war seit seiner Rückkehr nie mehr so glücklich gewesen wie vor jener schicksalhaften letzten Fahrt. Aber er war zufrieden, meistens jedenfalls. Und war Zufriedenheit nicht fast gleichbedeutend mit Glücklichsein?
Matilda seufzte. »Du kannst protestieren, so viel du willst. Mich überzeugst du nicht.«
»Das liegt ganz bei dir.«
»Aber einer Sache bin ich mir sicher.« Sie warf den blonden Kopf zurück. »Ich bin sicher, dass du Miss DeLancey bald begegnen wirst.«
Damit stand sie auf und ging hinaus. Er blieb zurück und wunderte sich über ihre Entschlossenheit. Und da er wusste, dass sie meistens recht hatte, wurde ihm ein bisschen unbehaglich zumute.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Kapitel 4
Am nächsten Tag kam eine an Clara adressierte Nachricht mit einer Einladung zum Tee im Pfarrhaus am kommenden Freitag. Im Pfarrhaus? War Mrs McPherson etwa die Frau eines Geistlichen? Darauf wäre sie im Leben nicht gekommen. Waren denn Geistliche und ihre Frauen nicht durchweg unglaublich bieder und altmodisch? Wer hätte gedacht, dass eine Pfarrersfrau so vorlaut und freundlich sein konnte – und so frivol, dass sie sich sogar für Romane interessierte?
Mutter runzelte die Stirn. »Du wirst hingehen müssen, wenn die Frau des Pfarrers dich eingeladen hat. Aber ich kann es trotzdem nicht gutheißen. Wo hast du sie denn kennengelernt?«
»Bei Donaldson, Mutter.«
»Hm. Vielleicht solltest du nicht mehr an solche Orte gehen, wenn du dort von Gott und der Welt belästigt wirst. Wo war denn Meg?«
»Besorgungen machen, glaube ich.«
»Nun ja«, Mutter tippte auf die Einladung, »ich kann nicht mitkommen. Ich habe für den Tag bereits Lady Osterleys Einladung zum Essen angenommen. Willst du mich wirklich nicht begleiten? Reginald müsste auch dort sein.«
Noch ein Grund, nicht mitzugehen. Der einzige Mensch, der noch mehr Begabung für todlangweilige Gespräche hatte als Lady Osterley, war ihr Sohn. »Vielen Dank, Mutter, aber ich finde, ich muss Mrs McPhersons Einladung annehmen.«
Mutter seufzte. »Ja, du solltest wohl hingehen. Aber nur dieses eine Mal. Ein Besuch müsste genügen, um dich von jeder weiteren Verpflichtung zu entbinden.«
»Danke, Mutter.«
»Trotzdem muss ich mich wundern. Aus welcher Familie stammt sie überhaupt?« Ihre Mutter runzelte schon wieder die Stirn. »McPherson? Ich kenne keine McPhersons, du?«
Clara jetzt schon. Doch sie behielt es für sich und murmelte nur: »Ich glaube, ihr Mädchenname ist Kemsley.«
Vater blickte nachdenklich von seiner Zeitung auf. »Kemsley? Woher kenne ich diesen Namen?«
Noch eine Frage, die sie nicht beantworten konnte.
Sein Stirnrunzeln vertiefte sich. »Ich möchte nicht, dass du dich mit indiskutablen Leuten einlässt. Sie gehören doch zu unserer Schicht, oder? Du bist schließlich die Tochter eines Viscounts. Wir machen uns nicht mit jedem gemein, der uns kennenlernen möchte.«
Wie konnte sie ihm das unerklärliche Ziehen in ihrem Herzen erklären? »Sie sind ganz bestimmt sehr achtbar.« Das war vielleicht ein wenig übertrieben. »Mrs McPherson war überaus freundlich und Miss Kemsley scheint ein liebes, schüchternes Mädchen zu sein.«
»Aber wer hat euch bekannt gemacht?«, fragte Mutter mit hochgezogenen Brauen. »Ich verstehe das überhaupt nicht.«
»Wie du schon sagtest, Mutter, wenn sie die Frau eines Geistlichen ist, wäre es unhöflich abzusagen.« Sie stand entschlossen auf, zwang sich zu lächeln. »Ich werde ihr schreiben und für Freitag zusagen.«
Und bevor noch jemand etwas sagen konnte, floh sie.
Freitag
»Miss DeLancey, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass Sie gekommen sind!«
Clara lächelte und murmelte eine höfliche Antwort. Der Tag hatte sich jetzt schon als Überraschung erwiesen. Das alte Pfarrhaus, obschon von bescheidener Größe und Ausstattung, bot eine großartige Aussicht aufs Meer und die Kreidefelsen. Sie konnte von hier aus beinahe ihr Haus in der Royal Crescent auf der anderen Seite von Brighton sehen. Als Erstes hatte sie Mr McPherson kennengelernt, den Vikar der Sankt-Nicholas-Kirche, der mit seiner verhaltenen Sanftheit einen starken Gegensatz zu seiner lebhaften Frau bot. Er hatte sich jedoch schon bald entschuldigt und etwas von einem Krankenbesuch gemurmelt. Miss Kemsley war zwar schüchtern, hatte aber sehr freundlich geantwortet, als Clara sie nach ihrer Meinung über den ausgeliehenen Roman gefragt hatte. Sie hatte gemeint, er sei doch nicht so erschreckend gewesen, wie ihr Bruder ihn anfangs hingestellt habe.
Clara hatte genickt. »Man kann dem Urteil eines anderen Menschen in diesen Dingen nicht immer trauen, nicht wahr? Wenn jemand ein Werk über alle Maßen lobt, ist man oft enttäuscht, und eine negative Ansicht ist oft ein beinahe sicherer Hinweis, dass der Roman sehr interessant ist. Man muss einander schon sehr ähnlich sein, um sich auf ein Urteil verlassen zu können.«
»Oh, aber ich vertraue Benjie«, sagte Miss Kemsley, »auch wenn er so viel mutiger ist als ich.«
Ihre schwesterliche Liebe zu dem jüngeren Bruder war sehr rührend. Claras Lächeln erlosch. Schade, dass sie ihren eigenen Bruder nicht mehr so hoch schätzen konnte.
Das Gespräch floss überraschend leicht dahin, obwohl Clara damit gerechnet hatte, dass es sich sehr schnell dem Thema des Kirchenbesuchs zuwenden würde. Doch geistliche Themen waren überhaupt nicht berührt worden. Sie sprachen über Romane, Mode und die Attraktionen Londons verglichen mit denen von Brighton; harmlose Gespräche, die überall hätten stattfinden können.
»Sie haben eine herrliche Aussicht«, sagte sie und blickte durch die großen Fenster hinaus.
»Benjie hat mir kürzlich ein Fernrohr geschenkt«, sagte Miss Kemsley. »Möchten Sie es sehen?«
»Ach? Ich dachte, Ihr Bruder sei auf See?«
»Nicht mehr, der Arme.« Der Rotschopf murmelte etwas und lief hinaus, um das Geschenk zu holen.
»Ihr Bruder lebt bei Ihnen?«, fragte Clara.
Mrs McPherson nickte. »Im Moment, ja. Bis er wieder richtig zu Hause angekommen ist. Das Zusammenleben mit unserem ältesten Bruder ist nicht immer ganz einfach.«
Clara musste fragend ausgesehen haben, denn die Pfarrersfrau fuhr fort.
»Unser Vater ist vor einem Weilchen gestorben und George hat einen Titel geerbt. Ich glaube, er hat das Gefühl, er sei jetzt das Oberhaupt der Familie und müsse dieser Aufgabe gerecht werden; deshalb ist er längst keine so gute Gesellschaft mehr wie früher. Außerdem lebt Benjie lieber am Meer, als mit George in Chatham Hall eingesperrt zu sein.«
Clara lächelte ironisch. Solche nicht sehr angenehme Gesellschaft kannte sie nur zu gut.
»Sagen Sie, Miss DeLancey, mögen Sie das Meer? Ich habe bis jetzt noch gar nicht versucht, im Meer zu schwimmen. Mein Mann ist sehr skeptisch, was diese Dinge betrifft, aber es muss sehr belebend sein.«
»Ich fürchte, meine Eltern sind da genauso skeptisch wie Mr McPherson.«
»Wie schade!«
Miss Kemsley kam zurück, einen zylindrischen Gegenstand in der Hand. »Wenn Sie durch das schmale Ende schauen, sehen Sie ganz fantastisch in die Ferne.«
Sie zeigte Clara, wie sie das Rohr halten und die Ringe drehen musste, um die Sicht schärfer zu stellen.
»Wie herrlich!«, rief Clara aus. Sie konnte die Schwimmer sehen, die kleinen Häuschen am Ufer, die Badekarren im Wasser mit den Badenden darin. Und … »Oh!« Ganz rot geworden, ließ sie das Fernglas sinken. »Ich wusste nicht, dass man so gut damit sehen kann.«
»Benjie warnt uns immer, zu genau hinzuschauen. Manches möchte man gar nicht sehen«, meinte Mrs McPherson mit Schalk in den Augen. »Ich hoffe, Sie sind nicht zu schockiert.«
»Ich hätte nicht gedacht, dass ein so beleibter Mensch sich über Wasser halten kann, ganz zu schweigen davon, dass er es für notwendig halten könnte, sich am ganzen Körper dem Wasser auszusetzen.« Clara schauderte; das Bild des dicken nackten Mannes wollte nicht verschwinden.
»Meerwasser trägt sehr gut, hat Benjie uns erzählt. Er sagt, im Meer zu schwimmen, sei ein wunderbares Erlebnis.«
»Ich würde zu gerne einmal im Meer baden«, sagte Miss Kemsley sehnsüchtig. »Würden Sie es nicht auch gern versuchen, Miss DeLancey?«
»Ich …«
»Aber meine Liebste, wir dürfen Miss DeLancey nicht langweilen! Warum erzählst du unserem Gast nicht von deinem Fernrohr?«
»Oh. Ja. Das Fernrohr kann sehr nützlich sein.« Miss Kemsley beugte sich vor. »Vor Kurzem wurde es sogar benutzt, um jemanden zu retten, der in Not war.«
»Wirklich?«
Die kleine Rothaarige nickte. »In der Nacht, in der es so schrecklich gestürmt hat. Ich möchte in so einer Nacht nicht draußen sein. Sie doch auch nicht, oder?«
Clara erstarrte. Nein, das konnte nicht sein. Es musste um die Rettung eines Bootes gehen.
Mrs McPherson lächelte. »Sie brauchen nicht so erschrocken zu sein, liebe Miss DeLancey. Es ist alles gut ausgegangen. Anscheinend wollte die alte Dame sich gar nichts antun.«
»Alte Dame?« Sie atmete erleichtert auf. Sie sprachen also doch von einem anderen Zwischenfall. Obwohl – wie viele Leute, die gerettet werden mussten, waren wohl in einer der stürmischsten Nächte des Frühjahrs unterwegs?
»Ja, auf den Klippen. Armes Ding. Es scheint sehr knapp gewesen zu sein.«
Du lieber Gott! Sie sprachen von ihrem Unfall. Aber wen meinte sie? In welcher Verbindung stand ihr Retter zu den McPhersons? Sie sah sich um. Entdeckte die kleine Laterne, die sie damals vergessen hatte. Ihr wurde übel. Sie musste hier weg, bevor ihr Retter zurückkam. Er hatte vielleicht geglaubt, eine alte Dame gerettet zu haben – sie spürte, wie Empörung in ihr aufstieg: So alt konnte sie doch auch wieder nicht wirken! Aber was, wenn er sie wiedererkannte?
»Miss DeLancey? Geht es Ihnen gut? Es tut mir leid, wenn dieses Gespräch Sie beunruhigt. Heutzutage fechten so viele Menschen schwere innere Kämpfe aus, vor allem jetzt, wo so viele Männer im Krieg fallen. Es wundert einen nicht, wenn manchmal jemand keine andere Möglichkeit sieht, als sich etwas anzutun. Deshalb haben wir hier in Brighton das Seemann-und-Soldaten-Heim gegründet.« Mrs McPherson sah ihre Schwester an. »Tessa, bring das Fernrohr fort. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kanne Tee.«
»Oh, aber ich …« Was konnte sie sagen? Dass sie gehen musste, bevor ihr geheimnisvoller Retter kam und sie womöglich wiedererkannte? Sich wohl bewusst, dass die beiden sie aufmerksam beobachteten, schluckte Clara, dann sagte sie: »Ich muss nach Hause und ich möchte Sie auch nicht zu lange von Ihrer Familie fernhalten.«
»Soll das heißen, Sie wollen den Helden nicht kennenlernen?« Mrs McPhersons Lächeln vertiefte sich. »Die meisten jungen Damen wünschen sich nichts sehnlicher.«
»Ich bin nicht wie die meisten jungen Damen«, platzte Clara heraus.
Mrs McPherson lachte. »Ich wusste, dass ich Sie mag. Keine Sorge, Miss DeLancey. Er ist den ganzen Tag fort.«
Wieder atmete sie erleichtert auf. Das anschließende Gespräch beim Tee ließ sie ihr Unbehagen beinahe gänzlich vergessen. Dann war es wirklich Zeit zu gehen. Clara stand auf, seltsam zögernd. Sie konnte gut verstehen, dass der Bruder der beiden Damen bei ihnen leben wollte. Sie hatte seit Jahren keine so warmherzige, freundliche Atmosphäre mehr erlebt.
»Ich danke Ihnen, Mrs McPherson. Es war sehr schön bei Ihnen.«
»Das freut mich. Ich habe Ihre Gesellschaft ebenfalls genossen. Und bitte, nennen Sie mich doch Matilda, schließlich sind wir ja jetzt Freundinnen.«
»Und ich bin Tessa«, sagte ihre Schwester.
»Sehr erfreut, Matilda. Tessa.« Clara lächelte und streckte die Hand aus. »Ich bin Clara. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.«
Jetzt würde die Einladung zum Gottesdienstbesuch kommen. Doch nein, ein schlichtes Auf Wiedersehen und sie war draußen, schritt durch das Tor und wanderte die Straße zurück zu Donaldson, wo Meg auf sie wartete.
Sie musste unwillkürlich lächeln. Es war so schön gewesen. Die Frau des Pfarrers und ihre Schwester wirkten so ungekünstelt. Wenn Mutter über ihre offene Art hinwegsehen könnte – die Wangen wurden ihr wieder heiß, als ihr der Unfall mit dem Fernrohr einfiel –, würde sie diese Bekanntschaft wahrscheinlich gutheißen.
Chatham Hall. Sie würde Vater fragen, ob er den Ort kannte. So, wie Matilda geredet hatte, klang es, als hätte ihre Familie durchaus gesellschaftlichen Einfluss. Wenn das stimmte, würden ihre Eltern die einzigen Freunde, die sie seit ihrer Ankunft in Brighton vor vielen Monaten gefunden hatte, nicht mehr ablehnen.
Wieder spürte sie das Ziehen in ihrem Herzen. Es war eine drängende Sehnsucht nach Freundschaft. Brighton mochte hübsch sein, doch es war einsam; hier lebten fast nur Alte und Kranke. Dennoch verspürte sie seltsamerweise keine Sehnsucht nach ihren Londoner Freunden, die sie nach der Sache mit Richard plötzlich nicht mehr zu kennen schienen.
Doch diese beiden Frauen, auch wenn es ihnen vielleicht an Kultiviertheit mangelte, besaßen eine Warmherzigkeit, nach der sie sich ganz tief innerlich sehnte. Vielleicht würde es sich lohnen, Vater zu einem Besuch des Gottesdienstes am Sonntag zu überreden.
Ganz in Gedanken versunken, bog sie um eine Ecke und wäre beinahe mit einem stattlichen Herrn zusammengeprallt. »Oh … Verzeihung!«
»Mein Fehler.« Der Mann, dessen gebräuntes Gesicht und breite Schultern an einen Sportler denken ließen, verbeugte sich.
Ihr stockte der Atem. Sie tat einen Schritt zurück.
Das rotblonde Haar verstärkte den Eindruck, dass sie diese Stimme kannte.
Er richtete sich auf und sah sie aufmerksam an, mit Augen so blau wie der Himmel.
Der Mann. Ihr Retter. Der Mensch, der vermutlich ihr Geheimnis kannte und den sie auf gar keinen Fall wiedersehen wollte.
»Entschuldigen Sie mich.«
Sie drehte sich um und lief los, um die Ecke in den rettenden Hafen der Bibliothek, betend, dass er nicht den Mut hatte, ihr zu folgen.