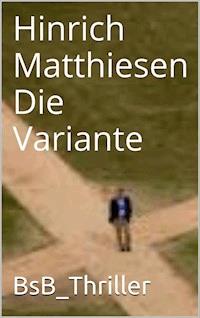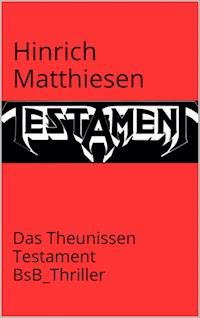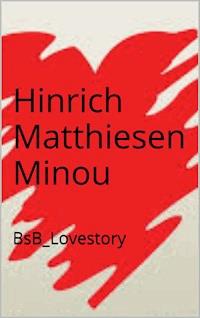Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hinrich Matthiesen Werkausgabe Die Romane
- Sprache: Deutsch
Klaus Hemmerich, Schiffs-Ingenieur auf einem 60.000-t-Tanker, wird aus der Karibik nach Deutschland zurückgerufen. Sein Bruder Victor ist verschwunden. Er hat auf Ibiza ein paar Abschiedsworte hinterlassen, und es gibt Indizien, die für ihre Echtheit sprechen. In dem Brief erzählt Victor von seiner Absicht, aus allen beruflichen und privaten Bindungen auszusteigen und nach einer alternativen Lebensform zu suchen. Doch Klaus Hemmerich hat Zweifel. Er kennt seinen Bruder besser als jeder andere, und er liest aus dem Brief mehr heraus, als da tatsächlich geschrieben steht. Er beschließt, nach Victor zu forschen. Christiane Hagen, Victors ehemalige Frau, begleitet ihn. Die beiden fliegen nach Ibiza, suchen nach dem Verschollenen und decken ein Verbrechen auf. Unkundig im Umgang mit zwielichtigen Naturen, geraten sie in ein Netz, das ihnen fast zum Verhängnis wird… Der Autor des Bestsellers 'Der Skorpion' hat hier einen ganz ungewöhnlich fesselnden Psycho-Thriller vorgelegt, dessen mitreißender Handlung man sich während der Lektüre nicht eine Minute entziehen kann. Handlung und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ibiza ist so schön und friedlich wie eh und je, aber leider gibt es auf unserer Erde keinen Platz mehr, der nicht schon morgen zum Ort des Schreckens werden könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexico. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman: MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal.«
FAZ-Magazin
Werkausgabe Romane Band 9
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Der Roman
Weil sein Bruder Victor spurlos verschwunden ist, wird Klaus Hemmerich, der Schiffsingenieur auf einem Riesentanker von 60000t ist, überraschend aus der Karibik nach Deutschland zurückbeordert. Er findet einen Brief seines Bruders aus Ibiza vor, in dem dieser neben ein paar Abschiedsworten von seiner Absicht berichtet »auszusteigen«, er wolle sich privat wie beruflich »befreien« und alternative Lebenswege beschreiten. Aber zwischen den Zeilen liest Klaus Hemmerich heraus, dass irgendetwas an der Sache nicht stimmt. Er beschließt, mit Christiane Hagen, Victors früherer Frau, nach Ibiza zu fliegen. Auf der Suche nach dem Vermissten geraten die beiden, die vom Umgang mit zwielichtigen Typen nicht die geringste Ahnung haben, auf die Spuren eines Verbrechens, ohne zu ahnen, in welche Gefahr sie sich begeben. Sie verfangen sich in einem Netz, aus dem es scheinbar kein Entrinnen gibt.
Der Autor des Bestsellers »Der Skorpion« hat hier einen ganz ungewöhnlich fesselnden Psycho-Thriller vorgelegt, dessen mitreißender Handlung man sich während der Lektüre nicht eine Minute entziehen kann.
Handlung und Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ibiza ist so schön und friedlich wie eh und je, aber leider auf unserer Erde gibt es keinen Platz, der nicht schon morgen zum Ort des Schreckens werden könnte.
Titelverzeichnis der Werkausgabe in 31 Bänden am Ende des Buches
Hinrich Matthiesen
Die Ibiza-Spur
Roman
:::
BsB_BestSelectBook_Digital Publishers
Werkausgabe Romane
Herausgegeben von Svendine von Loessl
Band 9
1.
Das Ticken unterschied sich nicht von dem der normalen Uhren, wie sie auf den Nachttischen stehen oder an den Wohnzimmerwänden hängen, in den Büros zu finden sind, oder wie Millionen Bürger sie am Handgelenk tragen, aber es hatte einen bösen, einen verhängnisvollen Sinn.
Niemand hörte es. Ein Stahlmantel dämpfte die ohnehin verhaltenen, in kurzen Intervallen ausgesandten Töne, deren Verstummen auf 18.03 Uhr programmiert war, und außerdem gab es dort, wo die kleinen, wispernden Impulse vielleicht aufgefallen wären, zu viel anderes Geräusch, als dass jemand sie hätte heraushören und definieren können. Der Stahlmantel, der das Zählwerk umschloss, war ein acht Zentimeter hoher und ebenso breiter Rahmen, der hufeisenförmig die Trittfläche einer Fahrstuhlkabine begrenzte. Er war in der Mittagsstunde, als die meisten der in dem Gebäude beschäftigten Männer und Frauen zu Tisch gegangen waren, angebracht worden. Doch auch den Stahl sah man nicht, er war überklebt mit dem gleichen dicken, olivfarbenen Velours, mit dem der Kabinenboden bedeckt war. Die Installateure hatten mit der Unaufmerksamkeit oder der Gleichgültigkeit der Fahrstuhlbenutzer gerechnet und sich nicht getäuscht. Viele fuhren in dem Lift schon jahrelang auf und ab, und sie bemerkten die Veränderung dennoch nicht. Andere sahen sie zwar, schwiegen aber oder kommentierten sie nur oberflächlich. Niemand kam auf die Idee nachzufragen, zu welchem Zweck der Kabinenboden plötzlich den sockelartigen Saum bekommen und wer diese Arbeit in Auftrag gegeben hatte. So tickte also, von allen unbemerkt, die Uhr ihrem fatalen Kollaps entgegen, ging dabei ungezählte Male mit dem Vehikel auf und ab, wechselte mit ihm die Etagen, verharrte mal weiter oben, mal weiter unten, und während ihres auf fünfeinhalb Stunden befristeten Einsatzes war ihr, jeweils nur für Bruchteile von Minuten, die Nachbarschaft von wohl im Ganzen vierhundert Füßen beschieden.
Um 17.31 Uhr fuhr eine Frau nach oben. Sie hatte einen Cockerspaniel bei sich. Beide, Frau und Hund, waren mit der Kabine vertraut. Die Frau bemerkte zwar die am Boden vorgenommene Veränderung, dachte aber nur: Wie hübsch! Eine Neugier jedoch, die sie vielleicht zur Frage nach dem Sinn der ungewöhnlichen Neuerung oder auch nur zu deren beiläufiger Erwähnung hatte veranlassen können, kam in ihr nicht auf.
Der Hund schnupperte aufgeregt an der neuen Kante. Vielleicht vernahm er sogar, ausgerüstet mit einem viel sensibleren Gehör als seine Herrin und obendrein dem verborgenen Uhrwerk natürlich ungleich näher, das geheimnisvolle Ticken. Vermutlich aber konnte auch er ein so dickverpacktes Wispern nicht von den Fahrgeräuschen der Kabine trennen, und es war also nur der frische Klebstoff, der ihn in seinen Bann zog. Er lief mehrmals am Sockel entlang, schnupperte, schnaubte, schabte schließlich ziemlich aggressiv mit seinen Krallen über den kleinen Sims, was seine Herrin, die an der Haltbarkeit der Noppen zweifeln mochte, zu einem ärgerlichen »Nein, nein!« veranlasste.
Im sechsten Stockwerk stieg die Frau aus, zog den Hund, der immer noch nicht von dem Sockel lassen wollte, unsanft an der Leine hinter sich her und ging, wiederum über olivgrünen Velours, auf das etwa dreißig Schritte entfernt gelegene Büro ihres Mannes zu. Wie sie es vereinbart hatten, holte sie ihn heute etwas früher ab als sonst. Das war nichts Ungewöhnliches. Die sechste Etage beherbergte die Büroräume der ImmobilienfirmaSOLMARIS, in der man längst zu gleitender Arbeitszeit übergegangen war. Ihr Mann kam ihr schon auf dem Korridor entgegen, und so konnten sie, ohne warten zu müssen, den Fahrstuhl stoppen, als er vom achten Stockwerk zurückkam. Um 17.35 Uhr hatten der Mann, die Frau und der Hund das Gebäude bereits verlassen und waren in den Passantenstrom der Straße eingetaucht.
Um 17.39 Uhr traten in der siebten Etage zwei ältere Herren auf den Fahrstuhl zu. Sie überboten einander in dem Bemühen, sich gegenseitig den Vortritt zu lassen. Aber die Automatik setzte die Türflügel wieder in Bewegung, und daraufhin traten beide zugleich ein, ganz schnell, der eine rechts, der andere links, was das Zugleiten der Türflügel so lange verhinderte, bis beide Herren ihren Platz in der geräumigen Kabine eingenommen hatten. Drinnen gab es Gelächter und dann einen kleinen Dialog über Umgangsformen, die sich bisweilen, wie sie es gerade erlebt hatten, als unzweckmäßig erweisen können. Es war nur ein kurzes Gespräch, wenige Sätze hin und her, denn diesmal glitt die Kabine ohne weiteren Aufenthalt bis nach unten durch. Den neuen Sockel hatten die beiden nicht gesehen, wie er ihnen auch nach der Mittagsstunde, als sie gemeinsam hinauffuhren, nicht aufgefallen war.
Um 17.42 Uhr bestand eine gewisse Chance, dass das geheime Uhrwerk vorzeitig zum Stillstand gebracht würde. Ein einzelner Herr, ebenfalls seit Langem mit dem Gebäude und dessen Fahrstuhl vertraut, warf, als er im Erdgeschoss die Kabine verlassen hatte und durch die Halle auf die Drehtür zuging, dem Pförtner die Bemerkung hin: »Gut gemacht, die Leiste, und vielleicht verhindert sie sogar, dass der Kasten, wie neulich, wegen Überfüllung stehenbleibt!«
Er hatte es sehr eilig, dieser Herr, nahm das letzte seiner Worte sogar mit hinein in die kleine, von den Türblättern in vier Sektoren aufgeteilte Rotunde und hatte, ehe der Pförtner aus seinem Kreuzworträtsel aufgetaucht war, schon den Bürgersteig betreten. Der Hüter des Hauses, eben noch befasst mit germanischem Wurfspieß und altrömischem Gewand, empfand die ihm zugeflogenen Begriffe wie »Leiste« und »Kasten« als Querschläger, die seinen Denkprozess störten, wusste mit ihnen nichts anzufangen, warf dennoch, weil der Herr während seines Zurufs mit einer fahrigen Bewegung hinter sich gewiesen hatte, einen kurzen Blick auf die Fahrstuhlkabine. Da er sich aber nicht bequemte aufzustehen, sondern nur flüchtig über seinen Tresen hinwegsah, bemerkte auch er die kleine bauliche Veränderung nicht, die ihm, gerade ihm und vielleicht nur ihm als dem für solche Auffälligkeiten zuständigen Mann, zu Bedenken hätte Anlass geben können. Zumindest hätte er sich wohl gefragt, wann und durch wen der Einbau des Sockels stattgefunden haben mochte, und dann wäre er vielleicht dahintergekommen, dass etwas Seltsames, ja Mysteriöses im Spiele war. Denn am Morgen, als er seinen Dienst antrat, war er einmal bis in den achten Stock hinauf- und gleich danach wieder heruntergefahren, und da war die Leiste noch nicht vorhanden gewesen. Andererseits hatte er während des ganzen Vor- und Nachmittages niemanden mit einem viereinhalb Meter langen, zweimal geknickten und veloursbeklebten Gegenstand die Halle betreten sehen. Gewiss hätte er nicht gleich den etwa dreißigjährigen Kellner, der während der Mittagsstunde, ein Tablett in der Hand, ins Gebäude gekommen war, mit dem neuen Fahrstuhlzubehör in Verbindung gebracht, hätte schwerlich kombinieren können, dass dieser Mann nur zum Zwecke der Täuschung ein Stück nach oben gefahren, gleich darauf aber über die Treppe wieder heruntergekommen war und dann eine Hintertür des Gebäudes geöffnet hatte, um seinen Komplizen mit dem monströsen Gegenstand ins Haus zu lassen, sodass sie zu zweit in weniger als einer Minute den maßgefertigten Rahmen im Fahrstuhl auslegen konnten. Das alles hätte er, selbst bei schärfstem Verstand und mit einem Maximum an Misstrauen, nicht – zumindest nicht ohne Weiteres – kombinieren können. Doch weil es sonst nichts gab, womit sich die seinem Blick zwar entgangene, aber tatsächlich irgendwann zwischen Morgen und Abend vorgenommene Montage des Sockels hatte erklären lassen, wäre er, bei etwas mehr Beflissenheit gegenüber dem eiligen Herrn, stutzig geworden, hätte nachgedacht, den Tagesablauf rekapituliert, vielleicht sogar den Sockel untersucht und dann festgestellt, dass er nicht verschraubt, sondern nur eingepasst war. Und dann wäre ihm das Auftreten des Kellners als einziges vom üblichen Tagverlauf abweichendes Vorkommnis vielleicht eingefallen und hätte ihn zu Nachforschungen, am Ende sogar zur Einschaltung der Polizei veranlasst. Jedoch, er blieb sitzen, entdeckte infolgedessen die Veränderung nicht, und so tickte es unaufhaltsam weiter auf dem Fußboden des auf- und niedergleitenden Gehäuses.
Um 17.48 Uhr fuhren sechs Personen nach unten, vier Herren und zwei Damen. Einer der Männer stand mit dem Rücken an die Kabinenwand gelehnt. Er hielt das rechte Knie leicht angewinkelt und ein wenig nach vorn geschoben. Seine Ferse ruhte auf dem Sockel, während die Spitze seines grauen Wildlederschuhs schräg nach unten zeigte. Er war schon oft in dieser Haltung auf- und abwärts gefahren, ja, es war, wie die anderen es gewiss hatten bestätigen können, die für Liftfahrten typische Haltung dieses Mannes, doch nie vorher hatte er dabei mit der Ferse auf einem Sockel Halt gefunden. So hätte er jetzt eigentlich, bei etwas mehr Aufmerksamkeit, das veränderte Terrain bemerken müssen. Aber er hatte vor dem Verlassen des Büros eine heftige Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten gehabt. Der Chef hatte ihn mit einer ganzen Serie von Grobheiten bedacht, und nun war er mit den Antworten beschäftigt, die er ihm erteilt hätte, wenn sie ihm nur rechtzeitig eingefallen wären. So registrierte er nicht die ungewohnte Beschaffenheit des Bodens unter seinem Absatz, empfand zwar diffus einen fremdartigen Effekt gegenüber dem, was seine Ferse sonst ertastete, machte sich allerdings keine Gedanken darüber. Die sechs verließen im Parterre die Kabine, wechselten in der Halle noch ein paar Worte miteinander und fädelten sich durch die Drehtür hinaus auf die Straße.
Um 17.53 Uhr verwandelte sich, wie seit einigen Wochen schon mehrmals um dieselbe Zeit, der nüchterne, von Gleitschienen und Stahlseilen gelenkte Transportbehälter in ein schwüles, schwebendes Séparée. Da kniete in seinem teuren Kammgarnanzug der schon etwas ältere kaufmännische Direktor der SpeditionsfirmaGLOBE-TRANSFER, die ihre Verwaltungsräume im siebten Stock des Hauses hatte, vor seiner um dreißig Jahre jüngeren Sekretärin. Er hatte ihren Rock bis zu den Hüften hinaufgeschoben, und was sein heißes, gefräßiges Gesicht sonst noch hätte behindern können, war nicht vorhanden; es steckte in der Handtasche der Dame. Ein paar kurze, hektische, akribisch auskalkulierte Sekunden lang schwitzte sich der arme, glückliche Mann hinunter ins Parterre, natürlich weit davon entfernt, den neuen Sockel auf dem Fahrstuhlboden zu bemerken. Und auch seine Partnerin hatte, wie gewohnt, ihre Augen woanders. Sie starrte auf die Knöpfe der Schalttafel und spielte ihr eigenes Spiel, prüfte wieder einmal, welche Telefonnummern ihres Bekanntenkreises sich aus den acht vorhandenen Ziffern zusammenstellen ließen. Es waren nur sehr wenige, weil die Null und die Neun fehlten und keine Ziffer mehr als einmal vorkam.
Unten, in der Halle, grüßte der Mann den Pförtner ganz besonders jovial, während die hochbeinige Blonde die Tür zum sanitären Bereich ansteuerte.
Zwischen 17.57 Uhr und 18.01 Uhr beförderte der Elevator eine Gruppe von elf Kindern aus dem fünften Stockwerk nach unten. Die lange Dauer dieses Transports war darauf zurückzuführen, dass die Jungen und Mädchen, die von der Schule her miteinander befreundet oder bekannt waren und nach einer Untersuchung beim Kieferorthopäden aufeinander gewartet hatten, nicht auf dem direkten Weg nach unten fuhren, sondern in ihrer Ausgelassenheit ein turbulentes Knopfdrücken auf der Schalttafel veranstalteten, sodass sie erst einige Male zwischen den Stockwerken hin und her pendelten, ehe sie unten ankamen. Dass sie die Vorhalle dann aber schnell und diszipliniert verließen, lag am Pförtner, der den lärmenden Haufen, als er sich schließlich ins Vestibül ergoss, zur Räson brachte. Wenige Sekunden nach 18.01 Uhr waren die Kinder auf der Straße. Sie rannten und wussten nicht, wie gut es war, dass sie rannten.
Um 18.02 Uhr wurde der Lift in den achten Stock gerufen. Dort hatte um genau 18.00 Uhr ein Dutzend Menschen Feierabend gemacht. Wie gewöhnlich standen die fünf Damen und sieben Herren vor dem mit Knöpfen und Leuchtzeichen ausgestatteten, noch verschlossenen Fahrstuhl und warteten. Das Summen ertönte, und dann erklang das gedämpfte Glockensignal, die Türen öffneten sich, die Damen gingen voran, die Herren folgten.
Die beiden etwa sechzigjährigen Schneidermeister Jacob Grünthal und Elias Winterstein, die in zwei großen Räumen der achten Etage ihre Werkstatt hatten und dort für ein in der Nachbarschaft gelegenes Konfektionshaus die täglich anfallenden Änderungen machten, hatten ein wenig abseits der kleinen, vor dem Fahrstuhl wartenden Menschentraube gestanden. Das taten sie, wenn der Feierabend da war, fast immer, ohne befürchten zu müssen, dass die Kabine überfüllt sein könnte und sie also nicht mitkämen, denn die zwölf Menschen, die in der achten Etage werktags pünktlich kurz nach achtzehn Uhr im Korridor standen, waren immer dieselben. Vielleicht, dass dann und wann einer fehlte, aber mehr als zwölf waren es nie, und noch nie hatte einer von ihnen wegen Überfüllung der Kabine zurücktreten und auf den nächsten Transport warten müssen.
Als Jacob Grünthal und Elias Winterstein diesmal den Lift betreten wollten, war die Situation plötzlich anders als sonst. Mit den zehn Personen, die vor ihnen die Fahrstuhltür passiert hatten, war die Kabine besetzt. Die beiden waren verblüfft, argwöhnten sogar einen Atemzug lang wiedererwachte Feindseligkeit gegenüber ihrem Volk, doch die anderen, das erkannten sie bald, waren nicht minder erstaunt. Was Abend für Abend ohne jede Komplikation, ja, fast schon wie ein Ritual ablief, sollte plötzlich, ohne dass jemand hinzugekommen war, nicht mehr funktionieren? Man sah sich an, verdutzt, irritiert, schob und drückte, versuchte Platz zu machen für die beiden, die dazugehörten. Einer hielt immer noch von innen die Tür auf, aber es war nicht zu ändern. Der Platz für die beiden letzten war an diesem Abend nicht mehr da.
Schließlich sagte eine Frau, sie stand an der Wand und stieß mit dem Fuß gegen den Sockel: »Das muss an dieser neuen Einfassung liegen!« Und ihre Kollegin, die neben ihr stand, antwortete: »Ja, sie ist fast so breit wie eine Hand, und das nimmt eine Menge Platz weg.«
Die beiden Schneider waren nicht so geartet, dass sie sich um einiger Minuten willen rücksichtslos in eine beengt stehende Gruppe drängen würden, eher gehörten sie zu denen, die den allzu nahen Kontakt meiden, und so traten sie lächelnd von der Kabine zurück. Die Tür schloss sich. Der Fahrstuhl glitt abwärts.
Die Zurückgebliebenen gingen den Flur entlang, und der Kleinere, Jacob Grünthal, dessen lebhafte Gestik etwas von der Quirligkeit eines Wiesels hatte, sagte: »Eine Handbreit und das durchgehend an allen drei Seiten, das macht schon was aus; ist beinah ein halber Quadratmeter. Der Platz für uns beide.« Sie hatten das Ende des langen Korridors erreicht, machten kehrt, und Elias Winterstein erwiderte: »Nun, was macht’s! Werden wir eben in Zukunft ein paar Minuten später hinunterfahren.«
Die Bombe zündete pünktlich um 18.03 Uhr, und zwar zwischen dem ersten Obergeschoss und dem Parterre. Die Explosion war von einer solchen Wucht, dass die beiden Schneider, obwohl relativ weit von der Unglücksstätte entfernt, gegen die Wand geschleudert wurden. Sie kamen mit Prellungen und Hautabschürfungen davon.
Aber die Kabine!
Und die unteren Stockwerke!
Und die Halle!
Die Sprengladung war, was die Kalkulation der Wirkung betraf, teuflisch platziert. Wie ein Kern in der Frucht hatte sie in der Tiefe des Hauses gesteckt, nicht dazu ausersehen, eine Fassade zu lädieren, sondern wie eine Eruption aus dem Innern heraus die Zerstörung zu betreiben. DasTNTim Stahlrahmen, der Rahmen in der Kabine, die Kabine im Fahrstuhlschacht, der Schacht im Zentrum des Gebäudes, das war wiedie Puppe in der Puppe in der Puppe,und jede hatte ihren eigenen starren Mantel aus Metall oder Beton. Das produzierte einen Druck, wie er vernichtender nicht hätte ausfallen können.
Von den zehn Insassen des Lifts war keiner mehr am Leben. Die Detonation hatte die Körper zerknüllt und zerrissen wie Papier. Im dritten Stock starben zwei Putzfrauen, die gerade angefangen hatten, ihre Staubsauger durch den Flur zu ziehen. Sie starben schnell, schon beim Anprall gegen die Decke.
In den Büroräumen des ersten, zweiten und dritten Stockwerks hatten sich noch einige Angestellte aufgehalten, deren Arbeitszeit über 18.00 Uhr hinausging oder die es mit dem Beginn des Feierabends nicht so genau nahmen. Von ihnen wurden vier getötet und vier schwer verletzt.
Der Pförtner lag tot auf der Straße. Die ungeheure Druckwelle hatte ihn vom Stuhl gefegt und durch das große Fenster seiner Loge nach draußen geschleudert.
Auch an anderen Stellen hatte sich die heftige, von innen nach außen zielende Stoßwirkung bis auf die Straße fortgepflanzt, teils noch weiter, bis hin zu den gegenüberliegenden Wohnblocks, deren Scheiben zersprungen waren.
Die Halle, größter Freiraum in der Nachbarschaft des Fahrstuhls, war übersät von Steinen, zersplittertem Glas und Gestänge.
Die Drehtür war aus ihrer Rotunde gedrückt worden und auf der Kühlerhaube eines Autos gelandet. Dabei war der Fahrer des Wagens getötet worden.
Unter den Straßenpassanten gab es mehrere Verletzte.
Um 18.10 Uhr waren die ersten Feuerwehren und Ambulanzen zur Stelle. Um 18.13 Uhr nahm eine Polizeidienststelle am Stadtrand einen Telefonanruf entgegen. Der Text war auf Band gesprochen und kam mehrmals, sodass der diensthabende Beamte mitschreiben konnte. Es hieß da:
»Hier spricht die AktionsgemeinschaftBRAUNE KOLONNE. Wir haben vor zehn Minuten in einem achtstöckigen Gebäude der Kölner Innenstadt eine Bombe gezündet. Es geht uns darum, Männer, die vor einem halben Menschenalter nichts weiter als ihre Pflicht getan haben, vor Diffamierung und Verfolgung zu bewahren. Gegen einen dieser verdienten Deutschen wird übermorgen der Prozess eröffnet. Der Zweck unserer Aktion ist zu verhindern, dass zwei Zeugen, die beiden österreichischen Juden Jacob Grünthal und Elias Winterstein, den Angeklagten zu Unrecht belasten. Weitere solcher Präventivmaßnahmen sind für die Bundesrepublik und für das Ausland geplant. Ende der Mitteilung.«
2.
Klaus Hemmerich saß im D-Zug Kopenhagen-Hamburg. Er war allein im Abteil und sah aus dem Fenster. Die Passkontrolle am Grenzübergang Puttgarden war erledigt. Nun raste der Express mit einer Geschwindigkeit von hundertvierzig Kilometern pro Stunde durch die norddeutsche Landschaft, vorbei an den Knicks und Gräben, den vom Westwind gebogenen Erlen und Weiden, an den kargen Frühjahrswiesen und dem grasenden Vieh.
Klaus Hemmerich zündete sich eine Zigarette an, griff nach der neben ihm liegenden Zeitung, warf einen Blick auf die erste Seite, las eine Überschrift, dann den Bericht und erfuhr von dem Bombenanschlag und den achtzehn Toten, auch von den näheren Umständen der Bluttat, so von derBRAUNEN KOLONNEund den beiden jüdischen Bürgern, denen das Attentat gegolten hatte, die jedoch wie durch ein Wunder verschont geblieben waren. Der Bericht schloss mit der lapidaren Feststellung: »Nach unseren Informationen dürfte es das erste Mal in der Geschichte des Terrorismus sein, dass diejenigen, denen der Anschlag galt, ihr Leben ausgerechnet der Bombe verdanken, weil sie ihnen den Platz wegnahm.«
Hemmerich legte die Zeitung wieder aus der Hand. Er konnte nicht ahnen, dass er schon bald mit den Hintergründen dieses Attentats zu tun haben würde.
Eine Weile noch dachte er an den durch die Platzierung erzielten vervielfachten Effekt der Sprengladung, aber auch an den – ebenfalls durch die Platzierung verursachten – Fehlschlag, an die beiden verschont gebliebenen Schneider. Und an die vielen Toten dachte er, die gar nicht gemeint gewesen waren, war entsetzt über den brutalen, hinterhältigen Mordanschlag selbst und über die gewissenlose Inkaufnahme möglicher Nebenwirkungen, die im vorliegenden Falle achtzehn Menschenleben gefordert hatte. Doch schließlich wandte er sich wieder seinen eigenen Problemen zu. Es gab welche, und sie wogen schwer.
Er war fünfunddreißig Jahre alt und Schiffsingenieur auf dem unter amerikanischer Flagge fahrenden 60000-Tonnen-TankerKOSMOS. Er hatte vor zwei Tagen Urlaub genommen und war nun auf dem Weg zu seiner Mutter, die in Hamburg-Blankenese wohnte. Sie war ganz allein, nachdem ihr ältester Sohn, Klaus’ vierzigjähriger Bruder Victor, die Wohngemeinschaft mit ihr unvermittelt aufgelöst hatte. Die Gründe für diesen Schritt hatte er ihr in einem Abschiedsbrief dargelegt. Allerdings entsprach alles, was er in diesem Brief schrieb, weder seinem Wesen noch seinem bis dahin so innigen Kontakt zur Mutter, es wirkte hergeholt und theoretisch.
Klaus Hemmerich, der von dem Ereignis in Port of Spain erfuhr, wo ihn der Brief seiner Mutter erreicht hatte, wollte sofort zu ihr fahren. Aber das ging nicht. Einer der Ingenieure war gleich nach der Ankunft in Port of Spain mit einem komplizierten Beinbruch ins Hospital gekommen, und wenn dann noch ein zweiter Mann vom Maschinenpersonal ausgefallen wäre, hätte das Schiff nicht auslaufen können. So rief er zu Hause an. Die Mutter schien sich schon etwas gefasst zu haben. Sie sagte, er solle sein Schiff nicht ihretwegen im Stich lassen, sondern mit seinem Besuch warten, bis er, wie vorgesehen, im Mai Urlaub bekäme. Dann hatte er aber doch schon früher fahren können. Mit derSASwar er nach Kopenhagen geflogen, und weil er in der Abendmaschine nach Hamburg keinen Platz mehr bekommen hatte, war er in den Nachtzug gestiegen.
Eigentlich war er gar kein Seemann. Er hatte nach dem Abitur die Technische Hochschule besucht, sein Examen gemacht und dann plötzlich das Bedürfnis empfunden, sich die Welt anzusehen, bevor er sich beruflich in Deutschland auf einen bestimmten Ort festlegte. Für die Verwendung in der Schifffahrt hatte er eine Zusatzausbildung durchlaufen und die entsprechenden Prüfungen ablegen müssen. Nun war er schon acht Jahre bei der Seefahrt, verdiente ziemlich viel Geld, gab als Junggeselle kaum etwas aus und plante, die zehn Vagabundenjahre, wie er sich der Mutter und dem Bruder gegenüber oft ausgedrückt hatte, noch vollzumachen und sich dann in der Bundesrepublik einen Job zu suchen.
Sein Vater, der vierzig Jahre lang Redakteur bei einer kleinen Zeitung im niederelbischen Raum gewesen war, lebte nicht mehr. Victor war auch zur Zeitung gegangen. Er war Journalist und Reporter geworden und also oft unterwegs, hatte aber sein Hauptquartier bei der Mutter im Blankeneser Elternhaus. Und nun war alles anders geworden! Was mochte da geschehen sein?
Die beiden Brüder hatten eine glückliche Kindheit erlebt. Sie waren, was unter Geschwistern mit einem vierjährigen Altersunterschied selten ist, Freunde, waren immer füreinander da und – untrügliches Zeichen für inneren Zusammenhalt – sehnten sich bei längerer Trennung nacheinander. Obwohl sie sich oft monatelang nicht sahen, hatten sie den engen Kontakt niemals abreißen lassen, hatten sich regelmäßig geschrieben und manchmal über den halben Globus hinweg miteinander telefoniert. Und wenn sie dann im Blankeneser Elternhaus zusammentrafen, wurde jedes Mal ein Fest daraus.
Klaus Hemmerich nahm sein Bordcase vom Gepäcknetz und zog aus einem Seitenfach die Kopie jenes Briefes heraus, den Victor der Mutter zum Abschied geschrieben hatte. Er hatte ihn im Laufe der vergangenen Wochen wohl ein Dutzend Mal gelesen, nun las er ihn ein weiteres Mal:
»Meine liebe Mutter! Ich habe einen Entschluss gefasst, der Dich erstaunen und bestürzen wird, denn er steht im Gegensatz zu allem, was bislang mein Leben ausmachte, mein Leben und damit auch meine Verbindung zu Dir. Manchmal gibt es im Verlauf eines Daseins Zäsuren, Einschnitte, ja, Einbrüche, die vom einen auf den anderen Tag die Ordnung auf den Kopf stellen und alle bis dahin befolgten Regeln außer Kraft setzen. Ein solcher Einbruch hat bei mir stattgefunden, und ich bin dabei, die Konsequenz zu ziehen und mein Leben neu einzurichten. Ich habe nicht vor, die Welt zu verändern, sondern nur, mir in ihr einen anderen Platz zu suchen, einen, der mit meiner bisherigen Existenz nichts zu tun hat. Du wirst fragen: Warum?
Ich werde irgendwohin gehen und ein neues Leben anfangen. Mein Beruf ist mir zweifelhaft geworden. Ich sehe keinen Sinn mehr in dem Bemühen, Vorgangs- und Zustandsbeschreibungen von einer Ecke dieser Welt in eine andere zu transportieren mit dem Ergebnis, dass neunzig von hundert Lesern sie nach drei Minuten, vielleicht nach drei Stunden, wenn es hoch kommt, nach drei Tagen wieder vergessen haben. Mag sein, dass dieser Sinn dennoch gegeben ist, vielleicht wegen der zehn Prozent; allein, ich kann ihn für mich nicht mehr sehen.
Ich lasse Dir meine Sachen schicken, denn auch sie gehören nicht mehr zu meinem Leben. Bitte, such nicht nach mir! Du würdest mich nicht finden. Ich bin ein Gewandelter, für den der Bezug zu allem Bisherigen nicht mehr existiert. Victor.«
Klaus Hemmerich faltete den Bogen zusammen und steckte ihn zurück ins Bordcase. Und wieder, wie schon so oft seit Erhalt des Briefes, resümierte er:
Ganz sicher, es ist seine Schreibmaschine, die alte Remington unseres Vaters, für deren Wiederbelebung und Instandhaltung er mehr Geld ausgegeben hat, als eine neue kostet. Es gibt keinen Zweifel, ich seh’s am verrutschten »M« und am lädierten »O«. Es ist das alte, ramponierte Ding, das dreimal soviel wiegt wie eine moderne Reiseschreibmaschine und das er aus purer Pietät immer wieder um den Globus schleppt und für das er bei den Luftlinien, wenn sie kleinlich sind, Übergewicht bezahlen muss.
Es ist ohne Frage auch sein Stil. Das antiquierte ›allein‹ anstelle des heute üblichen ›jedoch‹ ist eine Marotte, die er aus Verehrung für die Klassiker nicht abgelegt hat. Auch die Unterschrift scheint echt zu sein, und Gedanken sind da, die zu ihm passen. Ich kenne die kritischen Aspekte seiner Auffassung vom Journalismus. Wir haben oft darüber gesprochen. Aber es ist ganz und gar nicht seine Art, unsere Mutter, für deren Wohlergehen er jederzeit und unter Opfern eingetreten wäre, mit drei Dutzend maschine-geschriebenen Zeilen abzuspeisen. Allerdings: Indem er die Zäsur nennt, den Einbruch, den radikalen Wandel, der alle ins Rückwärtige weisenden Bezüge kappt, ist auch dieser Widerspruch in gewisser Weise erklärt. Also: Die Maschine stimmt, der Stil stimmt, die Ansicht über den Journalismus stimmt, und sogar das an sich Unbegreifliche seines Entschlusses bekommt durch den logischen Trick, dass er ja nun ein Gewandelter sei, einen Dreh ins Plausible.
Allein, mir fehlt der Glaube!
Und er grübelte weiter: Warum gab es nicht auch einen Brief für ihn? Oder warum war er nicht wenigstens in den der Mutter gewidmeten Zeilen erwähnt? Nicht, dass er sich übergangen fühlte und nun verletzt war. Seit Jahren hatte Victor bei allen entscheidenden Fragen und Mitteilungen zwei Adressaten gehabt, die Mutter und den Bruder. Und so hätten die Worte des Abschieds auch an ihn, Klaus, gerichtet sein müssen. Der Zusammenhalt der kleinen Familie war so stark, so zwingend, dass noch niemals einer der drei ein Ereignis von Gewicht ganz bewusst mit nur einem der beiden anderen erörtert hatte. Gerade diese Transparenz machte den Umgang miteinander so harmonisch, war die Grundlage des gegenseitigen Vertrauens. Und so fragte Klaus Hemmerich sich jetzt, und er fragte es wieder ohne die leiseste Spur eines Gekränktseins: Wenn schon hier, im völligen Ignorieren meiner Existenz, eine Ungereimtheit steckt, wie viel ist dann der kaustische Trick noch wert, der unserer Mutter weismachen will, dass sie ihn gar nicht finden könne, weil er sich gewandelt habe?
Ich kann doch nicht von heute auf morgen Luft für ihn sein, sagte er sich. Und dann fiel ihm eine Kindheitsgeschichte ein, an die er sich nicht wirklich erinnerte, die aber dennoch wie etwas bewusst Miterlebtes in seinem Gedächtnis gespeichert war, so oft und so plastisch war sie ihm von den Eltern erzählt worden: Victor, sieben Jahre alt, saß in der Schule. Weder Panama noch die Tropenkrankheiten gehörten in das Unterrichtsprogramm der Zweitklässler, aber der Lehrer hatte vor Jahren eine Reise nach Mittelamerika gemacht und erzählte davon, und so war es dann doch ein Thema für die Siebenjährigen. Er erzählte ihnen auch, wie es früher dort drüben gewesen war, sprach von der gelbfieberverseuchten Golfküste, ließ sich durch eine Zwischenfrage auf ein Nebengleis drängen und berichtete ausführlich und suggestiv über die Mücken, die das furchtbare Fieber auf den Menschen übertragen, sprach vom Kanalbau, in dessen Verlauf Tausende von Arbeitern an dieser Krankheit zugrunde gegangen waren, nannte schließlich die Impfungen, mittels derer man sich heute gegen das Gelbfieber schützt.
Der siebenjährige Victor Hemmerich hörte sich das alles mit wachsendem Interesse, aber auch mit wachsender Sorge an. Als es zur Pause geklingelt hatte und die Klasse auf den Schulhof ging, stahl er sich davon, schlüpfte an dem Hausmeister vorbei und entwischte durch das Schultor auf die Straße. Und lief. Lief ohne Unterbrechung, bis er zu Hause angekommen war. Klingelte Sturm. Als seine Mutter ihm die Tür geöffnet hatte, war er so außer Atem, dass er nicht sprechen konnte. Endlich, nachdem er mehrmals angesetzt und die Mutter ihn durch beschwichtigende Worte und Gesten einigermaßen beruhigt hatte, kam abrupt und für die Mutter völlig rätselhaft die Frage:
»Ist Klaus geimpft?«
Im Wohnzimmer, wo der Dreijährige auf dem Teppich saß und vergnügt mit seinen Bauklötzen spielte, klärte sich das Missverständnis auf. Der kleine Bruder hatte ein Jahr vorher Gelbsucht gehabt, eine leichte Form, und Victor, für den die Äußerungen seines Klassenlehrers etwas unwiderlegbar Gültiges hatten, war während des ganzen langen Wegs nach Haus überzeugt gewesen, die Eltern hatten die Schwere der Krankheit verkannt und ihnen wäre, was seinen Bruder betraf, ein lebensbedrohliches Versäumnis unterlaufen.
Als der Zug sich Hamburg näherte, war Klaus Hemmerich noch immer mit Victors unbegreiflichem Schritt ins Abseits beschäftigt, erwog er alle nur denkbaren Einflüsse, die den Vierzigjährigen von seinem Weg gedrängt haben mochten. Eine Frau zum Beispiel. Klaus Hemmerich hielt diese Möglichkeit für die unwahrscheinlichste, denn was für eine Frau sollte das wohl sein, die ihn veranlasst hätte, sein Leben umzukrempeln und dabei die Mutter und den Bruder zu opfern? Eine Krankheit vielleicht? Nein! Victor war nicht der Mann, der sich, wenn er zum Beispiel nur noch ein halbes Jahr zu leben hätte, auf diese Weise aus allen Bindungen löste. Vielleicht würde er sein trauriges Los verschweigen, aber bestimmt nicht würde er einen inneren Wandel erfinden und die Mutter fassungslos zurücklassen. War er am Ende auf der Flucht? Hatte er etwas getan, um dessentwillen man ihn verfolgte und das ihn zwang, für eine Weile zu verschwinden? Auch diese Version war, ging man von der Persönlichkeit des Verschollenen aus, ganz und gar abwegig. Victor würde sich nicht unter Hinterlassung von mysteriösen Abschiedserklärungen der Verfolgung entziehen, sondern sich stellen. Auch die für das plötzliche Aufgeben bewährter innerer und äußerer Positionen häufig genannten Gründe wie Midlife-Crisis, Fortschrittsmüdigkeit, Erfolgsüberdruss, Zweifel an der eigenen Leistung, das Kokettieren mit der alternativen Szene oder wie man die schmerzlichen Prozesse derer, die plötzlich alles in Frage stellen, sonst noch nennen mochte, hatte er als Motive für den Schritt seines Bruders in Betracht gezogen, aber an keines mochte er so recht glauben. Und indem er sie alle erwog und alle wieder verwarf, blieb die Skepsis, blieb die Unruhe. Und damit war er nicht gerade trefflich ausgerüstet für sein Vorhaben, nach Hause zu fahren und die nicht minder besorgte Mutter zu beruhigen.
3.
Das Blankeneser Haus war nicht groß. Es war auch nicht besonders ansehnlich, sondern sogar ein bisschen verunstaltet. Bei der Sturmflut im Frühjahr 1962 hatte sich nach der Überschwemmung der links vom Frontgiebel befindliche Hausteil um fast einen Meter gesenkt. Später hatte man ihn wieder stabilisiert, ohne jedoch den Dachfirst auf die ursprüngliche Höhe zu bringen, sodass er etwas niedriger war als der rechts vom Giebel verlaufende. Seit der Zeit sprach man in der Nachbarschaft von dem »Haus mit den schiefen Schultern«, was aber die Hemmerichs nicht kränkte. Von diesem Makel abgesehen, war es ein solides, in rotem Backstein errichtetes Einfamilienhaus. Es hatte graue Schindeln, Butzenscheiben, einen ebenfalls aus Backstein gebauten Windfang und eine schwere, grün gestrichene Eingangstür. Zwischen der am Bürgersteig entlangführenden Ligusterhecke und der Hausfront befand sich ein etwa hundert Quadratmeter großer Vorgarten, der nun, im April, außer Krokussen und Narzissen nichts Blühendes herzeigte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!