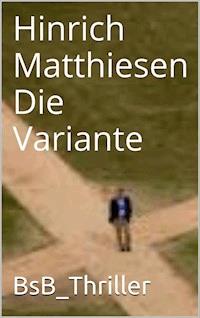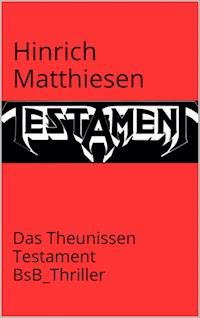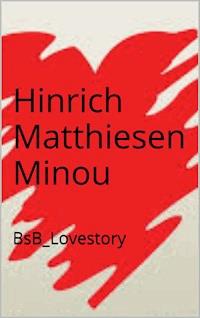Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Best Select Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Streifzug über die Insel: informativ und unterhaltsam für alle jetzigen und künftigen Sylt-Liebhaber. Hinrich Matthiesen, der erfolgreiche Autor, dessen Romane gerade alle als E-Books erscheinen, ist ein direkter Nachfahre des legendären Sylter Walfängers Lorenz de Haan. Hier erzählt er von der Geschichte seiner Insel und von ihren Bewohnern, vom alten Sylt, das es nicht mehr gibt, und vom heutigen, das sich zum Urlaubsparadies gewandelt hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinrich Matthiesen
Jahrgang 1928, auf Sylt geboren, wuchs in Lübeck auf. Die Wehrmacht holte ihn von der Schulbank. Zurück aus der Kriegsgefangenschaft, studierte er und wurde Lehrer, viele Jahre davon an deutschen Auslandsschulen in Chile und Mexico. Hier entdeckte er das Schreiben für sich.
1969 erschien sein erster Roman:MINOU. Dreißig Romane und einige Erzählungen folgten. Die Kritik bescheinigte seinem Werk die glückliche Mischung aus Engagement, Glaubwürdigkeit, Spannung und virtuosem Umgang mit der Sprache. Die Leser belohnten ihn mit hohen Auflagen.
Immer stehen im Mittelpunkt seiner Romane menschliche Schicksale, Menschen in außergewöhnlichen Situationen. Hinrich Matthiesen starb im Juli 2009 auf Sylt, wo er sich Mitte der 1970er Jahre als freier Schriftsteller niedergelassen hatte.
»Zum literarischen Markenzeichen wurde der Name Matthiesen nicht zuletzt durch die Kunst, in eine pralle Handlung Aussagen zu verweben, die außer dem aktuellen stets auch einen davon unabhängigen Bezug haben. Gedankliche Strenge, sprachliche Disziplin und ein offensichtlich unauslotbarer verbaler Fundus lassen Matthiesen zu einem Kompositeur in Prosa werden.«
Deutsche Tagespost
»Matthiesen ist zu beneiden um seine Fähigkeiten: Kompositionstalent, menschliche Einfühlung, scharfe Beobachtungsgabe – und vor allem um seinen Stil«
Deutsche Welle
»Matthiesen ist für seine genauen Recherchen bekannt. Seine Bücher weichen nicht einfach in exotische Abenteuer aus, sondern befassen sich immer wieder mit deutscher Vergangenheit und Gegenwart. Unterhaltsam sind sie allemal.«
FAZ-Magazin
Mein Sylt
Ein autobiographischer Streifzug über die Insel: informativ und unterhaltsam für alle jetzigen und zukünftigen Sylt-Liebhaber Hinrich Matthiesen, direkter Nachfahre des legendären Sylter Walfängers Lorenz de Haan, erzählt von der Geschichte seiner Insel und von ihren Bewohnern, vom alten Sylt, das es nicht mehr gibt, und vom heutigen, das sich zum Urlaubsparadies gewandelt hat.
© 2015
Alle Rechte bei
BestSelectBook_Digital Publishers München
ISBN 978-3-86466-384-0
Inhalt
Ein Wort vorweg
Was ist ein Sylter?
Greth Skrabbel
Von der friesischen Sprache
Die große Freiheit
Insel der Seefahrer
Sturmfluten
Ich blättere in einem vergilbten Journal
Nun ein eher heiteres Stück Seefahrt
Der Wandel
»Atem von Babylon«
Atlantis
United Venture
Noch eine Reise
Ein Sylt-Sommertag
Leuchtzeichen
Reden wir doch mal vom Wetter!
Die Gefährdete I
Die Gefährdete II
Wie wär’s jetzt mit ein bisschen Geschichte?
Schluss mit den Klischees!
Liebe ist mehr
Rundblick
Benutzte Literatur
Ein Wort vorweg
Eigentlich mag ich es nicht, wenn der Verfasser eines Buches im Vorwort seine Rechtfertigung für eben dieses Buch gleich mitliefert, begibt er sich damit doch meistens von Anfang an in die Defensive. Hier aber scheint mir eine begründende Erklärung erforderlich zu sein, denn ich werde von der Insel Sylt erzählen, und über sie gibt es schon einige Hundert Bücher.
Als ich gebeten wurde, über meine Insel zu schreiben, war es diese Titelflut, die mich davon abhielt, spontan ja zu sagen. Ich hatte auch die meisten Autoren sofort im Kopf, zunächst natürlich unsere alten Chronisten. Sie allerdings waren es noch nicht, die mir Bedenken einflößten, denn das Sylt ihrer Zeit hat sich inzwischen so stark verändert, dass es kaum zu Überschneidungen kommen würde. Nein, es waren meine Zeitgenossen und ihre Texte, die mich vor der im Grunde reizvollen Aufgabe zurückschrecken ließen, ob es sich nun um Hermann Schmidt handelt, um Georg Quedens oder Sven Simon, um Kurt Lothar TanksLesebuchmit den vielen illustren Namen oder um Manfred WedemeyersKäuze, Künstler, Kenner - kaum gekanntes Sylt, um Peter Schmidt-EppendorfsMemoiren einer Inseloder um Harald Voigts historische Abhandlungen über Sylt, um dasStern-Buch mit den Zitaten von Thomas Mann, Stefan Zweig, Max Frisch und anderen Großen oder um Bodo Schütts Lyrik, um Jessen, Jessel, Stöver und wie sie alle heißen, um Boy Lornsen, Sylter wie ich, Kapitänssohn wie ich, um alle die vielen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Sylt in Worten und Bildern dargestellt haben, nicht zuletzt um Henry Koehn, an dessen StandardwerkDie Nordfriesischen Inselnniemand, der sich etwas gründlicher mit Sylt befassen will, vorbeikommt. Aber auch zahlreiche journalistische Beiträge kamen mir in den Sinn, zum Beispiel die von Carla Petersen, die seit Jahrzehnten ebenso engagiert wie fundiert über die Insel berichtet. Und an Kurt Struve dachte ich, der mit Linse und Feder die Schönheiten der Insel festgehalten hat. Er war es, der meine ablehnende Haltung ins Wanken brachte. Ich traf ihn in der Westerländer Friedrichstraße, und wie immer, wenn ich ihn sah, staunte ich erst mal über seinen federnden Gang und sein frisches, wettergebräuntes Gesicht. An ihm schienen sich alle Heilkräfte unserer Nordseeluft so richtig ausgetobt zu haben. Er erzählte mir von seiner neuen Arbeit, einem Buchprojekt mit dem TitelSylt - Die Roseninsel. Aber wie denn das? Ein Titel wieDie Iglus am Amazonashätte mich kaum mehr verblüfft. »Die Roseninsel?«, fragte ich. »Ja«, antwortete er, »man muss nur die Augen offenhalten. Fahren Sie über die Insel! Überall Rosen in Fülle! «
Ich dachte sofort an das Blumenmeer in unserem Garten, zu dem auch Rosen gehören, die jetzt, im Juli, in voller Blüte standen. Aber ich hielt diese Pracht doch eher für die Ausnahme, für das Werk von Gondel, meiner Frau, die alle gärtnerischen Tricks kennt und – das glaub’ ich jedenfalls – heimlich mit ihren Pflanzen spricht und sich sogar Samen aus Mexiko schicken lässt.
Am Abend, zu Haus, geisterte Kurt Struves Roseninsel noch immer in meinem Kopf herum, und plötzlich hatte ich den Schlüssel zu meinem eigenen Sylt-Buch. Ein Spezifikum musste her! So etwas wie die Rosen! Etwas Besonderes also, das – wenn möglich – sogar den Reiz der Einmaligkeit hatte. Aber Moment, dieser Reiz war ja schon da, lag im vorgegebenen Titel!Mein Sylt. Also meins, nicht deins! Das war es. Selbst wenn zehn Autoren mit genau diesem Titel herauskämen, würden es zehn grundverschiedene Bücher sein. Das nur scheinbar einschränkende, in Wirklichkeit aber eine Fülle von Möglichkeiten bereithaltendeMeingab mir alle Freiheit, die ich nur wollte. Niemand würde mir vorhalten können: Du hast ja den Petritag gar nicht in deinem Buch und die Vogelkojen auch nicht, und nirgendwo steht, dass die Insel 38 Kilometer lang ist. Unser geologisches Paradestück, das Morsum-Kliff, hast du recht stiefmütterlich behandelt, und die Sylter Trachten... Macht nichts! Der Titel erlaubt es mir, auszuwählen, und das tu ich. Los geht’s!
Was ist ein Sylter?
Fast jeder Bundesbürger, der heute zu den älteren Jahrgängen gehört, hat es am Bildschirm oder am Radio miterlebt, und viele der jüngeren haben es im Geschichtsunterricht gelernt oder wissen es vom Hörensagen: 1963 rief der amerikanische Präsident John F. Kennedy vor dem Schöneberger Rathaus aus: »Ich bin ein Berliner!« Dabei war er nicht mal Europäer, geschweige denn Deutscher. Dennoch tat er jenen denkwürdigen Ausspruch, und alles jubelte.
Er durfte sich so äußern, obwohl seine Wiege in Massachusetts stand und der Potomac ihm ganz gewiss mehr bedeutete als die Spree. Ja, er durfte sich als einen Berliner bezeichnen, denn es handelte sich dabei, wie jeder weiß, nicht um eine regionale Zuordnung, sondern um ein weltpolitisches Signal.
Oft höre ich Leute sagen »Mein Sylt!« oder auch »Meine Insel!«, und ihr Wort klingt ähnlich emphatisch wie Kennedys Bekenntnis zu Berlin. Dabei stammen sie aus Hamburg und München, aus Düsseldorf und Köln. Sie sagen »Meine Insel!«, auch wenn Elbe und Isar und Rhein ihrem Leben näher sind als Wattenmeer und offene Nordsee und die Weltpolitik ohne sie gemacht wird. Dennoch, meine ich, dürfen sie Sylt als ihre Insel bezeichnen. Warum? Weil es nicht um Herkunft geht, sondern um Hinwendung. Sie haben sich für ein paar besondere, aus dem Gleichmaß des Jahres herausgehobene Wochen die Insel ausgewählt. Da komme bitte niemand und wende ein, mit einem Zweithaus oder einem alljährlich angemieteten Quartier auf diesem Flecken Erde sei man noch lange kein Sylter! In gewissem Sinne ist man es durchaus. Wer sich entschließt, hier regelmäßig Gast zu sein, hat schon mal etwas sehr Wesentliches an die Insel vergeben, sein Herz nämlich oder was immer der Ort sein mag für Liebe oder Vorliebe. Das zählt; jedenfalls, solange wir einen etwas gelockerten Umgang mit dem besitzanzeigenden Fürwort gelten lassen, und warum sollten wir das nicht tun? Schließlich wird uns Syltern mit diesem Anspruch nichts streitig gemacht, am allerwenigsten unsere Geschichte.
Diese Menschen meinen ja Sylt, wie es heute ist, meinen das Füllhorn, die Schatzkammer, und nicht jenen kargen, dem nordfriesischen Festland vorgelagerten Landstrich, der in vergangenen Zeiten seine Bewohner eher schlecht als recht ernährte. Nein, das schon geschichtliche Sylt meinen die Ferienmenschen nicht, denn dann ginge es um die Verwurzelung und also um andere Kriterien der Zugehörigkeit. Indes, so ganz eindeutig scheinen selbst die nicht zu sein.
Als ich 1953 ein Mädchen dieser Insel heiratete, begann zwischen meinem Schwiegervater und mir ein lange währender, aber immer verbindlich, mehr noch, ein liebevoll ausgetragener Disput über die Frage, wer denn nun eher berechtigt sei, sich ein Sylter Kind zu nennen, seine Tochter oder ich. Hier kurz die jeweilige Beweisführung:
Mein Schwiegervater, gebürtiger Ostfriese, war 1926, also noch vor Fertigstellung des Hindenburgdammes, als Rechtsanwalt und Notar in den Hauptort der Insel, nach Westerland, gegangen. Asphaltmüde hatte er das turbulente Berlin verlassen und führte dann für lange Zeit die einzige Anwaltspraxis von Sylt. Heute gibt es hier rund ein Dutzend Anwälte.
Seine Kinder wurden auf der Insel geboren, wuchsen dort auf. Was nun mich betrifft, so stand meine Wiege zwar in Westerland, und meine Vorfahren sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits waren Sylter, aber meine Kindheit verbrachte ich in Lübeck. Und die Kindheit, sie war es, die er immer wieder ins Feld führte, diese – wie er manchmal sagte – Zauberwelt, die jeden Inselquadratmeter zum ganz persönlichen Eigentum mache und daher mehr zähle als alles andere. Wenn, so plädierte er, Landschaft denn zur Identität eines Menschen beitrage, dann geschehe das vorwiegend in der Kinderzeit. Damit hatte er ja eigentlich auch recht, und so kam ich mir mit meiner fast vierhundertjährigen Sylter Ahnenkette und mit meiner friesischen Muttersprache schon fast geschlagen vor. Der Ort meiner Kindheit war nun mal nicht die Insel, sondern die Hansestadt an der Trave.
Doch eines Tages beantragte ich die Wiederaufnahme des Verfahrens. Ob ich denn neues Beweismaterial hätte, fragte er mich. Aber ja, erwiderte ich, und dann trug ich ihm, der es gewohnt war, Für und Wider sorgfältig gegeneinander abzuwägen, ein – wie ich fand – wirklich stichhaltiges Argument vor. Wenn meine Kindheit, so führte ich aus, nicht auf Sylt stattfand, sondern zweihundert Kilometer entfernt in einer Hafenstadt, dann doch nur deshalb, weil mein Vater Kapitän war und damit einen für die Sylter typischen Beruf hatte. Um den ausüben zu können, brauchte man große Reedereien, und die gab es nicht auf der Insel, sondern in Hamburg, Bremen, Lübeck oder Emden. Er müsse doch einsehen, dass diese Konstellation für einen authentischen Sylter schon fast Modellcharakter habe. Nun, er war nicht nur ein Mann des Rechts, sondern auch Schachspieler, und so antwortete er, nachdem er die veränderte Beweislage überdacht hatte: »Remis.«
Mit einem Vergleich davonzukommen, ist nicht der schlechteste Ausgang eines Rechtsstreites, aber der Fall zeigt, wie schwer es manchmal ist, Verwurzelung nachzuweisen. Selbst einer unserer ehemaligen Landesväter hat, wie er mir mal erzählte, gewisse Schwierigkeiten, die Zugehörigkeit zu seiner Heimatstadt Lübeck durchzusetzen. Dazu brauche man mindestens drei Generationen, sagte er, es sei denn, man habe einen Senator in der Ahnenreihe. Bei den Engholms sind es erst zwei Generationen, und den Joker haben sie auch nicht in der Hinterhand. Offenbar tut man sich andernorts genauso schwer, wenn es um Herkunft geht.
Ja, und was ist nun ein echter Sylter? Ich meine, zunächst einmal sollte man davon abrücken, in dieser Frage für andere entscheiden zu wollen. Ich für meinen Teil glaube herausgefunden zu haben, warum ich einer bin: Wenn es darum gehen wird, mich hinzulegen zum großen Schlaf, dann möchte ich, dass es in Keitum geschieht. Daran bei Lebzeiten zu denken, halte ich weder für makaber noch für kokett. Wann sonst sollte man es denn wohl tun? Ebenso wenig halte ich es für sentimental, und schon gar nicht ist es Ausdruck einer finalen Stimmung. Es geschieht sogar eher heiter als bedrückt, und mir unterlaufen dabei auch ganz diesseitige Empfindungen und Vorstellungen. Zum Beispiel liebe ich Hamburg, fände es aber traurig, dort begraben zu sein, weil ich dann recht einsam wäre als Friese unter lauter Hanseaten. Und auch in Mexiko, wo ich mit Begeisterung einen Teil meines Lebens verbracht habe, möchte ich den großen Schlaf nicht antreten; ich hätte Bedenken, es würde ein sehr unruhiger werden mit den vielen Indios und Mestizen in den Betten ringsum. Nein, ich will in Keitum liegen, wo der Nordwest durch die Bäume geht, wo Pastor Giesen unsere Tochter Svendine und ihren Philipp getraut hat und jenes Kirchenbuch bewachte, in das – um nur zwei der Namen herauszugreifen – die Eheschließung des Seefahrenden Matthias Lorenz Matthiesen und der Karen Haulk Mannis am 11. März 1808 eingetragen wurde und in dem manch andere meiner Vorfahren mit ihren biographischen Stationen vermerkt sind: der Geburt, der Taufe, der Hochzeit und dem Tod. Der Wunsch, wo man einmal liegen möchte, kommt ja nicht von ungefähr. Ganz sicher hängt er mit den Wurzeln zusammen.
Greth Skrabbel
Nein, das hat nicht einmal entfernt mit dem amerikanischen Kreuzworträtsel-Spiel zu tun, sondern es ist der Name jener Frau, die als Stamm-Mutter vieler Sylter Familien gilt. Die Geschichte ihrer Herkunft wird auf der Insel in mehreren, zum Teil stark voneinander abweichenden Versionen erzählt.
Eine lautet, Greth sei als Kind nach einem Schiffsuntergang in einer Wiege am Rantumer Strand angetrieben. Eine andere nennt statt der Wiege eine Hummerkiste. Eine dritte besagt, das Schiff sei nicht untergegangen, sondern nur gestrandet, und die Rantumer hätten das Kind von Bord geholt. Und wieder eine andere bekundet, diese Greth sei eine junge Frau gewesen und habe, als man sie von dem Schiff an Land brachte, einen kleinen Jungen bei sich gehabt. Es ist – wie so oft bei mündlichen Überlieferungen – eine Geschichte mit Arabesken, weil die Art der Weitergabe in hohem Maße von der Phantasie bestimmt wird. Der wahre Kern scheint zu sein, dass es um 1620 diesen Zuwachs zur Inselbevölkerung gegeben hat und dass jene Greth ein Amsterdamer Mädchen war und eigentlich Margareta hieß. ›Skrabbel‹ ist ein hiesiger Namenszusatz. Zum einen bedeutet das friesische Wortskrabeliso viel wie ›rasseln‹. Zum anderen – und das mag bei Greth zu dem Beinamen geführt haben – ist die syltringische Formulierungjü skrabeltzu übersetzen mit ›sie ist schwanger‹.
Ihr späterer Mann soll Jens geheißen haben. Ihrer beider Sohn Peter Jensen oder auch Peter Jens Grethen taucht in den Sylter Steuerlisten des ausgehenden siebzehnten Jahrhunderts unter den Namen Peter Jensen de Haen und Peter Janßen de Han auf, und einer seiner fünf Söhne, die alle Grönland-Kommandeure wurden, war Lorenz Petersen de Haan, der bis heute berühmteste Sylter Seefahrer. Die Grönland-Kommandeure, deren Namen in den Walfanglisten des Museums für Hamburgische Geschichte stehen, befuhren auf der Jagd nach Walen das nördliche Eismeer.
Nicht selten gingen die Sylter Jungs mit dreizehn, vierzehn, ja sogar schon mit zwölf Jahren auf die Schiffe, so dass in manchen Fällen die Konfirmation bei einem späteren, zwischen zwei Reisen anberaumten Landaufenthalt nachgeholt werden musste. Von diesem frühen Eintritt ins Berufsleben her ist es zu erklären, dass Lorenz de Haan bereits im Alter von vierundzwanzig Jahren Kommandeur war. Er hat unter anderen die SchiffeDe Swarte ArendtundFyf Gebroedergeführt, deren Reeder in Hamburg lebende Holländer waren. Lorenz de Haan, der von 1668 bis 1747 lebte, war ab 1718 Strand- und Düneninspektor, dem die Strandvögte von Westerland, Rantum, Kampen sowie die Ufervögte von Keitum und Morsum unterstanden. List hingegen gehörte zum Bereich der königlich dänischen Regierung.
Unsere Chronisten Henning Rinken und C. P. Hansen haben sich ausführlich mit der Sylter Ahnfrau befasst. Rinken gibt jener Version den Vorzug, nach der Greth und Jens als Mutter und Sohn auf die Insel gekommen sind. Hansen hält mehr von dem Wiegenkind Greth. Eine geradezu abenteuerliche Lesart bietet die Schriftstellerin Margarete Boie in ihrem BuchDer Sylter Hahnan, allerdings als Romanpassage und darum von vornherein nicht als Zeugnis zu werten, sondern als phantasievoll nachgestaltetes Geschehen. Gleich in der Eingangsszene ihres Buches erzählt sie von dem Schiffbruch vor Sylt, spricht von der holländischen Kuff, also einem flachen und breiten Frachtsegler für die Küstenfahrt, der bei Rantum aufs Land geraten sei, und beschreibt die Männer beim Bergen des Strandgutes, besonders einen, der sah, ...»daß er kein Schiffsgut gefischt hatte, sondern eine buntbemalte Wiege, in der in Kissen fest eingestopft ein Kind lag. Es war aber nicht tot... Einer von ihnen zog einen getrockneten Fisch aus seinem Hosensack, klaubte mit dem Fingernagel ein Stück grätenfreies Fleisch heraus und schob es in das lachende Mäulchen. ›Kuck, es frißt‹, sagte ein Dritter... Doch da wurde dem Berger der Wiege das Spiel zu lang. Er schlenkerte seinen schweren Holzschuh ab und hob ihn auf, um dem kleinen Ding damit den Garaus zu machen...«
Das tat er nicht, denn das kleine Ding wurde ja unsere Stamm-Mutter, aber die Autorin trifft, auch wenn sie statt der barbarischen Tat nur den barbarischen Impuls des Rantumers nennt, ganz sicher einen Wesenszug der Sylter aus jener Zeit, nämlich die Raubeinigkeit, zu der der Kampf mit dem Meer sie erzogen haben mag. Zugleich wird das entbehrungsreiche Leben der Insulaner verdeutlicht; ein Esser mehr am Tisch, das spielte eine große Rolle.
In welchem Maße die Sylter damals auf die Hinterlassenschaften gesunkener Schiffe erpicht waren, erhellt ein Gebet, von dem ich nicht weiß, ob sie es tatsächlich so gesprochen haben oder ob es ihnen in den Mund gelegt worden ist: »Herr, segne unseren Strand!« Mögen beschwichtigende Interpreten auch noch so eindringlich die Fische und Krebse anführen, die nach ihrer Ansicht mit dem Segen gemeint waren, so gibt es doch auch andere Stimmen, die davon ausgehen, dass hier der Herrgott angefleht wurde, er möge mal wieder ein Schiff untergehen lassen. Zwischen der ersten, der milden, und der zweiten, der radikalen Deutung gibt es eine dritte: Wenn du, Lieber Gott, es schon nicht lassen kannst, mal wieder ein Schiff und seine Männer zu vernichten, dann sorge wenigstens für vernünftigen Wind, damit die Ladung zu uns treibt und nicht sonst wohin!