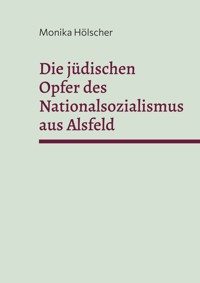
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit dem Buch "Geschichte der Juden in Alsfeld" aus dem Jahr 1988 haben die Lokalforscher Heinrich Dittmar und Dr. Herbert Jäkel den Grundstein für alle weiteren Forschungen auf diesem Gebiet gelegt. Mit der Veröffentlichung "Die jüdische Opfer des Nationalsozialismus aus Alsfeld" soll ein weiterer Schritt gemacht werden, um diesen Menschen in Alsfeld Namen und Gesicht zu geben, so dass sie nicht in Vergessenheit geraten und nachfolgenden Generationen in Erinnerung bleiben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Stolpersteine
Quellen
Zum Buch
Die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus aus Alsfeld
Aaron, Rosa
Adler, Betty (s.a. Familie Joseph Rothschild)
Adler, Fanny
Familie David Adler
Adler, Friederike
Adler, Hans Herbert Norbert
Adler, Moritz
Flörsheim, Samuel s.d.
Baer, Ida (s.a. Familie Salomon Strauß)
Baer, Sally (s.a. Familie Salomon Strauß)
Bauer, Frieda
Familie Jacob Bettmann
Bettmann, Adelheid “Adele” (s.a. Familie Gutkind Rothschild
Bettmann, Hermann
Bettmann, Jacob (s.a. Familie Gutkind Rothschild)
Blumenthal, Hans Hermann
Blumenthal, Rosa/Rosel
Buxbaum, Levi
Doellefeld, Siegfried
Flörsheim, Samuel “Sally” (s.a. Familie David Adler)
Freund, Sara
Gurassa, Sidonie (s.a. Gutkind Rothschild)
Heinemann, Adele (s.a. Familie Meier Wallach)
Hill, Cips Sidda
Isaac, Joseph
Joseph, Lydia
Justus, Juda Julius
Justus, Rosa
Katz, Klara
Kaufmann, Jenny (s.a. Familie Gutkind Rothschild)
Lamm, Julius
Familie Gabriel Levi II
Levi, Benno (Zeitzeugenbericht)
Levi, Frieda s. Bauer, Frieda
Levi, Regine
Lilienstrauß, Paula (s.a. Familie Abraham Lorsch)
Lind, Sara (s.a. Familie Gabriel Levi) S.
Lindenbaum, Siegmund (s.a. Familie Israel Lorsch) S.
Familie Abraham Lorsch S.
Lorsch, Arno
Lorsch, Gustav
Lorsch, Norbert Herbert
Lorsch, Paula s. Lilienstrauß, Paula
Lorsch, Sara
Lorsch, Selma
Familie Israel Lorsch
Lindenbaum, Siegmund s.d.
Lorsch, Carl
Lorsch, Johanna
Lorsch, Julius
Lorsch, Martha
Familie Zadock Lorsch I
Lorsch, Pfanni s. Selinger Pfanni
Familie Zadock Lorsch II
Lorsch, Frieda
Löser, Hedwig
Löwenbaum, Elise (s.a. Familie Meier Wallach)
Löwenstein, Berta (s.a. Familie Salomon Stein)
Metzger, Jacob
Moses, Ida (s.a. Familie Samuel Rothschild)
Moses, Philip(p) (s.a. Familie Samuel Rothschild)
Moses, Manfred alias Michael Maynard (Zeitzeugenbericht)
Oppenheimer, Johanna
Rath, Lidia (s.a. Familie Liebmann Schloss)
Rosenthal, Rosi Rebecka
Rothschild, Frieda
Familie Gutkind Rothschild
Rothschild, Adelheid
Rothschild, Ida s. Sundheimer, Ida
Rothschild, Isaak
Rothschild, Jenny s. Kaufmann, Jenny
Rothschild, Sidonie s. Gurassa, Sidonie
Familie Joseph Rothschild
Rothschild, Betty s. Adler, Betty
Rothschild, Clementine s. Stein, Clementine
Familie Liebmann Löb Rothschild
Rothschild, Julius
Familie Samuel Rothschild
Moses, Philip(p) s.d.
Rothschild, Ida s. Moses, Ida
Rothschild, Susanne “Sannchen”
Rothschild, Selma
Schaumberg, Rieke
Schaumberg, Samuel S.
Familie Liebmann Schloss S.
Schloss, Lidia s. Rath, Lidia
Schloss, Moritz
Selinger, Pfanni (s.a. Familie Zadock Lorsch) S.
Familie Hermann Speier
Speier, Franziska „Fanny“
Spier, Leopold
Familie Abraham Stein
Stein, Alice
Stein, Ernst
Stein, Heinz
Stein, Walter
Stein, Auguste
Stein, Clementine (s.a. Familie Joseph Rothschild)
Stein, Julius
Stein, Levi
Stein, Henny
Familie Salomon Stein
Stein, Albert
Stein, Bertha s. Löwenstein, Bertha
Stein, Cilly
Stein, Rosa s. Aaron, Rosa
Familie Gerson Steinberger
Steinberger, Hermann
Steinberger, Rebecka Franziska
Steinberger, Selma
Familie Juda Steinberger
Steinberger, Betti s. Stern, Betti
Steinberger, Julius
Steinberger, Selma
Steinberger, Therese s. Strauß, Therese
Strauß, Markus II s.d.
Stern, Betti (s.a. Familie Juda Steinberger)
Familie Julius Stern
Stern, Auguste
Stern, Julius
Stern, Walter
Stern, Johanna
Familie Marim Stern
Stern, Erna
Stern, Lore Marga
Stern, Lotte
Stern, Marim
Stern, Friedel Lotte
Straus, Max S.
Strauß, Auguste S.
Strauß, Kaufmann S.
Familie Josef Strauß S.
Strauß, Josef
Strauß, Meta
Strauß, Rebecka
Familie Salomon Strauß
Baer, Sally s.d.
Strauß, Ida s. Baer, Ida
Strauß, Jeanette Hannelore
Strauß, Markus II (s.a. Familie Juda Steinberger)
Strauß, Therese (s.a. Familie Juda Steinberger)
Sundheimer, Ida (s.a. Familie Gutkind Rothschild)
Wallach, Gerda
Familie Meier Wallach
Wallach, Adele s. Heinemann, Adele
Wallach, Elise s. Löwenbaum, Elise
Westheimer, Ilse
Zusammenfassung
Liste der Orte, Ghettos und Lager, in denen Alsfelder Jüdinnen und Juden umgekommen sind
Abkurzungsverzeichnis
Abbildungsnachweis
Einleitung
Heinrich Dittmar und Dr. Herbert Jäkel legten mit ihrem Buch „Geschichte der Juden in Alsfeld“ aus dem Jahr 1988 die Grundlage für alle weiteren Forschungen auf diesem Gebiet. Vor allem Heinrich Dittmar ist es zu verdanken, dass er die Liste der Juden, die Opfer des Holocausts wurden, ständig weiterschrieb und ergänzte, was vor allem seinen Kontakten zu Überlebenden, die er bis zu seinem Tod im Jahr 2014 pflegte, zu verdanken ist. Und so sind auch einige Berichte von Überlebenden des Holocausts, die von ihnen selbst geschrieben oder von Heinrich Dittmar aufgezeichnet worden sind, in dieses Buch eingeflossen. Sie berühren mehr, als es Geschichtsbücher vermögen. Zeigen sie doch hautnah, wie aus einem gesellschaftlichen Miteinander in einer ländlichen Kleinstadt wie Alsfeld auch hier nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 Ausgrenzung, Diskriminierung, Demütigung und Gewalt die Oberhand gewannen.
Immer wieder stellt sich dabei die Frage: Wie konnte es innerhalb so kurzer Zeit zu solch einem dramatischen Wandel kommen? Hatten die Christen ihre Menschlichkeit vollkommen vergessen? Natürlich berichten Zeitzeugen auch von Mitmenschen, die ihnen heimlich halfen, ihnen beistanden in diesen schweren Zeiten, vor allem auch, wenn es um die Auswanderung ging. Doch bleibt festzustellen, dass die Mehrheit der nationalsozialistischen, antisemitischen Propaganda und Politik erlag und ihr gehorsam folgte – selbst in der kleinen Stadt Alsfeld, wo jeder jeden kannte, teilweise schon seit Jahrzehnten, die Gluck und Leid der Nachbarn, Freunde und Kollegen teilten. Alsfeld ist diesbezüglich keine Ausnahme.
Das gesellschaftliche und vertrauensvolle Miteinander über Religionsgrenzen hinweg zeigt sich sehr gut an zwei Beispielen aus Alsfeld. So ist 1888 eine Hochzeit zwischen dem Juden Jacob Bamberger und der Christin Minna Bellinger in den Heiratsurkunden verzeichnet, und der Christ Karl Dechert zeigt den Tod des Juden Moses Flörsheim im Jahr 1927 an. Helmuth Riffer wies darüber hinaus darauf hin, dass viele Juden ab Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Kindern christliche Vornamen gaben.1 Juden waren in der Kommunalpolitik tätig, waren Förderer und Mäzene von Vereinen, wie beispielsweise dem Gesangverein Liederkranz, waren Vereinsmitglieder, Freunde, Nachbarn, Schulkameraden, Kriegskameraden im deutschfranzösischen Krieg 1870/71 und dem Ersten Weltkrieg, Geschäftspartner und -kunden sowie Arbeitgeber, beispielsweise in der Wallachschen Brauerei oder der Kleiderfabrik Steinberger & Co. All dies ging ab Anfang 1933 Stück für Stück verloren durch den Antisemitismus der Nationalsozialisten, der in einem beispiellosen Genozid endete.
Ab 1933 verschwanden nach und nach die vielen kleinen jüdischen Einzelhandelsgeschäfte in der Alsfelder Innenstadt, deren Besitzer auch Arbeitgeber waren, neben den größeren Unternehmen. Ihre Inhaber emigrierten oder gingen in größere Städte wie Frankfurt, Fulda oder Essen, weil sie glaubten, dort in der Anonymität besser geschützt zu sein, wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können. Einige Alsfelder Juden hatten versucht, sich durch die Emigration nach Belgien oder Frankreich den Schergen des Nazi-Regimes zu entziehen. Doch am Ende half auch diese Flucht nichts: Die nationalsozialistische Bürokratie und Polizei spürte sie überall auf, unterstützt nicht selten durch Spitzel und Denunzianten. Und so wurden über 100 Alsfelder Jüdinnen und Juden, jung und alt, Opfer des Holocausts. Sie starben in den Konzentrationslagern Auschwitz, Majdanek, Sobibor und Treblinka, den Ghettos Theresienstadt, Riga und Lodz, wurden misshandelt, entrechtet und gedemütigt in Internierungs-, Durchgangsund Sammellagern in Frankreich, Belgien, den Niederlanden. Auf einigen Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Alsfeld erinnern Gedenkinschriften an dieses Martyrium.
Auch in Alsfeld wurden die Machtübernahme der NSDAP und die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 mit einem Fackelzug gefeiert. Sie bedeuteten den Anfang des Endes der teilweise jahrhundertealten jüdischen Gemeinden in Europa.
Stolpersteine
Das Stolpersteinprojekt des heute im Alsfelder Stadtteil Elbenrod wohnenden Künstlers Gunter Demnig ist das weltweit größte dezentrale Kunstprojekt. Die Stolpersteine sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und werden vor deren letztem selbstgewählten Wohnort verlegt. Sie sollen die Erinnerung wachhalten an die Menschen, die verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben worden sind. Dazu gehören Juden, Sinti und Roma, Widerständler, kranke und behinderte Menschen, u.v.m.
Die ersten Stolpersteine verlegte Gunter Demnig ohne Genehmigung 1995 in Köln, die ersten mit Genehmigung 1997 in Salzburg und 2000 wiederum in Köln. Mittlerweile sind über 100.000 Stolpersteine in 21 europäischen Ländern verlegt.
Unumstritten war das Projekt Stolpersteine in der Anfangszeit nicht. Es gab immer wieder Proteste von Anwohnern, die einen solchen Stolperstein nicht vor ihrem Haus dulden wollten, um nicht daran erinnert zu werden, dass ihr Haus einmal Juden gehört hatte bzw. Juden dort gewohnt hatten. Vielleicht war auch Angst dabei, dass Nachfahren der ehemaligen Bewohner Regressansprüche stellen könnten, weil der Verkauf in der Nazizeit eventuell nicht ganz korrekt war. Einige waren auch der Meinung, dass beim Laufen über die auf Bürgersteigen oder in Füßgängerzonen eingelassenen Stolpersteine die Erinnerung an diese Menschen erneut im wahrsten Sinne des Wortes „mit Fußen getreten wird“. Dieses Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen, „stolpern“ doch am ehesten Besucher und Touristen in der Stadt über diese Steine. Dennoch ist dieses Kunstprojekt eine der wenigen Möglichkeiten, auf verfolgte und ermordete Menschen während des Nationalsozialismus hinzuweisen. Denn die Steine werden im öffentlichen Raum verlegt und können auch ohne eine Genehmigung von Anwohnern in den Bürgersteig eingelassen werden. Bei Hinweisschildern an den Häusern jedoch ist die Einwilligung der heutigen Besitzer nötig.
In Alsfeld sind in drei Aktionen 2009, 2010 und 2011 mittlerweile 42 Stolpersteine verlegt worden, die an die ehemaligen jüdischen Bewohner Alsfelds an ihrem wahrscheinlich letzten selbstgewählten Wohnort erinnern:
Adler, Friedericke
Hersfelder Str.
Baer, Ida
Steinborngasse
Baer, Sally
Steinborngasse
Bettmann, Jakob
Pfarrwiesenweg
Bettmann, Adele
Pfarrwiesenweg
Buxbaum, Levi
Mainzer Gasse
Flörsheim, Sally
Grünberger Str.
Doellefeld, Siegfried
Untergasse
Justus, Julius Juda
Ludwigsplatz
Justus, Rosa
Ludwigsplatz
Levi, Regine
Untergasse
Loeser, Hedwig
Ludwigsplatz
Lorsch, Arno
Rittergasse
Lorsch, Gustav
Rittergasse
Lorsch, Norbert
Rittergasse
Lorsch, Sara
Rittergasse
Lorsch, Selma
Rittergasse
Lorsch, Frieda
Mainzer Gasse
Lorsch, Johanna
Untere Fuldergasse
Lorsch, Karl
Untere Fuldergasse
Rothschild, Frieda
Obergasse
Rothschild, Isaak
Untergasse
Rothschild, Selma
Amthof
Speier, Fanny
Untergasse
Spier, Leopold
Mainzer Gasse
Stein, Alice
Zeller Weg 3
Stein, Walter
Zeller Weg 3
Stein Ernst
Zeller Weg 3
Stern, Marim
Untergasse 15
Stern, Erna
Untergasse 15
Stern, Lore Marga
Untergasse 15
Stern, Lotte
Untergasse 15
Stern, Auguste
Mainzer Gasse 1
Stern, Julius
Mainzer Gasse 1
Stern, Walter
Mainzer Gasse 1
Strauss, Auguste
Mainzer Gasse 20
Strauss, Jeanette Hannelore
Steinborngasse 12
Strauss, Josef
Altenburger Str. 21
Strauss, Rebecka
Altenburger Str. 21
Strauss, Meta
Altenburger Str. 21
Strauss, Markus II
Grünberger Str. 30
Strauss, Therese
Grünberger Str. 30
Stolpersteine fur Jeanette Hannelore Strauß, ihre Tante Ida Baer und deren Mann Sally Baer in der Steinborngasse 12
Nicht immer ist beim Verlegungsort von Stolpersteinen klar, ob dies wirklich der letzte selbstgewählte Wohnort der Menschen gewesen ist. Sind viele Juden aus Alsfeld wirklich unfreiwillig in größere Städte wie Frankfurt oder Essen gezogen, vor allem ab den Jahren 1935/36? Verließen sie freiwillig oder unfreiwillig ihre Heimat, in der ihre Familien zum Teil seit Generationen lebten, in der ihre Vorfahren beerdigt waren? Monica Kingreen (†) beschreibt die Flucht von Juden aus Landgemeinden in Großstädte sehr detailliert.2
Wie sicher und wohl fühlten sich die Juden in ihrer Heimatstadt Alsfeld noch nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933? In einer kleinen Stadt, wo jeder jeden kannte? Jeder wusste, wer Jude war? Wie fühlten sich Kinder in der Schule? Wie Erwachsene in ihren boykottierten Geschäften? Wie nach ihrem Ausschluss aus Vereinen und der Kommunalpolitik? Dem Verbot, Gasthäuser und Kinos, Schwimmbad zu besuchen? Wie nach der zwangsweisen Verordnung zum Tragen eines „Gelben Sterns“ und dem Tragen des Zweitnamens „Sara“ oder „Israel“? Wo war die soziale Geborgenheit in der Alsfelder Gesellschaft? Die Anerkennung und das Dazugehören?
Viele Alsfelder Juden verließen ihre Heimatstadt Alsfeld bereits kurz nach dem Machtantritt der NSDAP in Richtung USA, Palästina, Südafrika, wie beispielsweise der Lehrer der jüdischen Gemeinde, Leopold Kahn. Sie erkannten die Vorzeichen der Zeit und gingen wahrscheinlich nicht freiwillig. Sie suchten Schutz in der Fremde. Diejenigen, die noch blieben, waren in einem kleinen Landstädtchen wie Alsfeld schutzlos den Demütigungen und Angriffen von Nationalsozialisten und ihren Sympathisanten ausgeliefert. Kinder wurden in den Schulen ausgegrenzt und gedemütigt, wie es Michael Maynard alias Manfred Moses, der 1922 in Alsfeld geboren worden ist und seine Eltern und seine Großmutter im Holocaust verlor, beschreibt.3 Als er nach Frankfurt kam, erlebte er, wie gut es ihm tat, unerkannt durch die Stadt zu laufen, anonym zu bleiben. Keiner kannte ihn. Er besuchte Kinos und Museen, ohne Diskriminierung und Einschränkung. Auch Mathilda Wertheim Stein beschreibt die Qualen, denen sie in der Schule in Alsfeld ausgesetzt war.4
Mit ihrem Wegzug aus Alsfeld in eine Großstadt wie Frankfurt hofften die Alsfelder Juden, dass sie in einer größeren Gemeinschaft geschützter waren. Sie konnten halbwegs anonym ihr Leben leben, zumindest in der Anfangszeit des Nationalsozialismus. Darüber hinaus war es wesentlich einfacher, von hier aus zu emigrieren. Freiwillig kann man einen Umzug mit solchen Gedanken nicht nennen. Und dennoch erinnern in Frankfurt drei Stolpersteine an ehemalige Alsfelder Juden, an die auch jeweils ein Stolperstein in Alsfeld erinnert: Alice Stein und Auguste Strauss sowie Josef Strauß. Wo war ihr letzter selbstgewählter Wohnort? Oder ist das nicht wichtig angesichts des Leids, das diese Menschen durchgemacht haben?
Quellen
In dem Buch „Geschichte der Juden in Alsfeld“ finden sich Gedenklisten der umgekommenen Alsfelder Juden (S. 116 ff.), Alsfelder Juden, die nach außerhalb heirateten oder aus anderen Gründen verzogen (S. 118 f.) sowie vorübergehend in Alsfeld wohnender Juden (S. 119). Diese Listen sind vollständig überarbeitet und ergänzt worden durch die zahlreichen Online- Datenbanken, die mittlerweile zur Verfügung stehen und die ständig erweitert werden, so dass auch in Zukunft sicher noch neue Erkenntnisse über Opfer des Holocausts hinzukommen werden.
Für dieses Buch wurden folgende Online-Datenbanken durchgesehen:
www.alemannia-judaica.de
www.arolsen-archives.org
www.auschwitz.org
www.bundesarchiv.de
www.holocaust.cz
www.lagis-hessen.de/pstr
www.ushmm.org
www.yadvashem.org
Durch diese Recherchen konnten einige neue Holocaustopfer identifiziert werden. Hinzu kommen Ergänzungen aus lokalgeschichtlichen Gedenkbüchern wie beispielsweise Angenrod, Bobenhausen II, Kestrich und Lauterbach. Leider fehlen noch viele Zusammenstellungen von Holocaust-Opfern aus Ortschaften im Vogelsberg. Es wäre wichtig für das Gedenken an diese Menschen, wenn auch hier entsprechende Publikationen folgen würden.
Weiterhin waren Veröffentlichungen aus Hessen bei den Recherchen sehr hilfreich, wie das im Jahr 2022 erschienene Buch von Monica Kingreen über die Deportation der Juden aus Hessen. Eine weitere wichtige Quelle sind Zeitzeugen- und Zeitungsberichte aus Alsfeld.
Zum Buch
Dieses Buch listet in alphabetischer Reihenfolge die Namen der Alsfelder Holocaust-Opfer auf. Dabei wurde bewusst auf die Trennung zwischen Alsfelder Jüdinnen und Juden, in Alsfeld geborene und kurzzeitig in Alsfeld lebende verzichtet. Lediglich in einer vorangestellten Liste werden die 1933 in Alsfeld wohnenden alteingesessenen Juden, nach der Zusammenstellung von Dittmar/Jäkel, fett gedruckt, in Alsfeld geborene und später nach Auswärts verzogene kursiv und diejenigen, die nur zeitweise in Alsfeld lebten, in Standard, damit eine Vergleichbarkeit mit „Geschichte der Juden in Alsfeld“ gegeben ist.
Alle erreichbaren Informationen sind in biografischen Skizzen der Opfer angegeben. Dazu gehören auch einige Fotos, die sich vor allem in der Datenbank von Yad vashem finden. Ansonsten gibt es leider nur sehr wenige Abbildungen von Alsfelder Juden.
Neben den biografischen Skizzen ist versucht worden, einzelne Personen Familien zuzuordnen und Stammbäume zu erstellen. Diese Stammbäume zeigen die Lücken auf, die die nationalsozialistische Vernichtungspolitik auch in Alsfelder jüdische Familien gerissen hat, in Familien, die zum großen Teil seit Generationen in Alsfeld und Umgebung lebten, für die unsere Heimat auch einmal Heimat gewesen ist.
In einigen Online-Datenbanken, aber auch bei Dittmar/Jäkel, werden Personen aufgeführt, die nicht in Alsfeld, sondern einem Ort der heutigen Stadt Alsfeld bzw. einem Ort des Altkreises Alsfeld (bis 1972) angehört haben, und nach jetzigem Kenntnisstand auch nicht kurz in Alsfeld gewohnt haben. Diese Menschen sind in diesem Buch nicht aufgenommen worden, so dass es u.a. beim Vergleich der Liste in diesem Buch und der bei Dittmar/Jäkel zu Unstimmigkeiten kommen kann.
Einige Angaben in den Online-Datenbanken sind darüber hinaus sehr widersprüchlich. Es wurde versucht, diese Widersprüche so weit möglich aufzulösen, dies gelang jedoch nicht in allen Fällen. Vor allem bei den angegebenen Wohnorten der Opfer konnten diese nur relativ selten alle in einen chronologischen oder logischen Zusammenhang mit dem Lebenslauf gebracht werden.
Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Online zur Verfügung gestellte Dokumente in Datenbanken können hoffentlich in Zukunft weitere Lücken in den Lebensläufen füllen. Dittmar/Jäkel legten den Grundstein für diese Veröffentlichung, die nur ein weiterer Baustein zu einer vollständigen Erfassung aller Opfer sein kann.
1 Helmuth Riffer in: Kulturverein Lauterbach e.V. (Hg.), Fragmente… jüdischen Lebens im Vogelsberg, Lauterbach 1994, S. 35
2 s.u.a. Kingreen, Deportation, S. 24 ff.; dies., (Hg.), “Nach der Kristallnacht“. Jüdisches Leben und antijüdische Politik in Frankfurt am Main 1938-1945, Frankfurt/New York 1999, S. 119 ff.
3 s. Kingreen, Deportation, S. 31
4 Mathilda Wertheim Stein, Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung, mit einem Vorwort von Heinrich Dittmar, in: Heimat-Chronik, 20. Jahrgang 2003, Heft 1
Liste der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus aus Alsfeld
101 Menschen konnten nach derzeitigem Forschungsstand ermittelt werden, Otto Volk nennt die Zahl 118.5 Bei Dittmar/Jäkel ergibt sich die Zahl von 88 Opfern.
Aaron, Rosa
Adler, Betty
Adler, Fanny
Adler, Friederike
Adler, Hans Herbert Norbert
Adler, Moritz
Baer, Ida
Baer, Sally
Bauer, Frieda
Bettmann, Adelheid
Bettmann, Hermann
Bettmann, Jacob
Blumenthal, Hans Hermann
Blumenthal, Rosa
Buxbaum, Levi
Doellefeld, Siegfried
Flörsheim, Sally
Freund, Sara
Gurassa, Sidonie
Heinemann, Adele
Hill, Cips/Sidda
Isaac, Joseph
Joseph, Lydia
Justus, Julius Juda
Justus, Rosa
Katz, Klara
Kaufmann, Jenny
Lamm, Julius
Levi, Regine





























