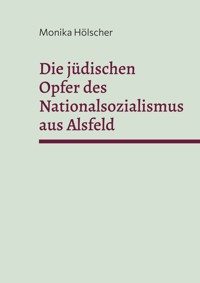Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Landhebammen gehörten Mitte des 20. Jahrhunderts zu den ersten motorisierten Frauen und für ihre Ausbildung verließen sie für mehrere Monate ihre Familien. Sie waren 24 Stunden für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen da, trugen die Verantwortung für das Leben der Frauen und ihrer Kinder. Umso erstaunlicher ist es, dass Landhebammen in der Lokalforschung kaum erwähnt werden. Anhand von zahlreichen Biografien und Fotos zeichnet die Autorin ein Bild vom oft harten und entbehrungsreichen Leben dieser bemerkenswerten Frauen in Alsfeld und dem nordwestlichen Vogelsberg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Der Beginn der Hebammenausbildung in der Provinz Oberhessen im 19. Jahrhundert
Hebammen in Alsfeld bis zum 19. Jahrhundert
Hebamme Elisabetha Margaretha Bommes
Hebammen in Alsfeld im 20. Jahrhundert
Hebamme Gudrun Fuhrmann
Hebamme Irma Lißberger
Das Alsfelder Krankenhaus und private Entbindungsheime in Alsfeld
Hebammen im „Dritten Reich“
Hebammen in Alsfelder Stadtteilen
Hebamme Marie Löb
Hebammen in Gemeinden des ehemaligen Landkreises Alsfeld
Feldatal
Eine Wöchnerin erzählt
Grebenau
Hebamme Marie Ochs
Hebamme Johanna Brettschneider
Homberg/Ohm
Hebamme Gertrud Hauffe
Kirtorf
Geburten in der jüdischen Gemeinde im 19. Jahrhundert
Hebamme Sophie Ehrhardt
Romrod
Hebamme Karoline Groß
Hebamme Berta Hamel
Die Tagebücher der Berta Hamel
Die Rechnungsbücher der Berta Hamel
Auswertung: Eine zeitgeschichtliche Dokumentation
Zusammenfassung
Register
Abbildungsnachweis
Vorwort
Am 24. Dezember 2016 hielt ich beim Christkindwiegen, einer jahrhundertealten Tradition auf dem Turm der Walpurgiskirche in Alsfeld, einen Vortrag zum Thema „Hebammen in Alsfeld und dem Vogelsberg“. An Heiligabend wird die Geburt Christi gefeiert. Was lag also näher, als sich einmal beim Christkindwiegen mit den Menschen zu beschäftigen, die bis heute, wenn auch in wesentlich geringerem Umfang, so vielen Menschen halfen, das Licht der Welt zu erblicken: den Landhebammen1.
Dem Vortrag folgte eine erste Veröffentlichung in der Heimat-Chronik, einer Beilage der Oberhessischen Zeitung, 33. Jahrgang 2017, Heft 1 und 2.
Das Thema stieß auf ein unerwartet großes Interesse, so dass ich in den folgenden Monaten zahlreiche Vorträge, zum größten Teil gemeinsam mit der ehemaligen Alsfelder Hebamme Irma Lißberger, hielt. Dies hatte zur Folge, dass immer mehr Material in Form von Dokumenten, Fotos, Anmerkungen und Anekdoten durch Zuhörerinnen zusammengekommen war, die eine umfangreichere Veröffentlichung sinnvoll erscheinen ließen.
Dieses nun vorliegende kleine Buch über Hebammen in Alsfeld und dem nordwestlichen Vogelsberg, mit dem Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert, verdankt sein Zustandekommen also zahlreichen Menschen. Hier sei in besonderem Maße auch Gisela Zeidler aus Liederbach genannt, die mir bei einem Besuch Anfang des Jahres 2016 ein Foto der Liederbacher Hebamme Marie Pabst zeigte – und damit mein Interesse an diesen Frauen weckte. Im Laufe der Zeit konnten durch zahlreiche weitere Interessierte viele kleinere und größere Lücken in der Überlieferung geschlossen werden. Mein besonderer Dank gilt neben diesen auch der bereits erwähnten ehemaligen Alsfelder Hebamme Irma Lißberger, die mir mit Rat und Tat immer zur Seite stand, sowie dem Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins der Stadt Romrod, Horst Blaschko, der mir auch den Kontakt zur Tochter der Strebendorfer Hebamme Berta Hamel, Irma Klose, vermittelte. Irma Klose stellte mir einen ganz besonderen Schatz zur Verfügung: die Tagebücher und Rechnungsbücher ihrer Mutter, die von 1940 bis 1978 als Hebamme in Romrod und seinen Stadtteilen tätig war. Diese Bücher sind außerordentliche zeitgeschichtliche Dokumente, die in dieser Veröffentlichung einen entsprechenden Platz bekommen. Auch sei Dr. Norbert Hansen und Hans-Jürgen Stinder vom Stadtarchiv Alsfeld für ihre Hilfe und Unterstützung bei der Auswertung des umfangreichen Materials sowie Dr. Ingrid Schill und Horst Blaschko für das Korrekturlesen herzlich gedankt, und vielen anderen, die im Buch genannt werden.
Letztendlich ist dieses Buch ein Werk vieler Menschen, die dazu beigetragen haben. Es ist ihr Buch und wird hoffentlich auch jüngeren Vogelsbergerinnen und Vogelsbergern eine längst vergangene und fast vergessene Geschichte ihrer Heimat näher bringen. Hebammen haben unser aller Respekt verdient – gestern und heute.
Diesen besonderen Frauen ist dieses Buch gewidmet.
Monika Hölscher
1 Das Wort Hebamme (9. Jh.) kommt aus dem mittelhochdeutschen hebeamme. Das „heben“ bezieht sich wahrscheinlich auf das Heben des Kindes unmittelbar nach der Geburt. Die neuere Bezeichnung Hebamme beruht auf der Vermischung mit Amme in der Bedeutung von Mutter (Kluge Etymologisches Wörterbuch; Berlin, 2002).
Einleitung
Hebamme ist einer der ältesten Frauenberufe, die es schon in der Antike, und mit großer Wahrscheinlichkeit in der schriftlosen Zeit davor auch gab. Es waren weise Frauen, Kräuterfrauen, Heilkundige, Heilerinnen. Im Babylonien des 2. bis 1. Jt. v.Chr. gab es beispielsweise schon Ärztinnen und Hebammen, die in Keilschrifttexten erwähnt werden. Eine schwangere Frau wird auf Tontafeln dort u.a. als „volles Boot“ beschrieben, das mit seiner „Ladung“ zum „Hafen des Lebens“ steuert, oder wird während der Geburt mit einem Krieger in der Schlacht verglichen.2
Im Alten Ägypten galt die Frau, sobald die Zeit ihrer „Reinigung“ (Periode) gekommen war und die Monatsblutung ausblieb, als „unrein“ und sie wurde (in Oberschichten) in eine „Wochenlaube“ umgesiedelt, einem kleinen Gebäude im Freien, auf dem Dach, im Innenhof, im Garten. Ob die Schwangere die ganze Zeit ihrer Schwangerschaft in der Wochenlaube verbrachte, ist nicht bekannt. Sie gebar dort jedenfalls ihr Kind mit Hilfe von Frauen aus der Familie oder Nachbarschaft, die sich auf Geburtshilfe verstanden.3 Beim gemeinen Volk dürfte die Geburt ebenfalls mit Hilfe erfahrener Frauen, aber wohl im Wohngebäude stattgefunden haben. Hieroglyphen zeigen schwangere, gebärende und stillende Frauen, vielleicht auch eine, die einen Gebärstuhl bezeichnet bzw. darstellt (msnet).4 Beschützt wurden die Schwangeren und Wöchnerinnen von zahlreichen Dämonen und Schutzgeistern, wie Thoëris und Bes, die durch ihre abschreckende Gestalt alles Böse von Frau und Kind fernhalten sollten.
Abb. 1: Bes im Tempel von Dendera (Ptolemäerzeit, Bauzeit 323-30 v.Chr.). Der volkstümliche Schutzgeist wird meist als missgestalteter Zwerg mit fratzenhaftem Gesicht und einem Löwenfell dargestellt. Er beschützt vor allem die Familie, Frauen bei der Geburt und das Neugeborene.
Abb. 2: Altägyptische Hieroglyphen, die schwangere, gebärende und stillende Frauen darstellen.
Abb. 3: Geburtsszene am Grabbau einer römischen Hebamme.
Auch aus römischer Zeit sind Frauen bekannt, die als Chirurginnen und Hebammen tätig waren.5
In der „Alsfelder Weihnacht 1517“ hören wir nichts von einer Hebamme, die Maria bei der Geburt beistand, im Protoevangelium des Jakobus allerdings, besser bekannt als Apokryphen, sucht Joseph nach einer hebräischen Hebamme, die bei der Geburt Jesu helfen soll6 und im 3. Buch Mose, Kap. 12, 1-8 kann man im „Gesetz für die Wöchnerinnen“ nachlesen, wann eine Frau nach der Geburt eines Knaben oder Mädchens wieder „rein“ wird.
Um Neugeborene vor bösen Dämonen zu schützen, bedienten sich die Menschen in früheren Zeiten auch oft Beschwörungen, Amuletten, mit Abwehrzauber beschriebenen Zetteln oder magischen Objekten. Im Museum Judengasse in Frankfurt, das Anfang 2016 nach einer grundlegenden Neukonzipierung wieder eröffnet worden ist, sind auch die Grundmauern eines Hauses zu besichtigen, in dem offensichtlich eine Hebamme gewohnt hatte. So wurde u.a. ein Messer für magische Zwecke bei der Geburt gefunden.7 Den Ritus des „Bekrasens“, bei dem ein solches Messer vielleicht benutzt wurde, hat der aus Alsfeld stammende Jude Hermann Rothschild in einem Schreiben vom 6. Mai 1927 an den Geschichts- und Altertumsverein der Stadt Alsfeld ausführlich beschrieben8:
Abb. 4: Lilith, die Dämonin der Nacht.
„[…] Der Inhalt ist eine Beschwörung gegen einen bösen Geist, der Gewalt über Wöchnerinnen und Neugeborene hat und sie tötet. Dieser Aberglaube, der seit hunderten von Jahren im Volke besteht, gründet sich auf die jüdische, alte Sage von Lilith, einer Dämonin, welche wie Adam aus Erde geschaffen worden war. Sie war Adams erstes Weib. Weil kein Frieden zwischen beiden war, entfloh sie in die Lüfte. Der Herr schickte drei Engel als Boten zu Lilith, damit sie zu Adam zurückkehre. Würde sie nicht umkehren, so sollten täglich hundert von ihren Kindern sterben. Die Engel fanden Lilith im Meere(!) stehend und richteten ihre Botschaft aus. Lilith wollte nicht umkehren. Die Engel wollten sie daraufhin im Meere ertränken. Lilith sprach: Lasset ab von mir, wisset ihr nicht, daß es meine Bestimmung ist, Jünglinge zu verderben; ist’s ein Knabe, so habe ich bis zu seinem 8ten Tage über ihn gewacht, ist’s ein Mädchen, so habe ich sie bis zum 20ten Tage. Sie schwor ihnen jedoch im Namen des lebendigen Gottes, daß sie allezeit, wenn sie die Gestalten der Engel über ihren Namen erblicken werde, von dem Kinde lassen würde. Die drei Engel hießen: Sanvai, Sansanvi und Semangelof. Diese drei Namen schreibt man auf die Amulette der Neugeborenen und hängt sie an das Bett der Wöchnerin, damit sie Lilith sehe und Kind und Wöchnerin verschone. […] Bei den alten Deutschen war die Holle dem Neugeborenen gefährlich. Sie will ihn in ihr unterirdisches Schattenreich entführen. Diese Sage hat sich in jüdischen Kreisen, in einer jüdischen Kultushandlung, der sogenannten Holle-Kreisch erhalten. Kinder bilden einen Kreis um das Neugeborene, und indem sie den Namen des Neugeborenen laut rufen (kreischen), vertreiben sie die gefährliche Holle. In dem Worte kreisen (gleich gebären) hat die deutsche Sprache den kultisch-mythologischen Hergang erhalten. Das eindringende Christentum verbot hinzu Bekennern den Gebrauch, der sich in jüdischen Kreisen bis heute erhalten hat. Zum Hollemythos gehört auch das Bekrasen, das bei den fränkischen Juden noch bis in die Neuzeit hinein auf dem Land geübt wurde. Nachbarinnen umstellen das Bett der Gebärenden. Mit einem Messer werden Kreise in der Luft geschrieben & dabei ausgerufen: ‚Wir wollen dies bekrasen (bekreisen). Unser Herrgott soll’s wasen (wissen). So sind Ziegel auf dem Dach, soviel Engel sind wach‘“.
Nicht nur in der kirchlichen Kunst werden Mutter und Kind, wie Maria mit ihrem Neugeborenen und ihre Mutter Anna mit ihrer Tochter Maria, recht oft dargestellt, auch aus vielen vorchristlichen Kulturen sind sie überliefert. Die bekannteste dürfte die altägyptische Göttin Isis mit ihrem Sohn Osiris sein. Wohl in jeder Epoche standen den Frauen bei der Geburt erfahrene ältere Frauen zur Seite. Die Erfahrung dieser Frauen entschied nicht selten über Leben und Tod der Mutter und des Kindes.
Abb. 5: Eucharius Rößlin, Rosgarten: "... wie sich ein jede Frawin vor und nach der geburt halte soll und wie man ir in harter geburt zu hilft kommen soll."; Holzschnitt von 1513
Schwangerschaft und Geburt waren reine Frauensache. Und weil die Männer nicht wussten, was bei der Geburt so alles passierte, begegneten sie den Hebammen, vor allem im Mittelalter, nicht selten mit Misstrauen. Dass Hebammen aber besonders unter der neuzeitlichen Hexenverfolgung gelitten hätten, ist nach neueren Untersuchungen nicht belegbar. Nur ein geringer Prozentsatz der hingerichteten Frauen war in der Geburtshilfe tätig. Sie wurden in manchen Fällen sogar zu Rate gezogen, wenn es um Schwangerschaften bei Hexenprozessen ging. Ganz ungefährlich war die Tätigkeit der Hebamme dennoch nicht: Starb das Kind, was bei den unhygienischen Zuständen früher nicht ungewöhnlich war, oder war es missgebildet, konnte es durchaus passieren, dass man der Geburtshelferin vorwarf, das Neugeborene getötet (Das Körperfett eines Neugeborenen wurde zur Herstellung der Flugsalbe der Hexen benötigt…) oder vertauscht zu haben („Wechselbalg“). Auch im Hexenhammer kann man lesen, dass „hexende Hebammen die Neugeborenen dem Teufel opfern“.
Auf der anderen Seite jedoch waren die Dienste der Hebammen sehr gefragt. Nicht nur bei den schwangeren Frauen. Hebammen galten als Heilerinnen und durften sogar bei entsprechender Ausbildung / Befähigung chirurgische Eingriffe vornehmen, z.B. einen Kaiserschnitt. Bekannt ist die Ärztin Tortula aus Salerno (um 1100), die Werke über Frauenheilkunde verfasste und die als „Kaiserin der Hebammen“ dargestellt wird.9
Abb. 6: Kaiserschnitt im Mittelalter, den die Mutter wahrscheinlich nicht überlebte.
Der erste Kaiserschnitt der Geschichte, den Mutter und Kind überlebten, wurde im Jahr 1500 vom Schweinekastrator Jacob Nufer in der Schweiz an seiner eigenen Frau durchgeführt.10
Gegen Ende des Mittelalters trat die Frau als Ärztin, d.h. eigentlich Chirurgin, Wundärztin, immer mehr hinter dem Mann zurück. Um 1600 verschwand sie fast vollständig aus dem Berufsleben allgemein. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts öffneten sich die Universitäten in den USA und den meisten Ländern Europas für ein Frauenstudium. 1901 promovierte in Freiburg die erste deutsche Frau zum Dr. med.
Es gab jedoch auch eine dunkle Seite des Hebammenberufes: Engelmacherin11. Als Engelmacher wurden Ärzte, Hebammen, Heiler oder auch medizinisch nicht vorgebildete Menschen bezeichnet, die mittels Werkzeugen wie Stricknadeln oder Chemikalien, (giftigen) Pflanzen oder Seifenlauge illegal Schwangerschaftsabbrüche durchführten, was nicht selten auch zum Tod der Schwangeren führte.
Als Engelmacherin wurde ab dem 19. Jahrhundert darüber hinaus auch eine Frau bezeichnet, die uneheliche Pflegekinder sterben ließ oder ermordete, um sich am Pflegegeld zu bereichern. Ein bekannter Fall ist hier die Hebamme Elisabeth Wiese (1853-1905) aus Hamburg, die mindestens fünf Kinder tötete, darunter auch ihr eigenes Enkelkind. 1905 wurde sie dafür durch Guillotine hingerichtet.
Doch solche Hebammen waren die Ausnahmen.
Soweit ein sehr kurzer allgemeiner Überblick.
2 Ulrike Steinberger: Von inneren Räumen und „blühenden“ Landschaften. Der weibliche Körper in der babylonischen Medizin; Antike Welt 2/2015, S. 19ff.
3 Bettina Schmitz: Tochter – Ehefrau – Mutter. Frauenalltag im Alten Ägypten, in: Waren sie nur schön? Frauen im Spiegel der Jahrtausende; Hg. B. Schmitz und U. Steffgen, Mainz 1989, S. 105ff.
4 Raymond O. Faulkner: A concise dictionary of Middle Egyptian; Oxfold 1981, S. 117
5 s. u.a. E. Künzl, H. Engelmann: Römische Ärztinnen und Chirurginnen; in: Antike Welt 5/1997, S. 375ff.
6 Erich Weidlinger: Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel; Augsburg 1995, S. 442
7 Die Frankfurter Judengasse – Geschichte, Politik, Kultur. Katalog zur Dauerausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt, hrsg. von F. Backhaus, R. Gross, S. Kößling, M. Wenzel; München 2016. Auf S. 171 wird dort jedoch ein anderer Brauch mit dem Messer beschrieben.
8 s. Monika Hölscher: Lilith – von der Kinder mordenden Dämonin zur Femme fatale; Heimat-Chronik 1/2008
9 Natascha Noll: Medizin und der Dienst am Kranken im Mittelalter, in: Elisabeth in Marburg. Der Dienst am Kranken; Katalog zur Ausstellung; Marburg 2007
10 Felix Rettberg: Die Stunde des Kastrators; in: Spiegel. Edition Geschichte 1/2016, S. 106f.
11 Wikipedia „Engelmacher“; abgerufen am 25.12.2018
Der Beginn der Hebammenausbildung in der Provinz Oberhessen im 19. Jahrhundert
Hebammen wurden bis Anfang des 19. Jh. von ihren Vorgängerinnen angelernt, erst danach finden sich erste öffentliche Institutionen, die mit der Hebammenausbildung beauftragt wurden.12 Für die Provinz Oberhessen war dies die Gebär-Anstalt in Gießen, für Kurhessen waren Mainz und Marburg zuständig. Direktor der ungsanstalt, dem Vorläufer der Universitäts-Frauenklinik Gießen, war von 1814, dem Jahr der Eröffnung, bis 1837 der Professor der Chirurgie und Geburtshilfe Ferdinand August Maria Franz von Ritgen (1787-1867), der 1824 ein „Handbuch der Geburtshülfe“ herausbrachte. Damit gehörte die Gießener Gebäranstalt mit anderen zu den ersten stationären Kliniken in Deutschland. In ihr konnten Gebärende entbinden, wurden kranke Frauen behandelt, sie war Lehranstalt für Studenten und Hebammen und diente der Wissenschaft. Bis 1828 sind dort rund 500 Hebammen ausgebildet worden.
Im „Alsfelder Wochen-Blatt für amtliche, Privat- und locale Interessen“ vom 25. Dezember 1841 informiert der Großherzogliche Provinzialcommissairs der Provinz Oberhessen über den Hebammenunterricht in Gießen, der vom 1. März bis zum 31. Mai, und vom 1. September bis zum 30. November stattfindet, sowie über den anfallenden Kostenbetrag in Höhe von 46 Gulden, der von den angehenden Hebammen selbst zu entrichten war. Im Allgemeinen Intelligenzblatt für den Kreis Alsfeld vom 1. Januar 1864 werden die großherzoglichen Bürgermeistereien vom großherzoglichen Kreisamt Alsfeld aufgefordert, das Verzeichnis über die Hebammen einzusenden.
Abb. 7: Darstellung einer Geburt im Krankenhaus, Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert.
12 Es gab bereits 1751 in der Berliner Charité die erste deutsche Hebammenschule, die im 18. Jahrhundert als eine der berühmtesten in Europa galt (s. www.kulturwerte-mv.de: Aus dem Tagebuch einer Hebamme).
Hebammen in Alsfeld bis zum 19. Jahrhundert
„Joseph, mich haben gepackt die Wehn…“
„Joseph, lieber Gevatter mein, hilf mir wiegen das Kindelein,
daß Gott, der Magd Maria Sohn, im Himmelreiche dich belohn‘,
Joseph, nimm die Wiege in die Hand, laß mein Kind dir sein bekannt,
wieg‘ es säuberlich und fein, daß es ja nicht wein‘.“
„Doch, Joseph, eins will ich dir klagen, das mag ich mir vor Jammer nicht versagen,
daß mir Windel und Windelband leider sind unbekannt,
daß ich das zarte Kindelein einmal könnte wickeln ein.
Drum brauch‘ ich deine Hilfe zart, daß es bleibt vor Frost bewahrt.“
„Auch heiß‘ es stillen der Mägde eine, das Kindelein, daß es nicht weine.“13
Diese Zitate stammen aus der berühmten „Alsfelder Weihnacht 1517“ und sind wahrscheinlich die ersten schriftlichen Überlieferungen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Säuglingspflege in Alsfeld. Entgegen der alten Mär, dass die Alsfelder Kinder vom Storch aus dem Grabborn, einem Kinderbrunnen, geholt und den Müttern ins Kindbett gebracht wurden14, gab es aber tatsächlich Hebammen auch in Alsfeld.
Die ersten mehr oder weniger namentlich erwähnten Hebammen finden sich in Alsfelder Beamtenlisten.15
Dies und die Formulierungen „angenommen“ und „vereidigt“ zeigen, dass diese Frauen von Anfang an in städtischen Diensten standen:
1579 – 1584 die Hinterbliebene16 von David Fritsch
ab 1607 die Hinterbliebene von Peter Glitsch
1635 Eva, des Andreas Klingelspor aus Heimertshausen17 Frau
1644 Catharina Bauer
1657 „Elschen, die Kühhirtin. Sie heißt: Elisabeth, Wendel Finks Hausfrau“18
1665 die Hausfrau Katharina Raab
1677 Judith, die Tochter der vorhergehenden Hebamme
1715 Anna Schwerd, Ehefrau des Bürgers und Bäckers Philipp Schwerd
1729 Gela Friedrich, eine 77 Jahre alte „Wehmutter“, die 1729 um die Annahme einer zweiten Hebamme bittet – verständlich, wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter für Frauen zu dieser Zeit noch keine 50 Jahre betrug.
Das Beispiel von „Elschen, der Kühhirtin“ 1657 zeigt sehr eindrücklich, dass es für Hebammen bis Anfang des 19. Jh. keine geregelte Ausbildung gab, man aber wohl davon ausgehen kann, dass sie über die Geburtshilfe hinaus auch über Kenntnisse bei spezifischen Frauenbeschwerden verfügten oder in der Kräuterheilkunde bewandert waren – nützlich sowohl für Mensch als auch Tier!
Letzteres gilt im Übrigen auch für den einen oder anderen männlichen Heilkundigen, der ebenfalls in der Beamtenliste aufgeführt wird, wie Henn Walrodt 1559, der auch kranke Schweine „geartztet“ hat, oder Baltin Urban 1590, „daß er einem armen Knaben seine böse Hand kuriert“, er war auch Turmmann, Heinz Ostermann heilt 1591 ein Pferd, und Meister Andreas löst 1610 ein Bein ab. Als Ärzte im weitesten Sinne waren auch die Apotheker und Stadtbader nicht nur in Alsfeld tätig. Der erste namentlich erwähnte Arzt in der Beamtenliste ist übrigens Dr. Johann Bartholomaeus Schleiermacher aus Wildungen, der 1655 vom Rat der Stadt bestellt worden ist.
In weiteren, nicht vollständigen, Dokumenten im Stadtarchiv Alsfeld finden sich ab 1800 folgende Namen von Hebammen:
1800 Anne Margaretha Döring, Witwe
1824 Philippine Lang und Clare Bücking; beide haben ihre Ausbildung ebenfalls in Gießen gemacht und sind zeitgleich tätig. Ab diesem Zeitpunkt sind meistens mindestens zwei, manchmal sogar drei Hebammen für Alsfeld zuständig; P. Lang stirbt 1826.
1829 Clare Bücking 1. Hebamme, Sibylle Barbara Hartmann, geb. Hill, 2. Hebamme
1830 – 1836 Elisabetha Margaretha Bommes 2. Hebamme, Clare Bücking 1. Hebamme
1837 die Frau von Koch 2. Hebamme, Clare Bücking 1. Hebamme
1841 – 1849 Gertraud Martin 3. Hebamme, die Frau von Koch 2. Hebamme, Clare Bücking 1. Hebamme
1849 – 1871 (?) Gertraud Martin 1. Hebamme, Clare Bücking geht in Ruhestand, die Frau von Koch wohl 2. Hebamme
1853 Elisabetha Formhals, geb. Allendorf, die Frau von Elias Formhals
1857 – 1870 Hebamme Mutter
1868 – 1896 (†) Katharina Gebhardt, geb. Hill
1889 – 1895 Louise Feiser (Dienstquittierung)
Hebamme Elisabetha Margaretha Bommes19
Am 8. Juni 1830 erhielt der Großherzogliche Landrat Neidhardt zu Alsfeld ein Schreiben der Großherzoglich Hessischen Regierung der Provinz Oberhessen, in dem er aufgefordert wurde, die Kosten für Unterricht, Verköstigung und Logis der Hebammenschülerin Bommes aus Alsfeld in Höhe von 40 Gulden und 20 Talern binnen acht Tagen zu begleichen, da das Entbindungsinstitut in Gießen, wo diese zu diesem Zeitpunkt zur Hebamme ausgebildet wurde, „dringende Ausgaben zu begleichen“ habe. Diese Kosten wurden an die Stadt Alsfeld und an Georg Jakob Ramspeck, der zu diesem Zeitpunkt erst fünf Jahre(von insgesamt 45 Jahren) Bürgermeister der Stadt Alsfeld war, weitergegeben.
Nur eine Woche später, am 14. Juni 1830, erhielt der Bürgermeister einen Brief vom Direktor der Gießener Gebäranstalt:
„Nachdem die Ehefrau des Peter Bommes aus Alsfeld den Unterricht in der Hebammenkunst vom 31en März bis 15en Juni 1830 in dem hiesigen Gebärhause genossen hat, bey Geburten zugangen gewesen ist, dabey selber Beistand geleistet, die neu geborenen Kinder selber verpflegt, überhaupt sich in Besuch und Hebammenkunst an Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen und neu geborenen Kindern geübt hat, ist dieselbe am heutigen Tage über die nöthigsten Gegenstände, welche eine wohl unterrichtete Hebamme wissen muß, geprüft worden. Daß dieselbe in dieser Prüfung ganz vorzüglich gut bestanden sey, wird hierdurch beglaubigt. Auch ist ihr der zweite Preiß zuerkannt worden.
Gießen, den 14. Juny 1830“
Abb. 8: Darstellung einer Hausgeburt, 19. Jahrhundert.
Der Direktor der Gebär-Anstalt daselbst Dr. Ritgen Der Preiß besteht in einer Denkmünze des höchst verstorbenen Großherzogs in Bronze. […]“
Weitere vier Tage später empfing Elisabetha Margaretha Bommes als 2. Hebamme nach Clare Bücking die notwendigen „Hebammen-Apparate“: einen Gebärstuhl nebst ledernem Kissen, eine glatte, oben eingekerbte, gebogene Nabelschere, eine große Klistirspritze, eine kleine Klistirspritze mit aufschraubbarem Mutterrohr; das Lehrbuch der Hebammenkunst von Dr. Ritgen wurde ihr am 7. Juli 1830 vom Bürgermeister ausgehändigt.
Elisabetha Margaretha Bommes, geb. Koch, schien eine erfolgreiche Karriere als Hebamme in Alsfeld bevorzustehen: ein hervorragendes Zeugnis, eine hohe Auszeichnung und gleich nach Abschluss ihrer Ausbildung die Anstellung als 2. Gemeindehebamme bei der Stadt.
Abb. 9: Gebärstuhl
Über die folgenden sechs Jahre hörte man nicht viel von ihr. Lediglich in einem Schreiben des Großherzoglichen Kreisraths des Kreises Alsfeld vom 14. April 1834 an den Bürgermeister der Stadt, in dem es um die „Bestimmung“ [Einweisung] einer jungen Frau, die sich zum zweiten Mal hat schwängern lassen, in die Entbindungsanstalt nach Gießen geht, wird sie erwähnt. Da die junge Frau und auch ihr Freund „gänzlich vermögenslos“ waren und zu erwarten war, dass die Gebühren für die Entbindung „der Bommes zur Last fallen“ könnten, wurde der Stadt die Überweisung nach Gießen angetragen.
Die nächste Erwähnung der Hebamme Bommes findet sich dann in einem höchst bemerkenswerten Brief des Kreisarztes Dr. Stammler am 10. Juli 1836 an Bürgermeister Ramspeck. Im Betreff des Briefes heißt es: „Die Dienstfähigkeit der Hebamme Bommes dahier, insbesondere den sittlichen Lebenswandel.“ Weiter führte Dr. Stammler in seinem Brief aus: „Die Hebamme Bommes soll in einer abscheulichen Trunkenheit gestern Abend gänzlich dienstunfähig gewesen seyn und einen öffentlichen Straßen-Handel verursacht haben.“ Dr. Stammler waren schon vorher Gerüchte über die Trunksucht von Elisabetha Margaretha Bommes zu Ohren gekommen und dass sie als Hebamme „wenig oder gar nicht“ gebraucht werde, da sie wenig Vertrauen beim „Publikum“ genieße. Er forderte von Bürgermeister Ramspeck einen ausführlichen offiziellen Bericht über den sittlichen Lebenswandel der Hebamme.
In den nächsten Wochen wurden wohl weitere Nachforschungen angestellt, die dazu führten, dass die Hebamme Bommes dem Hebammendienst freiwillig entsagte und Kreisrat Neidhardt in einem Brief vom 12. August 1836 an den Bürgermeister verfügte, sie zu entlassen.
Landrat Neidhardt erwartete nun von Bürgermeister Ramspeck einen Bericht über die Bommes, die Anzeige ihrer Kündigung vorm Ortsgericht und eine Erklärung der Bommes, nicht mehr als Hebamme tätig zu sein. Doch Georg Jakob Ramspeck, der für seinen Eigensinn bekannt war, ignorierte wohl diese Aufforderungen trotz Strafandrohung. Nicht überraschend kam dann am 17. September eine erneute Aufforderung, binnen 24 Stunden die Auflagen zu erfüllen, und schließlich am 20. September ein Brief mit der Strafzahlung von 1 Reichstaler. Erst dadurch fühlte sich der Bürgermeister bemüßigt, handschriftlich Notizen, wohl für die lange geforderte Beantwortung, auf das Schreiben des Landrats zu kritzeln, dass die Hebamme Bommes gekündigt habe, und dass er anscheinend mit der Antwort so lange gewartet hatte, bis die inzwischen neu gewählte Hebamme