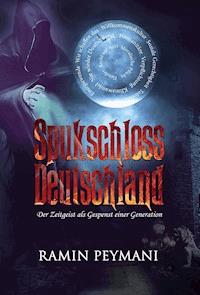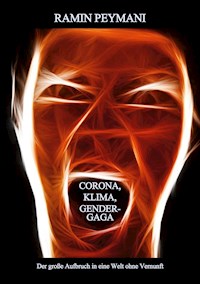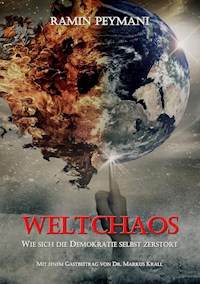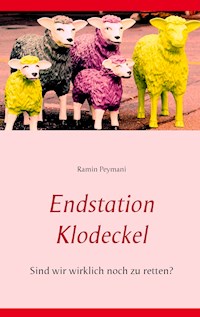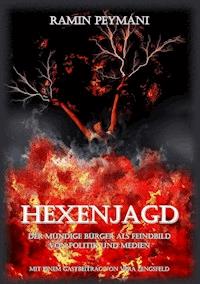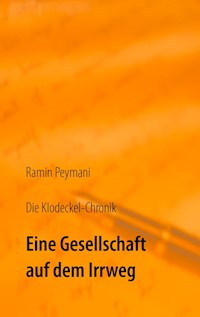
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Bevormundung, Umerziehung und Gleichmacherei, stets im scheinbar unangreifbaren Gewand der Political Correctness. Immer neue Lebensbereiche werden von schier unerbittlicher Regelungswut erfasst oder fallen dem voll entflammten Tugendfuror zum Opfer. Diesem Zeitgeist stellt sich die Klodeckel-Chronik entgegen, die viel mehr ist, als die Zusammenstellung der beliebten Texte aus Peymanis wöchentlichem Blog. Mit neuen, bisher unveröffentlichten Inhalten und überarbeiteten Beiträgen, die nichts von ihrer Scharfzüngigkeit eingebüsst haben, ist dieses Buch ein überzeugendes Plädoyer für die Freiheit. "Mit seinen spitzen, amüsanten und herrlich unkorrekten Kommentaren hat sich Ramin Peymani mittlerweile eine feste Leserschaft im Internet geschaffen." (Frankfurter Neue Presse)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Nicht die Diktatoren schaffen Diktaturen, sondern die Herden.“
Georges Bernanos, frz. Schriftsteller (1888-1948)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Wie die Kirche die Welt vor Schwulen und Frauen schützt
Wowi & Friends: Das Milliarden-Desaster von Berlin
Verlags-Zensur: Die Moralpolizei marschiert ins Kinderzimmer ein
Sinkender Stern: Des Menschen Wille ist sein Himmelreich
Das ist link(s): Wenn Neid und Missgunst das Zepter schwingen
Von der Inquisition, angeblich Verfolgten und wirklichen Opfern
„Sitzenbleiben, nein danke!“: Schule als Beschäftigungstherapie
Absatzmarkt Tafel: Pferdefleisch und andere Delikatessen
Umerzieher am Werk: Die Gefahr der neuen „Tugendhaftigkeit“
Ärger mit der „falschen Braut“: Ein Fehltritt mit Folgen
Öffentlich-rechtliche Propaganda: Die verstrahlte Wahrheit
Zombies in Berlin: Die Piraten und ihre Selbstbeschäftigung
Geld statt Gedenken: „Die Mauer muss weg!“
Die Verfassungsfeinde machen mobil: „Ich bin linksextrem“
Umverteilung „at its best“: Angriff der Gleichmacher
Endstation Euro: Frankreichs unerfüllter Traum
Der Abschied des Doktor „Ex“: Chatzi trägt Eulen nach Athen
Inzest auf Steuerzahlerkosten: In Bayern bleibt´s in der Familie
Angriff der Religionskrieger: Die Angst vorm getürkten Prozess
Der erfundene Skandal: Das „Aufstocker“-Märchen der SZ
Wahlkampfunterstützung aus Mainz: ZDF lässt SPD jubeln
Grüner Wahlkampf: Ausschaltung durch Einschüchterung?
Der Hochmut der 4. Gewalt: Klebers Ausflug nach Nordkorea
Gassi gehen im Parlament: Hundeliebhaber auf Abwegen
Das ESM-Komplott: Die Demokratie wird den Banken geopfert
„Verräter Deutschland“: Ist die Öko-Weltherrschaft in Gefahr?
Liberalismus wider Willen: Costa Rica legalisiert die Homo-Ehe
Hass statt Talent: Bushidos unmusikalische Morddrohungen
Auf Nummer sicher: Friedrichs Relativitätstheorie
Thüringer Starthilfe: Der Steuerzahler als lieber Knecht
Der Unbelehrbare: Schmolli-Schmolli statt Bunga-Bunga
Der Fall Bartels: Pure Absicht oder peinlicher Ausrutscher?
Steinzeit-Statistik als Trick: Wie die Enteignung verschleiert wird
„RAF“ reloaded: radikal, anti, faschistisch
Hausaufgaben sind doof: Neues von „Siggi pop“
Bevormunden, verbieten, umerziehen: Die Grünen machen Ernst
Richter als Aufklärer: Schulpflicht statt religiöser Eskapaden
Lügen haben kurze Beine: Der grüne Pädophilie-Sumpf
Aufatmen im Harz: „Knöllchen-Horst“ hat ausgepetzt
Dreyers stümperhafter Brief: Dilettantismus oder Volksnähe?
Limburger Allmachtsphantasie: Der Bischof aus dem Mittelalter
Phänomen Beck: Zu krank für die Politik, aber fit für die Wirtschaft
Wider die Staatsräson: Gauck und die unbequeme AfD
St. Martin unterm Halbmond: Kita brockt sich dicke Suppe ein
Sozialistische Doppelmoral: Die „taz“ und der Mindestlohn
Der Export-Buhmann: Deutschland in der Protektionismus-Zange
Gründlich verrechnet: Wenn die Naturwissenschaft irrt
Der „Copy & Paste”-Club: Deutsche Medien im Armutsrausch
Der Sturm im Wasserglas: Viel Wind im Kampf um die Quote
Südafrikas Hampelmann: Wenn einem Hören und Sehen vergeht
Großkoalitionäre „Bescherung“: Die neue Rentenbeitragssteuer
Dem Zeitgeist geopfert: Das Ende der „Europäischen Idee“
Über den Autor
Prolog
Seit Jahrtausenden ringen wir nun schon um die beste Staatsform, mit dem Ziel eines möglichst gerechten und stabilen Zusammenlebens. Dieses Ringen hat in der westlichen Welt Gesellschaftssysteme hervorgebracht, die sich auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität berufen. Sie stellen die größtmögliche Entfaltung des Individuums sowie die Fürsorge für die Schwachen in den Mittelpunkt. Doch was ist aus diesen Errungenschaften der Aufklärung geworden? Schätzen wir ihren Wert noch, indem wir sie mit dem notwendigen Augenmaß einsetzen? Oder sind wir längst auf einen Kurs eingeschwenkt, der an seinem Anspruch scheitern muss, es jedem recht machen zu wollen? Haben wir gar im unablässigen Streben nach Gerechtigkeit das rechte Maß verloren? Ist die allseits gepriesene Offenheit einer immer globaleren Welt am Ende mehr Fluch als Segen? Und macht uns die rasante Eroberung der Demokratie durch die Wohlmeinenden nicht eher unmündig als frei?
Eine Patentlösung hat sicher niemand, doch fallen meine Antworten auf all diese Fragen recht eindeutig aus. Und so zeigt dieses Buch an mehr als fünfzig Beispielen, wie sehr unsere Demokratie sich selbst im Weg steht. Nicht immer geht es dabei um die große Politik. Oft sind es gerade die kleinen Ereignisse des Alltags und die eher unscheinbaren Randnotizen, die den Irrweg der modernen Gesellschaft illustrieren. Interessengruppen geben den Ton an, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch solche, die vorgeben, sich für soziale Belange oder die Umwelt zu engagieren. Von der Politik wird der Interessenmix dabei nicht mehr gestaltet, sondern nur noch verwaltet, weil das Gesamtsystem im Zuge der angestrebten Allgefälligkeit in wechselseitigen Abhängigkeiten erstarrt. Der Zeitgeist hat überdies vieles hinweg gespült, was der Gesellschaft in der Vergangenheit Form und Halt gegeben hat.
Zu verdanken haben wir dies nicht zuletzt einer alles verschlingenden Political Correctness, die in Verbindung mit der europaweiten Renaissance des Etatismus immer weniger Raum zur persönlichen Entfaltung lässt. Staatsgläubigkeit ist das Gebot der Stunde. Die Verfechter des Nanny-Staates haben Hochkonjunktur, weil der Appetit auf ein selbstbestimmtes Leben rapide nachzulassen scheint. Wer hingegen Selbstverantwortung fordert und den Staat in erster Linie als Helfer in echter Not begreift, gilt als kalt und herzlos. Mit der moralischen Keule der nicht objektiv definierbaren „sozialen Gerechtigkeit“ wird jeder Widerstand im Keim erstickt. Es ist das präventive Kümmern, das man vom Sozialstaat heutiger Prägung verlangt. Und immer mehr Menschen sind offenkundig gerne bereit, ihre Freiheitsrechte für die vermeintlichen Verheißungen eines Fürsorgestaates einzutauschen.
Dieser Fürsorgestaat soll nach unten umverteilen. Gerecht ist, was „denen da oben“ nimmt und „uns hier unten“ gibt. Nicht mehr die Sicherstellung des Existenzminimums ist Grundlage staatlichen Handelns, sondern der laute Ruf der Masse, die empört skandiert, dass sie nun auch mal etwas abhaben will. Die Besserverdiener sollen gefälligst mehr Steuern zahlen, damit der Staat jeden (vielleicht auch aus eigenen Fehlern) gescheiterten Lebensentwurf mit größtmöglicher Finanzkraft alimentieren kann. Und da der Fürsorgestaat zunehmend mehr verspricht, finden sich naturgemäß immer mehr Anhänger für das Postulat der Umverteilung. Folgerichtig gibt es inzwischen nur noch sozial-demokratisierte und sozialistische Parteien im höchsten deutschen Parlament. Denn mit Appellen an die Selbstverantwortung des Menschen sind heutzutage keine Wahlen mehr zu gewinnen. Bestenfalls reicht es für einen schrillen Lacher in einer politischen Satiresendung.
Das Zepter haben längst die Gutmenschen übernommen, die allerdings nicht selten eher kalkulierend als altruistisch ans Werk gehen. Sie sind irgendwie unangreifbar, weil sie sich für das Gute stark machen. Doch wo gute Menschen Gutes tun, reden Gutmenschen häufig nur darüber. Und sie bevormunden gerne. Vor allem aber fehlt ihnen jedes Verständnis dafür, dass eine Gesellschaft ihren Zusammenhalt nicht aus Nivellierung bezieht, sondern aus Orientierung. Menschen vergleichen sich miteinander, und das ist gut so. Es dient dem Wettbewerb, der unerlässlich für die Weiterentwicklung jedes Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes ist. Chancengleichheit lautet die Devise, nicht Gleichmacherei. Und auch im Wettstreit der Konzepte sollten die besseren Argumente und nicht Ideologien den Ausschlag geben. Doch Gutmenschen sind Fundamentalisten. Zweifel an ihrem Glauben tolerieren sie nicht. Stattdessen wird der Gesellschaft diktiert, was „richtig“ und „falsch“ ist.
Es erscheint dabei nur auf den ersten Blick paradox, dass trotz aller Gleichmacherei das Einzelschicksal im Mittelpunkt des Gutmenschentums steht. Und doch fühlen sich immer mehr Menschen ungehört, obwohl inzwischen jede noch so kleine Gruppierung ihre eigene Bühne bekommt. Die Allgemeinheit zahlt dabei den Preis dafür, dass Einzelne ihren ganz speziellen Lebensentwurf verwirklichen oder ihr persönliches Anliegen durchsetzen wollen – im ganz sprichwörtlichen Sinne. Wo aber die Rücksichtnahme auf Einzelinteressen regiert, fühlt sich bald niemand mehr an Regeln gebunden, weil immer noch ein bisschen mehr herauszuholen ist. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass den selbsternannten Weltverbesserern aufgrund ihrer großen Fokussierung auf vermeintlich Benachteiligte die Kraft zur Sanktionierung von Missbrauch fehlt.
Die Allesversteher, für die selbstverschuldetes Leid nicht existiert, haben den Grundstein für die heutige Demokratiekrise gelegt. Sie haben durch ihr alles verzeihendes Verständnis zu eben jenem Verfall der Werte beigetragen, der von ihnen selbst so heftig beklagt wird. Als Anwalt auch derer, die unsere gesellschaftlichen Spielregeln nicht einhalten, haben sie Gräben vertieft, wo sie glaubten, Brücken zu bauen. Sie haben eine Gesellschaft geschaffen, die es denen, die zur Rechenschaft gezogen werden müssten, leicht macht, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ihrem naiven Menschenbild gehorchend haben sie trotz aller Warnsignale etwa der Finanzindustrie so lange gutgläubig das Feld überlassen, dass diese uns heute erpressen kann. Aber auch im Kampf gegen alle anderen Kriminellen schaden die Gutmenschen der Gesellschaft mehr als sie ihr nutzen. So sehr haben sie ihre Sorge um Härtefälle kultiviert, dass jeder Täter auf mildernde Umstände hoffen darf. Nicht etwa wegen schwacher Gesetze, sondern weil nachsichtige Richter den Strafrahmen nicht ausschöpfen. Besonders groß ist die Nachsicht der Jugendgerichte.
Vor allem aber muss man den Gutmenschen vorwerfen, den Staat finanziell zugrunde zu richten. Am deutlichsten zeigt sich dies bei den Sozialausgaben. Reflexartig wird das anvertraute Steuergeld an allerlei „Bedürftige“ verteilt, wobei unbequeme Wahrheiten konsequent ausgeblendet werden. Zu diesen Wahrheiten gehört, dass selten der lauteste Rufer derjenige ist, der die dringendste Hilfe braucht. Statt jedoch zu hinterfragen, ob überhaupt Not vorliegt und wie groß diese ist, überbieten sich die Gutmenschen darin, stets einen anderen Verantwortlichen zu suchen als den Betroffenen selbst. Und auch ansonsten fließen die Geldströme immer an die gesellschaftlichen Gruppen mit dem größten „Erpressungspotential“. Mächtige Lobbyisten gibt es nämlich nicht nur in der Wirtschaft. Jeder darf darauf hoffen, irgendwann in den Genuss einer auf seine spezielle Lebenssituation zugeschnittenen Wohltat zu gelangen. Der Wunsch, keine Interessengruppe zu verprellen, kommt im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zum Ausdruck, wobei Finanzierungsfragen angesichts von mehr als zwei Billionen Euro Staatsschulden immer weiter in den Hintergrund treten. Aufgrund der komplizierten Finanzierungsströme zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sind diese auch immer schwieriger zu beantworten. Doch eine Politik, die es allen recht machen will, führt zu Stillstand.
Die deutsche Konsensgemeinschaft heutiger Tage hat aber noch ein ganz anderes Unheil über uns gebracht. Mit besonderem Eifer wird die aus Amerika importierte Political Correctness hierzulande gepflegt. Sie durchforstet unseren seit Generationen gepflegten Sprachschatz nach allem, was im Verdacht stehen könnte, vermeintlich die Gefühle eines der restlichen 7,2 Milliarden Menschen auf dem Erdball zu verletzen. Schleichend wirkt das Gift der Umerzieher, ihm ist aber der als Migrant wiedergeborene Ausländer ebenso bereits zum Opfer gefallen wie Zigeuner und Mohr. Auch Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Angehörige unterer Gesellschaftsschichten erfreuen sich heutzutage wohlfeiler Korrektheit. Sie sind nun arbeitssuchend, heißen Kunden und stammen schlicht aus schwierigen sozialen Verhältnissen. An ihrer prekären Lebenssituation ändert dies freilich nichts.
Zum Glück hat es aber nicht jede Formulierung über den „Großen Teich“ geschafft, manch absurdes Sprachprodukt blieb uns auf diese Weise erspart. Ebenso die ständigen Neuschöpfungen, die den immer gleichen Sachverhalt aufgrund einer fortgesetzt vermuteten Diskriminierung immer wieder neu umschreiben. Ein Beispiel hierfür ist die fortlaufend neue Bezeichnung für dunkelhäutige Menschen, die zunächst „Neger“, dann ganz profan „Schwarze“, später „Farbige“ und schließlich „Afro-Amerikaner“ heißen durften. Es lässt sich auch darüber streiten, ob Betroffene sich wirklich besser fühlen, wenn sie als „geistig herausgeforderte Person“ betitelt werden, wie es die amerikanische „Sprachpolizei“ vorschreibt. Für mich eröffnet diese Bezeichnung mehr Spielraum für Interpretationen und Diskriminierungen als das bewährte „geistig behindert“. Die politisch Korrekten scheitern an ihrer eigenen Dogmatik, weil sich in fast jeder Redewendung und in weiten Teilen unseres Sprachgebrauchs etwas Anstößiges finden lässt, wenn man es nur darauf anlegt – wie sehr man sich auch um eine sprachliche Neutralisierung bemüht.
Der Siegeszug der „Political Correctness“ in Amerika hat natürlich vor allem materielle Gründe. Zu leicht macht es das amerikanische Rechtssystem scheinbar Geschädigten, horrende Summen von vermeintlichen Tätern einzuklagen. Diesem Risiko möchte sich verständlicherweise niemand gerne aussetzen, schon gar nicht Unternehmen und Behörden. So baut jeder vor und verhält sich vorauseilend überkorrekt. Die globalisierte Welt gehorcht dem Diktat. Vergessen sind die Reaktionen deutscher Printmedien, die sich Anfang der 1990er Jahre der neuen Korrektheit widmeten. So prangerte die Süddeutsche Zeitung den „Sprach-Terror“ an Amerikas Universitäten an, während der Spiegel in der „Political Correctness“ einen wiederbelebten „Kampfbegriff“ der schwarzen Bürgerrechtsbewegung sah. Bei den politisch Korrekten handele es sich um „eine Sprach- und Denkpolizei radikaler Minderheiten“. Geholfen hat all dies nichts; nach zwei Jahrzehnten politischer Korrektheit im Politikbetrieb darf auch hierzulande das Kind nicht mehr beim Namen genannt werden. Es ist kein Zufall, dass Klartext nur noch jene wagen, die ihre (Partei-)Karrieren hinter sich haben und nichts mehr zu werden hoffen. Da mutet es fast schon verwegen an, wenn Bundespräsident Gauck den „Tugendfuror“ geißelt.
So bunt treiben es inzwischen die politisch Überkorrekten mit der Vergewaltigung unserer Sprache, dass ich mich frage, wann wir wohl für männliche Pflegekräfte mit der Wortschöpfung „Krankenbruder“ beglückt werden. Ganz ausgeschlossen scheint dies nicht, wenn man bedenkt, mit welchem Feuereifer jeder männlichen Bezeichnung ein weibliches Pendant zur Seite gestellt wird – und sei es nur durch ungelenke Anfügungen. Holprig wirkt auch das zum Standardrepertoire aller Politiker gehörende „Bürgerinnen und Bürger“, das einzig dem Zweck dienen soll, das weibliche Geschlecht zu hofieren und zu eigenen Wählerinnen zu machen. Jahrzehntelang begnügte man sich mit Mitarbeitern, Mitgliedern oder Besuchern – und Frauen fühlten sich selbstverständlich ebenfalls angesprochen. Heutzutage sind ganze Heerscharen von Wissenschaftlern damit beschäftigt zu beweisen, dass die Verwendung der maskulinen Form Frauen in der Wahrnehmung zurücksetzt.
Doch es geht noch schlimmer: Der in den 1990er Jahren von einer übereifrigen Pädagogin erfundene und von den rot-grünen Weltverbesserern zu ihrer Regierungszeit in die öffentliche Wahrnehmung eingeführte Begriff „Migrant“ steht wie kein anderer für eine außer Kontrolle geratene Korrektheit. Was war so falsch an dem über Generationen hinweg geläufigen Sammelbegriff „Ausländer“, der zwar die vielen Facetten von Zuwanderung und Einbürgerung unzureichend abbildete, aber doch von jedem verstanden wurde? Als Rechtfertigungsargument passt der Begriff der Migration den Gutmenschen jedoch bestens ins politische Konzept. Und hier schließt sich der Kreis. Man kann sich tatsächlich des Eindrucks nicht erwehren, dass gerade die eifrigsten selbsterklärten politisch Korrekten eine morbide Lust dabei verspüren, ihre Mitmenschen zu gängeln und zu bevormunden. Doch warum lassen wir sie gewähren? Ist der „Tugendfuror“ gerechter als die von ihm angeprangerten Ungerechtigkeiten? So banal es klingen mag, Minderheitenschutz bedeutet nicht, dass alle anderen sich nach der Minderheit richten müssen, sondern dass sich Minderheiten frei entfalten können müssen.
Wir selbst haben es in der Hand, zu einer Gesellschaft zu kommen, die Maß und Mitte wiederfindet. Dazu gehört die Stärkung der Eigenverantwortung des Menschen ebenso, wie der Glaube daran, dass wir miteinander Lösungen im Zusammenleben finden können, ohne dass eine staatliche Aufsicht alles Handeln reglementiert. Dies gilt im Jahr der Europawahl erst recht auf europäischer Ebene. Wir werden heute von EU-Kommission, ESM und EZB regiert – ohne Legitimation durch demokratische Wahlen. Doch der Verlust der nationalen Handlungsfähigkeit gefährdet nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, er schadet vor allem der Demokratie. Wollen wir das friedliche und wirtschaftlich erfolgreiche Miteinander in Europa nicht aufs Spiel setzen, muss die Stärkung staatlicher Souveränität wieder das politische Handeln bestimmen, nicht der Wunsch nach Schaffung eines europäischen Imperiums. Größenwahn hat noch jedes Vorhaben am Ende zum Scheitern gebracht.
Vielleicht tragen die vielen kleinen Geschichten in diesem Buch dazu bei, dass künftig nicht mehr jeder Ideologe, Bevormunder und Umerzieher so leichtes Spiel hat. Tauchen Sie mit mir ein in die gar nicht so undurchschaubare Welt der offensichtlichen und weniger offensichtlichen Gegner der Freiheit. Lernen Sie Menschen kennen, die sich einen zweifelhaften Namen gemacht haben, ob als Systemgünstling, als oberste Moralinstanz oder als selbsterklärter Hüter der Deutungshoheit. Ein Jahr lang habe ich beobachtet, analysiert und kommentiert. Woche für Woche, insgesamt zweiundfünfzig Mal, habe ich den „Klodeckel des Tages“ für einen ganz besonderen Fehltritt vergeben. Manchmal mit einem Augenzwinkern, manchmal aber auch voller Wut, immer jedoch voller Überzeugung. Entstanden ist die Chronik einer Gesellschaft auf dem Irrweg. Doch es ist niemals zu spät zur Umkehr. Die Hoffnung lebt weiter!
Wie die Kirche die Welt vor Schwulen und Frauen schützt
Der erste „Klodeckel“ in diesem Jahr geht an die anglikanische Kirche in England. Diese verkündete zum Wochenende die Zulassung homosexueller Priester zur Bischofsweihe. Doch nicht für diesen lobenswerten Akt der Gleichstellung wird ihr die zweifelhafte Ehrung zuteil, sondern dafür, dass sie gleichzeitig klarstellte, schwule Priester nur dann zum Bischof zu weihen, wenn diese hoch und heilig versprechen, fortan völlig enthaltsam zu leben. Deren heterosexuelle Kollegen dürfen dagegen sehr wohl weiterhin ihren fleischlichen Gelüsten nachgehen. Über den Sinn eines Zölibatsgelübdes kann man ohnehin streiten, doch warum es nur von gleichgeschlechtlich orientierten Bischofsanwärtern eingefordert wird, lässt sich wohl kaum nachvollziehbar begründen. Vermutlich ist dieser Umstand der Sorge geschuldet, die künftigen Bischöfe könnten sich an ihren Messdienern vergehen – und so weit hergeholt ist das angesichts der hinlänglich bekannten Vorfälle ja nun auch wieder nicht.