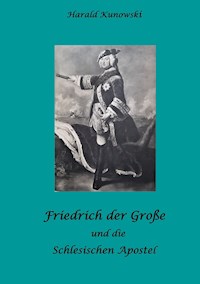Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Bau der ehemaligen Berliner Kunowski-Brücke sowie der darüber geführten Rochstraße geht auf eine private Initiative des Justizrats Georg Karl Friedrich Kunowski und des Architekten Roch zurück. Beide waren Anwohner des Königsgrabens und erkannten die Notwendigkeit einer weiteren Überquerung des Grabens aus dem damaligen Zentrum Berlins in Richtung Alexanderplatz. Das Brückenunternehmen startete im Jahre 1925 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die Einnahmen wurden über einen Brückenzoll erzielt, für dessen Erhebung ein 80-jähriges Privileg eingeräumt wurde. Aus vielen, in diesem Buch anhand von Originalschriften belegten Gründen geriet das Unternehmen nach seinem Start zunächst in wirtschaftliche Schwierigkeiten, die das Königshaus durch finanzielle Hilfen abmilderte. Durch den Fortschritt der modernen Verkehrstechnik, insbesondere den Bau der Berliner Stadtbahn, wurde die Brücke nach 55 Jahren obsolet. Am Anfang 1884 erwarb die Stadt Berlin von den Erben der Brückenunternehmer die Kunowski-Brücke und die Rochstraße sowie andere Liegenschaften zur Weiterführung des Stadtbahnprojekts. Im Zuge dessen wurde die Brücke ab 1884 demontiert und entfernt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1. Die Entwicklung Berliner Straßen-Brücken
2. Die Planung eines neuen Brückenprojekts über den Königsgraben
3. Rechtliche Rahmenbedingungen
3.1. Der Bauvertrag
3.2. Das Aktienstatut
4. Bau und Fertigstellung der Kunowski-Roch-Brücken-Communication
5. Staatliche Hilfen
5.1. Die erste staatliche Unterstützung des Brückenunternehmens 1826
5.2. Die zweite staatl. Unterstützungsmaßnahme 1828
5.3 Die Brückengesellschaft unter staatlicher Administration
6. Generationswechsel bei den Gründerfamilien
7. Die Rückübereignung der Brückencommunication an die Kunowski-Erben
8. Die Anbindung Berlins an das Eisenbahnnetz
9. Das Berliner Stadtbahn-Projekt
10. Die Kunowski-Brücke weicht der Berliner Stadtbahn
10.1 Geplantes Neubauprojekt der Brückeneigentümer
10.2. Planung und Projektierung der Kaiser Wilhelm- Straße
10.3. Anlegung eines Notauslass-Kanals
10.4. Verkauf der Kunowski-Liegenschaften an die Stadt Berlin
10.5. Das Ende der Brückenmaut
11. Anlagen
11.1 Technischer Nachspann
11.2. Transskribierte Handschriften
11.2.1. Dokumentenverzeichnis
11.2.2. Transskribierte Originaldokumente
11.3. Amortisationsrechnung der Kunowski-Brückengesellschaft Aktien-Capital Litt. B.
11.4. Brückeninventar-Listen 1877
11.5. Einnahmen-Ausgabenrechnungen 1845 – 1874
11.6. Genealogie Kunowski-Erben
12. Personenverzeichnis
13. Literaturverzeichnis
14. Personenregister
Vorwort
Die Berliner Kunowski-Brücke ist eine von vielen ehemaligen Brücken Berlins, die durch den Vormarsch der Eisenbahn und die dadurch bedingten verkehrstechnischen Baumaßnahmen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weichen musste. Ihre Besonderheit bestand darin, dass sie als Eisenbrücke konzipiert war und als sog. Aktien brücke von 1825 bis 1905 mit dem Recht ausgestattet war, für ihre Benutzung einen sog. Brückenzoll zu erheben.
Über die Geschichte dieser Brücke sind bisher nur wenige, noch dazu falsche Informationen im Umlauf. So wird berichtet, die Brücke sei wegen des Baus der Berliner Stadtbahn im Jahre 1879 abgerissen worden1. Aus den heute verfügbaren Unterlagen der damaligen Berliner Stadtverwaltung2 geht hervor, dass die Stadt Berlin die Brücke erst Ende 1883 von den Kunowski-Erben erwarb. Zum 1. Januar 1884 wurde der Brückenzoll, der inzwischen als Verkehrshindernis galt, aufgehoben. Darüber hinaus hatte die Brücke durch Schaffung anderer Verkehrwege und den Einsatz moderner Verkehrsmittel an Bedeutung eingebüßt. Sie wurde auf Veranlassung der Stadtverwaltung ohne weiteres Aufsehen im Zuge der Erweiterung der Stadtbahn demontiert und beseitigt.
Wesentliche Informationen über den Bau, die Nutzung und das Ende der Brückenanlage liefern bisher in der Öffentlichkeit unbekannte Originalhandschriften und Manuskripte aus dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin und den Archiven der Berliner Stadtverwaltung. Sie stehen nach noch weiter laufenden Bestandserhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen dem Leser "vor Ort" zur Verfügung. Von einem digitalen Zugriff auf die Bibliotheksbestände ist man in Berlin allerdings noch weit entfernt.
Die für die vorliegende Arbeit erforderlichen Dokumente wurden über mehrere kostenpflichtige Photoauftrage von den beiden Berliner Instituten bezogen. Die entsprechenden Seiten stehen nunmehr zum kostenlosen Download auf den Internet-Seiten der Anbieter jedermann zur Verfügung.
Von den etwa 1200 gelieferten Handschriftseiten wurde der überweigende Teil in 139 Einzel-Dokumenten im Rahmen dieser Arbeit transskribiert und in chronologischer Folge im Anhang 11.2 abgedruckt.
1 Eckhard Thiemann, Dieter Deszyk, Horstpeter Metzing: Berlin und seine Brücken , Berlin 2003 , S. 185, Wikipedia: Liste der Brücken in Berlin, und alle Zollmünzenanbieter im Internet
2 Siehe Kap. 10.5. Das Ende der Brückenmaut
1. Die Entwicklung der Berliner Straßen-Brücken
Die zahlreichen natürlichen und künstlichen Wasserwege durch Berlin wurden im Laufe der Jahrhunderte von annähernd tausend Brücken überquert. Neben den unterschiedlichen Standorten und den Jahren ihrer Entstehung werden sie unterschieden nach der Art der Konstruktion, nach dem Werkstoff wie etwa Stein, Holz. Metall, nach Art der Finanzierung etwa durch staatliche oder private Mittel.3
Die älteste Straßen-Brücke, die die damals noch getrennten Städte Berlin und Cölln miteinander verband, bildete der um 1220 entstandene Mühlendamm. Etwa dreihundert Jahre später verfugte die Stadt innerhalb der Festungswerke bereits über 14 Brücken.
Durch die stark zunehmende Einwohnerzahl und die dadurch steigenden Verkehrs- und Transportbedürfhisse stieg die Anzahl neuer sowie wieder instandgesetzter Brücken seit dem auslaufenden 18 Jh. bis zum Ende des ersten Quartals des 19 Jh. weiter deutlich an. Doch an vielen Stellen Berlins mussten immer noch längere Wege zur Überquerung einzelner Wasserläufe zurückgelegt werden. Im Zentrum Berlins waren verschiedene Brücken über die bestehenden Kanäle und Gräben teilweise beträchtlich voneinander entfernt, was die Kommunikation zwischen diesen Standorten erheblich erschwerte.
Abb. 1 Berliner Stadtplan mit Rochstraße und Kunowski-Brücke ('Rochbrücke') über den Königsgraben
An der Nordostseite der Stadtfestung verlief der Königsgraben, der nur durch wenige Passagen überquert werden konnte. Die Spandauer Brücke im Norden wurde 1785 als eiserne Brücke erbaut. Im weiteren Verlauf des Königsgrabens in Richtung Südosten entstand bereits 1777 die Königsbrücke aus Rothenburger Sandstein. Sie löste eine bis dahin bestehende Holzbrücke ab und war noch in im 19. Jh. bis zu ihrem Abriss die meist frequentierte Brücke über den ehemaligen Festungsgraben hin zum Paradeplatz, der 1805 zum Alexanderplatz umbenannt wurde. Zwischen diesen beiden Brücken gab es seitdem keine weitere Verbindung über den Königsgraben.
Mit dem zunehmenden Verkehr wurden die Brücken stärker frequentiert, sodass es beim Überqueren derselben zu zeitlichen Verzögerungen kommen konnte, was die Passagen insgesamt verlängerte.
3 Pinkenburg. Georg, Die Straßenbrücken Berlins, Berlin 1886
2. Die Planung eines neuen Brückenprojekts über den Königsgraben
Ein von dieser Verkehrssituation betroffener Berliner Bürger entwickelte Anfang der zwanziger Jahre die Idee, eine Verbindung zwischen der Münzstraße auf der nordöstlichen Seite des Kanals zur Neuen Friedrichsstraße auf der südwestlichen Seite herzustellen. Für den Berliner Justizkomissarius Georg Carl Friedrich Kunowski, der mit seiner Familie seit 1820 in der Friedrichstr. 28 lebte, bedeuteten die weiten Umwege einen Zeitverlust, der ihn in seiner anwaltlichen Tätigkeit benachteiligte. 1822 erhielt er zudem ein Angebot zur Übernahme der Rolle des Syndikus an dem neu zu errichtenden Königsstädtischen Theater, das nach der Vorgabe des Königs am Standort Alexanderplatz oder dessen unmittelbarer Umgebung errichtet werden sollte.4 Mit dieser Standortwahl war für Kunowski die Perspektive verbunden, den Sitz seiner anwaltlichen Tätigkeit aus den beengten Verhältnissen seiner Privaträume in die künftigen Diensträume am geplanten Theater zu verlegen. Mit seiner Zusage zur Übernahme der juristischen und verwaltungstechnischen Funktion an dem neuen Theater jenseits des Königsgrabens erhielt das Brückenprojekt für den künftigen Syndikus wegen der günstigeren Verbindung eine noch höhere Bedeutung und Dringlichkeit, was die Fertigstellung der Brücke betraf. Für die Eröffnung des Theaters war der 4. August 1824 vorgesehen, ein Tag nach dem 54. Geburtstag des Königs Friedrich Wilhelm III..
Kunowski gewann für sein Brückenbau-Vorhaben den ihm bekannten Baukondukteur Johann Albert Roch, mit dessen Hilfe das Brücken-Konzept einschließlich der entsprechenden Zuwege noch während des ersten Quartals 2023 erstellt wurde.
Der formelle Bau-Antrag einschließlich der Planungsunterlagen wurde gegen Ende des Quartals beim Staatsminister von Bülow (Abb. 2) eingereicht, der nach Prüfung das Gesuch samt Unterlagen mit einem Empfehlungsschreiben5 vom 14. April 1823 an König Friedrich Wilhelm III. weiterleitete. Er befürwortete den Antrag und begründete ihn wie folgt:
Zwischen der Königs- und der Spandauer Brücke, die den Königsgraben überqueren und beide noch im 18 Jahrhundert erbaut wurden, fehlt es an einer weiteren Verbindung über den Kanal, um von der Münzstraße zur gegenüberliegenden Neuen Friedrichs-Straße zu gelangen. Dieser Mangel wird schon seit langem öffentlich beklagt, denn es sind größere Umwege notwendig, um von der einen Straße in die andere zu gelangen. Wenn hier eine neue Brücke entstehen soll, dann setzt dies voraus, das zwei sich gegenüberliegende Grundstücke finden, die die Anlage einer Verbindung zwischen diesen beiden Straßen erlauben. Es ist deshalb zu brgrüßen, dass sich gegenwärtig zwei Privatpersonen, der Justiz-Kommissionsrat Kunowski und der Conducteur Roch, die über zwei solcher Grundstücke verfügen, in der Lage sehen und bereit erklären, eine entsprechende Straßenverbindung über eine eisernen Brücke gem. folgender Bedingungen erstellen zu lassen.
Sie beabsichtigen den Bau der gesamten Anlage, d.h. der Straße und der Brücke, deren Unterhaltung und die Beleuchtung aus eigenen Mitteln zu finanzieren, wobei sie sich verpflichten, die Durchfahrt vier Fuß (1.2 m) breiter als die der neuen Wilhelmstr. zu anlegen zu lassen.
Dagegen bitten sie um die Erlaubnis, von den Nutzern (Passanten) eine Gebühr für die Nutzung der Brücke, einen sog. Brückenzoll, zu erheben. Der zugrundeliegende Tarif soll dem von Sr. Königlichen Majestät für die Aktienbrücke bei Monbijou genehmigten Tarif entsprechen, jedoch mit der Modifikation, dass die hier bestehenden Sätze von 5 und 10 Pfg. nach Maßgabe der neuen Münzeinteilung (aufgrund der eingetretenen Geldentwertung) auf 6 Pfennige und 1 Silbergroschen (12 Pfge.) erhöht werden.
Die Befugnis zur Erhebung dieser Abgabe verlangten die Unternehmer zunächst für einen Zeitraum von 100 Jahren, sie haben sich jedoch mit einer Verkürzung dieses Zeitraums auf 80 Jahre infolge der ihnen zugestandenen Erhöhung der Tarifsätze von 5 und 10 Pfennigen auf 6 Pfennige und 1 Silbergroschen einverstanden erklärt. Außerdem wollen sie, ähnlich wie bei der Nutzung der Monbijou-Brücke einer Befreiung von Zahlungen bestimmter Nutzer zustimmen, und z.B. auch armen Schulkindern, die ihre Armut durch Atteste nachweisen, den unentgeltlichen Übergang gestatten.
Nach Ablauf von 80 Jahren der Abgabeerhebung und der Unterhaltung der Anlage wird das Recht der Durchfahrt durch beide Häuser, die nun angelegte Straße und die Brücke selbst, freies Eigentum des Staats.
Anfangs waren die Unternehmer zwar nicht geneigt, die Beleuchtung auf ihre Kosten zu übernehmen. Da jedoch das Ministerium des Innern wegen der beschränkten Möglichkeiten der hiesigen Straßenbeleuchtung-Fonds die Übernahme der Beleuchtung der neuen Anlage ablehnte, erkärten sich die beiden Privatunternehmer Kunowski und Roch bereit die Kosten für die Beleuchtung mit zu übernehmen. Minister von Bülow formulierte sein Plädoyer für den Bau der Brücke gegenüber dem König wie folgt: „Die hier angeführten Vorstellungen und Bedingungen der Unternehmer erscheinen nun so vorteilhaft, dass keinerlei Bedenken bestanden, Ihrer Königl. Majestät zu empfehlen, die Allerhöchste Genehmigung huldreichst erteilen zu wollen."
Abb. 2 Hans von Bülow
Abb. 3 Daniel Ludwig Albrecht 6
Der König stimmte mit seiner Cabinettsordre vom 29. April 18237 dem Bau der Brücke unter den genannten Bedingungen zu und autorisierte von Bülow, einen entsprechenden Vertrag mit den Unternehmern abzuschließen.
4 Kunowski, Harald, 200 Jahre Königsstädtisches Theater Berlin, Bd. 1 – Kabale und Resignation, 2023, S. 31 ff.
5 Dok. 1, S. 77 ff.
6 Bildquelle Abb. 2 und 3 Wikipedia
3. Rechtliche Rahmenbedingungen
Nach eingehenden Verhandlungen schlossen die Eigentümer der Grundstücke Neue Friedrichstr. Nr. 34 und Münzstr. Nr. 6, der Justiz-Commissionsrat Kunowski und der Conducteur Roch mit dem Königlichen Fiskus, vertreten durch die Ministerialrat-Baukommission am 28.07.1823 einen
3.1. Bau-Vertrag8
in dem sie für den Brückenbetrieb die Rechtsform der Aktiengesellschaft gewählt haben. In diesem verpflichten sie sich, den Königsgraben zwischen ihren oben bezeichneten Grundstücken zu überbrücken, indem sie eine Passage von der Neuen Friedrichs-Straße zur Münz-Straße durch beide Grundstücke herstellen. Es ist Ihnen erlaubt, von dem Tage der Eröffnung an, auf die Dauer von 80 Jahren, von den Benutzern dieser Passage einen „Allerhöchsten Orts" genehmigten Brückenzoll zu fordern. Ferner haben sich die Unternehmer dem Fiskus gegenüber verpflichtet, die Brücke über den Königsgraben in Eisen-Konstruktion, und die Passage mit Bepflasterung und einem Trottoir anzulegen, nach polizeilichen Vorschriften zu unterhalten und zu beleuchten. Die Brücke nebst der Straßenanlage soll nach Ablauf von 80 Jahren dem Fiskus ohne Entschädigung zum freien Eigentum zu überlassen werden. Das Zollprivilegium soll zu einem Drittel dem Hause Münzstr. 6 und zu 2/3 dem Hause Neue Friedrichstr. 34 zugeschrieben werden. Endlich ist dem Fiskus und der Commune im Falle der Veräußerung das Vorkaufsrecht sowie überhaupt das Recht eingeräumt, mit dem Ziel der Aufhebung des Zolls die Brücke nebst der Passage, sowie die beiden Häuser auch vor Ablauf des Zollprivilegiums gegen Entschädigung zu erwerben, und zwar nach den näheren Bestimmungen der §§ 16 und 17 des Vertrages.
Nach dem Erlass des Innenministeriums, Abteilung für Handel in Berlin vom Berlin, 6. Juni 1824 wurde den Unternehmern gestattet, statt des eisernen Belags, wozu sie vertraglich verpflichtet waren, einen hölzernen Belag für die Brücke anfertigen zu lassen und solange zu benutzen, wie dies ohne Gefahr geschehen kann, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Brücke nach Beendigung des Zollprivilegs mit einem eisernen Belag an den Fiskus zu übergeben ist. Dieser Vorbehalt ist in der dem Vertrag vom 28. Juli 1823 (Dok. 3) beigefügten Anlage vom 9. August 1824 festhalten. Außerdem ist er mit allen sonstigen wesentlichen Verpflichtungen des Vertrags in das Hypothekenbuch des königlichen Stadtgerichts von Berlin (...) eingetragen und in den beiden Hypothekenscheinen vom 7. April 1825 vermerkt.
Die beiden Unternehmer der Anlage bekamen mit dem Kaufmann Schwederski aus Memel einen stillen Teilhaber. Sie schlossen mit Datum 29. August 1822 einen 1. Societätsvertrag, durch den Schwederski mit einem Drittel bzw. 30.000 rthlm. an dem Unternehmen beteiligt wurde.
Um den letzteren wegen dieses Vorschusses zu befriedigen, sowie um einen weiteren Betrag des Anlagekapitals zu decken, beschlossen die drei Socien, Actien bis zu Höhe von 60.000 rthlr. auszugeben, und schlossen untereinander das vom 7. Januar 1825 datierte.
3.2. Das Aktien-Statut,
das auch als Kautions-Instrument bezeichnet wird.9
Dem Statut ist ein Schema der Actien, der Coupons und Dividendenscheine beigefügt. Die für die Inhaber der Actien littr. A. von 20.000 rthlr. bestellte Caution ist laut dem Statut der angehefteten beiden Hypothekenscheine vom 7. April 1825 bei den beiden Grundstücken Neue Friedrich Str. 34 und Münzstr. 6 (Rubr. III. usw.) eingetragen.
Die Kunowski-Brücken-Gesellschaft wurde als privates Untermehmen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet. Private Gründungen dieser Art waren zu dieser Zeit nicht unüblich. Als Beispiel diente hier die Monbijou-Brücke.
Die aus den Napoleonischen Kriegen herrührenden finanziellen Belastungen des Staates waren nach wie vor groß und beschränkten die Möglichkeiten des Königs hauses als Finanzier für alle öffentlichen Bauvorhaben zur Verfügung zu stehen. Zur gleichen Zeit stellte sich die Frage nach der Finanzierung des von Friedrich Wilhelm III. favorisierten Volkstheaters am Alexanderplatz, das als Königsstädtisches Theater im September 1822 auf Aktienbasis gegründet wurde. Auch hier war der Justizrat Kunowski für die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung des Unternehmens zuständig. Hier fanden sich sehr schnell einige Berliner Bankiers, mit denen Kunowski als einer der bekanntesten Berliner Juristen in Geschäftsbeziehungen stand, die bereit waren, die Finanzierung des Unternehmens sicherzustellen. Auch bei der Kunowski-Brücke verlief die Plazierung des Aktien sowie die die Anfangsfinanzierung des Unternehmens zunächst unproblematisch.
7 Dok. 2, S. 79
8 Dok. 3, S. 79 ff.
9 Dok. 4, S. 85 ff.
4. Bau und Fertigstellung der Kunowski-Roch-Brücken-Communikation
In einer Mitteilung vom 28. Februar 182510 1w1andte sich Kunowski an den König, um ihm die Fertigstellung der Communikationsanlage anzuzeigen und ihn um entsprechende Namen zu bitten:
Man habe mit dem Anbruch der Frühjahrs 1824 den Bau der Anlage begonnen und ihn bis jetzt soweit vollendet, dass man die Eröffnung der neuen Communication und der neu errichteten eisernen Brücke für das Publikum gegenwärtig bei der Behörde in Antrag bringe. Die sonach bald zu eröffnende neue Straße und Brücke sei bis jetzt mit keinem Namen bezeichnet, er erdreiste sich deshalb, Sr. königlichen Majestät die allerunterthänigste Bitte vorzulegen, denselben einen Namen huldreichst verleihen zu wollen.
Friedrich Wilhelm III. ließ Kunowski seine Entscheidung über seinen Minister von Schuckmann am 6ten März 1825 “mitteilen: „Auf diesfällige Anfrage des Justiz-Commissionsrathes Kunowski will ich der von demselben und dem Conducteur Roch mit MeinerGenehmigung zur Verbindung der neuen Friedrichs-Straße mit der Münz-Straße angelegte Straße den Namen „Roch-Straße" oder -Gasse und der eben daselbst errichteten eisernen Brücke den Namen „Kunowski-Brücke" beilegen. Bitte hiernach die weitere Verfügung anhand geben."
Nach einer in der Spenerschen und Vossischen Zeitung und dem Intelligenzblatt abgedruckten Bekanntmachung der Ministerial-Bau-Kommission vom 1. Mai 1825 war die Eröffnung der Passage mit dem Datum vom 2. Mai erfolgt, sehr zum Bedauern der Direktion des neuen Königsstädtischen Theaters, das seinen Spielbetrieb bereits am 4. August 1824 in der Erwartung einer fertigen und funktionsfähigen Brücke und eines dadurch bedingten Zustroms weiterer Theaterbesucher aufgenommen hatte. Vom Tag der Eröffnung der Brücke an gerechnet sollte das Privilegium nach 80 Jahren, demnach am 2. Mai 1905 erlöschen.
Abb. 4 12 Zollmarke der Communicationsanlage Kunowski-Brücke und Roch-Straße
Mit Datum vom 1. Juli 1825 schlossen die Eigentümer Kunowski und Roch und der Kaufmann Schwederski einen zweiten Vertrag, nach dem zum Ausgleich des von ihnen verwendeten Kapitals Aktien Lit. B von 40.000 thlr. in Stücken von 1000 thlr. /20 Stk. und 500 thlr /40 Stk. unter den laufenden Nrn. 1-60 geschaffen werden sollen.
Die Bestimmungen dieses Vertrages entsprechen im Wesentlichen denjenigen in dem Actienstatut vom 7. Januar 182513. Entsprechend §§ 4 und 5 lauten die Actien auf den Inhaber, berechtigen zu 5% Zinsen und partizipieren an der Dividende zu einem Drittel. Im § 7 ist eine gleiche Bestimmung wie im § 8 des Vertrags vom 7. Januar 1825 aufgenommen, auch hinsichtlich der Einsetzung eines Commune-Mandatars (§ 10) und Beschlagnahme der Einkünfte.
Die Aktien sollen vom 7. Januar 1857 ab jährlich mit 1.000 rthlr., höchstens jedoch mit 4.000 rthlr. amortisiert werden und zwar gegen Quittung (§§ 2 und 9), die vom Notar und Zeugen auf der Aktie ohne weitere Legitimationsprüfung auszustellen ist.
Für alle in diesem zweiten Aktienvertrag den Inhabern der Actien littr. B eingeräumten Vergünstigungen sind von den contrahierenden titulierten Eigentümern die beiden Grundstücke Neue Friedrich Str. 34 und Münzstr. 6 nebst allem Zubehör verpfändet. Die Caution in Höhe von 40.000 thlr. ist bei den beiden Grundstücken nach den Hypothekenscheinen vom 24. November 1825 eingetragen.
10 Dok. 5
11 Dok. 6
12 Exemplar aus dem Familien-Nachlass,. Die Münze war vom Eröffnungstag, dem 2. Mai 1825 an gültig
13 Dok. 4
5. Staatliche Hilfen
5.1 Die erste staatliche Unterstützung des Brückenunternehmens 1826
Das Unternehmen zur Überbrückung des Königsgrabens und der Anlegung einer Passage hatte indessen nicht den erhofften Anfangs-Erfolg. Die während der ersten neun Monate seit Eröffnung am 1. Mai 1825 erzielten Einnahmen reichten zur Verzinsung der Aktien nicht aus, geschweige denn, dass es zur Zahlung einer Dividende kommen konnte. Die Eigentümer wandten sich deshalb an die Staatsregierung und baten um Unterstützung, alternativ um den Ankauf der gesamten Zoll-Communikation nebst den Grundstücken durch den Fiskus.
Der Justizrat Kunowski richtete mehrere Petitionen an den König selbst und an seinen Geheimen Kabinettsminister AI brecht14 und bat um Unterstützung für das Brückenprojekt in seiner Anfangsphase. Er gab zu bedenken, dass ein niedrigerer Brückenzoll die Frequentierung der Brückenanlage deutlich erhöhen und die Gesamteinnahme erheblich steigern könne. Dies sei jedoch im Anfangsstadium des Brücken-Unternehmens nicht ratsam.
Sein erstes Petitionsschreiben richtete Kunowski am 3. Nov. 1825 15 an den König mit der Bitte, einen Teil der Brückenaktien, die zwar bereits 5 % Zinsen verdienen, jedoch noch keinen großen Gewinn abwerfen, für die königliche Schatulle zu zeichnen. Auf Grund schlechter Erfahrungen habe er davon abgesehen, ihm bekannte Berliner Bankiers um die Übernahme der Aktien zu bitten.
In seiner Antwort auf Kunowskis Schreiben teilte der Kabinettsminister Albrecht am 9. November 182516 mit, der König sei grundsätzlich nicht abgeneigt sich an der Brück en-Gesellschaft zu beteiligen und wünsche darüber sowie die Ausstattung seiner Aktien nähere Erläuterungen zu erhalten, die Kunowski am 11. November 1825 mit einem entsprechenden Begleitschreiben an Albrecht übersandte:18 In demselben gab Kunowski einen Überblick über das Aktienkapital, den Stand der angenommenen Hypotheken und die Beteiligungsverhältnisse. Die aktuelle Ertragslage sei ungünstig, allerdings könne man in den künftigen Jahren mit einer deutlichen Steigerung der Einnahmen rechnen. Er stehe mit den reichsten Leuten Berlins in Verbindung, allerdings beabsichtige er nicht, sie um eine Beteiligung an dem Brückenunternehmen nachzusuchen, weil er zur Erhaltung einer unbefangenen Stellung ihnen gegenüber nicht wünsche ihnen noch mehr verpflichtet zu sein, als er es namentlich 1178 durch sein Verhältnis zum Königsstädtischen Theater schon sei19. Es sei daher sein sehnlicher Wunsch, Sr. Majestät zu den Actionären einer ihm sehr lieben Unternehmung zählen zu können.
Abb. 5 „An der Rochbrücke"17
Der König erklärte sich daraufhin gegenüber Kunowski bereit 10 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je 1.000 rthlr., also insgesamt 10.000 rthlr. zu übernehmen und wies in einer Order vom 25. Januar 182620 seinen Kämmerer Timman, die Papiere zu Lasten der königl. Chatoulle zu erwerben. Am gleichen Tage21 informierte Albrecht Justizrat Kunowski über die Entscheidung des Königs.
Kunowski richtete daraufhin am 1ten Februar 1826 ein Dankesschreiben an den König.22 Zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass diese Unterstützungsmaßnahme wesentlich zur Überwindung der Anfangsschwierigkeiten beitragen sollte.
5.2 Die zweite staatliche Unterstützungsmaßnahme 1828
Es vergingen fast zwei weitere Jahre, als sich die Unternehmer der Kunowski - Brückenanlage am 12. November 1827 erneut an den Geheimen Kabinettsrat wandten und um finanzielle Unterstützung bitten mussten. Statt der erwarteten Verbesserung der Einnahmen war eine Verschlechterung eingetreten, die für das Jahr 1827 ein weiteres Defizit von fast 900 rthlr. erwarten ließ. Zudem hatten diverse behördliche Anordnungen zwischenzeitlich Änderungen an der gesamten Brückenanlage notwendig gemacht, die zu unvorhergesehenen Kostenerhöhungen führten. Die von den Unternehmern zunächst vorgesehene Einfach-Version des Brücken- und Straßenbauprojekts hätte nach Einschätzung von Kunowski in diesem Zeitraum zu einer insgesamt ausgeglichenen Ertragsrechnung geführt.
Der Mitunternehmer Roch war infolge der finanziellen Belastungen durch die Brückengesellschaft insolvent geworden. Er war nicht mehr in der Lage, den auf ihn entfallenden Kapitaleinschuss zu leisten. Der Justizrat Kunowski glich die auf Roch entfallenden
Abb. 6 23 Georg Karl Friedrich Kunowski
Abb. 7 Ehefrau Leopoldine Eleonore
Verluste für das Jahr 1826 aus. Für 1827 war eine weitere Verlustübernahme zu erwarten, eine Besserung hingegen nicht abzusehen.
Um die Brückengesellschaft zu retten, bat Kunowski den Geheimen Cabinettsrat Albrecht in einem Schreiben vom 12. November 182724 dem König eine komplette Übernahme des Brückenunter-nehmens durch den Staat vorzuschlagen. Er machte in seinem Schreiben auch deutlich, dass vor allem die zusätzlichen Wünsche des Fiskus bei der Errichtung der Kommunikation das Gesamtprojekt erheblich verteuert hätten.
Zwei Tage später, am 14. November 182725 wandte sich Kunowski noch einmal direkt an den König, um ihn um Unterstützung zu bitten. Er wiederholte zum Einen die bereits an anderer Stelle vorgetragenen Gründe für die Verschlechterung der Ergebnisse. Als besonders nachteilig für die Ertragslage des Brückenunternehmens hätten sich außerdem herausgestellt:
- Die verordnete Reduzierung der Dauer des Zollprivilegs von ursprünglich 100 auf 80 Jahre in der Annahme, dass die Erhöhung des Zolls um ½ Silbergroschen pro Transfer per Saldo zu einer entsprechenden Erhöhung der Gesamteinnahme und und einer zwanzig Jahre früheren Amortisation des Aktienkapitals führen würde. Ein solcher Effekt sei nicht zu erkennen, im Gegenteil sei die Einnahme gesunken. insofern sei die Verkürzung des Zollprivilegs ungerechtfertigt.
- die Zusatzwünsche von Seiten des Fiskus, die erheblichen zusätzlichen Aufwand bedingt hätten: Es seien dem Unternehmen durch Ew. Königliche Majestät zahlreiche Bedingungen gestellt worden, namentlich die ungemeine Erweiterung der Anlage, die den dazu nötigen Fonds wenigstens verdoppelte, ferner der freie Übergang des Militärs und der uniformierten Beamten, der den Ertrag wesentlich minderte, endlich die Pflicht nach Ablauf der Privilegien die ganze Anlage und einen Großteil der Grundstücke unentgeltlich dem Staat zu überlassen.
- Die Unternehmer hätten sich diesen Bedingungen unterworfen, teils weil ihr Ziel nicht anders erreichen werden konnte, teils weil sie selbst nach dem Urteil der Behörden auf einen guten Ertrag hofften.
Kunowski erkennt in seinem Schreiben ohne weitere Hilfen keine Ansätze für eine Verbesserung der Ertragssituation und schlägt deshalb vor, der Staat möge sein Vorkaufsrecht ausüben und das Brückenunternehmen zu einem Gesamtbetrage von 60.000 rthlr. zu kaufen. Von den auf den Häusern lastenden Hypotheken-Schulden von 42.500 rthlr. würde nur ein Rest von ca. 10.000 rthlr. des Anlage-Capitals hinzukommen, ferner müsste der jetzige jährliche Ausfall von ca. 800 rthlr. abgedeckt werden.
Der König leitete Kunowskis Bittschreiben am 25. November 182726 an seine Staatsminister von Schuckmann und von Motz zur Beurteilung und Berichterstattung weiter.
Beide Minister rieten dem König in ihrer Replik27 vom 7. Dezember 1827 die Vorstellungen Kunowskis zu verwerfen. Der König schloss sich dem Votum der beiden Minister an und teilte Kunowski die Ablehnung des Gesuchs über den Cabinettsrat Albrecht 28 mit.
Der König änderte wenig später seine Meinung und ließ diese über Albrecht den Ministern Schuckmann und Motz mitteilen. Er gestand zu, dass der Fiskus sehr dazu beigetragen habe, die Kosten der Anlage durch zusätzliche Anforderungen und Wünsche zur deren Verschönerung in die Höhe zu treiben, und zeigte Verständnis, dass hierfür ein Ausgleich geschaffen werden müsse. Im Übrigen, man dürfe die Unternehmer nicht sinken lassen, Er forderte die Minister deshalb über Albrecht am 18. Febr 182829 auf, mit Kunowski als Absender des Gesuchs in Verhandlungen zu treten.
Die Minister Schuckmann und Motz nahmen mit einem Schreiben vom 13. Dezember 182830, dem offenbar Gespräche mit dem Justizrat Kunowski vorangegangen waren, Bezug auf die Ordre des Königs vom 18. Feb. 1828 und bestätigten mit den Brückenunternehmern in Verhandlung treten zu wollen.
Die Minister warnten vor der kompletten Übernahme der Brückenanlage, insbesondere wegen der Verknüpfung mit den beiden Häusern, für die ältere Hypothekenvereinbarungen galten. Der Staat dürfe aus ihrer Sicht nicht in eine Häuseradministration hineingezogen werden. Eine solche Lösung sei die kostspieligste aller denkbarer Varianten.
Die Minister gehen in ihrem Bericht der Aussage Kunowskis nach, die ursprünglich veranschlagten Kosten für die Brückenanlage seien durch weitere Anforderungen des Staates, durch polizeiliche Vorschriften und aufgrund von Verschönerungswünschen in die Höhe getrieben worden. Sie stellten fest, dass es auch notwendige technische Modifikationen hinsichtlich der Brückenmaße gab, die zu Veränderungen in der Kalkulation führten. Der genaue durch den Staat verursachte Mehraufwand lasse sich jedoch nicht exakt ermitteln.
Die Minister schlugen deshalb eine Lösung vor, mit der aus ihrer Sicht das Brückenunternehmen aufrecht erhalten werden kann:
Der Staat übernimmt die Aktien Litt. A. in Höhe der 20.000 rthlr. darlehensweise und verzichtet im Nachrang auf Verzinsung und Amortisation bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Hypotheken und die Aktien Litt. B. hinsichtlich Verzinsung und Amortisation vollständig befriedigt worden sind. Die Inhaber der Aktien Litt B. sollen dabei auf die Dividende verzichten, außerdem soll mit der Amortisation erst ab 1856 begonnen werden. Der im einzelnen begründete und bezifferte Vorschlag kommt zu dem Ergebnis, dass unter den vorgeschlagenen Prämissen ein Überschuss von etwa 600 rthlr. erzielt werden könne, der zur Verzinsung des Staatsdarlehens von 20.000 rthlr. mit einem rechnerischen Prozentsatz von 3 % zur Verfügung steht.
Zu dem Bericht erfolgte eine Stellungnahme 31des Friedrich August Staegemann, eines engen Vertrauten und Beraters des Königs, der offenbar zu den Beratungen über ein weiteres Engagement des Staates bei der Kunowski-Brückengesellschaft hinzugezogen wurde.
Nach Staegemanns Einschätzung handelte es sich dem Brückenprojekt um eine verfehlte Spekulation der Unternehmer, die das Unternehmer als Goldgrube betrachteten und von falschen Vorstellungen über Erträge und Kosten ausgingen.
Er vermisste in dem Bericht der Minister eine Aussage darüber, ob die zusätzlichen ungeplanten Maßnahmen, die er im einzelnen auflistete, polizeilich notwendig waren oder aufgrund von entbehrlichen Verschönerungen entstanden sind. Auf jeden Fall stehe fest, dass die Unternehmung ohne diese Extras profitabler geworden wäre.
Von diesem Gesichtspunkt ist die K. M. in der Ordre vom 18. Febr. des J. ausgegangen und hierauf sind die Vorschläge der Herren Minister abgefasst, die als die zweckmäßigsten Maßregeln erscheinen.
Staegemann gab zu bedenken, ob es nicht vorzuziehen sei, dass jeder Überschuss zur Amortisation der Aktien Litt. B. verwendet werde und dass, sobald diese erfolgt sei, dieser Teil dem Staat anheim fallen solle.
Auch könne man ohne Bedenken die Bewilligungen des Staats an die Bedingung zu knüpfen, dass die Aktien Litt B. nur zu 4 Prozent verzinst und die gleichfalls zur Amortisation verwendet wird.
Allerdings sollte zunächst die Allerhöchste Entscheidung darüber fallen, ob
1. dem Justizrat Kunowski nach dem Vorschlage (der Minister) zu V. 10.000 rthlr. zur Bezahlung der Bauschulden zu schenken (sind)?
2. Ob die Staatskasse bei Übernahme der Actien Litt. A 20.000 rthlr. hergeben dürfe.
Auf der Basis des Stegemannschen Gutachtens willigte der König in den Vorschlag der Minister von Schuckmann und Motz vom 13. Dezember 1828 ein. Daraufhin erging die Allerhöchste Cabinetts-Order vom 11. Januar 1829 32, nach der
1. der Staat den Unternehmern eine Unterstützung von 10.000 Thlrn. zahlt. Nach dem Erlass des Herrn Ministers des Innern vom 18. Juli 1829 hat zugleich seine Majestät den aus der Chatoulle zu den Aktien hergegebenen 10.000 rthlr. zu diesem Abkommen die Genehmigung erteilt.
2. der Staat die Actien Littr. A über 20.000 rthlr. gegen Zahlung diese Betrages zur Einlösung übernimmt, den Actien littr. B die Priorität einräumt und die Zinsen auf 4% unter der Bedingung ermäßigt, dass die Inhaber der Actien littr B auf eine Dividende verzichten.
Der Order gemäß wurden die 20.000 thlr und 10.000 thlr. vom Staate an die Unternehmer resp. die Inhaber der Actien litt. A gezahlt.
Wie aus den Akten des Königlichen Ministerialamts für Handel33 näher hervorgeht, haben die Inhaber der Aktien Lit. A Wilhelm Beer und Moritz Ebers34 nach der von Kunowski unter dem 18. März 1829 eingereichten gerichtlichen Erklärung sich bereit gefunden, die Aktien Littr. A dem königlichen Finanzministerium gegen Zahlung des Nominal-Betrages von 20.000 rthlr. zu übertragen.
Auf Veranlassung des Königlichen Ministeriums für Handel vom 23. März 1829 wurde die königl. General-Staatskasse von dem Herrn Finanzminister am 31. März 1829 (Dok.24) angewiesen, den Nennwert der Actien littr. A mit 20.000 rthlr und das „Gründungsgeschenk" von 10.000 thlr zu zahlen.
Das in der Allerhöchste Cabinetts-Ordre vom 11. Januar 1829 vorgesehene Abkommen mit den Inhabern der Aktien Litt. B kam jedoch in dieser Form nicht zustande. In einem an die Minister von Schuckmann und Motz gerichteten Schreiben wies der Justizrat Kunowski auf Probleme bei der Durchführbarkeit der vorgesehenen Regelung hin und schlug eine entsprechende Modifikation vor, die er einem Schreiben an die beiden Minister vom 12. Februar 182935 erläuterte.
Erneut wurde Staegemann vom König zu Rate gezogen. Dieser gab mit dem 13. März 182936 seine Stellungnahme mit dem Hinweis, aus seiner Sicht sollten zunächst die Actien Litt. A. von 20.000 rthlr amortisiert werden.
Unterdessen nahmen von Schuckmann und Motz die Anregungen Kunowskis vom 12. Febr. auf und unterbreiteten dem König einen entsprechenden Änderungsvorschlag in einem Schreiben vom 31. März 1829 37. Sie schlugen vor, die allerhöchste Kabinetts-Order vom 11. Januar d. J. in dem Sinne zu ändern, dass:
1. aus dem Reinertrag der gesamten Kommunikationsanlage nach Abzug der Zinsen auf die Hypothekenschulden eine jährliche Summe bis zur Höhe von Zweitausenfünfhundert Talern zur Verzinsung und Amortisation des Aktienkapitals Litt. B. von 40.000 rthlr. bestimmt und
2. in der Zwischenzeit bis zur Tilgung dieses Aktienkapitals nur der über 2500 rthlr. hinausgehende Ertragsüberschuss zur Verzin-sung und respektiven Amortisation des Staatsdarlehens von 20.000 Thalern verwendet werden darf, und
3. dass nach erfolgter Tilgung des Aktienkapitals der ganze Ertrags-Überschuss zuerst zur Berichtigung der laufenden Zinsen und zur Amortisation des Staatsdarlehens nach bewirkter Amortisation aber zur Berichtigung in der Zwischenzeit zu B etwa verbliebenen Zinsrückstände bestimmt werde.
4. Herr Kunowski hat im Übrigen zugestimmt, dass die Verwaltung und der Tilgungsfonds unter Aufsicht des Staats gestellt werden.
Die Kabinattsordre vom 11. Jan. wurde schließlich durch die Allerhöchste Cabinetts-Ordre vom 11. Juni 182938 entsprechend modifiziert, und zwar in der Weise, dass es der Gesellschaft auch freistehen sollte, den Überschüssen der Brückenerträgen, nach Abzug der Zinsen der Hypothekenschulden für die Aktien Litt. B nicht erst die Verzinsung der Actien Litt. A, sondern zunächst deren Amortisation zu bewirken, die Berichti-gung der Zinsen dieses Capitals aber solange auszusetzen, bis nicht allein die 20.000 rthlr, sondern auch die Aktienschuld der 40.000 rthlr. vollständig abgetragen sind. Nun war einer der drei Gründungsaktionäre, Schwedersky39 aus Memel aufgrund der allgemeinen schlechten finanziellen Verhältnisse in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Ihm war zu Ohren gekommen, dass der preußische Staat in Not geratene Teile der Kunowski-Brückenaktien übernommen hatte und unternahm deshalb den Versuch, ein Bittschreiben vom 26. Dezember 1830 40 an den König zu richten, weitere Aktien im Wert von 10.000 rthlm. von ihm anzukaufen. In einer Mitteilung vom 6. Januar 183141 bedauerte der König seiner Bitte nicht entsprechen zu können.Ohne Antwort diese Antwort des Königs abzuwarten, hatte Schwedersky am 7. Januar 183142 seine Bitte bereits erneuert und erhielt mit Datum 10. Januar 183143 eine weitere Absage mit eine zusätzlichen Erläuterung des
Abb. 8 44 Friedrich von Schuckmann
Abb. 9 45 Von Motz
Staatsministers Albrecht: „Wie sehr ich auch bedaure, dass der Allerhöchste Bescheid Ihrem Gesuche nicht entspricht, so werde Ew. doch selbst ermessen, dass der jetzige, für die Staatsausgaben so ungünstige Zeitpunkt nicht geeignet ist, durch solche Privat-Unterstützungen die Geldmittel zu verringern, die zu den eigens dringenden Bedürfnissen des Staats vorhanden sind."
Bezüglich der vom König zuletzt mit Kabinetts-Ordre vom 11.06.1829 abgelehnten Empfehlungen der beiden Minister Schuckmann und Motz hatte der Justizrat Kunowski alternative Vorschläge unterbreitet, nach denen er unter anderem Maßnahmen für die Absicherung der 20.000 rthlr der durch den Staat erworbenen Aktien Litt. A beinhalteten. Er soll auch gegenüber den Ministern grundsätzlich mit einer Administration der Brücken-Anlage durch den Fiskus einverstanden erklärt haben.Die Verhandlungen hierüber gelangten jedoch zu keinem Abschluss, was vor allem darin begründet lag. dass der Finanzminister Motz wenig später starb. Seine Nachfolge trat der ebenfalls betagte Johann Karl Georg Maassen an, der es als seine oberste Pflicht ansah, die staatlichen Finanzen unter allen Umständen zu schützen. So sah er sich verpflichtet, zusammen mit seinem Innenministerkollegen von Schuckmann den König auf Risiken bei der Anlage der Aktien Litt. A von 20.000 rthlr. hinzuweisen. Er setzte dem Justizrat Kunowski daraufhin eine Frist zur Regulierung der Kunowski-Brückenangelegenheit bis zum 29. April 1831. Kunowski ließ offensichtlich diese Frist aus nicht bekannten Gründen verstreichen. Hierüber verärgert empfahl Maassen mit aller Härte des Gesetzes vorzugehen. Die letzte Entscheidung hierüber hätte allerdings der König zu treffen.
Der härteren Gangart entsprechend wies der Innenminister Schuckmann den Regierungsrat Du Vigneau mit Schreiben vom 29. April 183146 an, die notwendigen Maßnahmen zu treffen und sich bei Bedarf des Rechtsbeistands Justizrat von Herr zu bedienen, der damit beauftragt wurde, ein Gutachten zu erstellen, das die rechtlichen Möglichkeiten aufzeigen sollte, Kunowski zur Regulierung de Brückenangelegenheit zu veranlassen. Du Vigneau setzte Kunowski eine weitere Frist, die dieser angeblich wiederum verstreichen ließ.
Hierüber berichtete Du Vigneau dem Innenminister am 29. Januar 183247 in Kenntnis. In demselben Schreiben wurden Maßnahmen erörtert, den Justizrat Kunowski durch Zwangsmaßnahmen zum Wohlverhalten zu veranlassen. Sie wurden im Einzelnen einer rechtlichen Prüfung unterzogen, jedoch wegen fehlender Voraussetzungen als unwirksam und unangemessen eingestuft. Die Vertreter der harten Linie waren mit ihren Vorstellungen recht schnell gescheitert.
In ihrer Hilflosigkeit wandten sich von Schuckmann und Maassen am 30. April 183248 an den König, um ihm die "unangenehme Angelegenheit" vorzutragen.
Der König ließ den Ministern über Albrecht am 27. Mai 183249 mitteilen , dass er Ihnen angesichts der in ihrem Berichte vom 30. vrn. Monats angezeigten Umständen überlasse, die wider die Unternehmer der Kunowski-Brücke geeigneten restriktiven Mittel zur Sicherstellung der aus dem Staatsfonds freigegebenen Darlehns von 20.000 rthlr. zu verfolgen. In wieweit hierbei auf die Vermögensverhältnisse und die Konservation der Unternehmer Rücksicht zu nehmen ist, könne er nur Ihrem pflichtmäßigen Ermessen anheimstellen50.
Der Innenminister wandte sich daraufhin an den Oberregierungsrat Du Vigneau und wies ihn in einem Schreiben vom 11. Juli 1832 an, beim Justizrat Herr das in Auftrag gegebene Gutachten anzumahnen, das alternative Maßnahmen gegenüber den Brückenunternehmern aufzeigen soll, sie zur Sicherung des vom Staat übernommenen Aktien-Anteil Litt. A von 20.000 rthlr. zu verpflichten. 51
5.3. Die Brückengesellschaft unter staatlicher Administration
Nachdem nun alle bisherigen Versuche gescheitert waren, die Interessen des Fiskus gegenüber den Brückenunternehmern wirksam wahrzunehmen, verfügte der Minister des Innern für Handel und Gewerbe in einem Erlass vom 4. Januar 1833 die sofortige Staatliche Administration der Brückengesellschaft. So wurde der Antrag des fiscalischen Sachwalters in dem mit dem Berichte vom 14ten Dezember 1832 eingereichten Gutachten vom 8ten des Monats auf die sofortige Einleitung der Administration in der durch den § 8 des Aktien-Statuts52 bestimmten und durch die Brücken-Unternehmer akkordierten Vorgehensweise genehmigt. Sodann wurde die königl. Ministerial-Bau-Commission beauftragt, die Führung dieser Administration unter Bestellung eines Commun. Mandatars in der Person des Geheimen expedierenden Sekretärs Thomas, und unter Hinzuziehung des Regierungsrats von Herr als Rechtsbeistand zu übernehmen. Damit war zugleich die bisherige Administration der Brückengesellschaft durch die Haupteigentümer Kunowski und Roch auf unbestimmte Zeit beendet.
Um diese Beschlüsse gern. § 8 Actien-Statut durchzusetzen, musste ein entsprechender Protest beim Preußischen Kam-mergericht eingereicht werden. Am 20. Januar 1833 gab die Ministerialbaukommission eine diesbezügliche amtliche Erklärung ab, die jedoch den Anforderungen eines Protestes nicht genügte und deshalb vom Königl. Preußischen Kammergericht zurückgewiesen wurde. Danach wurde erneut ein Protest eingereicht, der nun den formalen Anforderungen entsprach. Er wurde am 14. März 1833 vom Justizrat Bergling aufgenommen; und am 18. des Monats wurde der entsprechende Antrag an das Kammergericht wegen Erlasses der Arrestatorien und der Inhibitorien unter Beifügung des Protestes und eines Verzeichnisses der Mieter und Mieten erneut gestellt und am 2. Mai 1833 gebilligt.
Über die inzwischen fortgesetzten Verhandlungen mit dem Justiz-Commissionsrat Kunowski, der sowohl von dem Conducteur Roch als auch von dem früheren Socius Schwederski nach den gerichtlichen Vollmachten vom 8. Februar und 21. März 1829 zur Führung aller Verhandlungen autorisiert war, ist am 10. März unter Beifügung zweier Contracts-Entwürfe und eines Pro Memoria von dem Vorsteher der Baukommission berichtet worden.
Inzwischen war der neu im Amt befindliche Finanzminister Maassen am 7. November 1834 in Berlin gestorben. Ihm folgte Albrecht Graf von Alvensleben, der sich im Rahmen einer Bestandsaufnahme über die finanzielle Situation der Kunowski-Brückengesellschaft informierte und dabei feststellte, dass die inzwischen zweijährige Administration gezeigt hat, dass aus dem Mietzins der beiden Häuser in der Münz- und Neuen Friedrichstraße und aus der Einnahme des Brückenzolls nach Abzug der Unterhaltungs- und Administrationskosten sowie nach Bezahlung der Zinsen von den auf den Grundstücken lastenden Hypotheken-Kapitalien nicht soviel übrig bleibt, um überhaupt die Zinsen von 5 % auf das Aktienkapital der 40.000 zu zahlen. Dabei sei an die Amortisation der 20.000 Thlr. Litt. A sowie der 40.000 Thlr. Litt. B nicht einmal zu denken, ebenso wie an die für die 20.000 rthlr. auflaufenden Zinsen. Er hielt es deshalb für dringend erforderlich, dem König am 4. September 183553 hierüber Bericht zu erstatten, der nach dem Erhalt seines Schreibens v. Alvensleben anwies, die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung dieses Übels zu ergreifen.54
Die Ministerien für Handel und Finanzen verfügten die aus ihrer Sicht adäquaten Maßnahmen:
die Unterhandlungen Kunowski und den Inhabern des Aktienkapitals der 40.000 Thlr. abzubrechen,
die durch die königl. Ministerial-Baukommission geführte Administration aufzuheben und
dass die Königl. Ministerial-Baukommission hinsichtlich des Kapitals der 20.000 Thlr. weiterhin jährlich einen Administrationsabschluss vorlegen solle.
Diese ministerielle Verfügung hatte jedoch nur für kurze Zeit Bestand, da dadurch keine Verbesserung erzielt worden war. Vielmehr blieben Zinsen und Dividende seit dem 1. Januar 1833 für die Inhaber der Aktien Littr. B weiterhin aus. Daraufhin einigten sich die
Abb. 1055 Rother
Abb. 11 v. Alvensleben
Aktieninhaber sowie der Vertreter der königlichen Chatoulle in einem Beschluss vom 16. November 1835 auf eine Wiederaufnahme und Fortsetzung der Administration. Entsprechend informierte das Berliner Kammergericht am 23. November 183556 die Minist. Bau-Kommission, dass auf das Arrestgesuch vom 16. d. Monats die Inhaber der Aktien Littr. B den Geheimen expedierenden Mandatar Thomas angewiesen haben, für diese die eingeleitete Administration der Kunowski-Brücke und der beiden Häuser nunmehr fortzusetzen. Gleichzeitig wurde das Arrestatorium (Forderungspfändung) an die Mieter der beiden Häuser und an den Brückenzoll-Einnehmer der Kunowski-Brücke, und das Inhibitorium57 an den Justizrath Kunowski und den Kondukteur Roch erlassen."
Die vorgelegten Administrationsabschlüsse der Brückengesellschaft ließen nur unbedeutende Reparaturkosten erkennen. Sie ermöglichten zum Ende 1840 ein positives Ergebnis von 1.072,29 rthlr.. Statt diesen Betrag zur Bestreitung der Kosten für künftig notwendig werdende größere Reparaturen zu reservieren, beschlossen die Aktieninhaber Lit. B. eine Ausschüttung von 1000 pro rata Aktienanteile beschlossen und diesen von ihren Aktien abgeschrieben. Durch die Amortisation des Aktienkapitals Littr. B von 1000 rthlr. wurde der Gesamtbestand von 40.000 rthlr. auf 39.000 rthlr. reduziert. Diese Maßnahme stieß beim Fiskus auf Widerstand. Der königliche Wirkliche Staats- und Finanzminister Flottwell, der offenbar erst lange nach der Rückzahlung von diesem Vorgang erfuhr, protestierte angesichts der erlittenen Verluste der Brückengesellschaft gegen die erfolgte Rückzahlung und ließ ein Gutachten58 über die Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs erstellen. Zugleich wurden die betroffenen Aktionäre am 27. Juni 184559 zu einer Verhandlung in dieser Angelegenheit eingeladen. Hier wurde zwar auf eine Rückabwicklung des Vorgangs verzichtet60, allerdings vereinbart, dass Rückzahlungen im Falle von anstehenden nennenswerten Reparaturen künftig wieder rückgängig gemacht werden müssten und in einem möglicherweise wiederkehrenden Falle eine Rückzahlung höheren Orts zu genehmigen sei.
In den Folgejahren ab 1846 unterblieben weitere Rückzahlungen. Sie waren auch deshalb nicht möglich, weil weitere defizitäre Rechnungsabschlüsse61 zu beklagen waren.
Zwischenzeitlich waren die beiden Gründer und Hauptinitiatoren der Kunowski-Roch-Brückenanlage verstorben. Am 23. Dezember 1846, ein Tag vor Weihnachten, kam der Justizrat Kunowski bei einem Eisenbahnunglück in Sorau ums Leben. 6 Jahre später, am 11. Sept. 1853, folgte der Conducteur Roch nach.
Rochs Tochter Pauline stellte nach dem Tod des Vaters als Erbin Ansprüche an die Administration aus der Beteiligung an der Brückengesellschaft. Sie beklagte, dass die Brückenkommunikation ihrem Vater das gesamte Vermögen geraubt habe und stellte Ansprüche auf Entschädigung. Die Ministerial-Bau-Kommission lehnte das Ersuchen in einem Schreiben vom 3. August 1855 an den Minister für Handel, Gewerbe und Öffentliche Arbeiten mit folgender Begründung ab62:
1. Herr Roch habe seine Verbindlichkeiten gegenüber seinen Genossen nicht erfüllen können und hatte überhaupt nur einige hundert Taler in der Unternehmung.
2. Er habe die Administration der Anlage übernommen und bis ult. Dezember 1826 geführt und ist dermaßen in "Vermögensverfall" geraten, dass sich einige Tage vor dem Zinszahlungstermin 1. Januar 1827 ergab, dass der ganze Bestand der Brückenkasse von ca. 1.700 rthlr. verschwunden war.
3. Er habe die auf Abschlag seines Einlagekapitals sukzessive zur Baukasse gezahlten 8000 rthlr. allmählich bis auf ca. 1.300 rthlr. wieder aus der Kasse entnommen.
Abb. 12 v. Manteuffel
Abb. 13 v. Bodelschwingh
4. Er habe vor der persönlichen Insolvenz und sich unter
5. Hinterlassung nicht unbedeutender Schulden aus Berlin entfernt.
Da Herr Roch weder Hypothekengläubiger noch Aktieninhaber war, so konnten auch keine Zinsen gezahlt werden.
Sind dem Herrn Roch ursprünglich Aktien nicht ausgehändigt worden, so mag das daran liegen, dass er nach den vorstehenden Vermerken seinen Verbindlichkeiten gegen seine Parii nicht genügt hat. Die Angabe des Herrn Roch, dass nach Abtragung sämtlicher Zinsen jährlich ein Überschuss von 1.400 rthlr. vorhanden sein soll, ist nicht begründet.
Entsprechende Mitteilungen erhielt die Erbin Frl. Pauline Roch von den Ministern Pommer-Esche63 und von der Heidt64 jeweils am 31. Oktober und am 17. November 1855.
In den Folgejahren reichten laut Berichterstattung an die beiden Minister von Bodelschwingh und von Manteuffel wie bisher die Einnahmen der Brückengesellschaft nicht aus um die Zinszahlung an die Aktionäre Litt. B abzudecken.
In dem drei Jahre später folgenden Jahresabschlussbericht wurde von dem Geheimen Regierungsrat Pehlemann ein seit Jahren geäußerter Wunsch der Aktionäre zu Litt. B aufgegriffen, einen Reserve-Fonds für anstehende oder unvorhergesehene Reparaturen zu bilden. In seinem Bericht an die Minister von Auerswald und von P a t o w vom 12. Juli 185965unterbreitete Pehlemann den Vorschlag des Reservefonds und zwar in Höhe von 2000 rthlr.. Am 28. Januar 186066 wandte er sich erneut an die beiden Minister, um Ihnen einen weiteren Vorschlag seitens der Aktionäre der Aktien Litt. B anzudienen. Dieser beinhaltet eine Beschleunigung der Aktien-Amortisation durch Zinsverzicht, konkret eine Absenkung des jährlichen Zinses auf das Aktien-kapital von 5 auf 4 %.
Das Aktienkapital Litt. B betrug ursprünglich
40.000 rthlr.,
davon sind in dem Jahre nach dem Berichte
vom 3. Juni 1845 amortisiert
1.000 rthlr.
Es verbleiben
39.000 rthlr
Davon besitzen:
1. der Familien Fidei-Kommiss-Fonds
9.750
2. der Banquier W. Brose
9.750
3. der verehelichte Dr. Sinogowitz
4.875
4. der Kaufmann Nolte
4.875
5. der kaiserl Königl Hofschauspieler
Nolte zu Wien
4.875
6. die verwitwete Justiz-Rätin
1.950
Kunowski
7. die Erben des Kaufmanns Caspari
975
8. die Erben des Kaufmanns F. Lehr
975
und
9. das Fräulein Stubbe
975
39.000 rthlr.
Im Jahre 1905, also in 45 Jahren, endet das 80-jährige Privilegium der Aktiengesellschaft zur Erhebung des Brückenzolls. Mit diesem Jahr ist dasjenige Capital für die Aktionäre verloren, das bis dahin nicht amortisiert worden ist. Die durch eine vorgeschlagene Zinssenkung frei werdenden Mittel könnten für eine stärkere Amortisierung des Aktienkapitals Litt. B verwendet werden.
Abb. 14 v. Auerswald
Abb. 15 v. Patow
Die Zinsen dieses Capitals sind regelmäßig quartalsweise mit 5 % pro anno durch die Hochlöbliche Bau-Commission ausgezahlt worden. Würde bis zum Jahre 1905, in dem das Privilegium der Brückenzoll-Einnahme erlischt, mit der bisherigen Zinszahlung fortgefahren werden, so kommen die Actionäre allerdings bis dahin in einen Zinsgenuss pro 5 % per annum, es drohe ihnen aber bei fehlender Amortisation der Verlust ihres ganzen Actiencapitals von 39.000 rthlrn. Die Aktionäre schlagen deshalb zur Rettung Ihres Kapitals vor, die jährlichen Überschüsse verstärkt zur Amortisation der Aktien Litt. B zu verwenden. Sie wären deshalb bereit auf 1% Zinsen zu verzichten und statt der jährlichen 5 nur mit 4% Zinsen zu erhalten. Bezogen auf das Aktienkapital der Aktien Litt. B von heute noch rthlr. 39.000 würden 1 % bzw. rthlr. 390.- jährlich für eine zusätzliche Amortisation zu Verfügung stehen.
In einer Ordre des Ministers des Königlichen Hauses im Allerhöchsten Auftrage vom 10. April 186057 an den Regierungsrat Pehlemann — Hochwohlgeboren erfolgte die königliche Zustimmung zur Absenkung des Zinses auf 4 % bezogen auf das 67 Aktienkapital von 10.000 rthlr. Litt. B. und die Differenz zur Amortisation des Aktienkapitals zu verwenden.
Ferner wurde zugestimmt, dass die Verwaltung des Staatsschatzes ihre Forderung an rückständigen Zinsen von den in ihrem Besitze befindlichen 20.000 rthlr. Aktien Litt A. bis Ende Dezember 1858 im Gesamtbetrage von 24.000 rthlr. bis nach vollständiger Amortisation der Aktien Littr. B zurückstellt68.
Die verbleibenden Überschüsse nach Zahlung der angepassten Zinsen sollen für die Jahresrechnung 1859 und in den Folgejahren zur Amortisation der Aktien Littr. B verwendet werden.
In einer Mitteilung vom 4. Mai 1860 setzte Pehlemann die Minister von Auerswald und von Patow von der beschlossenen Zinsabsenkung in Kenntnis69
Er wies auch darauf hin, dass für Rechnung der Aktien-Besitzer Litt. B bis zum Jahre 1856 nur geringe Überschüsse erlangt wurden, von da ab sich die Einnahmen erheblich gesteigert haben, und es ist am Schlusse des Jahres 1859 außer dem eisernen Fonds von 2.000 rthlr. zu einem Überschuss von 2.000 rthlr. gekommen, der im Jahr 1860 zu einer entsprechenden Amortisation des Kapitals Litt. B vergewandt wurde.
Zur Durchführung der Zinsabsenkung war die Zustimmung aller Aktieninhaber Litt B. in Form einer schriftlichen Erklärung erforderlich. Sämtliche Aktionäre der Aktien lit. B haben sich mit den festgesetzten Bedingungen zur Amortisation der Aktien Litt. B einverstanden erklärt. Die Abgabe der Erklärung derselben hat sich jedoch dadurch verzögert, dass einzelne Aktionäre zeitweise von hier abwesend waren, andere aber außerhalb Berlins wohnhaft sind, und mit diesen in Schriftwechsel getreten werden musste. Es kam hinzu, dass bei einigen Aktionären die Erben ermittelt werden mussten.
Was die Besitzverhältnisse der Grundstücke betrifft, waren bisher im Grundbuch keine Veränderungen eingetreten. Deshalb sind die Herren Kunowski und Roch bzw deren Erben noch jetzt als titulierte Besitzer der Grundstücke Münzstr. 6 und Neuen Friedrich Straße Nr. 34 sowie der Kunowski-Brückenanlage angesehen worden. Die Erben der beiden Gründer sind bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Sie sind bisher als Erben noch nicht legitimiert und daher im Berliner Grundbuch noch nicht eingetragen.
Die Aktionäre haben sich auch dafür ausgesprochen, dass der Reservefonds von 2000 Thlr. in Obligationen der Königl. Preuß. Staatsanleihe angelegt bleiben möge. Die Einrichtung eines angemessen dotierten Reserve-Fonds erhielt im Zusammenhang mit der Absenkung des Zinses eine besondere Bedeutung, was den Interessen der Aktionäre an einer zügigen Amortisation zunächst entgegenlief. Allerdings hatte sich in den vergangenen Jahren ein beträchtlicher Reparaturstau entwickelt. Dringend erneuerungsbedürftig war der Oberbelag der Kunowski-Brücke. Er wurde im Jahre 1857 unter Leitung des Bau-Inspektors Schrobitz 70 erneuert. Die Kosten hierfür betrugen rund 1.000 rthlr.. Damals waren, weil nennenswerte Überschüsse sich erst in den Jahren 1859 und 1860 einstellten, die Geldmittel zur Herstellung eines eisernen Belags, wie im ursprünglichen Brückenvertrag vorgesehen, nicht vorhanden; man musste sich zunächst mit einem hölzernen anstatt eines eisernen Belages begnügen.
Dank einer verbesserten Ertragslage, vor allem bedingt durch die geringere Verzinsung, aber durch durch verbesserte Einnahmen, war es möglich, ab 1860 mit der Amortisation der Aktien Litt. B. zu nennenswerten Beträgen zu beginnen71.
Darüber hinaus hatte der Fiscus noch Zinsforderungen von 1858 und früher in Höhe von 24.000 rthlr., die auch noch erwirtschaftet werden mussten. Insofern hielten die Behörden die Fortsetzung der Administration seitens des Fiscus bis zur endgültigen Rückzahlung für notwendig.
Von dem ursprünglichen Aktienkapital litt. B von 40.000 rthlrn. sind bis ultimo 1863 9.000 rthlr. zurückgezahlt worden 72. Von dem verbleibenden Saldo von 31.000 rthlr. wurden ab 1864 bis 1867 jeweils 3.000 rthlr. p.a. Amortisiert.
Während im Jahre 1868 wiederum 3.000 rthlr. Kunowski-Brücken-Aktien Litt. B amortisiert worden sind, hat im Jahre 1869 wegen der verursachten Bau-Unterhaltungs-Kosten die Aktien-Amortisation ganz unterbleiben müssen. Es ist aber, um dasselbe wieder aufzunehmen, in diesem Jahre, nach dem Beschlusse der Besitzer der Kunowski-Brücken-Aktien Litt. B der Reserve-Fonds von 2.000 rthlr. in Obligationen der Königl. Preußischen Staatsanleihe de 1855 und 1857 für 1914 rthlr. 15 Sgr. versilbert, und es sind aus diesem Betrage, dem ultimo 1869 verbliebenen Bestande und aus den laufenden Einnahmen, die Zinsen von den Kunowski-Brücken-Aktien Litt. A pro 1870 mit 800 rthlr.. berichtigt, auf ultimo März d.J., Mitte Juni d.J. und Mitte dieses Monats je 1000 Kunowski-Brücken-Aktien Litt. B. amortisiert worden.
Am Schluss des Jahres 1868 waren von dem Aktien-Kapital Litt. B im Betrage von
40.000 rthlr.
amortisiert:
24.000
Dazu traten die in diesem Jahr
bis jetzt amortisierten
3.000
und nach Abrechnung dieser
27.000 rthlr.
hat sich jetzt das Aktien-Kapital
Litt. B
bis auf
13.000 rthlr.
73
vermindert.
In den Jahre 1868 und 1869 unterblieb die weitere Amortisation wegen dringender Häusersanierung. Sie wurde 1870 und 1871 mit jeweils 4.000 und 5.000 rthlm. Fortgesetzt
14 3. Nov. 1825 an Se. Majestät Friedrich Wilhelm III, Dok. 7 11. Nov. 1825 an Cabinetsrat Albrecht, Dok. 9 28. Dez. 1825 an Cabinettrat Albrecht, Dok. 10
15 Dok. 7
16 Dok. 8
17 Berliner Holzstich, ca. 1882, im Familienbesitz
18 Dok. 9
19 Kunowski war seit September 1822 in der Funktion des Syndikus am neugegründeten Königsstädtischen Theater in Berlin. Als angesehener Jurist war er Bankenkreisen sehr geschätzt. Ihm gelang es einige Kapitalgeber aus der Berliner Hochfinanz für das Theater zu gewinnen. Näheres hierzu in: Kunowski, Harald, 200 Jahre Königsstädtisches Theater in Berlin, Bd. 1, Kabale und Resignation, 2022
20 Dok. 11
21 Dok. 12
22 Dok. 13
23 Justizrat Kunowski (Abb. 6) und rechts daneben seine Frau (Abb. 6), Kohlezeichnungen, um 1840, beide im Familiennachlass
24 Dok. 14
25 Dok. 15
26 It. Vermerk des Königs im Dok. 15
27 Dok. 16
28 Dok. 17
29 Dok. 18. Dem König war Kunowski von dessen Tätigkeit als Direktor des Königsstädtischen Theaters bekannt. Etwa gleichzeitig mit der Absage an Kunowski wurde für das Theater eine ablehnende Entscheidung getroffen, die das durch Königliches Urteil verfügte Verbot der Aufführung der Weberschen Oper Oberon beinhaltete.
30 Dok. 19
31 Dok. 20
32 Dok. 21
33 Fach 62 , 25 Vol. I. und II. und aus dem Erlass vom 11. Juli 1832
34 Beide Berliner Bankiers waren zu dieser Zeit zugleich Mitglieder des Direktoriums am Königsstädtischen Theater; vgl. Kunowski, Harald, 200 Jahre Königsstädtisches Theater in Berlin, Bd. 1, Kabale und Resignation, 2023
35 Dok. 22
36 Dok. 23
37 Dok. 24
38 Dok. 25
39 Schwedersky hatte mit Kunowski weitere gemeinsame Unternehmungen, siehe etwa: Plan des Kaufmannes Schwedersky in Memel, des Justizrates Kunowsky und des Justizkommissars Bode zur Errichtung einer Hypothekenversicherungssozietät und eines Bankinstitutes in Memel 1825- 1835, Geheimes Staatsarchiv Berlin, I. HA Rep. 89, Nr. 28217
40 Dok. 26
41 Dok. 27
42 Dok. 28
43 Dok. 29
44 Bildbestand Stadtmuseum Berlin
45 Deutsches Historisches Museum Berlin Inv.-Nr.: Gm 92/48
46 Dok. 30
47 Dok. 31
48 Dok. 32
49 Dok. 33
50 Zur Ausführung der Order siehe Schreiben von Alvensleben vom 4. Sept. 1835
51 Dok. 34 und 35
52 Dok. 4
53 Dok. 40
54 Dok. 41
55Abb. 10 und 11 Wikipedia-Artikel
56 Dok. 43
57 Inhibitorium bedeutet, dass die Brückengesellschaft als Vollstreckungs-Schuldner die Forderung nicht bei den Mietern als Drittschuldner einziehen oder diese an einen Dritten abtreten darf
58 Dok. 46
59 Dok. 45
60 Siehe auch Dok. 50
61 Dok. 51 bis 59
62 Dok. 60
63 Dok. 61
64 Dok. 62
65 Dok. 65
66 Dok. 66
67 Dok. 67
68 Dok. 69
69 Dok. 68
70 Friedrich Emanuel Louis Schrobitz (* 1809 in Berlin; † 1882 ebd.) war ein deutscher Architekt und Baubeamter. 1855 kam er als Bauinspektor zur Ministerial-Baukommission nach Berlin und wurde dort 1867 zum Baurat befördert. Von 1871 bis 1873 hatte er die Bauleitung bei der Verbreiterung der Königsbrücke
71 Dok. 71 - 84
72 Dok. 78